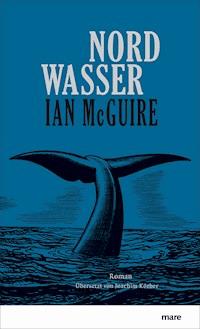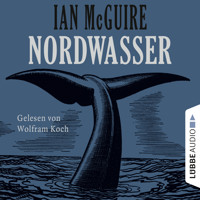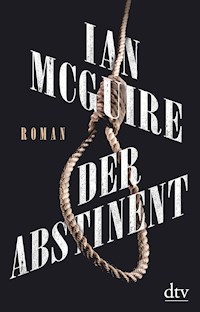
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein literarischer Noir, dicht und spannend.« Richard Ford Manchester, 1867. Im Morgengrauen hängen die Rebellen. Die englische Polizei wirft ihnen vor, die ›Fenians‹, irische Unabhängigkeitskämpfer, zu unterstützen. Eine gefährliche Machtgeste seines Vorgesetzten, findet Constable James O'Connor, der gerade aus Dublin nach Manchester versetzt wurde. Einst hieß es, er sei der klügste Mann der Stadt gewesen. Das war, bevor er seine Frau verlor, bevor er sich dem Whiskey hingab. Mittlerweile rührt er keinen Tropfen mehr an. Doch jetzt sinnen die ›Fenians‹ nach Rache. Der Kriegsveteran Stephen Doyle, amerikanischer Ire und vom Kämpfen besessen, heftet sich an O'Connors Fersen. Ein Kampf beginnt, der O'Connor tief hineinzieht in einen Strudel aus Verrat, Schuld und Gewalt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Manchester, 1867. Im Morgengrauen hängen die Rebellen. Die englische Polizei wirft ihnen vor, die ›Fenians‹, die irischen Unabhängigkeitskämpfer, zu unterstützen. Eine gefährliche Machtgeste seines Vorgesetzten, findet Constable James O’Connor, der gerade von Dublin nach Manchester versetzt wurde. Einst hieß es von ihm, er sei der klügste Mann der Stadt gewesen. Das war, bevor er seine Frau verlor, bevor er sich dem Whiskey hingab. Mittlerweile rührt er keinen Tropfen mehr an. Doch jetzt sinnen die ›Fenians‹ nach Rache. Der Kriegsveteran Stephen Doyle, amerikanischer Ire und vom Kämpfen besessen, heftet sich an O’Connors Fersen. Ein erbitterter Kampf beginnt, Mann gegen Mann, der ihn tief hineinzieht in einen Strudel aus Rache und Schuld, Verrat und Gewalt.
»Ein brillanter historischer Roman: Cormac McCarthy trifft auf Raymond Chandler.« Philipp Meyer
Für Abigail, Grace und EvaUnd im Gedenken an meine Mutter Joan McGuire(1925–2018)
Erstes Kapitel
Manchester, 22. November 1867
Mitternacht. Feldgeschütze in der Stanley Street, Barrikaden an jeder Brücke und Kreuzung. Die hellen Flammen der Wachfeuer spiegeln sich rötlich schimmernd auf dem schwarzen, bootlosen River Irwell. Im Rathaus in der King Street klopft James O’Connor den Regen von seiner Melone, knöpft den Mantel auf und hängt beides an einen Haken neben dem Pausenraum. Sanders, Malone und vier, fünf andere schlafen in einer Ecke auf Strohsäcken; die anderen sitzen an den Tischen, spielen Whist, plaudern oder lesen den Courier. In der Luft hängt der vertraute Kasernendunst aus starkem Tee und Tabak, links an der Wand verstaubt ein Regal voller Turnkeulen und Medizinbälle, in der Mitte steht ein mit Brettern abgedeckter Billardtisch. Fazackerley, der Sergeant vom Dienst, bemerkt O’Connor und nickt.
»Und?«
O’Connor schüttelt den Kopf.
»Früher oder später wird sich einer blicken lassen«, sagt Fazackerley. »Irgendein besoffener Schwachkopf. Einen gibt’s immer. Warten Sie’s nur ab.«
O’Connor nimmt sich einen Stuhl, Fazackerley füllt eine verbeulte Blechkanne halb mit kochend heißem Wasser aus dem Kessel und rührt zweimal um.
»Östlich von Kingstown ist außer mir kein Ire auf den Beinen«, sagt O’Connor. »Die anderen liegen brav im Bett, folgen dem Rat der Priester und halten sich da raus.«
»Ich dachte, eure Fenians geben nicht viel auf das, was die Pfaffen sagen.«
»Nur, wenn’s ihnen in den Kram passt. So wie wir alle eben.«
Fazackerley nickt, gestattet sich ein Grinsen. Sein Gesicht ist ein borstiger Wust aus Furchen und Flächen, die Augenbrauen sind verwildert, die angegrauten Haare dünn und fettig. Wären da nicht die blassblau leuchtenden Augen – eher wie die eines Neugeborenen oder einer Porzellanpuppe als die eines über Fünfzigjährigen –, würde er vielleicht erschöpft wirken, verwahrlost, doch so strahlt er sogar im Sitzen eine Art verschmitzten Elan aus.
»Die haben die Dragoner durch Deansgate trotten sehen«, fährt O’Connor fort. »Die Kanonen und die Barrikaden. Die sind nicht so dumm, wie Sie glauben.«
»Na, zumindest drei von denen werden heute um acht Uhr ziemlich dämlich aus der Wäsche kucken.«
Fazackerley legt den Kopf zur Seite, imitiert einen Gehängten, doch O’Connor beachtet ihn gar nicht. Neun Monate sind inzwischen vergangen, seit er aus Dublin hierher versetzt wurde, und er hat sich an die Sitten seiner englischen Kollegen gewöhnt. Ständig machen sie ihre Witze, sticheln, lassen nichts unversucht, um ihn zu provozieren. Oberflächlich sind sie freundlich, aber hinter dem Grinsen und Gelächter spürt er Misstrauen. Was hat der hier verloren?, fragen sie sich. Taucht hier einfach auf und will uns vorschreiben, wie wir unsere Arbeit machen sollen … Sogar Fazackerley, bei Weitem noch der angenehmste, behandelt ihn meist nur als lustiges Kuriosum, als sonderbare Abnormität, wie einen durchreisenden Apachen oder einen Tanzbären. Andere wären beleidigt, aber O’Connor nimmt es hin. Manchmal, denkt er, hat man es leichter, wenn man missverstanden wird.
»Maybury will Sie sehen«, sagt Fazackerley, richtet sich auf. »Er ist oben bei Palin.«
»Maybury und Palin? Was wollen die von mir?«
Fazackerley lacht.
»Sie sind hier das Orakel vom Dienst, Constable O’Connor. Die wollen von Ihnen hören, was die Zukunft bringt.«
»Hätten sie mal vorher auf mich gehört, dann wäre Charley Brett womöglich noch am Leben.«
»Kann sein, aber behalten Sie das besser für sich. Unsere glorreichen Herren und Meister mögen es nicht, wenn man ihnen ihre Fehler unter die Nase reibt.«
»Angeblich soll Palin sowieso gefeuert werden, sobald der Sturm sich gelegt hat. In Pension geschickt.«
»Ach, hier wird zu viel getratscht«, winkt Fazackerley ab. »Sie würden wohl gern selbst das Ruder übernehmen, was? Chief Constable O’Connor, hm?«
Fazackerley prustet los, als hätte er einen großartigen Witz gemacht. O’Connor trinkt seinen Tee aus, zupft sein Wams zurecht und befiehlt dem Sergeant vom Dienst in aller gebotenen Höflichkeit, sich zu verpissen.
Oben lauscht er einen Augenblick an der Bürotür. Maybury kennt er ganz gut, aber den Chief Constable hat er bislang nur bei dienstlichen Anlässen und aus der Ferne gesehen – auf einem Podium oder hoch zu Ross. Palin ist kurz gewachsen, wirkt soldatisch und zumindest in der Öffentlichkeit steif und etwas reizbar. Am Tag des Hinterhalts war er nirgends zu erreichen, weshalb trotz der eindeutigen Warnsignale niemand etwas unternahm. Ein leitender Beamter hat seinen Posten wegen des Debakels schon verloren, jetzt munkelt man, Innenminister Gathorne Hardy habe sich persönlich eingeschaltet und auch Palin müsse demnächst seinen Hut nehmen. Zwangspension irgendwo auf dem Land und ein Lebensabend in Komfort und Wohlstand, schlimmer kommt es für einen wie ihn sowieso nie.
O’Connor hört die beiden durch die Tür – Palins leise Stimme, Mayburys gelegentliche Einwürfe –, versteht jedoch kein Wort. Er klopft, das Gespräch verstummt, und Maybury ruft ihn herein. Keiner der beiden lächelt oder steht von seinem Stuhl auf. Maybury – mittelgroß, untersetzt, Backenbart, Feuermal auf der Wange – nickt ihm knapp zu. Palin beäugt O’Connor misstrauisch, als hätte er ihn schon einmal irgendwo gesehen, wüsste aber nicht mehr genau, wo. Beide Männer sind in Hemdsärmeln, Palin raucht eine Zigarre. Auf dem Tisch stehen ein Senftopf und eine Flasche Essig, Wurstgeruch vermischt sich mit dem blauen Dunst.
»Der Sergeant sagt, Sie wollen mich sehen, Sir«, wendet O’Connor sich an Maybury.
Maybury sieht Palin an, will ihm den Vortritt lassen, doch der schüttelt den Kopf.
»Ihren Bericht, Constable«, befiehlt Maybury, als gehöre es eben zu O’Connors Job, mitten in der Nacht dem Chief Constable von Manchester persönlich Meldung zu machen.
O’Connor zieht sein Notizbuch aus der Innentasche und blättert durch die Seiten.
»Ich habe den ganzen Tag mit meinen Informanten in der Stadt gesprochen. Heute Nacht sollten wir nichts zu befürchten haben. Die Hinrichtung wird problemlos über die Bühne gehen. Sollte es zu Vergeltungsmaßnahmen kommen, dann später, wenn es wieder ruhiger ist. Nachdem sämtliche Soldaten die Stadt verlassen haben.«
»Es wird von Vergeltung geredet?«
»Ach, geredet wird immer, Sir, aber vorerst nichts, was wir allzu ernst nehmen müssten.«
»Die Fenians haben also Angst vor uns«, freut sich Palin, als läge dieser Schluss klar auf der Hand. »Unsere Machtdemonstration zeigt Wirkung.«
»Vorerst, ja«, stimmt O’Connor zu. »Aber in ein, zwei Monaten dürften die Dinge anders liegen.«
»Inwiefern?«, fragt Maybury.
»Die Hinrichtung wird die Leute gegen uns aufbringen. Schon jetzt sind viele überzeugt, dass die Urteile ungerecht sind und das mit Sergeant Brett schlimmstenfalls Totschlag war, aber ganz sicher kein Mord. Wenn die drei Männer hängen, werden andere nachrücken. Am Ende könnte die Fenian Brotherhood in Manchester sogar gestärkt aus der Sache hervorgehen.«
Palin runzelt die Stirn, richtet sich im Stuhl auf.
»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen«, sagt er. »Das klingt ja, als wollten Sie sagen, eine so harte Strafe könnte andere zu ähnlichen Verbrechen ermuntern. Wie soll das gehen? Wo läge da der Sinn?«
O’Connor blickt Hilfe suchend zu Maybury, doch der hebt nur die Brauen und lächelt ausdruckslos zurück.
»Es ist immer gefährlich, Märtyrer zu schaffen, Sir.«
»Märtyrer?«, ruft Palin aus. »Das sind doch keine Märtyrer! Gewöhnliche Verbrecher sind das. Kaltblütige Polizistenmörder.«
»Ich persönlich sehe das natürlich auch so, Sir, aber die herrschende Meinung unter den Iren lautet anders.«
»Dann ist die herrschende Meinung eben Unsinn. Sind Ihre Landsleute wirklich so dumm? Lernen die es denn nie?«
O’Connor antwortet nicht gleich. Er denkt daran, wie der alte Aufrührer Terence MacManus 1861 tot aus Kalifornien heimgeholt wurde und halb Dublin in braunem Nebel und strömendem Regen dem Trauerzug beiwohnte. Die Leute hingen aus den Fenstern, standen dicht gedrängt rund um den Mountjoy Square. Als der Zug das Tor des Friedhofs Glasnevin erreichte, war er fast drei Kilometer lang. Zwanzigtausend Dubliner, und kaum ein Flüstern zu vernehmen, als MacManus ins Grab gelegt wurde. Gibt man den Fenians eine Leiche, kann man Gift darauf nehmen, dass sie ihren Vorteil daraus ziehen werden. Bevor sie Terence Bellew MacManus heimbrachten, hatte sich für die Fenians kaum jemand interessiert, doch schon am nächsten Tag galten sie als heldenhafte Nachfolger der Männer von ’48. Wer klug ist, unterschätzt niemals die Macht der Toten, aber Palin ist nicht klug. Niemand von denen ist klug.
»Die meisten meiner Landsleute sind arm und ungebildet, Sir«, erklärt O’Connor schließlich. »Das nutzen die Fenians aus. Sie versprechen ihnen Freiheit und ein Ende ihrer Leiden.«
»Die Fenians sind Fanatiker.«
»Stimmt, Sir, aber Fanatiker sind hartnäckig.«
»Wir auch«, erwidert Palin. »Das ist doch gerade der Punkt, Constable. Das Empire ist stark und standhaft; es hat schon schlimmere Meutereien überstanden. Vielleicht sollten Sie Ihre Freunde bitten, diese Botschaft zu verbreiten. Unsere Feinde sollen wissen, dass sie sich für eine hoffnungslose Sache opfern.«
»Das ist nicht …«
O’Connor will selbst antworten, doch Maybury fällt ihm ins Wort.
»O’Connors Freunde taugen nicht zu Boten, Sir«, erklärt er. »Ihre Leben wären in Gefahr.«
»Natürlich«, sagt Palin. »Nicht dran gedacht.«
Stille. Im Ofen bröckelt Kohle. Palin schnaubt, streift die Zigarre in einen leeren Kaffeebecher ab.
»Woher haben wir die überhaupt, diese Informanten?«, fragt er, an Maybury gewandt. »Und woher wissen wir, dass wir ihnen trauen können?«
»Normalerweise kommen diese Leute von sich aus auf uns zu«, erklärt Maybury. »Sie sind auf Geld aus. Wir genießen ihre Aussagen mit Vorsicht, aber hin und wieder ist was Nützliches dabei. Wenn wir wissen, was die Fenians planen, können wir meistens vorab etwas dagegen unternehmen.«
Palin kratzt sich das Kinn, runzelt die Stirn.
»Parasiten. Ich frage mich, ob wir uns nicht selbst herabsetzen, wenn wir uns mit denen einlassen.«
»Manchmal muss man durch die Scheiße schwimmen, um an den Schatz zu kommen, Sir«, trällert Maybury, als zitiere er ein altes Sprichwort. »Genau dafür haben wir ja Constable O’Connor.«
Palin nickt, lächelt, blickt zu O’Connor.
»So, so, das tun Sie also für uns, Constable?«, fragt er und schüttelt sich ein wenig angesichts der vulgären Formulierung. »Durch die Scheiße schwimmen?«
»In gewisser Hinsicht könnte man das so sagen, Sir.«
»Und das macht Ihnen Spaß, ja? Ist nach Ihrem Geschmack?«
O’Connor merkt, dass Palin ihn verspottet. Die Sticheleien seiner Kollegen ist er gewöhnt, doch dass der Chief Constable denselben Ton anschlägt, ist schon erstaunlich.
»Ich tue meine Pflicht, Sir«, sagt er. »So gut ich kann. Ich hoffe, einen kleinen Beitrag zum Erfolg leisten zu können.«
Palin zuckt die Achseln.
»Wir führen einen zähen Krieg gegen einen minderwertigen und unorganisierten Gegner. Einen Orden bekommt dafür niemand, Constable, das verspreche ich Ihnen.«
O’Connor nickt, verkneift sich eine Antwort. Er blickt auf seine Schuhspitzen: Das abgewetzte schwarze Leder hebt sich deutlich ab von den wirbelnden Rot- und Grüntönen auf Palins Perserteppich. Das Feuer wärmt ihm von hinten die Waden. Er hat gelernt, seine Zunge zu zügeln. Zu gewinnen gibt es selten etwas, wenn man den Mund aufmacht, aber jede Menge zu verlieren.
»Dann gehen Sie mal wieder an die Arbeit«, weist Maybury ihn an. »Geben Sie Bescheid, falls Sie noch was Interessantes hören.«
»Und sagen Sie Harris, er soll neuen Kaffee bringen«, fügt Palin hinzu, indem er nach der Abendzeitung greift. »Mit dieser Kanne sind wir durch.«
Unten im Pausenraum spielt O’Connor Whist, anstatt zu schlafen. Er verliert einen Schilling, gewinnt ihn zurück, verliert ihn erneut. Bei Tagesanbruch begleicht er seine Schulden bei Fazackerley, schnappt sich Hut und Mantel und geht wieder nach draußen. Rußschwarze Häuser drängen sich unter einem marmorierten Himmel. Er überquert Deansgate und geht entlang der Bridge Street in Richtung Irwell. Zerlumpte Grüppchen rotäugig blinzelnder Männer, ausgespien aus den Bierstuben, blicken sich fragend um, als versuchten sie, sich zu erinnern, wo und wer sie sind. In Tücher gehüllte Frauen stehen lachend in Hauseingängen beisammen, schütteln die Köpfe und reiben sich die Arme, um sich aufzuwärmen. Die Schaufenster sind vernagelt, vorsichtshalber, doch hier und da verkauft jemand aus einem Handwagen Kaffee oder Pasteten, und Gassenjungen preisen Extrablätter zu einem halben Penny an. Auf der Albert Bridge bleibt O’Connor stehen und sieht zu, wie sich die Menge einfindet.
Sie kommen zu zweit, zu dritt, zu sechst, zu siebt. Aus Knot Mill und Ancoats, aus Salford und Shude Hill. Finstere, klobige Gestalten, gehüllt in Wolle und Barchent. Ihre Haut ist gelb und schmutzig. Plaudernd und scherzend drücken sie sich an O’Connor vorbei, riechen nach Sägemehl, Pfeifenrauch und dem beißenden, tief sitzenden Schweiß endloser Fabrikarbeit. So eine Hinrichtung hat etwas Erhabenes, das muss O’Connor zugeben – als sähe man mit an, wie ein schönes Haus abbrennt oder ein großes Schiff sinkt. Zumindest einen kurzen Augenblick kommt es einem dabei vor, als sähe man direkt ins Herz von etwas, als wäre die ganze Scham der Welt kurz abgefallen und übrig bliebe nur des Pudels Kern.
Eigens aus Rochdale und Preston herbeigeholte Hilfstruppen umringen dicht gedrängt den Galgen, zum Schutz vor Übergriffen. Sie rauchen, lachen, raufen, singen Lieder; hin und wieder ruft man sie zur Ordnung, lässt sie strammstehen. Sie sind mit Knüppeln bewaffnet, weiße Abzeichen am Ärmel zeigen ihren Rang an. Viel unbeschwertes Hin und Her ist auf den Barrikaden zu hören, raue Worte und Spott. Als es im Osten heller wird, wird auch die Menge dichter, und O’Connor spürt die Erregung in sich wachsen, in Brust und Bauch und in den Eiern. Er kommt nicht dagegen an. Auch er ist nur ein Mensch. Auf dem Weg über die Brücke zum Gefängnis wärmt ihn das Gedränge; er schmeckt den Bieratem der Leute, atmet ihn ein, fühlt sich für einen Augenblick als Teil von etwas Größerem, von einem gemeinsamen Begehren, einem starken, unbestimmten Trieb. Oben auf dem Eisenbahnviadukt vor der Nordwand des Gefängnisses wachen rotberockte Infanteristen mit Gewehren und Bajonetten. Blau uniformierte Polizisten stehen in stummen Grüppchen an jeder Kreuzung. Die Gefängnisuhr schlägt zur halben Stunde.
Die Soldaten zu holen, war ein Fehler, denkt O’Connor. Gewalt wird das Problem mit den Fenians nicht lösen, und der Anblick der Truppen lässt die Leute glauben, wir befänden uns im Krieg. Solche Machtdemonstrationen führen zu nichts Gutem; man gießt nur Öl ins Feuer. Akribische Ermittlungen und Fingerspitzengefühl, das wird diesen Kampf entscheiden, nicht protzig zur Schau gestellte Grausamkeit. Doch Protz und Grausamkeit sind den Engländern nun mal am liebsten. In gemäßigteren Tönen hat er seine Bedenken auch in den Berichten an Maybury und in seinen Briefen nach Dublin Castle geäußert – gemessen am Ergebnis hätte er die auch auf Chinesisch oder Hebräisch schreiben können.
Als es acht Uhr schlägt, verstummt die Menge und blickt auf. Hinter dem Galgen öffnet sich eine Tür, und ein groß gewachsener Priester in Ornat tritt aufs Podest, gefolgt von einem der Verurteilten – William Allen. Der Priester betet die Litanei vor, der gebrechlich wirkende Allen antwortet. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Ihre verschlungenen Stimmen sind leise, aber gut vernehmbar. Kurz blickt Allen in die Menge, wendet den Blick jedoch gleich wieder ab. Als Nächstes tritt der Henker Calcraft aufs Podest, gefolgt von den beiden anderen Gefangenen, O’Brien und Larkin, jeweils mit einem Wächter und einem psalmodierenden Priester im Schlepptau. Allens Augen sind geschlossen, seine gefesselten Hände zu einem unbeholfenen Gebet erhoben. Der Priester flüstert ihm ins Ohr. Calcraft legt den dreien die Schlingen um die Hälse und zieht sie fest, fesselt ihre Füße, zieht jedem einen weißen Sack über den Kopf. O’Brien ruckt zur Seite, küsst Allen ungelenk die Wange. Larkins Beine geben nach, und es wird kurz etwas hektisch, als ein Priester und ein Wächter ihn mit Mühe aufrecht halten. Calcraft huscht indessen ungerührt übers Podest, justiert die Knoten mit der flinken, zappligen Gewandtheit eines Schneiders, der Maß für einen Anzug nimmt. Er betrachtet kurz sein Werk, nickt zufrieden, tritt zur Seite. Eine Krähe krächzt, als zöge man einen trockenen Korken aus einer Flasche; irgendwo am Fluss klappern Wagenräder und ein Pferd wiehert. Einen langen Augenblick stehen die drei Männer Seite an Seite unter dem schweren Eichenbalken wie grob gehauene Karyatiden, getrennt und doch vereint, dann, erschreckend plötzlich, sind sie weg. Anstelle ihrer lebendigen Leiber bleiben nur drei stramme Stricke, wie lange, lotrechte Kratzer auf der Gefängnismauer. Die Menge hält die Luft an und lässt dann einen langen, kehligen Seufzer fahren, wie eine Welle, die sich vom Strand zurückzieht. O’Connor schaudert, schluckt, spürt Übelkeit aus seinem Magen in den Mund drängen.
Eine Pause, eine stumme Lücke, der entscheidende Moment scheint vorüber – dann zuckt und schwingt einer der Stricke, und aus dem abgeschirmten Bereich unter dem Podest dringt gequältes Grunzen. Buhrufe werden laut, dann Pfiffe. Die Priester unterbrechen ihr Gebet, linsen nach unten. Der Strick zuckt immer noch, und Larkins verhüllter Kopf hüpft auf und ab wie ein Fisch an der Angel, bis Henkerlehrling Armstrong den Verurteilten anhebt und mit einem kräftigen Ruck wieder herabzieht, um die Sache zu beenden. Meine Güte, ist es denn so kompliziert, jemanden zu töten?, staunt O’Connor. Der Strick, der Sturz – wie schwer kann das schon sein?
Er macht kehrt und drängt sich durch die dicht wogende Menge. Aus Gewohnheit blickt er sich um, hält Ausschau nach bekannten Gesichtern. Zu seiner Linken, knapp zehn Meter entfernt, entdeckt er Tommy Flanagan, der mit einer speckigen Bibermütze auf dem Kopf ganz allein dasteht und eine Meerschaumpfeife raucht. Natürlich, denkt O’Connor, wenn einer alle Vorsicht in den Wind schießt, dann Thomas Flanagan. Er bleibt einen Moment stehen und betrachtet ihn. Flanagan zieht an der Pfeife, atmet grauen Rauch aus, blinzelt in den Morgenhimmel. Ein kleiner, rumpliger Kerl mit buschigen schwarzen Brauen, eingefallenen Wangen und einer viel zu großen Nase für sein hageres Gesicht. Wie immer sieht er maßlos selbstzufrieden aus. Man könnte meinen, er hätte gerade beim Pferderennen gewonnen, statt mitanzusehen, wie drei seiner Landsleute am Strick starben. O’Connor tritt näher, versucht, seinen Blick zu erhaschen. Als Flanagan ihn endlich bemerkt, verzieht er kurz das Gesicht, dann lächelt er rasch und nickt in Richtung Worsley Street.
Zehn Minuten später sitzen die beiden Männer an einem kleinen Tisch im hintersten Separee des White Lion. Flanagan tröpfelt heißes Wasser in seinen Brandy, O’Connor sieht ihm zu, das Notizbuch aufgeschlagen vor sich auf dem Tisch und einen Stift in der Hand.
»Sie fragen sich bestimmt, was ich hier mache«, sagt Flanagan. »Warum ich nicht im warmen Bett geblieben oder mit den anderen zum Gottesdienst gegangen bin.«
»Ich vermute, irgendwer hat Sie geschickt. Damit Sie Bericht erstatten.«
Flanagan schnaubt, schüttelt den Kopf.
»Unsinn«, sagt er. »Ich bin aus eigenem Antrieb hier. Ich lass mir nichts vorschreiben, wissen Sie doch. Ich geh lieber meinen eigenen Weg.«
O’Connor nickt. So rechtfertigt Flanagan eben gern seine diversen Betrügereien – besser, man stellt das gar nicht erst infrage. Er ist eingebildet und schlicht, doch die Fenians von Manchester vertrauen ihm, und in dem Unfug, den er redet, findet sich ab und an auch mal ein Bröckchen sachdienliche Wahrheit.
»Dann wollten Sie sich also bloß das Spektakel nicht entgehen lassen, was?«
Flanagan runzelt die Stirn, wirkt plötzlich ernst, als fände er die Witzelei geschmacklos.
»Ich wollte den dreien bei ihrem Ende zur Seite stehen«, sagt er. »So gut es ging, wenigstens. Michael Larkin hab ich lang gekannt. Seine Frau kenne ich auch, Sarah heißt sie. Die anderen beiden, Allen und O’Brien, die waren bisschen hitzköpfig, bisschen ungestüm, na gut, aber Michael war ein braver Familienvater. Seine vier armen Kinder sind jetzt Waisen, war das wirklich nötig?«
»Das sind nicht die einzigen Waisen in dieser Stadt«, erwidert O’Connor.
»Das mit dem Gefängniswagen war ein Unfall. Das weiß doch jeder. Die drei wollten die Tür aufschießen, und der arme Sergeant Brett stand leider im Weg. Mord war das im Leben nicht.«
»Das spielt jetzt wohl kaum noch eine Rolle. Die Sache ist erledigt.«
Flanagan schüttelt den Kopf.
»Für die Leute, die ich kenne, spielt das sehr wohl noch eine Rolle. Eine große sogar.«
Er schweigt, pustet den Dampf von seinem Brandy und nimmt einen vorsichtigen Schluck.
»Feines Tröpfchen, das«, sagt er. »Recht vielen Dank auch, Mr O’Connor.«
»Dann sind die also wütend, diese Leute, die Sie kennen?«, sagt O’Connor. »Wie wahrscheinlich ist es denn, dass aus der Wut noch mehr wird?«
»Oh, sehr wahrscheinlich, sehr! Man schmiedet große Pläne, wie ich höre.«
»Was für Pläne?«
»Das weiß ich nicht, nur dass es verflucht große sind.«
O’Connor schweigt. Groß sind die Pläne immer, von denen Flanagan und seinesgleichen ihm erzählen, aber verwirklicht werden sie nur selten.
»Angeblich wird eigens jemand aus Amerika geholt«, fährt Flanagan fort. »Ein Soldat, ein Veteran aus dem Bürgerkrieg.«
»Aha. Und wie heißt dieser Soldat?«
»Den Namen weiß ich nicht. Nur, dass er eigens aus Amerika geholt wird.«
»Und woher aus Amerika? Aus New York?«
Flanagan zuckt die Achseln.
»Vielleicht New York, vielleicht Chicago. Jedenfalls heißt es, er soll hier ordentlich Unruhe stiften.«
»Ich hab nichts davon gehört, dass jemand aus Amerika kommt. Davon hat bisher niemand was gesagt.«
»Ja, weil es sonst niemand weiß. Ist ein Geheimnis.«
»Ohne Namen kann ich mit dieser Information nichts anfangen«, sagt O’Connor.
»Ich sag Ihnen nur, was ich weiß. Man hat ihn geschickt, damit er Rache für die Hinrichtungen übt, damit alle sehen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen.«
»Wenn Sie nicht wissen, wie er heißt, gibt es ihn vermutlich gar nicht. Ein Hirngespinst, sonst nichts.«
»Und ob’s den gibt! Die passen diesmal bloß auf wie die Schießhunde. Hüten sich vor Spitzeln.«
O’Connor nickt, leckt an der Bleistiftspitze und schreibt einen Satz in sein Notizbuch.
»Dann seien Sie mal besser vorsichtig«, sagt er.
Flanagan zuckt erneut die Achseln. O’Connor steht auf, legt eine Münze auf den Tisch.
»Trinken Sie noch einen Brandy«, sagt er. »Wenn Sie den Namen oder etwas anderes von Belang erfahren, wissen Sie, wo Sie mich finden.«
Flanagan steckt die Münze ein und nickt zum Dank.
»Haben Sie gesehen, wie der arme Michael noch gezappelt hat?«, fragt er. »Haben Sie’s gesehen? Grausiger Anblick, oder? Furchtbar, wirklich. Können Sie sich denken, was der durchgemacht hat, wie er da gebaumelt ist, halb tot und halb lebendig, Hände und Füße gefesselt? Eine Schande, wenn Sie mich fragen. So einen Tod verdient niemand. Vor aller Augen das Leben aus dem Leib gezerrt zu kriegen …«
»Calcraft ist ein Pfuscher. Wenn es ginge, würde man sofort einen anderen einstellen, aber niemand will heute mehr Henker sein.«
Flanagan überlegt einen Moment.
»Also ich würd nicht gleich Nein sagen, wenn’s mir einer anbietet«, sagt er. »Solange die Bezahlung stimmt.«
O’Connor sieht ihn an, schüttelt den Kopf.
»An Ihrer Stelle, Tommy Flanagan, würde ich mir nicht über das obere Ende des Stricks Gedanken machen«, sagt er, »sondern über das untere.«
Zweites Kapitel
Am Hafen von Liverpool fragt Stephen Doyle einen Gepäckträger nach der Richtung und geht den langen Hang hinauf zum Bahnhof Lime Street, den Rucksack über der Schulter, die Beine noch wacklig von der achttägigen Überfahrt. Leeräugige Bettler rufen nach ihm, halten ihm die ausgebeulten Hüte hin, doch er achtet nicht auf sie. Am Schalter kauft er eine Fahrkarte, prüft die Abfahrtszeiten nach Manchester, dann nimmt er Platz im Wartesaal der zweiten Klasse. Durch die breiten Fenster sieht er jenseits der eisernen Absperrungen die gewaltigen Loks ein- und ausfahren. Er zählt mit, blickt auf die Uhr. Dreißig Züge in der Stunde, rechnet er, fünfhundert am Tag, vielleicht auch mehr. Neben ihm isst ein alter Mann Pflaumen aus einer Papiertüte, rosa tropft der Saft ihm in den weißen Bart. Auf dem Bahnsteig bläst ein Wachmann in adretter blauer Uniform zweimal in seine Pfeife und hebt eine rote Fahne.
Als der Zug in St Helens hält, betritt ein junger, wie ein Landarbeiter gekleideter Mann das Abteil und mustert Doyle vorsichtig.
»Sind Sie der Yankee?«, fragt er.
»Kenn ich Sie?«, erwidert Doyle.
»Ich hab eine Nachricht.«
Er reicht ihm einen Zettel, Doyle faltet ihn auf und liest. Eine Warnung, unterzeichnet von Peter Rice, Hauptquartier Manchester: Am Bahnhof London Road warten Detectives, die jeden aus Liverpool kommenden Amerikaner aufhalten und befragen.
»Soll ich hier aussteigen?«, fragt Doyle.
»Nächste Station. Jemand holt Sie ab. Ich zeig’s Ihnen.«
Doyle nickt, steckt den Zettel in die Tasche. Der junge Mann setzt sich in eine Ecke und glotzt durchs Fenster auf den leeren Bahnsteig. Er hat gelblichen Flaum auf Wangen und Oberlippe, seine Haut ist fettig und verpustelt. Der Zug zischt zweimal, dann rattert er weiter. In Collins Green steigen sie aus, der Jüngere führt Doyle aus dem Bahnhof und zeigt auf eine wartende Kutsche.
»Das ist Skelly. Er bringt Sie an Ihr Ziel«, erklärt er.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragt Doyle. »Was haben die von mir erzählt?«
»Bloß, dass ich Sie an den Narben im Gesicht erkenne.«
»Sonst nichts?«
Er zuckt die Achseln.
»Die meinten, Sie sollen hier Stunk machen.«
Bauernhöfe weichen Steinbrüchen und Ziegeleien, die wiederum Fabriken, Kalkwerken und rußgeschwärzten Reihenhäusern Platz machen. Es riecht nach Rauch, Fabrikschornsteine ballen sich vor regendunklem Himmel wie verkohlte Überreste eines Walds. Sie folgen einem Omnibus in die Corporation Street, dann hält die Kutsche in einer schmalen Nebenstraße. Skelly beugt sich herab und teilt Doyle mit, dass sie am Ziel sind. Ein weiterer Mann erscheint und führt Doyle in einen schattigen Innenhof, über dem Leinen voll tropfender Wäsche gespannt sind. Ein Schwein durchwühlt einen Müllhaufen, in der Luft hängt der heiße Gestank von Fäulnis und Urin. Der Mann klopft an eine Tür, und mit einem kurzen Quietschen wird der Riegel zurückgezogen.
Das Zimmer dahinter ist klein und karg, in der Mitte stehen zwei wurmstichige Stühle und ein Tisch, sonst ist es leer. Halbherzig fällt diffuses Licht durch die verdreckten Fenster. Peter Rice deutet auf einen Stuhl und setzt sich dann selbst. Er ist korpulent und breitschultrig. Sein angegrautes Haar ist kurz über den vierschrötigen Schädel geschoren, seine Züge sind fleischig und breit.
»Hier werden Sie wohnen«, erklärt er. »Oben gibt’s ein Bett. Ich schicke später eine Frau, die Ihnen Feuer macht.«
Doyle sieht sich im Zimmer um.
»Und die Nachbarn? Wissen die, wer ich bin?«
»Die wissen, wie man das Maul hält. Machen Sie sich wegen denen keine Sorgen.«
»Der Junge hat mir Ihre Nachricht gegeben. Ich muss gestehen, ich war ein wenig überrascht.«
Rice rutscht auf dem Stuhl herum, reibt sich die Nase.
»Vorsicht ist besser als Nachsicht«, sagt er. »Vielleicht nur falscher Alarm.«
»Aber am Bahnhof hat die Polizei auf mich gewartet?«
»Haben jedenfalls die Gepäckträger gesagt. Dass die Bullen nach Amerikanern fragen, die aus Liverpool ankommen. Aber vielleicht war’s auch gar nichts.«
»Wie viele Leute hier wussten, dass ich komme?«
»Drei oder vier.«
»Verraten Sie mir die Namen?«
Rice schüttelt den Kopf, beugt sich ein Stück vor. Seine Haut ist schmierig und vernarbt, die Stoppel am Kiefer sind dick und schwarz wie Eisenspäne.
»Immer langsam, Freundchen«, raunzt er. »Sie können hier nicht einfach aufkreuzen und unsere Leute verdächtigen.«
»Woher sollte die Polizei denn sonst Bescheid wissen?«
»Die wissen gar nichts. Das sind alles bloß Mutmaßungen und Gerüchte. Nicht mal einen Namen haben die.«
»Und die Gerüchte, woher kommen die?«
»Vielleicht aus New York. Was man so hört, wimmelt’s da ja nur so von Verrätern.«
Doyle holt tief Luft und zuckt mit den Schultern. Kelly hat ihn vor Peter Rice gewarnt: Er ist der Sache treu ergeben, aber auch empfindlich in Bezug auf seine Autorität und argwöhnisch gegenüber Fremden.
»Ich muss ganz sicher sein, ehe ich anfange«, sagt Doyle. »Ich darf kein Risiko eingehen.«
»Vor dem Überfall auf den Gefängniswagen haben auch alle dichtgehalten. Fünfundzwanzig Männer, und kein Mucks. Denken Sie daran, bevor Sie hier in Manchester nach Spitzeln suchen.«
»Die Leute ändern sich, sie kriegen kalte Füße oder werden gierig. Alles schon erlebt.«
Rice schüttelt den Kopf.
»In Amerika vielleicht, aber nicht hier.«
Doyle nickt.
»Colonel Kelly hat mir schon erzählt, dass Sie Ihren eigenen Kopf haben«, sagt er. »Dass Sie nicht gern Befehle annehmen.«
»Von Befehlen weiß ich nichts. In seinem Brief hat Kelly nur geschrieben, ich soll Ihnen Hilfe anbieten, wenn Sie welche brauchen, und das werde ich auch tun.«
Doyle zieht einen Beutel aus der Tasche, stopft seine Pfeife. Er hält Rice den Beutel hin, doch der lehnt ab.
»Aber falls hier in Manchester doch mal jemand den Drang verspüren sollte, mit der Polizei zu sprechen, wie würde er das dann wohl anstellen?«
»Die Detectives haben ihre Dienststelle im Rathaus, in der King Street.«
»Haben Sie davor jemanden postiert?«
»Meistens.«
»Aber nicht immer?«
Rice blitzt ihn an. Doyle mahnt sich zur Vorsicht. Wenn er zu grob vorgeht, wird er Rice ganz verlieren, und dafür ist es viel zu früh.
»Tagsüber haben wir dort einen Jungen«, erklärt Rice, »aber nachts passt keiner auf.«
»Und wenn einer zum Rathaus geht und reden will, nach welchem Detective würde er da fragen?«
Rice schnaubt verächtlich.
»Es geht keiner zum Rathaus«, sagt er, »und es redet auch keiner.«
»Aber falls doch?«
Rice antwortet nicht sofort. Auf dem Hof grunzt das Schwein. Ein Baby schreit.
»Es gibt da einen Constable namens O’Connor«, räumt Rice schließlich ein. »Wurde vor sechs oder sieben Monaten aus Dublin hergeholt. Der steckt überall seine Nase rein und stellt neugierige Fragen.«
»Wissen Sie, wo er wohnt? Seine Adresse?«
Rice schüttelt den Kopf. »Kriege ich aber raus.«
»Ich will nur sichergehen«, sagt Doyle. »Das verstehen Sie doch. Ich kann nicht anfangen, bevor ich nicht absolut sicher bin.«
»Nur die Ruhe«, sagt Rice. »Warten Sie von mir aus ab, so lang Sie wollen. Kein Grund zur Eile.«
Doyle nickt, sieht sich im leeren Zimmer um.
»Wenn diese Frau kommt, soll sie eine Öllampe und eine Flasche Whiskey mitbringen«, sagt er.
»Richte ich aus.«
Rice hat eine zerlumpte Bandage um den rechten Arm. Doyle sieht sie an und nickt.
»Wie wurden die drei eigentlich erwischt? Das hat Kelly mir nicht erzählt.«
»Die Bullen haben sie in der Ziegelei in Gorton aufgespürt. Larkin war zu krank, um wegzulaufen, die beiden anderen wollten ihn nicht allein lassen.«
»Die Briten haben uns einen Gefallen getan«, sagt Doyle. »Hätten sie die drei in den Knast gesteckt, wären ihre Namen bereits nächstes Jahr vergessen gewesen.«
»Sie sind für ihr Land gestorben«, erwidert Rice. »Das war kein Gefallen, sondern Mord. Die drei sind Märtyrer.«
»In Gettysburg hab ich gesehen, wie tausend Mann an einem Nachmittag getötet wurden. Die Leichen haben sich wie Feuerholz gestapelt. Auch alles Märtyrer, wenn Sie so wollen, nur singt keiner Lieder über sie.«
Rice kneift die Augen zusammen und legt den Kopf zurück.
»Warum riskiert ein Weißer seinen Hals für Schwarze? Das will mir nicht in den Kopf.«
»Ich bin nicht zur Armee, um Schwarze zu befreien. Ich bin hin, weil ein Kerl mit gewichstem Schnurrbart und glänzenden Rockknöpfen mir fünfundzwanzig Dollar und ein Bier anbot. Bei der ersten Schlacht war ich noch kein Soldat, aber das hat sich schnell geändert. Notgedrungen. Dann bin ich auf den Geschmack gekommen.«
»Und jetzt kämpfen Sie für Irland.«
Es ist nicht als Frage gemeint, klingt aber wie eine. Als gäbe es unterschiedliche Grade von Loyalität und Überzeugung, und Rice wollte Doyle zeigen, wo er steht.
»Ich wurde in Sligo geboren; mit dreizehn bin ich von dort weg. Zweifeln Sie an mir, Peter?«
Rice schüttelt den Kopf und runzelt die Stirn, als verstünde er gar nicht, was Doyle meint.
»Warum sollte ich an Ihnen zweifeln?«, sagt er.
Als das Gespräch beendet ist, bringt Doyle seinen Rucksack nach oben und legt sich auf das Bett. Die Matratze ist feucht, riecht nach Sperma und Haaröl. Eine Stunde später kommt eine junge Frau mit einer Schachtel Kerzen, einem Laib Brot, drei Eiern, etwas Tee und einem Eimer Kohle. Von Whiskey habe ihr niemand was gesagt, antwortet sie auf Doyles Nachfrage. Während sie am Boden kniet und Feuer macht, kommt ein Junge mit O’Connors Adresse. Doyle nimmt den Zettel an sich und lässt den Jungen vor der Tür warten. Nach dem Abendbrot geht er mit ihm zur George Street, und der Junge zeigt auf Nummer sieben. Doyle drückt sich ein Weilchen an der Ecke herum, spaziert ein Stück, kommt noch einmal zurück. Im Erdgeschoss brennt schwaches Licht, aber es rührt sich nichts. Inzwischen ist es kalt und dunkel, schmutzige Regenschwaden gehen nieder. Der sternlose Himmel hat dieselbe matte Farbe wie die Dächer und Mauern, und die Dächer und Mauern haben dieselbe matte Farbe wie das verschlammte Pflaster unter Doyles Füßen, so als wäre die gesamte Welt in denselben Ton von Trostlosigkeit und Tod getaucht. Er geht zur Oxford Road und fragt dort nach der King Street. Schneller ginge es mit Kutsche oder Omnibus, doch er muss sich die Wege selbst erschließen. Vor dem Rathaus bleibt er einen Moment stehen, dann tritt er ein und sucht nach der Dienststelle der Polizei. Als er sie findet, setzt er sich auf eine Bank im Flur und sieht zu, wie die Polizisten kommen und gehen. Gelassen wirken sie, sorglos, als könnte ihnen unmöglich etwas passieren. Niemand spricht ihn an oder würdigt ihn eines zweiten Blickes. Er überlegt, unter einem Vorwand nach James O’Connor zu fragen, entscheidet sich jedoch dagegen. Nach einer halben Stunde zieht er Bleistift und Notizbuch aus der Tasche, zeichnet einen Lageplan vom Flur und den angrenzenden Räumen, dann steht er auf und geht.
Am nächsten Morgen wartet Doyle am Kutschenstand in der King Street, und als James O’Connor aus dem Rathaus tritt, macht Rices Junge Seamus, der ihn vom Sehen kennt, das verabredete Zeichen. Die beiden Männer gehen durch Piccadilly, vorbei am Spital und dem Irrenhaus, dann den Hügel hinauf: O’Connor voraus, gebückt und nichts ahnend, Doyle hinterdrein, in zehn Metern Abstand. Schwarzer Rauch strömt aus den hohen Fabrikschornsteinen in den dicht bewölkten Himmel, das Morgenlicht ist fahl, zurückgenommen, als neigte sich der Tag dem Ende zu, bevor er angefangen hat. Als sie den Bahnhof London Road erreichen, warten dort bereits ein Sergeant und fünf Constables. O’Connor gesellt sich zu ihnen; sie unterhalten sich ein Weilchen, dann, als der Zug aus Liverpool ankommt, verteilen sie sich auf dem Bahnsteig und befragen die aussteigenden Männer. Doyle sieht von einer Bank am Fahrkartenschalter aus zu. Viel zu plump, denkt er. Auf den Bahnsteigen herrscht zu großes Gedränge; jeder mit etwas Verstand könnte mühelos den rechten Augenblick abwarten und unbemerkt vorbeischlüpfen. Alle halbe Stunde kommt ein Zug aus Liverpool, und Doyle sieht sich das Schauspiel siebenmal an. Zweimal winkt einer der Constables O’Connor herbei, und der spricht persönlich mit dem Passagier, stellt weitere Fragen und notiert die Antworten in seinem Notizbuch, doch beide Male lassen sie den Mann nach wenigen Minuten wieder gehen.
Gegen Mittag trifft ein neuer Trupp aus sechs Constables ein. Die beiden Gruppen stehen eine Weile beisammen, plaudern und scherzen, dann fährt der Zug ein, und der erste Trupp zieht ab, während die Ablösung die Fahrgäste befragt. O’Connor bleibt noch kurz auf dem Bahnsteig, um sich zu vergewissern, dass sie ihre Arbeit richtig machen, dann geht er ins Bahnhofscafé und setzt sich an einen Tisch am Fenster. Doyle behält ihn weiterhin im Auge. O’Connor bestellt eine Tasse Tee und trinkt sie langsam, pustet erst darauf und stellt die Tasse nach jedem Schluck auf der Untertasse ab. Als er ausgetrunken hat, gähnt er, reibt sich die Augen, holt sein Notizbuch hervor und blättert darin. Blass ist er, die Augen sind eingesunken und schwarz gerändert. Irgendetwas daran, wie er sitzt und sich bewegt, so steif und unsicher, bringt Doyle auf den Gedanken, er könnte krank oder verwundet sein. Ein Kellner fragt etwas, O’Connor nickt und blickt wieder in sein Notizbuch. Ein paar Minuten später zahlt er, zählt das Wechselgeld und steckt es in die Westentasche. Er verlässt das Café und geht an der Bank vorbei, auf der Doyle noch immer sitzt. Doyle wartet kurz, dann steht er auf und folgt ihm. Getrennt und doch zusammen durchqueren die beiden Männer im Gänsemarsch die geschäftige Bahnhofshalle und treten wieder hinaus in den kalten, grauen, weiten Tag.
Es ist bereits nach Mitternacht, als Doyle findet, was er sucht. Er sitzt allein in einer Branntweinschenke, in einer der engen Gassen rund um Deansgate. Ein unberührtes Glas Rum vor sich belauscht er aufmerksam und unauffällig das Gespräch der beiden Männer rechts von ihm. Die zwei feilschen um den Preis für eine silberne Taschenuhr mit Kette. Der Verkäufer ist jünger als sein Gegenüber. Er spricht schnell, rutscht auf dem Stuhl herum, als wäre er es nicht gewohnt, so lange still zu sitzen. Sein Schnurrbart ist spärlich, seine Haut im Gaslicht feucht und körnig. Der andere ist dick, sein langer brauner Bart hängt ihm auf die Brust wie eine schmutzige Serviette. Er gibt sich kokett, spöttisch und nörglerisch. Während der Jüngere auf ihn einredet, schiebt er die Uhr mit spitzen Fingern auf dem Tisch herum, zuckt die Achseln und verdreht die Augen. Als der Verkäufer seinen Preis nennt, schüttelt er glucksend den Kopf, als wäre er gleichermaßen belustigt und entsetzt über die aberwitzige Summe. Doch der Jüngere bleibt unbeirrt. Noch einmal zählt er die vielen Vorzüge der Uhr auf, betont ihr Gewicht und ihren Glanz. Ein neuer, deutlich niedrigerer Preis wird vorgeschlagen, abgelehnt und durch ein drittes Angebot ersetzt, bis sich die beiden endlich einig werden, nicht ohne ihren jeweiligen Widerwillen und ihren leichtsinnigen Großmut noch einmal zu unterstreichen. Doyle schätzt, dass der Mann höchstens ein Viertel dessen zahlen muss, was die Uhr tatsächlich wert ist, doch dafür, dass sie so eindeutig gestohlen ist, kommt der Verkäufer noch gut weg. Er wartet, bis der Dicke fort ist, dann wendet er sich an den Jüngeren.
»Sie haben nicht zufällig noch so eine Uhr im Angebot?«, fragt er.
Der Mann blickt ihn kurz an und dann gleich wieder weg, als wüsste er nicht recht, ob diese Frage eine Antwort wert sei.
»Und wenn?«, sagt er.
»Dann würde ich gut dafür bezahlen«, antwortet Doyle. »Mehr als der andere da eben.«
Der junge Mann schnaubt und mustert ihn von Kopf bis Fuß.
»Was sind Sie überhaupt für einer?«, fragt er. »Amerikaner?«
»Ire. Aus New York.«
»So, so, einer von denen also.«
»Ich hätte mehr für die Uhr bezahlt. Viel mehr.«
Der junge Mann zuckt mit den Schultern.
»Ich wollt sie ihm billig überlassen«, sagt er. »Ist ein alter Freund von mir, darum.«
»Eine wirklich schöne Uhr war das. Bestimmt nicht leicht zu finden. Da muss man schon wissen, wo man sucht.«
Der junge Mann grinst.
»Oh, das weiß ich wohl«, sagt er. »Wenn hier einer weiß, wo man suchen muss, dann ich.«
»Ein Experte, was?«, fragt Doyle.
Der junge Mann richtet sich kopfschüttelnd im Stuhl auf, als fiele ihm plötzlich wieder ein, wer er ist.
»Ich bin kein Prahlhans«, sagt er. »Ich häng meine Angelegenheiten nicht gern an die große Glocke.«
»Aber ein patenter Kerl sind Sie: tapfer, gewitzt und einfallsreich. Sehe ich Ihnen sofort an.«
»Na ja, da will ich mal nicht widersprechen.«
»Und wenn jemand etwas Bestimmtes bräuchte, einen Wunsch hätte? Wenn ich zum Beispiel etwas haben wollte, dass ich auf üblichem Weg nicht kriegen könnte?«
»Was wäre das denn für ein Wunsch?«
Doyle schnappt sich seinen Rum, steht auf und streckt dem jungen Mann die Hand hin.
»Mein Name ist Byrne«, sagt er.
»Dixon.«
Doyle wirft einen kurzen Blick auf den freien Stuhl, und Dixon nickt.
»Nur zu«, sagt er.
Doyle schiebt die leeren Gläser zur Seite, stellt seinen Rum ab und setzt sich.
»Ich kann leicht noch so eine Uhr beschaffen«, erklärt Dixon. »Kommen Sie morgen Abend wieder her.«
»Mir geht es nicht bloß um die Uhr; da ist noch etwas anderes.«
»Und zwar?«
Doyle zuckt die Achseln, beugt sich vor und flüstert: »Nichts Besonderes. Wenigstens nicht für einen aufgeweckten Burschen wie Sie. Ein Kinderspiel.«
Drittes Kapitel
Heute – eine Woche nach der Hinrichtung – findet der Trauerzug der Fenians statt. Dreitausend Iren versammeln sich in der Mittagsfeuchte auf dem Stevenson Square: Männer, Frauen und Kinder mit grünen Halstüchern, Schleifen und Rosetten, angeführt von einem Spielmannszug, der den »Totenmarsch« aus Händels Saulspielt, und von drei Priestern, die gerahmte Bilder der Verstorbenen vor sich her tragen. O’Connor wartet in einer Seitenstraße, bis der Zug aufbricht, und reiht sich dann ganz hinten ein. Die schwarzen Regenschirme wie Legionärsschilde gegen den Nachmittagsniesel erhoben, geht es durch Piccadilly, vorbei am Spital, am Irrenhaus und an Trauben neugieriger Zuschauer, und dann die London Road hinauf. Bei der Druckerei überqueren sie den Medlock und biegen rechts in die Grosvenor Street. O’Connor bahnt sich langsam seinen Weg nach vorn, mit wachsamem Auge und gespitzten Ohren. Abgesehen von den scharrenden, schlurfenden Schritten und den Musikfetzen, die vom Kopf des Zugs herüberwehen, ist es still wie in der Kirche. Man spricht mit gedämpfter Stimme, und wenn ein Kind laut auflacht oder ruft, drehen sich alle nach ihm um. Der Umzug soll Stärke demonstrieren, allen zeigen, dass die Hinrichtung niemanden eingeschüchtert hat. Dabei wird es jedoch ganz bestimmt nicht bleiben, da ist O’Connor sicher – irgendetwas kommt noch. Wieder muss er an den Amerikaner denken, von dem Flanagan erzählt hat. Die würden doch nicht eigens jemanden aus New York herschicken, wenn sie nichts geplant hätten. Allerdings wird es kein neuer Aufstand werden, nicht so bald nach dem letzten Fiasko; eher etwas Kleineres, etwas, das ihre Feinde verstören und ihren Unterstützern neue Hoffnung geben soll – Brandstiftung vielleicht, schlimmstenfalls ein Mordanschlag, wobei sie meist ja doch nur große Töne spucken.
Der Regen lässt nach, und die Leute klappen ihre Schirme zu. Weiter geht es, vorbei an der All Saints Church zur Rechten und dem Chorltoner Rathaus zur Linken. Der Himmel hat die Farbe nassen Mörtels, die Luft schmeckt nach Ruß und ganz leicht nach Ammoniak aus dem nahen Chemiewerk. Der Wind ist schwach, der dunkle Rauch steigt in zerrissenen Säulen aus den Schornsteinen. In Hulme schließen sich weitere Trauernde an, und als der Zug Deansgate erreicht, ist er neun oder zehn Mann breit und über einen Kilometer lang. Kutschen und Omnibusse weichen auf den Bürgersteig aus, um sie vorbeizulassen. Ehe sie den Fluss überqueren, bemerkt O’Connor ein Stück weiter vorn Tommy Flanagan. Er hat sich eine grüne Schleife um die braune Melone gebunden und trägt Trauerflor am Arm, ist ins Gespräch vertieft mit einem Mann, den O’Connor nicht erkennt. Jenseits der Brücke hält der Zug vor dem Gefängnis, und die Priester sprechen ein paar unverständliche Gebete. Der Galgen wurde bereits abgebaut, doch der abgeschirmte Raum unter der Falltür, in dem Michael Larkin so grausam zu Tode kam, ist noch da. O’Connor bleibt auf Abstand, bis Flanagan allein ist, dann tritt er neben ihn und spricht, ohne ihn anzusehen.
»Mit wem haben Sie sich da gerade unterhalten?«
Flanagan dreht sich kurz nach ihm um und wendet sich gleich wieder ab.
»Doch nicht hier, Menschenskind!«, raunt er. »Sind Sie von allen guten Geistern verlassen?«
»Ist doch eine ganz einfache Frage.«
»Der braucht Sie nicht zu interessieren.«
Flanagan klingt angespannt, längst nicht so selbstgefällig wie gewöhnlich.
»Hat er etwas gesagt, dass Sie beunruhigt, Tommy?«
»Ist doch egal, was er gesagt hat.«
»Das war doch nicht etwa Ihr berühmter Amerikaner, oder? Ist er schon eingetroffen?«
»Was für ein Amerikaner?«
»Der, von dem Sie letzte Woche erzählt haben.«
»Es gibt keinen Amerikaner, verflucht noch mal. Das war nur Gerede. Und jetzt gehen Sie. Das ist hier weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort.«
»Dann war er’s also nicht?«
»Natürlich nicht.«
O’Connor sieht sich nach dem Unbekannten um. Nur kurz hat er ihn von der Seite gesehen. Er hatte langes, dunkles Haar, anscheinend eine Narbe auf der Wange, mehr war nicht zu erkennen. O’Connor blickt auf seine Taschenuhr und macht sich eine Notiz in seinem Buch, um in seinem Bericht an Maybury nichts zu vergessen. Irgendwas ist faul mit Flanagan, doch vielleicht ist es nicht weiter wichtig. Höchstwahrscheinlich schuldet er dem Mann nur Geld.
Der Zug schwenkt zurück über den Fluss und nach Shude Hill. Die anfängliche Düsternis ist jetzt verflogen; die Stimmen werden lauter, und es wird gelacht, hin und wieder stimmt jemand ein Lied an. Bei New Cross legt der Spielmannszug die Instrumente ab, und jemand bringt aus dem Crown Hotel eine Kiste Bier; die drei Priester verabschieden sich und steigen in eine Kutsche. Vom Eingang eines Pfandleihhauses sieht O’Connor zu, wie sich die Menge auflöst. Ärger gab es nicht, doch den hat er auch nicht erwartet – Manchester ist ja nicht Glasgow oder Liverpool, wo es angriffslustige Oranier gibt wie Sand am Meer. Er überlegt, direkt zurück ins Rathaus zu gehen und seinen Bericht zu schreiben, entscheidet sich jedoch dagegen. Es wird schon dunkel, und ihm knurrt der Magen. Er wird im Commercial Coffee House zu Abend essen und auf dem Rückweg ins Büro gehen.
Quer über die gepflasterte Kreuzung steuert er die Oldham Street an. Versprengte Grüppchen aus dem Trauerzug schwatzen noch immer und vertreiben sich die Zeit. Jemand holt einen verbeulten Flachmann aus der Tasche, nimmt einen Schluck und reicht ihn weiter. O’Connor verspürt das übliche Stechen, den innerlichen Schauder, doch dabei bleibt es. Er wird einen schönen Teller Eintopf essen und ein Ginger Ale dazu bestellen, seine Pfeife rauchen und die Zeitschriften lesen.
Seit seiner Ankunft in Manchester hat O’Connor nicht mehr getrunken, auch wenn die Versuchung manchmal noch stark ist. Statt Whiskey trinkt er jetzt Limettensirup, Gingerette, Sarsaparilla, schwarzen Kaffee und becherweise süßen Tee. Täglich raucht er eine halbe Unze billigen Tabak und arbeitet viel mehr, als er bezahlt bekommt. Die Brust ist ihm nicht mehr so schwer wie früher, doch den Druck spürt er noch immer. Meistens fühlt er sich, als würde er auf einem Hochseil balancieren, vorsichtig einen bestrumpften Fuß vor den anderen setzen und niemals hinabsehen. In England ist er sicher besser dran, hier, wo ihn niemand kennt, sich niemand für ihn interessiert, wo er frei von Vorgeschichte und Erwartungen ist, aber wie lang kann dieser Hochseilakt noch gut gehen, und wie wird er enden? Wird er wirklich bis zum Ende seiner Tage hier in seinem einsamen Exil bleiben und Karten im Enthaltsamkeitscafé spielen?
Er schlägt die Zeitschrift zu, schiebt sie zur Seite. Wenn ihm zum Lesen nur noch die weltfremden Frömmlereien im British Workman