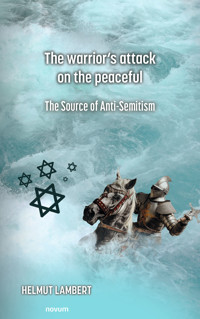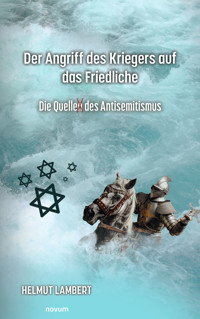
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aristokratien und totalitäre Diktaturen müssen, im Zeichen von Religion oder "Wissenschaft", den dummen und aggressiven Untertanentyp formen und in Krisen gegen friedliche, tolerante Minderheiten aufbringen. Dies waren seit fast 2.000 Jahren vor allem die Juden der Diaspora. Bei der Entwicklung der "zivilen" Werte, die Grundlagen der westlichen Welt, gingen sie voran. Diese mit dem begrifflichen Instrumentarium von Elias und Luhmann entwickelte These bestätigt sich über die Jahrhunderte bis zum heutigen Konflikt um Israel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe:978-3-7116-0207-7
ISBN e-book:978-3-7116-0208-4
Mag. Eva-Maria Peidelstein
Umschlagfotos: Helmut Lambert;Helena Bilkova | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Widmung
min hjertestjerne
Einleitung
Vorbemerkung
Das Buch entstand aus der Analyse des Antisemitismus aus soziologischer Perspektive und deren Überprüfung in der Geschichte. Dies führte über viele Stationen eines großen historischen Überblicks zur klaren Einsicht, dass er notwendiges Herrschaftsinstrument der jeweils herrschenden Kräfte war, im christlichen Abendland war es meist die Aristokratie.
Das Thema erhielt durch den Überfall der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und den Raketenangriff des Iran im April 2024 eine bestürzende Aktualität, die nach Berücksichtigung rief. Die Anwendung der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse nun nicht mehr auf historisches, sondern auf heiß umstrittenes politisches Feld ist unvermeidlich heikel und muss kleinteilige Betrachtungen vermeiden. Der über Jahrtausende gespannte Blick konnte jedoch auch hier mehr Klarheit bieten, in Bezug auf den Antisemitismus ebenso wie auf unsere deutsche, westliche Position.
Die Kapitelfolge mit dem schrittweisen Erkenntnisgewinn, an dessen Ende die Behandlung der Situation Israels steht, zeigt die Erklärungsmacht der entwickelten Argumentation für die Gegenwart und ermöglicht ein abschnittsweises Lesen.
Überblick
Die bisher angegebenen, zahlreichen Gründe für den Antisemitismus sind unbefriedigend: Das Christentum erklärt nicht den von Hitler und Stalin, die Quelle in der bürgerlichen Gesellschaft nicht den anderer Gesellschaftsformen, Aberglaube nicht die Auswahl der Juden als Objekte, der Palästinakonflikt nicht den muslimischen. Auch die Aufteilung in sozialen, psychologischen, ökonomischen Antisemitismus führt ebenso wenig zu der Quelle wie der primäre und sekundäre Antisemitismus.
Die die hier präsentierte Analyse des Antisemitismus führt ihn auf eine Hauptquelle zurück: Es ist der Angriff der in den Aristokratien Jahrtausende lang vorherrschenden, aggressiven militärischen Werte und Verhaltensformen auf die Juden, die durch ihre Existenz in der Diaspora zur Entwicklung von Friedlichkeit, Gleichberechtigung und Empathie – ziviler – Verhaltens- und Empfindungsformen gezwungen waren. Heute sind sie die Grundwerte der westlichen Welt und der Menschenrechte.
Ausgehend von der extremen Form des militärischen Verhaltens- und Empfindungskanon mit der Wiederbelebung des Antisemitismus unter Kaiser Wilhelm II wird diese These an vielen Beispielen bestätigt. Georg Simmel sieht in der Wirtschaft generell und mit der Durchsetzung des Geldes besonders eine Tendenz zu Friedlichkeit, Karl Popper in der Aristokratie die Aggressivität, die philosophisch-religiös verbrämt wird.
Diese besondere Vorreiterrolle der Juden in der Entwicklung der westlichen und weltweiten Kultur ist weder uns noch den Juden bewusst. Daher sind die hier vorgelegten Ergebnisse geeignet, das Ansehen des Judentums zu vergrößern und in der aktuellen Auseinandersetzung größere Klarheit zu schaffen. Sie machen auch deutlich, warum der Kampf gegen Antisemitismus ein Kampf für unsere Freiheit ist.
Darstellungsfolge
(1) Am Anfang stand die Überlegung, dass die Juden in ihrem fast zwei Jahrtausende dauernden Dasein in der Diaspora unter geringem Rechtsschutz und dauernder Bedrohung eine besondere Form gesellschaftlicher Werte und Fähigkeiten des friedlichen Miteinanders entwickelt haben, um zu überleben. Dazu kam Norbert Elias „Studien über die Deutschen“, in denen er die katastrophalen Entwicklungen zum Ersten und Zweiten Weltkrieg mit der besonders militaristischen Ideologie des Wilhelminischen Reiches erklärte, die dazu diente, die schwankende Adelsherrschaft in Deutschland gegen soziale und demokratische Kräfte zu stabilisieren. Die Vermittlung von Ideologie und Einzelperson erfolgt nach Elias durch die Ausprägung eines „Verhaltens- und Empfindungskanons“, hier eines militärischen, in dem sich seine Werte widerspiegeln: Disziplin, Unterordnung, Gefühlskälte und Glauben statt Wissen. Durchgesetzt wurde er nach Elias durch die Erfindung der „satisfaktionsfähigen Gesellschaft“, die die Erlangung von Führungsposten von der Unterwerfung unter den militärischen Kanon mittels der Schlagenden Verbindungen abhängig machte. Dieser Verhaltens- und Empfindungskanon stand nun ganz offensichtlich dem Friedlichen, Unkriegerischen der Juden diametral gegenüber, der jedoch dem der demokratischen und sozialen Bewegungen entsprach.
Eine Überprüfung, ob die gängigen Vorurteile gegen Juden ganz wesentlich aus einem Wirken militärischer Werte erklärbar waren, bestätigte diese These. Der verstärkt auftretende Antisemitismus war danach ein Nebenprodukt des Wilhelminischen Militarismus in einer gegenüber späteren Auswüchsen noch gemäßigten Form, und das, obwohl der Adel die Juden für seine Wirtschaft nötig hatte.
(2) Der wieder aufgebrochene Antisemitismus suchte nach der Abschwächung des religiösen Motivs neue Wege der Bestätigung und fand sie in der neu aufgekommenen „wissenschaftlichen“ Rassentheorie. Um ihn jedoch dort einordnen zu können, musste man die verderblichen Eigenschaften der Juden bereits viele Jahrtausende zurück verorten, da sonst eine jüdische „Rasse“ nicht hätte entstehen können. Diese „rassenmäßige“ Begründung machte die fortschreitende Integration der Juden in die Mehrheitsgesellschaft durch angepasstes Leben, Verdienst oder Konversion zum Christentum unmöglich.
Um die von den Juden ausgehende, angebliche Gefahr weiter zu vergrößern, wurde das Hauptwirkungsfeld der Juden, der Handel, mit seinen weiten Verbindungen mittels seiner Identifikation mit dem von ihnen angeblich gesteuerten Kapitalismus zur Weltverschwörung diabolisiert. Beides war nur möglich, wenn man die gesamte Entwicklung in Europa seit vorchristlicher Zeit nicht – wie allgemein gesehen – als eine Vermehrung von Einsicht und Humanität bewertet – sondern als steten Niedergang zur Vernichtung einer angeblichen „germanischen Kultur“. Dabei habe diese mit entgegengesetzten Werten – Gefühl, Gewalt und Tiefsinnigkeit – eigentlich die Führung der Welt verdient. Zum systematischen Nachweis der Schlechtigkeit der Juden musste man sich in immer willkürlicheren, vernunftwidrigeren und menschenfeindlicheren Argumenten versteigen. Als ein Kernpunkt der jüdischen Gefahr für das germanische Übermenschentum wurde ausgerechnet eine liberalere Haltung gegen die Homosexualität ausgemacht, wie sie heute mehrheitlich akzeptiert ist.
(3) Eine weitere Begründung für das Auftreten des Antisemitismus ergibt sich aus Georg Simmels „Philosophie des Geldes“, in der er die Wirtschaft mit den ihr immanenten Tendenzen zu Gleichberechtigung, Interessenausgleich, Friedlichkeit, Flexibilität und Drang nach Wissen, also dem zivilen Kanon, detailliert herausgearbeitet hat. Diese Werte waren für die Juden als Händlervolk existenziell wichtig und besonders die Friedlichkeit wurde durch ihre unsichere Existenz in der Diaspora noch verstärkt, wie es in einem eigenen Staat nicht nötig gewesen wäre. Es handelt sich also um eine welthistorische Auseinandersetzung zwischen den Werten einer aristokratischen, allgemeiner gesagt: stratifizierten Gesellschaft, die auf Unterdrückung und Ausbeutung beruht, und einer Gesellschaft der Gleichen, auf Friedfertigkeit und sozialen Ausgleich bedacht wie die westlichen Demokratien („offene Gesellschaft“). Die mit dem Bedeutungszuwachs der Wirtschaft verbundene Machtverschiebung der Neuzeit verlief konfliktreich über das Erkämpfen von mehr Rechten (GB) und über Revolutionen, die niedergeschlagen wurden oder erfolgreich waren (F, USA). In Deutschland artete die Verteidigung der Macht des Adels im 19. Jh. gegen die Triebkräfte der Epoche in verstärkter Repression und Militarisierung aus und erzeugte unvermeidlich als Nebenprodukt den systematischen Antisemitismus – mit monströsen Folgen.
Die Bundesrepublik hat sich 1949 im Grundgesetz zu den zivilen Werten bekannt, nachdem die militärischen zweimal in schreckliche Katastrophen geführt haben.
(4) Die neueren Erklärungen des Antisemitismus in Büchern von Michael Woffsohn und Götz Aly bestätigen die Thesen und erlauben ihre Weiterentwicklung und Differenzierung.
(5) Anhand des Blicks von Zeitzeugen werden die Thesen an konkreten Erscheinungen überprüft:
Fontane verfolgt aufmerksam die negativen Veränderungen von Preußen im 19. Jahrhundert und besonders unter Wilhelm II, u. a. mittels der Verbreitung eines bis in die höchsten Staatsämter reichenden „Byzantinismus“. Bei Fontane selbst verwandelt sich im Lauf seines Lebens sein unreflektierter, traditioneller Antisemitismus aufgrund seiner positiven Erfahrungen mit Juden in ausgesprochene Wertschätzung.
Döblin schildert seine Eindrücke im Judenviertel von Warschau 1926 mit seiner kulturellen Vielfalt, Vitalität und Geschäftigkeit, aber auch der Not und Fremdheit der in großer Zahl aus Russland vertriebenen Juden.
George Orwell beobachtet, dass der Antisemitismus in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg trotz des Wissens über den Holocaust in den traditionellen Klischees weiter reproduziert wurde.
(6) Orientiert an Karl Poppers „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“ wird der militärische Kanon als Unterdrückungsinstrument der Herrscherklasse verständlich. Diese benötigt eine Ideologie zur Rechtfertigung der Unterdrückung der Mehrheit. Sie hat philosophisch in Platons „Der Staat“ ihren Ursprung und wurde, immer neu abgewandelt, im Christentum und von Philosophen der Neuzeit (wie Hegel) von den Herrschenden propagiert.
(7) Berichte aus der Diaspora ergänzen das Bild – zum einen daraus erwachsene Lebensweisheiten für das praktische Leben aus der jüdischen Tradition, zum anderen die plastische Schilderung der Unterdrückung in arabischen Ländern, die im herrschenden Meinungsbild als milder steht. Sie macht jedoch deutlich, dass sie ganz praktische Verhaltensregeln der Juden zur Folge haben musste, für die jedoch noch eine systematische Aufarbeitung zu fehlen scheint.
(8) Schließlich hat die Untersuchung des jüdischen Selbstverständnisses in der Zeit der Aufklärung und heute zum Ergebnis, dass es ausschließlich durch die Stellung zur Religion geprägt ist. Für Verhaltens- und Empfindungsweisen, die aus dem praktischen Leben entstehen, hat es keinen Blick. Hier ist eine Leerstelle, die von zwei jüdischen Soziologen – Kaplan und Wine – angedeutet, aber nicht bearbeitet wird.
(9) Die Freimaurer als Vertreter der Aufklärung und Humanität erleiden ähnliche Diskriminierungen, waren jedoch als Sündenbock weniger leicht zu fassen, da sie als Teile der Mehrheitsgesellschaft kaum erkennbar waren. Die Antisemiten ersparen sich Differenzierungen und spannen beide unter dem Drohwort der freimaurerischen-jüdischen Verschwörung zusammen.
(10) H.A. Winklers Darstellung der Westlichen Welt und ihrer Werte über die vergangenen 2.000 Jahre aus historischer Perspektive lässt sich auch als Kampf der beiden Kanons lesen und bestätigt so die neue Antisemitismuserklärung.
(11) Aus der von F. A. Hayek analysierten Entwicklung des 20. Js., mit den prägenden Diktaturen von Stalinismus und Faschismus ergibt sich deren Antisemitismus aus der Gemeinsamkeit des kollektivistischen Charakters, der wieder folgsame Untertanen braucht und freie Menschen verfolgt.
(12) Mit dem Staat Israel entsteht eine welthistorisch neue Situation. Hier kommen die Konflikte beim Übergang der 6.000jährigen Klassengesellschaft (Stratifiziertes System) zu einem freien Gesellschaftssystems mit der Beendigung von fast 2.000 Jahren Diasporadasein zusammen. Der archaische muslimische Antisemitismus trifft auf einen modernen Staat. Durch ihn ändern sich unvermeidbar einige der spezifischen in der Diaspora notwendigen Eigenschaften, besonders die Friedlichkeit. Die zivile Ausrichtung aber bleibt, und auch deren Feinde, die nun in Israel ein weiteres, aber nicht mehr leicht zu unterdrückendes Ziel haben. Große Teile der muslimischen Welt bekämpfen dies als Vertreter der Moderne fanatisch mit Krieg, Terror und Propaganda, stellen sich dabei gleichzeitig als Opfer des Westens dar. Diese Sichtweise zeigt auch in verunsicherten Kreisen der westlichen Welt Wirkung, die unsere Freiheit gefährdet.
Fazit
Die Erkenntnis, dass die Juden Vorreiter in der Entwicklung eines zivilen Wertekanons waren, der zu den Grundlagen des westlichen Wertesystems wurde, ist weder uns noch ihnen bewusst, erhöht jedoch ihre Wertschätzung, kann zu ihrem nicht-religiösen Selbstverständnis beitragen und lässt ihre Gegner klarer als von den Herrschern programmierte Vertreter von Unfreiheit und Gewalt hervortreten.
Die Untersuchung trägt so auch zu einer Klärung der weltweiten Auseinandersetzungen zwischen Unfreiheit (militärischer Kanon) und Freiheit (ziviler Kanon) bei, in dem die autokratischen Herrscher in alter aristokratischer Manier ohne Rücksicht auf Menschen um Land kämpfen lassen und es letzterem um Wohl und Freiheit der Menschen geht. Dabei wird auch der Unterschied zwischen Diaspora und Staat deutlich gemacht. Die extreme Friedlichkeit, manchmal auch die erzwungene Unterwürfigkeit, über zwei Jahrtausende, war ein historischer Sonderfall. Ein Staat kann sie sich, will er Bestand haben, nicht leisten. Er muss nach innen und nach außen Macht ausüben.
1 Der Hass des Kriegers auf das Friedliche
Antisemitismus unter dem Instrumentarium von Norbert Elias
1.1 Übersicht
Der Antisemitismus ist eine über die Jahrtausende hindurch bestehende Erscheinung und ist selbst nach den beispiellosen Verbrechen des Holocaust nicht verschwunden, selbst nicht im Staat der Täter.Antisemitische Taten verursachen Reaktionen der Empörung und Verurteilung, darüber hinaus aber keine oder nur geringe Auseinandersetzungen mit den tieferen Quellen antisemitischer Haltungen.Wenn man dies jedoch tut, wie im Folgenden skizziert, gelangt man zu dem Ergebnis, dass die jüdische Kultur aufgrund der Besonderheit ihrer Entwicklung in fast 2.000 Jahren Diaspora eine ganz ungewöhnliche Zivilisationshöhe des friedlichen Miteinanders entwickelt hat, und der Antisemitismus aus aggressiven Ideologien gespeist wird, die zur Aufrechterhaltung der Unterdrückung in aristokratischen Gesellschaften dienten.In den Begriffen von Norbert Elias: Weil die einen einem „militärischen“, die anderen einem (extrem) „zivilen-Verhaltens- und Empfindungs-Kanon“ unterworfen waren.
Die Aristokratie musste zur Sicherung ihrer Herrschaftsposition auf Unterdrückung, Hierarchien, Befehl und Gehorsam setzen. Das Volk sollte unwissend und gläubig sein. Wissen könnte Ansprüche schaffen und die Herrschaft infrage stellen.
Im zivilen Verkehr, besonders im Handel, begegnet man sich jedoch gleichberechtigt. Unterschiedliche Meinungen werden mit Argumenten ausgetragen und man steuert Kompromisse an. Dazu sind Bildung, Wissen und Kreativität hilfreich.
Aus dem Konflikt dieser entgegengesetzten Wertesysteme über fast 2 Jahrtausende entwickelte sich die Besonderheit der antisemitischen Klischees, im Vergleich zu üblichen gesellschaftlichen Ausgrenzungen von Gruppen.
Dies wird im Folgenden näher erläutert und anhand von Beispielen nachgewiesen.
1.2 Die Unwahrscheinlichkeit der jüdischen Kultur
1.2.1 Friedlichkeit als Überlebensform
Die Juden hatten nach der Vertreibung durch die Römer im ersten Jahrhundert nach Christus nie einen Staat und damit keine staatliche Organisation, die sie nach innen und außen schützen konnte. Sie waren in ihren christlichen „Gastländern“ eine meist von der Mehrheit schon aus religiösen Gründen nicht gern gesehene Minderheit und konnten von deren Autoritäten wenig Gerechtigkeit erwarten, ganz zu schweigen von Unterstützung. Selbst wenn Herrschende sie ins Land geholt hatten, war deren Gunst unsicher; immer gab es willkürliche Steuern und Beschneidungen ihrer wenigen Rechte. Sie blieben unter sich in eigenen, sicheren Stadtteilen (Gettos), was einer Integration neben ihrer von der Mehrheit abweichenden Religion zusätzlich im Weg stand.
Im Verkehr mit den Einheimischen mussten sie sich daher auf ein gefälliges, friedliches Verhalten einstellen, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können. Sie mussten Konflikte möglichst frühzeitig vorausahnen, sie umschiffen, Ausweichstrategien, z. B. Witz, entwickeln, und immer aufmerksam sein. Traditionelle Berufe wie Landwirt und Handwerker waren ihnen verwehrt, sie konnten nur Händler und Geldverleiher werden, beides hatte jedoch keinen guten Ruf.
Auch manche negativ empfundenen Eigenschaften sind aus diesen Verhältnissen leicht erklärbar. Ihre angebliche Lust am Streiten ist wohl Folge ihrer Erziehung und komplexen Sicht auf die Welt und der Versuch einer argumentativen statt gewaltsamen Formulierung von Interessen. Ihre Beharrlichkeit im Verfolgen ihrer Ziele ist leicht als Folge wirtschaftlicher Notwendigkeit zu verstehen.
Aggression als Grundlage aristokratischer Herrschaft
Alle Staaten waren aristokratisch, also gekennzeichnet durch eine kleine Herrscherschicht und eine Mehrheit von Untertanen mit weniger Rechten. Dies erforderte Zwang nach innen und ständige Auseinandersetzungen nach außen. Die dazu vermittelten Werte schlugen sich im Einzelnen in einem kriegerischen, Norbert Elias sagt „Militärischem Verhaltens- und Empfindungskanon“, nieder1. Dieser war bei den Adligen stärker, wirkte sich jedoch auch in den nichtadligen Gesellschaftsschichten aus und wurde dort sogar als Vorbild verstanden und verbreitet.2
In einer solchen gesellschaftlichen Umgebung konnten sich auf Gewaltlosigkeit beruhende Verhaltensformen nur in engen Grenzen entwickeln.
Dagegen war gerade dies für die Juden in der Diaspora die Voraussetzung für ihr Überleben als Gruppe und es entwickelte sich dort in einer sehr ausgeprägten Form als „ziviler Verhaltens- und Empfindungskanon“. Er war dem militärischen Kanon entgegengesetzt und stellte für ihn eine latente Bedrohung dar, da er eine alternative Gesellschaftsform aufzeigte, die andere Fähigkeiten erforderte.
1.3 Trennungen von Gesellschaften in Etablierte und Außenseiter
Nach allgemeiner Lebenserfahrung gehören gewisse Ausgrenzungen von Gruppen zum allgemeinen Alltag in jeder Gesellschaft. Seien es nun fremde Dialekte, Haarfarbe, Kleidung oder Gewohnheiten, alles kann bereits bei wenig differenzierten Gesellschaften zum Anlass für Ausgrenzungen werden.
Norbert Elias und John L. Scotson haben diese gesellschaftlichen Prozesse in „Etablierte und Außenseiter“3 am Beispiel einer kleinen Vorortsiedlung in den Midlands von England, die sie verschlüsselt „Milton Prava“ nannten, wissenschaftlich näher untersucht und allgemeine Erkenntnisse zu diesen Prozessen abgeleitet.
1.3.1 Allgemeine soziale Gesetzmäßigkeiten
Es gibt in Gesellschaften eine Tendenz, sich gegen andere Gruppen abzugrenzen. Es bedurfte dazu nach den Befunden im Untersuchungsgebiet Winston Prava keiner großen Unterschiede ethnischer, religiöser oder kultureller Art. Es genügte dort schon der Unterschied zwischen etwas älteren und jüngeren Stadtteilen.4
In Winston Prava stellte sich dieses Problem mit besonderer Schärfe, weil die meisten gängigen Erklärungen für Machtdifferenziale – soziale Klasse, Nationalität, ethnische Herkunft, Religion oder Bildungsniveau – hier versagten. Die beiden betroffenen Gruppen unterschieden sich in der Tat nur durch ihre Wohndauer am Platz.5
Die Bevölkerung des älteren Stadtteils gehörte zu den Etablierten, die die Machtpositionen in der Gemeinde innehatten und die Neuhinzugezogenen bewusst von einer Integration, also von der Teilhabe in Clubs, Vereinen und informellen Zusammenkünften im Pub abhielten. Das damit verbundene Machtgefühl wirkte sich aus im Empfinden, „etwas Besseres“ zu sein als die Neuhinzugezogenen.
Bei der unterlegenen Gruppe der Neubürger überwog das Gefühl, dass auch sie sich „schlechter“ fühlten als die Etablierten. Nur bei wenigen Jugendlichen äußerte sich die Herabsetzung in provokativer Verletzung von Regeln und Gesetzen.
Die Gleichförmigkeit des Musters, nach dem übermächtige Gruppen weltweit ihre Außenseitergruppen stigmatisieren – eine Gleichförmigkeit über alle kulturellen Unterschiede hinweg – mag zunächst etwas überraschen. Aber die Symptome menschlicher Minderwertigkeit, die eine machtstärkere Etabliertengruppe am ehesten an einer machtschwächeren Außenseitergruppe wahrnehmen, die ihren Mitgliedern als Rechtfertigung ihrer Vorrangstellung und als Beweis ihrer Höherwertigkeit dienen, werden bei den Außenseitern gewöhnlich durch die bloßen Bedingungen ihrer Gruppenposition, durch die damit verbundene Erniedrigung und Unterdrückung erzeugt. Diese Bedingungen sind in mancher Hinsicht überall dieselben. Armut, ein niedriger Lebensstandard, gehören dazu. Aber es gibt andere (…) etwa das ständige Ausgeliefertsein an launenhafte Entscheidungen und Befehle von oben, die Demütigung des Ausschlusses von den „besseren Kreisen“ und eingebläute Haltungen der Unterwürfigkeit.6
In jedem Fall kann man die zwingende Kraft einer Etablierten-Außenseiter-Beziehung und die eigentümliche Hilflosigkeit der so aneinandergebundenen Menschengruppen nicht begreifen, solange man nicht erkennt, dass sie in einer Doppelbinderfalle gefangen sind.7
1.3.2 Wirkung bei der Mehrheitsgesellschaft
Wenn derartige Ausgrenzungstendenzen bereits unter aus heutiger Sicht zivilisierten Verhältnissen in Großbritannien in den 1960er Jahren und bei minimalen Gruppenunterschieden zu verzeichnen waren, kann man davon ausgehen, dass sie in früheren Jahrhunderten noch viel ausgeprägter waren.
Hinzu kommt, dass die Juden eine fremde Gruppe waren, die sich in Bezug auf Aussehen, Sitten, Berufstätigkeit und besonders Religion – also in vielerlei Hinsicht – deutlich von den im Mittelalter überwiegend als Bauern und Handwerker tätigen Einheimischen unterschieden. Dies hat auf Seiten der Etablierten die gesellschaftliche Tendenz zu verstärkter Abgrenzung mit der damit verbundenen Erhöhung der eigenen Position und zur Herabwürdigung der Außenseiter verstärkt.
Das Gefühl der eigenen Höherwertigkeit durch die Zugehörigkeit zur machtstärkeren Gruppe erfordert andererseits aber auch eine strenge Unterwerfung unter deren Regeln. Dazu gehört auch die Diskriminierung von Außenseitern. Sonst sinkt man in der Statushierarchie ab und es droht der Ausschluss.
Die Strafe für Abweichung, und manchmal bereits für vermutete Abweichung, ist Machtverlust und Statusminderung.
Der Einfluss der internen Meinung einer Gruppe auf jedes ihrer Mitglieder geht aber noch weiter. Eine solche Gruppenmeinung hat unter manchen Aspekten das Gepräge und die Funktion eines persönlichen Gewissens.
(…) Sein Selbstbild und seine Selbstachtung sind daran geknüpft, was andere Mitglieder seiner Gruppe über ihn denken.8
Unter den Bedingungen aristokratischer Herrschaft gehörte die Ausübung von Gewalt zu den grundlegenden Voraussetzungen, was sich auch in der Zivilgesellschaft im täglichen Umgang niedergeschlagen hat, jedoch durch Gesetze und Sitten im Zaum gehalten wurde. Dies gilt nicht, oder nur in geringem Umfang, gegenüber der Minderheit der Juden. Sie waren schutzlos.
Der militärische Verhaltens- und Empfindungskanon prägt den zivilen Kanon mit: wenig Empathie, weniger Argument als Drohung, beschränkte Anerkennung von Werten der Kaufleute wie Kompromiss, Eingehen auf den Handelspartner, Fantasie und ähnliches.
1.3.3 Wirkungen auf die jüdische Minderheitsgesellschaft in der Diaspora
Die oben geschilderte, auf die Abwertung durch dominierende Gruppen folgende eigene Abwertung fand bei den Juden nicht statt.
Hier wurden der Ausgrenzung offensichtlich die eigene Identität, die gegenseitige Unterstützung, Versicherung der gemeinsamen Religion und Bräuche entgegengestellt.
Eine gewalttätige Reaktion auf erlittene Demütigungen ist in der Diaspora aufgrund der geringen Zahl der Juden und ihrer weitgehenden Rechtlosigkeit praktisch ausgeschlossen. Damit wird ihnen ein ungeheuer großer Willensaufwand zur Beherrschung ihrer Affekte in der Hinnahme von Ungerechtigkeiten auferlegt.
Eine psychische Arbeit, die wie Norbert Elias in „Der Prozess der Zivilisation“ nachweist, in den europäischen Gesellschaften seit dem Ausgang des Mittelalters über Jahrhunderte gewachsen ist, mussten sie innerhalb weniger Generationen bewältigen: Friedfertigkeit.
Damit verbunden sind andere Werte als in der Mehrheitsgesellschaft: Eine besondere Sensibilität für sich anbahnende heikle Situationen, ein frühzeitiges Ausweichen, die Bewältigung von Konflikten durch Kompromiss und Witz, die Hinnahme aktueller Ungerechtigkeit im Hinblick auf längerfristige Ziele, verstärkte gegenseitige Hilfe, Argumente statt Gewalt sowie Bildung und Wissen.
Es sind die Werte, die mittlerweile im Grundgesetz verankerte Grundlagen unserer Gesetze sind, die aber den Werten der Aristokratie diametral entgegenstanden. Kein Wunder, dass die Diskriminierung einer friedlichen Kultur unter diesen Bedingungen eine gesellschaftliche Aufgabe war. Wir werden ihnen bei antisemitischen Klischees wieder begegnen.
1.4 Die aristokratische Ideologie
1.4.1 Verankerung und Amoralität
Die Entwicklung einer Ideologie ist ein weitgehend unbewusster und von vielen Mächten beeinflusster gesellschaftlicher Vorgang. Die meinungsbildenden Gruppen der weltlichen und geistigen Herrschaft müssen ihre Erklärungen zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft möglichst mit den sich wandelnden äußeren Bedingungen in Einklang bringen. Die Ideologie prägt dann einen Kanon innerer Werte, Emotionen und Verhaltensmuster aus, die zum inneren Bedürfnis werden. Bei den Herrschenden stehen sie im Gegensatz zu den allgemeinen moralischen Werten und werden in Form von „Ehre“ zu einem Teil des Gewissens. „Du sollst nicht töten, nicht rauben, nicht Unzucht treiben, nicht lügen…“ galten für sie nicht.
Norbert Elias beschreibt es folgendermaßen:
„Die Zwangsapparatur und die Gesetze des Staates […] sind nützlich, um die Ordnung unter der unruhigen Masse aufrechtzuerhalten. Aber wir, die Krieger und die Regierenden, sind diejenigen, die die Ordnung im Staat aufrechterhalten. Wir sind die Herren des Staates. Wir leben nach unseren eigenen Regeln, die wir uns selbst geben. Für uns gelten diese Staatsgesetze nicht.“9
1.4.2 Gefährdung aristokratischer Herrschaft durch Demokratie und Rechtsstaat
Die Entwicklung der Neuzeit war mit dem Vordringen von Vernunft und Humanismus auch eine Entwicklung zur Aufhebung der aristokratischen Gesellschaft und der Erlangung von mehr Freiheit, gleicher Rechte und sozialer Verbesserungen. Diese Tendenzen hatten in den verschiedenen europäischen Staaten entsprechend den jeweiligen Machtverhältnissen und der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Entwicklung unterschiedliche Folgen. In England musste der König aufgrund seines schwachen Landheeres diesem Drängen von unten nachgeben und Kompromisse schließen. In Frankreich konnte dieser Aufstieg aufgrund der Stärke der Zentralmacht lange Zeit vermieden werden, bis es zur Revolution kam. In Deutschland mit seiner politischen Zersplitterung blieben die fortschrittlichen Kräfte politisch schwach. Nach der Erschütterung durch Napoleon und der Wiedererlangung der Macht bildete sich eine besondere Ideologie heraus, die sich der politischen Aufklärung widersetzte und der deutschen Kultur und dem deutschen Wesen eine Sonderrolle jenseits der Vernunft zuschrieb. Abgesichert wurde dies auf der Seite der Aristokratie durch die Betonung des militärischen Werte- und Verhaltenskanons, den eine ehrgeizige bürgerliche Oberschicht dann auch übernahm.
Die Stellung des Kriegs- und Beamtenadels als höchstrangierende und mächtigste Schicht der Gesellschaft wurde durch den Sieg von 1871 nicht nur gewahrt, sondern verstärkt. Nicht das gesamte, aber doch ein guter Teil des Bürgertums passte sich verhältnismäßig rasch diesen Gegebenheiten an. Sie fügten sich als Vertreter einer zweitrangigen Klasse, als Untertanen, in die Gesellschaftsordnung des Kaiserreichs ein (…) und adoptierten dessen Modelle und Normen.10
Im 19. Jahrhundert tritt an die vorher wirtschaftsbestimmende landwirtschaftliche Produktion die Industrialisierung. Damit schwindet die wirtschaftliche Basis der Aristokratie und neue, bürgerliche Kräfte gewinnen an Bedeutung. Sie vertreten andere Werte als der Adel und werden diesem damit nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ideologisch gefährlich. Die Reaktion:
Eines der Standardmittel, wenn ein Establishment seine Stellung bedroht sieht, besteht in der Verschärfung der Zwänge, die sich seine Mitglieder selbst und die sie der breiteren Gruppe der Beherrschten auferlegen (…)11
In Deutschland äußert sich diese Tendenz in einer Verschärfung des militärischen Werte- und Verhaltenskanons und in der Herausbildung der „satisfaktionsfähigen Gesellschaft“ als führende Gesellschaftsschicht mit dem Duell als zwingendem, einigendem Ritual.
(Das Duell) ist ein Sinnbild bestimmter menschlicher Haltungen, einer gesellschaftlich geregelten Pflege der Gewalttätigkeit. Studenten und Offiziere waren die Hauptträger der Duellkultur. Sie brachte die Gewöhnung an eine streng hierarchische Ordnung mit sich, also an eine Betonung der Ungleichheit zwischen den Menschen.12
1.4.3 Die Zunahme des Antisemitismus im Kaiserreich
Entgegen den Hauptströmungen der Zeit und im Unterschied zu den sie in verschiedener Weise berücksichtigenden Reformen in den Nachbarstaaten, tritt in Deutschland eine Radikalisierung der aristokratischen Geisteshaltung auf. Der damit verbundene Kampf richtet sich gegen zivile Werte allgemein und damit – gewissermaßen zwangsläufig – gegen ihre typischsten Vertreter, die Juden.
Man unterließ nicht, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich das Machtgewicht des Bürgertums in dieser neudeutschen Gesellschaft verstärkt hatte. Aber die traditionelle Überzeugung des Kriegeradels, dass eine kaufmännische Betätigung nicht ganz honorig sei, blieb in der höfischen Gesellschaft des Kaiserreichs und in Adelskreisen überhaupt noch sehr lebendig (…) erhielt sich doch die Vorstellung, dass für einen Adligen ein Erwerbsberuf nicht standesgemäß sei, in voller Stärke.
(…) Gewiss öffneten sich die höfischen Gesellschaften des Kaiserreichs bürgerlichen Menschen in größerem Umfange als zuvor. Aber es waren vor allem hohe Beamte, darunter Universitätsprofessoren und insbesondere bekannte Gelehrte, die hinzugezogen wurden.13
Gewiss litten die Exponenten von Handel und Gewerbe, wie man es nannte, unter der traditionellen Verachtung eines Establishment… Gewiss, Handel und Gewerbe, Kaufleute und Fabrikanten murrten (…) Aber weite Kreise des gehobenen Bürgertums, allen voran höhere Beamte und Akademiker, unterwarfen sich freudig und oft enthusiastisch der militärischen Führung von Hof und Adel.14
Das Dilemma der Herrschenden war, dass die wirtschaftlich dominierenden Kräfte in Industrie und Handel ihre Herrschaft gleichzeitig trugen und bedrohten. Es wurde dadurch aufgelöst, dass man eine kleine exponierte Gruppe davon bekämpfte, die seit Jahrhunderten in derartigen Konfliktfällen als Sündenböcke herhalten mussten: die Juden. Es passte, dass diese in den zahlreichen neuen Berufen einen zunehmenden Einfluss ausübten.
Die Spannungen und Konflikte zwischen Untertanen und Herren, zwischen Unterdrückten und Unterdrückern, werden zu inneren Spannungen und Konflikten der Beherrschten und Unterdrückten selbst, Hände, die sich sonst leicht gegen die Herren erhoben hätten, werden gelähmt.
(…) Der hauptsächliche Schauplatz des Kampfes verschiebt sich vom zwischenmenschlichen auf das innermenschliche Feld. Gegenüber dem Unterdrücker macht sich der Konflikt nun in einer Verstärkung der umgekehrten Geste bemerkbar, in „Unterwerfungslust“.15
Die „Unterwerfungslust“ wurde zu „Angriffslust“, Hass gegen Menschen, die sozial unterlegen und schwächer sind oder einem traditionell so erscheinen. Das Mittel ist in erster Linie der, wie Elias es nennt, „Schimpfklatsch“. Danach folgten dann Herabsetzungen in den Medien, von den Kanzeln, im Beruf in Form antisemitischer Klischees. Letztere machen zugleich deutlich, dass sie sich gegen die von uns heute hoch gehaltenen Werte richten und stellen sich damit als Mittel der Unterdrücker bloß.
1.5 Antisemitische Klischees
Einige ausgewählte Beispiele machen diese Tendenz deutlich und bieten die Möglichkeit, die entwickelten Thesen zu überprüfen. Wir folgen der Zusammenstellung von Beiträgen vieler Autoren in:
„Antisemitismus – Vorurteile und Mythen“
Herausgeber: Julius Schoeps und Joachim Schlör, Verlag 2001, 1995
(Zitate kursiv.)
Peter Dietmar: Die antijüdische Darstellung
Seit dem 15. Jahrhundert werden also die Juden öfter zum Gegenstand bewusster bildlicher Präsentation wie der Bildpolemik. Das physische Erscheinungsbild erfährt vermehrt Beachtung, vorrangig in der Malerei (…)
Betrachtet man die Darstellungen von Juden (im „Bilderbogen“) vor diesem Hintergrund, fallen sie deutlich aus diesem Weltentwurf heraus. Ihr Geld- und Profitdenken ist das beherrschende Thema. Gezeigt werden Trödler und Hausierer oder Kleinhändler und Arrivierte in ihrem den neuen Umständen nicht adäquaten Aufstiegsverhalten. Die physische, oft schon denunzierende Charakterisierung gehört stets dazu. (S.44 – 46).
(…) Die Juden erscheinen als Wucherer, als Geldaristokraten, als Umstürzler, als mächtig oder tückisch, als eine dem sozialen Konsens sich entziehende oder sich auf diesem nur zur eigenen Gewinnmaximierung einfügende Größe. Der Genus des Schacherjuden mutiert zu dem des finanzmächtigen Weltherrschers (…) Teil dieses Vorgangs ist die Verzeichnung der äußeren Erscheinungen (…)
Sie finden sich ausgeprägt auf Blättern, die sich als humorvolles Genre gerieren. Es sind jene, die die angebliche Feigheit der Juden schildern, exemplifiziert an ihrer Unfähigkeit zu jeder Form militärischen Dienstes.
Aus schlechter Erfahrung ist die Vermeidung von Konflikten bei Juden verständlich; heute gilt allerdings als zivilisiertes Verhalten generell: lieber einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Wege gehen, obwohl wir heute, anders als die Juden in der Geschichte, notfalls auf die Polizei zurückgreifen könnten. Der frühere Krieger ist Staatsbürger in Uniform geworden.
Freddy Raphael: „Der Wucherer“
Die Rolle des Wucherers stellt dabei eine Konstante dar, die das Abendland ihm seit dem Mittelalter und bis in die heutige Zeit aufgezwungen hat.
Erst das von der Kirche im 12. Jahrhundert erlassene Verbot, Geld gegen Zinsen zu verleihen, schuf die enge Verbindung zwischen dieser Form des Geldverleihs und den Juden, damit wurde der Begriff des Wucherers zu einem Begriff der Schande. Die Juden (…) (hatten) ihr Heil ein für alle Mal verspielt; sie waren deshalb dazu ausersehen, dieses widerliche und unehrenhafte Gewerbe auszuüben. Während die Erinnerung an christliche Geldverleiher wie die Cahorsiens und Lombards im Laufe der Jahre verschwand, wurde das Stereotyp des Judas Ischariot, der für 30 Silberlinge zum Verräter geworden war, zum Bild für das Wesen des Judentums selbst (…)
Der Wucherer wird, weil er eine leblose Sache wie das Geld „fruchtbar“ zu machen scheint, im Mittelalter wie ein Zauberer angesehen (…) denn, wie Thomas von Aquin sagte „Münzen zeugen keine Münzen, Geld vermehrt sich nicht“.
(…) Er pervertiert die Berufung des Menschen, „im Schweiße seines Angesichts“ sein Brot zu verdienen, und zwingt seine Mitmenschen, für ihn zu schaffen. (103)
Hier kommt das in allen Gesellschaften fehlende Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge ebenso zum Ausdruck wie die ebenfalls in allen Feudalstaaten herrschende Herabsetzung wirtschaftlich produktiver Tätigkeit. Von der die Zusammenhänge ebenfalls nicht durchschauenden Kirche werden religiöse Begründungen für dieses Verhalten geliefert. Dabei war den Fürsten klar, dass sie ohne das Geld aus dem Handel und dem Bankwesen weder ihren aufwendigen Lebensstil noch ihre zahlreichen Kriege hätten führen können.
Selbst ein Wirtschaftssoziologe, Werner Sombart, stimmt in das Raunen ein:
„Die Juden „erkennen eben die Welt mit dem Verstande, nicht mit dem Blute (…)
Der Jude ist in seinem innersten Wesen nach allem Ritterlichen, aller Sentimentalität, aller Chevallerie, allem Feudalismus, allem Patriarchalismus abgeneigt. Er versteht auch ein Gemeinwesen nicht, das auf solchen Beziehungen aufgebaut ist“ (S. 112)
Wir sehen heute, was für ein Unsinn – mit schlimmen Folgen – das Geraune vom Blut war und sind auch „dem Feudalismus und dem Patriarchalismus“ abgeneigt.
Für Heinrich von Treitschke muss der Staatsbürger ein Krieger (!) sein, der „bereit ist, sich für den Staat zu opfern“ und für die Aufrechterhaltung der Einheit des Volkes. Die Juden dagegen, deren einziges Interesse der Profit ist, bilden die Speerspitze des Angriffs, den Liberalismus und Materialismus gegen den Staat führen, der doch das heilige Band zwischen den Generationen darstellt. (113)
Treitschke vertritt den militärischen Verhaltens- und Empfindungskanon in voller Blüte.
Der Bürger muss ein Krieger sein. Wieso eigentlich?
Liberalismus und Materialismus haben zu einer Welt der Freiheit und des Wohlstands geführt.
Es ist aufschlussreich und beängstigend zugleich, wie ein Fachmann für Geschichte so stark von einer Ideologie der Herrschenden eingeschränkt ist, dass er sie sogar mit radikalen und ganz unvernünftigen Argumenten gegen die großen Kräfte der Zeit – Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – propagiert.
Sander L. Gilmann: „Der jüdische Körper“
In seinem um die Jahrhundertwende verfassten Buch Die Juden und das Wirtschaftsleben liefert Werner Sombart ein klares Bild des jüdischen Körpers als Zeichen seiner Anpassungsfähigkeit (seiner inhärenten Unveränderlichkeit):
„Seine Zielstrebigkeit ist natürlich die treibende Kraft, die nun den Juden das vorgestellte Ziel: Anpassung an irgendeine Situation, wie er sie aus Zweckmäßigkeitsgründen gerade für vorteilhaft erachtet, auch wirklich hartnäckig und ausdauernd verfolgen lässt (…)
Und seine Beweglichkeit endlich bietet ihm die äußeren Mittel dar, das Ziel zu erreichen.
Es ist ja erstaunlich, wie beweglich der Jude sein kann, wenn er einen bestimmten Zweck im Auge hat.
Man muss sich im Klaren darüber sein, dass ohne Hartnäckigkeit und Ausdauer viele Juden ihre Existenz in der Diaspora gar nicht hätten sichern können. Und geistige Beweglichkeit, Ideenreichtum und Kreativität sind heute die mit am höchsten geschätzten Werte in der Gesellschaft.
Sombart ordnet die Eigenschaften nicht einer Erziehung zu, womit sie veränderbar wären, sondern dem Körper, was sie zu Eigenschaften einer „Rasse“ macht.
Jeanette Jakubowski: „Die Jüdin“
Der Berliner Karl Wilhelm Friedrich Grattenauer (1773 – 1838), ein Notar und Justizkommissär, war (…) Vertreter eines frühen rassischen Antisemitismus und wohl der aggressivste Kritiker der modernen intellektuellen jüdischen Frauen.
Der Jurist polemisierte gegen den „unweiblichen“ hohen Bildungsstand der Salonjüdinnen, der nur adeligen Frauen zukäme. Bei Jüdinnen sei er hingegen eine künstliche „Appretur“, erworben bei einem kapitalistisch-materialistischen Bildungsgeschäft“, bei dem ihre „Weiblichkeit… vernichtet“ würde.
Und er deutet in seiner ironischen Anspielung auf Jesaiha 3,16 wiederum an, dass jüdische Frauen Prostituierte seien. (S. 200)
Die militärische Ideologie richtet sich gegen Bildung für das Volk ebenso wie gegen die Gleichberechtigung der Frau – und mit was für Argumenten:
In einem Klima wirtschaftlicher und politischer Depression während und nach der französischen Besetzung Deutschlands durch Napoleon und den folgenden Befreiungskriegen verstärken sich dann die antisemitischen Ressentiments. Der Aufstieg der jüdisch-deutschen Bankiersfamilie Rothschild aus dem Frankfurter Getto bildete einen Angriffspunkt; ebenso der Gegensatz zwischen dem (…) bürgerlichen Ideal der gebildeten, keinesfalls gelehrten Nur-Hausfrau und Mutter und der zumeist im Betrieb des jüdischen Kleinhändlers und Kaufmanns mithelfenden jüdischen Frau. (S. 201).
Heute ein Idealbild: Gebildete berufstätige Frauen sind gleichzeitig Hausfrau und Mutter. Sicher auch in der Fülle der Aufgaben und Interessen oft eine Überforderung, früher wie heute.
1877 vermutete der Berliner Hofprediger und Politiker Adolf Stoecker (1835 – 1909) (…) in deutschen Jüdinnen einen wirtschaftlich selbstständigen alttestamentarischen Frauentyp.
(…) Jüdische Mädchen verkörperten für ihn den (…) alten Topos der „typisch jüdischen“ geringeren intellektuellen Fähigkeiten und den von ihm (…) bekämpften angeblich „jüdischen“ Atheismus an den Schulen. (S. 202)
Der eine hält die jüdischen Frauen für zu intellektuell, der andere für dumm. Sie stellen sich jedoch beide als verblendet bloß. Hofprediger Stoecker offenbart ungewollt die Begründung für den Hass: Es geht darum, keine neuen Gesichtspunkte in der religiösen Erziehung, die die Adelsherrschaft metaphysisch begründet, zuzulassen. Daher entspringt die Ablehnung von Bildung.
Die Stellung der Frauen zeigt den extremen Unterschied zwischen zivilem und militärischem Verhaltens- und Empfindungskanon. Sie zeigt auch am deutlichsten, wie weit in den letzten 100 Jahren unsere Gesellschaft den Schwenk vom Militärischen zum Zivilen geschafft hat und wie weit die gesellschaftlichen Wertegrundlagen der jüdischen Gesellschaft der deutschen voraus waren.
Volker Ullrich: „Drückeberger“
Dass Juden „von Natur aus feige“ seien und daher für den Kriegsdienst nicht taugten – dieses Vorurteil aus dem Arsenal antisemitischer Stereotype war auch noch im zweiten Jahr des Ersten Weltkriegs wirksam, obwohl die Haltung der deutschen Juden seit Kriegsbeginn es doch vielfach widerlegt hatte.
(Obwohl,) Wie Jakob Segal festgestellt hat, (…) die deutschen Juden sowohl an Opfern wie an Leistungen für den Krieg insgesamt „in einer dem Durchschnitt mindestens entsprechenden Weise teilgenommen“ haben.
Dennoch blieb das Brandmal der „Drückebergerei allein an den Juden hängen.
Als Ende September 1918 die oberste Heeresleitung sich gezwungen sah, (…) die militärische Niederlage des Kaiserreichs einzugestehen, verband sich die Agitation gegen „jüdische Drückeberger“ und „Kriegsgewinnler“ mit der Dolchstoßlegende – also der Behauptung, das deutsche Heer sei durch die Arbeit der „linken“ und „der Juden“ in der Heimat entscheidend geschwächt und um die Früchte des Sieges betrogen worden. Mit dieser Geschichtslüge suchten sich die gesellschaftlichen Führungsschichten, die das Kaiserreich ins Verderben gestürzt hatten, aus ihrer Verantwortung zu stehlen (…) (S. 216,217).
Die Kriegerkaste wird den eigenen Ansprüchen an Mut und Geradlinigkeit aus Feigheit und Opportunismus untreu.
Joachim Schlömer: „Der Urbantyp“
„Ein spezifischer Zug des jüdischen Lebens ist sein fast ausschließlich städtischer Charakter“, schreibt der Berliner Rabbiner Joachim Prinz (…) Auf der anderen Seite ist in Darstellungen zur Geschichte der modernen Großstädte häufig vom „wesentlichen Beitrag“ der Juden zur Entwicklung dieser oder jener Stadt, zur Herausbildung einer bestimmten städtischen Eigenart die Rede, bis hin zur These, erst die Anwesenheit jüdischer Kaufleute oder Bankiers verlieh erst einer Ansiedlung den Charakter des Städtischen. (229)
Wodurch sollte der „Urbantyp“ sich auszeichnen, was macht ihn erkennbar? Es ist der, (…) der sich ihren Bewegungen, ihren Geschwindigkeiten, ihren wechselnden Rhythmen anpassen kann. Es ist der Fremde, der mit einem Dasein als Fremder, als Unvertrauter umgehen kann…er findet sich in jeder Situation zurecht, er erkennt Gefahrenmomente schneller als andere und versteht es, sich ihnen rechtzeitig zu entziehen, er weiß, wie die Stadt funktioniert (…) Er geht nicht unter, er schwimmt immer oben auf. Er erkennt die Gelegenheiten und nutzt sie sofort. Er hat überall seine Leute (233, 234)16
Wie sollte es anders sein, wenn die Juden aus der Landwirtschaft und vielen Handwerksberufen herausgehalten wurden und größtenteils vom Handel leben mussten! Wo findet der Handel statt, wenn nicht in der Stadt? Dass sich hier, in der Verbindung von Stadt und Handelsberuf, im Laufe der Jahrhunderte andere Fähigkeiten und Eigenschaften herausbilden als auf dem Dorf, ist notwendig und klar. Diese machten die urbanen Vertreter, sicher nicht nur die Juden, den Menschen auf dem Dorf in Bezug auf Wissen, Verbindungen, Ideenreichtum u. a. m. in unvermeidlicher Weise überlegen. Neid und Missgunst waren die Folgen.
Zu beachten sei also, so Fritsch, „dass schließlich immer der Jude am weitesten kam, der sich auf das Leben als Gast in fremder Umgebung verstand, der also folgende Fähigkeiten besaß: Einfühlung in fremdes Seelenleben, umsichtiges Auftreten, Gewandtheit der Rede, Berechnung der Verhältnisse in Gegenwart und Zukunft, ferner eine Art Schlagfertigkeit und Spitzfindigkeiten… Einen weiteren Schlüssel findet man, wenn man die Berufe betrachtet, denen sich der Jude mit Vorliebe zuwendet. Nach Lenz (München) handelt es sich um Berufe, bei denen das Eingehen auf die jeweilige Neigung des Publikums und deren Lenkung Erfolg bringt. Das sind etwa folgende Berufe: Kaufmann, Händler, Geldverleiher, Zeitungsschreiber, Schriftsteller, Verleger, Politiker, Schauspieler, Musiker, Rechtsanwalt und Arzt. (236,237)
Eine Aufzählung positiver Eigenschaften, die die Gewandtheit des zivilen Juden gegen die Starrheit des Militärs deutlich abhebt.
„Die Juden werden heute gehasst“, schreibt Arnold Rose, „weil sie in erster Linie ein Symbol für das Stadtleben sind“.
(…) Die City hat uns unsere Männlichkeit genommen. Dafür hassen wir das Symbol der City, den Juden.“ (Gordon Allport: Die Natur des Vorurteils, Köln 1971, Seite 219 f)
Seine Männlichkeit hat vor allem der chauvinistische, traditionalistische Männertyp verloren und ist durch den Fortschritt tief verunsichert. Seine Aggression sucht sich im Juden den Typus, der mit den modernen Verhältnissen gut zurechtkommt, ihm also überlegen ist.
Ingeborg Nordmann: „Der Intellektuelle“
Die Matrix des „deutschen Geistes“ war nicht Eindeutigkeit, sondern Zweideutigkeit, die es erlaubte, zwischen den gegen-sätzlichen Polen des Ganzheitlichen bzw. Organischen und der jeden festen Standort übersteigenden Maßlosigkeit zu oszillieren.
(…) Als ein repräsentatives Beispiel für diese Haltung können Thomas Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen“ bewertet werden, die 1918 erschienen. Dort wird die „Demokratisierung Deutschlands“ als „Entdeutschung“ verunglimpft. (253, 254)
Avraham Bakai: „Der Kapitalist“
Die Identifizierung der Juden mit der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung gehört seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den Stereotypen des säkularisierten modernen Antisemitismus. Abwechselnd wurden entweder der Kapitalismus als „jüdisch“ oder die Juden generell als „Kapitalisten“ verrufen. Die gegen die Juden gerichtete antikapitalistische Argumentation tauchte ebenso in der frühen sozialistischen wie in der konservativen und völkischen Propaganda auf. Gemeinsam war diesen Richtungen die Ablehnung der liberalen freien Konkurrenz als Ursache der Verunsicherung und des sinkenden Einkommens breiter Bevölkerungsschichten.
Die Juden bedienten das sich immer weiter ausbreitende Feld von Berufen außerhalb der Landwirtschaft, während die herrschenden Feudalherren weiterhin ihre Ressourcen aus ihren Landgütern zogen.
Friedrich Engels sah klar: „Wenn aber das Kapital diese Klassen der Gesellschaft vernichtet, die durch und durch reaktionär sind, so tut es der Gesellschaft (…) ein gutes Werk, einerlei, ob es nun semitisch oder arisch, beschnitten oder getauft ist.“ (267)
1.6 Ergebnis
Sieht man diese antisemitischen Argumente vor dem Hintergrund der soziologischen Erkenntnisse von N. Elias und anderen, so wird Mehreres klar:
Dass es zwischen den mit dem militärischen Verhaltens- und Empfindungskanon aufgewachsenen und unter seiner Herrschaft stehenden Einheimischen und den in vieler Hinsicht anders fühlenden und denkenden Juden zu Reibungen kommen musste, ist offensichtlich. Dazu bedurfte es nicht noch zusätzlich gemeiner oder fanatischer Einstellungen.Das jüdische, über viele Jahrhunderte entwickelte Verhalten, ist nahe bei Elias‘ zivilem Verhaltens- und Empfindungskanon und weit näher an unseren heutigen Einstellungen, als an den noch vor 70 oder 100 Jahren verbreiteten Einstellungen.Die Juden haben bei der Ablösung der feudalen Gesellschaft seit der Aufklärung und besonders im 19. und 20. Jh. wirtschaftlich und kulturell eine besondere, ja überragende Rolle gespielt, weil sie in expandierenden Wirtschaftszweigen tätig waren und ihre aufgeklärtere Lebensweise sich friedlicher Verkehrsformen bediente.Im Deutschland des 19. Jahrhunderts besteht eine Diskrepanz zwischen zunehmender Aufklärung mit dem Abbau jüdischer Diskriminierungen auf der einen Seite und dem verstärkt auftretenden Antisemitismus auf der anderen Seite. Dies ist durch die traditionelle Judenfeindlichkeit von aristokratischen Gesellschaften erklärbar, das Vorherrschen des Militärischen im kaiserlichen Deutschland erhält jedoch eine unzeitgemäße, radikale Ausprägung. Auch das Nazideutschland beruht auf der extremen Steigerung des militärischem Kanon zur brutalen Herrschaft einer bestimmten Rasse.Es wird auch klar, welch weiten Weg die deutsche Gesellschaft seit einigen Generationen zurückgelegt hat, und dass diese Werteveränderung als ungesteuerter Prozess nicht gleichmäßig für alle und in einer stringenten Weise geschehen konnte.Der Antisemitismus erwächst heute aus in Europa längst überholten, inhumanen Gesellschaftsbildern, deren Kern der militärische Verhaltens- und Empfindungskanon ist. Er hat nicht nur eine Unterdrückung der Juden zum Ziel, sondern letztlich die Wiedererrichtung einer reaktionären, ausbeuterischen Herrschaft.