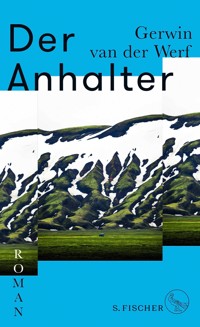
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Gerwin van der Werfs Roman »Der Anhalter« nimmt die Leser mit auf eine spannende Reise in die archaische Natur Islands und in das Herz einer Familie, die an ihren Geheimnissen zu zerbrechen droht. Für Tiddo, Isa und ihren Sohn Jonathan soll es die Reise ihres Lebens werden, mit dem Wohnmobil durch Island. Schon immer hat es sie auf die mystische Insel gezogen. Nun endlich wird es was, muss es was werden – Tiddo erhofft sich von der Reise nicht weniger als die Rettung seiner Ehe. Doch dann nehmen die drei auf ihrem Roadtrip einen merkwürdigen Anhalter mit, der immer neue Gründe findet, um weiter mitzureisen. Der Fremde durchbricht die Zurückhaltung Jonathans, fasziniert Isa und fordert Tiddo heraus. Als das fragile Gleichgewicht der Familie endgültig zu kippen droht, sieht Tiddo in einer halsbrecherischen Fahrt zum Kratersee Öskjuvatn den einzigen Ausweg. Wie weit geht ein Mensch, der Gefahr läuft, alles zu verlieren? »Das schwarze Land ist kahlgeschoren, von Wind und tausend Wintern. Kein Lebewesen hat dort etwas zu suchen, selbst die toten Steine liegen gegen ihren Willen da.« »Was für ein Erzähler, der van der Werf!« Trouw
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Gerwin van der Werf
Der Anhalter
Roman
Roman
Aus dem Niederländischen von Marlene Müller-Haas
FISCHER E-Books
Keiner versteht das Herz –
am allerwenigsten
die überhängenden, von Nebeln
oder tanzenden Stürmen umspielten Berge,
die göttergleich über diesen schmalen Küstenstreifen
am naßkalten, seegrünen Fjord herrschen.
Halldór Laxness, »Salka Valka«
Das schwarze Land ist kahlgeschoren, von Wind und tausend Wintern. Kein Lebewesen hat dort etwas zu suchen, selbst die toten Steine liegen gegen ihren Willen da. Astronauten haben sich dort eine Woche lang auf die erste Mondlandung vorbereitet. Es fällt nicht schwer zu glauben, dass es auf dem Mond so aussieht wie auf der Askja, staubig und leblos. Aber dann hast du den Öskjuvatn noch nicht gesehen, den Kratersee, er versteckt sich hinter einem Bergrücken und ist so magisch, dass man vor lauter Entzücken auf völlig andere Gedanken kommt – dass alles möglich ist, selbst Trost und Erlösung in einer Aschewüste. Der Öskjuvatn, grau wie Blei, außer bei klarer Sicht, dann liegt dir plötzlich ein Stück Himmel zu Füßen. Und das Unbegreiflichste – ein Weg führt dorthin, eine zweihundert Kilometer lange Schotterpiste, auf der man schon nach dem ersten Kilometer meint, dass sie von Trollen und Teufeln aus purer Bosheit in diesem genau kalkulierten, katastrophalen Zustand gehalten wird – wenn überhaupt ein Weg erkennbar ist und nicht von Schnee bedeckt oder in einem reißenden, namenlosen Fluss verschwunden.
Genau das hat mir der Anhalter über die Askja erzählt. Für mich klang das ziemlich schwülstig, als ob er aus einem antiquierten Reiseführer vorläse. Aber er sprach begeistert, ohne zu stocken und ganz und gar frei.
Teil 1Die Ringstraße
1
Es sollte die Reise unseres Lebens werden, mit dem Wohnmobil durch Island. Solange ich Isa kenne, will sie nach Island. Früher fehlte uns das Geld dafür, nach Jonathans Geburt war schon ein kurzer Urlaub im eigenen Land eine echte Herausforderung. Jetzt hatten wir Geld, Jonathan war alt genug, und ich, tja, ich hatte auch meine Gründe. Man kann es glauben oder nicht, aber ich war davon überzeugt, mit dieser Reise meine Ehe retten zu können.
Am Tag unseres Abflugs besuchte ich noch einmal meine Mutter. Sie hatte mir am Abend zuvor am Telefon erklärt, dass sie mir noch etwas geben wolle. »Du brauchst mir nichts zu geben«, sagte ich. »Ach Unsinn«, erwiderte sie, »es wäre schon schade, wenn du nicht kommen könntest.« Man fuhr eine halbe Stunde bis in das Dorf, in dem ich aufgewachsen war, und unser Flugzeug nach Keflavik startete erst nachmittags um fünf. Deshalb hatte ich zugesagt, es würde schon klappen.
Gegen zehn stellte ich mein Auto vor ihrer Tür ab. Mutter saß nicht an ihrem angestammten Platz, im Lesesessel am Fenster. Das bedeutete, dass sie gerade in der Küche Kaffee kochte. Die Besuche bei meiner Mutter verliefen nach festen Ritualen. Sie würde mir eine Tasse Kaffee mit einem Schuss Milch vorsetzen, sie weiß, dass ich keinen Zucker im Kaffee mag. Dass ich meinen Kaffee schon seit ein paar Jahren schwarz trinke, ohne die fette Kondensmilch, habe ich irgendwann aus unerfindlichen Gründen verschwiegen, und wenn du erst mal mit dem Schweigen angefangen hast, wird es schwer, den Mund später überhaupt noch aufzukriegen. Beim Kaffee wird sie zuerst nach Jonathan fragen, sich erkundigen, wann er wieder mal vorbeischaut. Mit meiner ausweichenden Antwort gibt sie sich zufrieden. Sie fragt nach Isa, immer in Verbindung mit deren Job: »Alles in Ordnung mit Isa, auf der Arbeit?« Und zwar deshalb, weil Isa und ihre Arbeit mehr oder weniger eins sind. Ganz anders als bei mir, ich arbeite im Büro, nur drei Tage die Woche. Ich bin nicht mein Job, ich bin das glatte Gegenteil. Wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, leite ich meist noch im selben Satz auf Isa über, erzähle, wie es ihr geht, denn Isa arbeitet viel, sie ist Molekularbiologin und forscht zur Proteinsynthese. Davor hat sie sich mit dem Züchten von Blaualgen für Biobrennstoff beschäftigt. Ja, mit meiner Frau kann man Eindruck machen. Dass ich selbst so wenig Ambitionen habe und ein einfaches Leben mit meiner Familie anstrebe, heißt übrigens nicht, dass ich keine Träume habe und keine Leidenschaft kenne – was die Leute oft denken, wenn man sich mit ein paar Tagen pro Woche im Büro zufriedengibt. Es ist einem nur nicht so wichtig und man redet nicht groß darüber.
Bei den Nachbarn waren alle Fenster geschlossen, keine Fahrräder vor der Tür, kein Spielzeug im Garten. Im Juli bestand das Dorf aus Geisterstraßen, merkwürdig leer und steril, wie ein Filmset, das nach der Kaffeepause wieder von Schauspielern bevölkert sein würde, die wie die Nachbarn aussahen. Die Schlüssel vom Haus steckten in meiner Tasche, es war das Haus, in dem ich aufgewachsen war.
»Hallo!«, rief ich, nicht laut, in diesem Haus wurde nicht geschrien. Wie immer zog ich die Schuhe auf dem Abtreter aus und ging durch ins Wohnzimmer. Ich roch keinen Kaffee, das erschien mir merkwürdig. Weder im Wohnzimmer noch in der Küche fand ich meine Mutter. Es kam gelegentlich vor, dass sie ein Mittagsschläfchen hielt, aber Viertel nach zehn schien mir ein bisschen früh dafür. Außerdem erwartete sie mich. Nun gut, in ihrem Alter durfte sie ruhig, was meine Besuche betraf, mit den Traditionen brechen. Wenn sie ruhen wollte, sollte sie ruhen, warum nicht, dann verschwand ich einfach wieder.
»Guten Tag, Mutter!«, rief ich. Es hallte durch die Küche. Es klang genau wie früher, wenn ich aus der Schule gekommen und durch die Hintertür ins Haus gegangen war, mir die Schuhe ausgezogen und gerufen hatte. Ich lief auf Socken durchs Zimmer, der synthetische Bodenbelag unter meinen Füßen fühlte sich vertraut an. Ich hatte vorhin nicht richtig aufgepasst, denn jetzt sah ich auf dem Couchtisch einen großen braunen Briefumschlag liegen. Für Tiddo und Isa stand darauf, in der Handschrift meiner Mutter, kräftige Buchstaben, nach rechts geneigt. Ich nahm den Umschlag, er fühlte sich schwer an. Ich riss ihn auf und zog einen Stapel Geldscheine heraus. Fünfzigeuroscheine. Es war auch eine Ansichtskarte dabei, mit dem Foto eines Geysirs samt Fontäne. Wo hatte sie die her? Auf der Rückseite stand: »Island ist sehr teuer. Macht Euch eine schöne Reise damit. Die Reise Eures Lebens! Alles Liebe, Deine Mutter.« Ich zählte das Geld, es waren zwanzig Scheine. Ich steckte sie zurück und lief mit dem Umschlag in der Hand in den Flur. Am Fuß der Treppe rief ich noch einmal »Mutter!«. Keine Antwort. Sie war natürlich kurz einkaufen. Der Kaffee war alle und sie hatte es gerade erst bemerkt. Ich ging ins Wohnzimmer zurück und setzte mich auf die Couch, ihrem Lesesessel gegenüber. Ich hasste es, wenn sie mir Geld gab, weil es sich anfühlte, als würden meine Liebe und Fürsorge bezahlt. Ein Vorschuss darauf, so fühlte es sich wenigstens an. Ich liebte meine Mutter, weil ich wusste, dass ihr derlei Überlegungen völlig fremd waren. Sie ist ein guter Mensch.
»Das wär doch nicht nötig gewesen, Mutter«, sagte ich.
»Ach Junge, überlass das doch mir.«
»Das ist viel Geld.«
»Solange ich es noch kann, mach ich es gern.«
Ich zog den Stapel Geldscheine noch einmal aus dem Umschlag, spielte damit herum und las erneut den Text auf der Ansichtskarte. Die Reise Eures Lebens.
»Wie bist du bloß an so eine Karte gekommen?«
Ich sah zu dem leeren Stuhl hinüber.
»Manchmal denke ich«, fuhr ich fort, »dass du überall, wo ich hinreise, schon gewesen bist, heimlich, um zu überprüfen, ob es dort schön ist, und sicher, und nicht übertrieben teuer.«
Ich steckte das Geld wieder zurück und spielte eine Weile mit dem Umschlag, während ich so dasaß. Wo sie nur blieb? Viel länger konnte ich nicht warten, ich musste Isa mit den Koffern helfen, Jonathan Beine machen. Ein Mann rettet seine Ehe nicht nur mit Verreisen, er muss dafür auch etwas tun. Ich wollte auf meinem Handy nachsehen, ob sie mich vielleicht angerufen hatte oder um Isa zu sagen, dass ich hier saß und wartete, aber als ich an meiner Hosentasche entlangtastete, fiel mir wieder ein, dass das Ding zu Hause am Ladegerät hing. Meine Mutter hatte bestimmt vergessen, dass ich noch kommen wollte, der Umschlag lag seit gestern da, und sie war bei einer Nachbarin oder einer alten Dame aus der Kirchengemeinde Kaffee trinken. Nein, ich konnte wirklich nicht länger warten. Dann eben eine Nachricht dalassen. Ich sah nirgendwo Papier liegen, aber ich konnte notfalls auf die Rückseite des Umschlags schreiben. Also machte ich mich auf die Suche nach einem Stift, zuerst auf den Tischen und Fensterbänken, dann im Geschirrschrank. Schließlich zog ich alle Küchenschubladen auf. Nichts.
»Ich ruf dich an, Mutter«, sagte ich laut, um mein aufkommendes Schuldgefühl loszuwerden. »Noch heute Nachmittag.«
Kurz darauf fuhr ich die Straße hinunter.
Als ich nach Hause kam, standen im Flur zwei Koffer. Isa kam gerade mit dem dritten die Treppe herunter.
»Dein Koffer wiegt zwölf Komma fünf Kilo«, sagte sie. »Aber ich weiß nicht, ob alles drin ist.«
Ich holte Luft, räusperte mich, holte noch einmal Luft. Sie hastete schon wieder die Treppe hinauf. Auf halbem Weg drehte sie sich um.
»Überleg dir gut, welche Schuhe du mitnehmen willst. Am besten ziehen wir alle die Wanderstiefel an, das spart Platz im Koffer.«
»Ja, ja, das stimmt«, sagte ich. Sie war schon wieder oben.
»Jonathan, Jona!« Was Isa ihm sonst noch sagte, verstand ich nicht. Kurz darauf kam Jonathan mit finsterer Miene heruntergestampft. Ich stand noch immer im Flur und dachte über den Umschlag nach.
»Na, mein Junge«, sagte ich.
Er begann, die Jacken an der Garderobe zu durchwühlen.
»Und deine Regenhose, Jonathan, hast du die auch mit?«, rief Isa von irgendwo oben. »Ach so, Tiddo, wie war’s bei deiner Mutter?«
Jonathan stand mit einer zerknitterten Regenhose in der Hand da, er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger und musterte sie wie einen toten Fisch. Ich legte ihm meine Hand auf die Schulter.
»Alles okay mit ihr?«, rief Isa. Sie dachte bestimmt, dass ich es nicht gehört hatte. Ihr Gesicht erschien über der Treppe.
»Oder ist was?«
»Nein, nein, alles gut. Sie wird nur langsam alt. Ein bisschen vergesslich. Nichts weiter.«
Den Umschlag versteckte ich hinter meinem Rücken. Es ist merkwürdig, obwohl Isa so aufmerksam ist, kommt sie nicht auf die Idee, dass jemand, der etwas hinter seinen Rücken hält, womöglich etwas zu verbergen hat.
2
Wir flogen, kilometerhoch über dem schlechten Wetter, durch dieses Himmelsblau, das bei Flugreisen so schnell langweilig wird. Jonathan kritzelte in seinem Skizzenbuch herum. Er wird oft für seine Zeichnungen gelobt, oder nein, eigentlich weniger für die Zeichnungen, sondern dafür, dass er überhaupt zeichnet. Statt ständig zu zocken oder auf seinem Smartphone herumzuwischen. Ich sehe das anders. Es ist nicht schwer, abweichendes und vermeintlich interessantes Verhalten an den Kindern zu schätzen und zu loben, die einen nichts angehen. Beim eigenen Sohn sieht man es doch lieber, wenn er ungefähr genauso ist wie die anderen Gleichaltrigen, damit sie ihn nicht für einen komischen Vogel halten und er nicht so einsam ist. Was er gerade zeichnete, konnte ich nicht sehen, meist waren es Phantasiewesen und Monster. Isa hatte die Augen geschlossen, ich saß auf dem Gangplatz und starrte in einen Reiseführer, ohne etwas aufzunehmen. Ich musste ständig an den braunen Umschlag denken, den ich tief in meinem Koffer vergraben hatte. Meine Mutter wusste sehr genau, dass es in den letzten Jahren zwischen Isa und mir nicht gut lief. Ich hatte ihr nie etwas gesagt, aber sie sah es trotzdem. Meine Frau entglitt mir, oder genauer gesagt, mir entglitt, was uns früher verbunden hatte. Isa war in ihrer bescheidenen Art noch immer wunderbar. Das Schönste ist ihr Blick, ich meine nicht nur die graublauen Augen, sondern auch ihre Lider, die Wimpern und die Brauen wie zarte, kerzengerade Pinselstriche, die ihre kühle Iris so melancholisch aussehen lassen wie den Blick einer Madonna von Raffael. Der Schönheitssinn verändert sich mit den Jahren, aber für mich blieb Isa genauso schön wie früher. Früher, das war die Zeit vor Jonathans Geburt. Wie alle jungen Paare liebten wir uns damals fast jeden Tag, in einem halbbewussten Zustand und ohne die geringste Ahnung, dass damit eines Tages Schluss sein würde. Nach zwanzig Jahren muss man sich nicht mehr unbedingt im anderen verlieren, das ist ja gar nicht zu machen, sich den lieben langen Tag zu befummeln, miteinander zu schmusen und sich abzuküssen, endlos in der Vergangenheit des anderen zu wühlen und sich ihn ganz und gar einzuverleiben. Unendlich viel Zeit ging dafür drauf, und ich kann nur wehmütig daran zurückdenken. Aber das muss nicht mehr sein. Es ist die Frage, ob man sich noch besser kennenlernen kann, ob eine Beziehung nach ein paar Jahren nicht mehr durch das definiert ist, was man geteilt, sondern was man vor dem anderen verborgen hat. Ich musste nicht in die Vergangenheit zurück, ich wollte Isas neue Geheimnisse kennen, ich würde ihr jeden Fehltritt mit ihren drögen Kollegen von der Uni verzeihen. Nur allzu gern! Ich verzehrte mich danach, ihr großherzig etwas zu vergeben. Was würde ich nicht für ein Streicheln tun, dafür, mich für die Länge eines Kusses in ihrer Seele zu versenken. Ich würde einen Mord begehen, allein für ein paar liebe Worte oder ein herzliches Lachen. Isa ist die Liebe meines Lebens, und so etwas wird einem nur ein Mal geschenkt. Was mir meine Mutter hatte sagen wollen, stand unmissverständlich auf der Karte: Gib nicht auf, halt fest, was dir geschenkt wurde.
Gut, Mutter, wenn du meinst.
Oh, und, Tiddo, mein Lieber …
Ja, Mutter?
Gib das Geld aus. Island ist schrecklich teuer. Und dann denkt noch kurz an mich.
Ich denk auch so an dich, auch ohne Geld.
Der Pilot teilte mit, dass der Landeanflug auf Keflavik gerade begonnen hatte. Wir tauchten aus dem für Flugreisende so trügerischen Sonnenschein in eine dicke graue Wolkendecke ein, auf dem Weg in eine fremde Welt.
3
Ich hatte noch nie ein Wohnmobil gefahren, mein Gott, was für ein Ungetüm! Außerdem sah das Ding noch funkelnagelneu aus. Diese blitzendweiße Karosse sollte ich also durchs Land kutschieren und unbeschädigt wieder zurückgeben – das erschien mir unmöglich. Ein paar alte Kratzer da und dort wären mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Die junge Frau vom Autoverleih erklärte alles in einem englischen Singsang, ich starrte auf ihren schönen, ein bisschen großen Kopf – ihr Gesicht strotzte vor Gesundheit wie bei dem Milchmädchen von Vermeer, ihre Augen waren so blau wie Fjorde bei klarem Wetter, und durch den Akzent klang alles, was sie sagte, wie ein Gedicht. Isa ist schöner, dachte ich, denn das dachte ich vorsichtshalber immer mit dazu, wenn ich andere Frauen betrachtete, ihr Gesicht, ihre Augen. Ich nickte zu allem, was die Frau sagte, mehr, um es hinter mir zu haben, als um zu zeigen, dass ich alles richtig verstanden hatte. Schließlich musste ich mir nicht alles merken, denn ich hatte ja Isa, die speicherte alles, ich konnte mich blind auf sie verlassen. Sie stellte ein paar Fragen, zu Kraftstoffverbrauch, Gasbrenner und Elektrik. Die Frau überreichte ihr die Schlüssel – entweder waren wir hier in einem höchst emanzipierten Land oder Isa hatte wieder mal den fähigeren Eindruck gemacht. Die Frau hatte mich kein einziges Mal direkt angesehen und ich fragte mich, ob das eine isländische Angewohnheit war.
Jonathan stand die ganze Zeit daneben, geistesabwesend, wie morgens beim Warten an der Bushaltestelle. Sein dunkles Haar war eher lang und fiel ihm bis knapp über die Augenbrauen. Störrisches Haar über einem kindlichen Gesicht mit einer noch rührend weichen Kinnpartie. Er sieht nett aus, wie fast alle Dreizehnjährigen nicht besonders hübsch, aber nett. Einer von diesen Jungs, in die man nicht hineinschauen kann. Man hofft natürlich, man ist ständig am Hoffen, man hat Erwartungen, die man unausgesprochen lässt. Jonathan war ein klein wenig sonderlich, das ließ sich nicht leugnen. Manchmal meine ich, dass ich Fremde, wie die Frau von der Autovermietung, binnen fünf Minuten besser durchschauen kann als mein eigenes Kind. Mein Sohn entfernt sich allmählich und das lässt sich nicht ändern, nicht von mir und nicht von ihm. Ich ging zu ihm hin, legte einen Arm um ihn und zog ihn an mich heran. Ein Angriff oder eine Umarmung, als ob ich mich nicht entscheiden könnte. Er gab keinen Ton von sich, ließ es einfach über sich ergehen.
»Wer ist denn dieser Fremde?«, fragte ich. »Was sucht er hier? Ha-ha-ha.«
Ich lachte nicht, ich sagte ha-ha-ha. Man könnte versuchen zu erklären, warum man so etwas tut, aber dann wird man seines Lebens nicht mehr froh. Man macht etwas Dummes und bleibt dann dabei, um nicht völlig das Gesicht zu verlieren, oder nicht? Ich hielt ihn also fest, Jonathans Haare kitzelten meinen Unterarm und das erinnerte mich daran, dass mein Pullover noch in dem kleinen Büro lag. Den durfte ich nicht vergessen. Island kennt kein Erbarmen mit Leuten, die ihren Pullover verbummeln. Ich überlegte, ob Isa es vielleicht komisch fand, wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde.
»Du fährst zuerst?«, fragte Isa.
»Hmmmm.« Jonathan stöhnte in meinem Klammergriff.
»Tiddo!«
Wenn sie meinen Namen ausspricht, fühle ich mich meist wie ein Kind, höchst selten wie ein Mann, nie wie ein Geliebter. Ich ließ Jonathan los, er fiel fast auf die Nase, sein Skizzenbuch landete auf dem Boden.
»Ja klar, ich fahre, kein Problem.«
Ich schlug Jonathan auf die Schulter, als eine Art Versöhnungsangebot, und ließ ihn los. Er hob den Block auf und steckte ihn in seine Jackentasche. Mein Atem ging gejagt, keuchend, ein Gefühl, als würde mir die Kehle abgedrückt. Vielleicht war die Luft hier ja dünner, am 66. nördlichen Breitengrad.
Es regnete noch immer, und vor den Bergen, die der Karte nach da sein mussten, hing dicker Nebel. Steinfelder sahen wir, links und rechts, bis sie von feuchten Schwaden verschluckt wurden. Die Nationalstraße 1 wurde hinter Reykjavík zweispurig, einer Stadt, von der wir auch nichts sahen. Geländewagen überholten uns, Reisebusse kamen uns entgegen. Was hatte ich denn erwartet? Trolle und Hexen? Wenn wir durch ein Schlagloch fuhren, tanzten die Plastikteller und -tassen in den Einbauschränken.
4
Ein Gemälde hat Isa und mich zusammengebracht. Jede Liebe hat eine Geschichte, das hier scheint mir ein schöner Eröffnungssatz für unsere zu sein. Es war nicht gerade romantisch, das Gemälde, aber eines, das man nicht schnell vergisst – Barnett Newmans Cathedra. Ein paar Quadratmeter blaue Farbe auf einer Leinwand, wenn man es respektlos ausdrückt. Eine spirituelle Erfahrung, sagen die Wohlmeinenden, eine Darstellung des Himmelsgewölbes, der Thron Gottes, das Geheimnis des Lebens. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man es aus der Nähe ansehen muss, ohne zu zwinkern, dann werde man in den blauen Pigmentschichten ertrinken. Angeblich war das Gemälde bedeutungsschwanger. Ich halte diese Bezeichnung für unglücklich. Man fragt sich dabei doch sofort, wann die Bedeutung denn endlich geboren wird. Nachdem ich das Blau eine Weile aus nächster Nähe angestarrt hatte, trat ich noch ein Schrittchen näher, ich konnte meine Nase fast auf die Leinwand drücken, versuchte, nicht das Bild zu sehen, sondern etwas, das sich dahinter befinden musste, die Tiefsee, die Ewigkeit, was weiß ich. Nicht weit von mir entfernt stand eine junge Frau und starrte genauso wie ich, und auch sie blieb lange stehen. Hinter uns warteten Leute darauf, dass wir endlich verschwinden, damit auch sie ertrinken könnten. Ich spürte ihre Blicke in meinem Rücken, kümmerte mich aber nicht darum, die Frau neben mir war genauso standhaft.
Wir widerstanden dem Druck, und wir schauten, ohne zu sehen. Na ja, was sie sah, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, man kann schließlich auf dasselbe schauen und trotzdem etwas anderes sehen, selbst wenn es nur eine strahlendblaue Fläche ist. Aber mir wurde ein bisschen schwindlig davon. Na komm schon, blaue Farbe, dachte ich, enthülle dein Geheimnis.
»Stehen wir vielleicht zu nah dran?«, fragte sie.
Ich wollte etwas Witziges antworten, wurde aber nervös und mir fiel nichts ein. Wir traten gleichzeitig zwei Schritte zurück, ich machte verstohlen noch zwei Schrittchen zur Seite, so dass ich näher bei ihr stand.
»Was siehst du?«, fragte ich.
Sie antwortete nicht. Feine Gesichtszüge, blaugraue Augen, suchend, forschend. Sie schüttelte den Kopf.
»Es ist echt schön, aber es sagt mir nicht viel.«
Ich betrachtete sie verstohlen von der Seite, das Bild wurde zum blauen Schleier, es interessierte mich nicht mehr. Mir gefiel ihr Gesicht. Dunkelblonde Locken, die bis knapp über die Schultern fielen, links über der Stirn hatte sie einen charmanten Wirbel, wodurch sich ihr Haar nicht in der Mitte teilte. Eigentlich nichts Besonderes, solche Haare sieht man bei Hunderten von Frauen, aber diese Hunderte standen nicht neben mir. Der Blick ihrer großen Augen war weder herausfordernd noch selbstbewusst, sondern aufmerksam und neugierig, sie wollten verstehen, was sie sahen, und schienen sich gleichzeitig für ihre Begriffsstutzigkeit zu entschuldigen.
»Vielleicht will es gar nicht unbedingt etwas bedeuten«, sagte sie, »nur etwas bewirken.«
»Müde Füße und Durst«, sagte ich. »Das ist es, was so ein Museum immer bewirkt.«
Sie sah mich an, als würde sie mich erst jetzt wahrnehmen. Sie schlug die Augen nieder, zum Küssen, dieser sanfte, nach unten gerichtete Blick.
»Ich weiß eigentlich nicht, was ich hier will.« Der Anflug eines Lächelns, nicht kokett oder berechnend, sondern schüchtern und schlicht bezaubernd.
»Ich auch nicht«, sagte ich, und das war die Wahrheit, denn ich spielte damals ja gerade mit dem Gedanken, Kunstgeschichte zu studieren, weil mir nach einem abgebrochenen BWL-Studium eine sinnentleerte Zukunft im Büro Angst machte.
Doch nachdem ich jetzt dieser Frau begegnet war, überfiel mich eine ganz andere Angst – dass es eine Zukunft ohne sie sein würde.
»Hast du Lust auf einen Kaffee?«, fragte ich. »Dann lass uns doch eine Tasse trinken. Oder bist du nicht allein?«
Sie antwortete, sie sei allein, ein Satz, in dem sich Kummer verbarg, der mir aber in diesem Augenblick wie Musik in den Ohren klang. Ich weiß noch, dass ich mich leicht fühlte auf der großen, imposanten Treppe, meinetwegen konnten alle Bilder von den Wänden fallen, und gleichzeitig waren sie eins wie das andere Freunde, denn ich konnte über sie sprechen, und diese Frau mit dem netten Gesicht ließ mich erzählen. Es berührte mich, und ich fühlte mich dabei groß und stark. Wir tranken Kaffee, sie fragte alles Mögliche über Künstler, wo sie herkamen, nach Jahreszahlen, dies und das, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich alles an Antworten gab, es muss eine peinliche Menge Unsinn dabei gewesen sein, obwohl ich mich noch erinnere, dass sie mich mehrmals mit der Frage unterbrach: »Du weißt das auch nicht genau, stimmt’s?« und ein paarmal mit »Woher weißt du das?«. Nicht um mich in Frage zu stellen, es war eine Prüfung. Ich konnte ihr kein einziges Zitat oder auch nur eine belegbare Quelle nennen. Nach einer Weile stellte ich fest, dass ich nichts mit Sicherheit sagen konnte, selbst die Datierungen der bedeutendsten Werke von Malewitsch oder Matisse waren keine harten Fakten mehr. In dieser halben Stunde Kaffeetrinken hatte ich so gut wie ständig das Wort geführt und dennoch hatte sie das Gespräch gelenkt. Sie war das außergewöhnlichste Geschöpf, dem ich je begegnet war.
»Hier, warte«, sagte ich schnell und besorgt, als sie aufstand (sie stand ohne Ankündigung auf, nicht wegen des Effekts, sie war einfach so), »ruf mich doch mal an, wenn du Lust hast, noch weiterzureden.« Ich schrieb meinen Namen und meine Telefonnummer auf ein leeres Zuckertütchen. Sie nahm es, Zuckerkörnchen rieselten auf den Tisch zwischen uns. »Oder darf ich dich einmal anrufen?«, fragte ich.
»Ich ruf dich an«, antwortete sie. »Tschüs Tiddo, danke für den Kaffee und die Unterhaltung.«
Ich wusste nicht einmal, wie sie hieß.
Sie rief mich nicht an, sie rief mich schrecklich lange nicht an, sie würde mich nie anrufen! Drei Wochen gingen vorüber, und obwohl ich natürlich nicht den ganzen Tag an sie dachte, wurden meine Versuche, mich an ihre Augen und ihr Gesicht zu erinnern, immer verzweifelter. Dann endlich meldete sie sich. »Hier ist Isa.« Ich wiederholte ihren Namen, um meine Nerven zu beruhigen. Es war der Tag, nachdem Cathedra im Stedelijk Museum von einem Verrückten mit einem Teppichmesser schwer beschädigt worden war. Sie fragte, ob ich es schon gehört hätte. Ich wusste von nichts und war zu verblüfft, um zu erfassen, was sie sagte.
»Das hast doch nicht etwa du gemacht?«
»Ich? Was hab ich gemacht?«
»Das Gemälde zerstört.«
»Natürlich nicht. Ich weiß nicht einmal, wovon du sprichst.«
»Ich bin die Frau aus dem Museum. Wir haben uns zusammen das Bild angesehen.«
»Mein Gott, natürlich, wie könnte ich das vergessen? Ich meine, was ist denn mit dem Bild?«
Sie erzählte mir in aller Ruhe, was geschehen war, und ich genoss es, ihre Stimme zu hören. Ihren Namen. Ich hätte jubeln können. Das Bild interessierte mich überhaupt nicht. Cathedra war angegriffen worden. Das waren ihre Worte: angegriffen worden. Drei meterlange, horizontale Schnitte in die Leinwand, ein paar schnelle, vertikale Hiebe. Ein Massaker. Und nur diesem aufgeschlitzten Bild hatte ich ihren Anruf zu verdanken. Wie man ein Gemälde doch liebgewinnen kann, wenn es zerfetzt ist!
»Sag mal, Isa.« Es war toll, ihren Namen auszusprechen.
»Hast du wirklich gedacht, dass ich das war?«
»Nein, nein, ich habe es in den Nachrichten gehört und musste an dich denken. Vielleicht wollte ich die Möglichkeit ausschließen.«
Die Möglichkeit ausschließen, mir schien dieser Spaß eher fragwürdig. Später habe ich das anders betrachtet. Wie das mit dem Zuckertütchen. Damals dachte ich noch, sie hätte es aufgehoben, aber nein, sie hatte sich meine Nummer gemerkt. In ihre Datenbank eingespeichert, wie sie es ziemlich nerdig ausdrückte. Ein Jahr darauf zogen wir zusammen, in Delft, wo sie an ihrer Doktorarbeit schrieb. Sie war dreiundzwanzig, beide Eltern waren bereits gestorben, die Mutter an Brustkrebs, der Vater an einem Schlaganfall, sie hatte einen zwölf Jahre älteren Bruder, der in San Francisco lebte. »Ich bin allein«, wieder hörte ich sie das sagen an dem Tag im Museum, es hatte sich angehört, als sei das immer so gewesen. Ich bewunderte alles an ihr. Isa war ein Mensch, der nicht vom Schicksal überwältigt wurde, sondern der in der Lage war, sein Leben in die Hand zu nehmen, und das obwohl sie schon mit neunzehn Waise geworden war. Für sie war es selbstverständlich, dass wir zusammenleben würden und dass dieses Leben dann so wäre, wie es jetzt war. Wie unglaublich mir das alles vorkam, das Haus, das wir zusammen kauften, Jonathans Geburt, für sie schien das alles völlig logisch zu sein. Sie genoss es genau wie ich, aber man konnte an ihrem Blick und ihrem Gang sehen, dass sie bei allem dachte: Natürlich geht das so, was hattest du denn gedacht, Tiddo? Ich fühlte mich als Teil von etwas Größerem, als Teil eines kosmischen Plans, den Isa entschlüsselt hatte und in dem ich offenbar ein kleines Rädchen war. Zwei Jahre nach Jonathans Geburt hatte Isa ihre erste Fehlgeburt, gut ein halbes Jahr später die zweite. Ein Sturm tobte über unserem Haus, riss am Dach, bis es wie ein Schiffsrumpf knarrte, doch das änderte nichts an Isas Grundeinstellung zum Leben. Auch Rückschläge gehörten ihrer Meinung nach zum natürlichen Lauf der Dinge, der Tod ihrer Eltern hatte sie das gelehrt. Rückschläge würden uns nie voneinander trennen können.
Es war ein Gemälde, das uns zusammengebracht hatte, ein zerstörtes Gemälde. Ohne dieses Bild hätten sich unsere Wege nie gekreuzt. Für mich war und blieb das ein Wunder. Ohne den geringsten ironischen oder relativierenden Nebengedanken. Für sie mochte es selbstverständlich sein, aber wie sollten zwei Menschen wie Isa und ich im wahren Leben zueinander finden, wenn nicht durch eine göttliche Fügung?
5
Die Nacht kam ohne die barmherzige Dunkelheit, die einen grauen Tag zudecken und vergessen machen kann. Der Regen auf dem Dach des Wohnmobils hörte sich an wie eine verstimmte Pauke, auf der einer nervös mit den Fingerspitzen trommelt. Neben mir atmete Isa ganz entspannt, als ob sie auch im Schlaf alles im Griff hätte, ihren Körper, ihre Träume. Wir lagen in der Schlafkabine über dem Fahrersitz eng nebeneinander, ohne dass sich unsere Körper berührten. Das fahle Nachtlicht fiel durch ein kleines, längliches Seitenfenster direkt über unseren Köpfen, denn das Fensterrollo verweigerte den Dienst. Jonathan lag hinten, im unteren Teil des Stockbetts. Wenn er sich umdrehte, schaukelten wir sachte mit, wie in einem schwankenden Boot.
Dass ich keinen Schlaf finden würde, hätte ich mir denken können.
Unser Camper stand auf einem Platz mit mindestens dreißig anderen Fahrzeugen und ein paar Kuppelzelten. Als Campingplatz konnte man es nicht recht bezeichnen, es war ein schlammiges, flaches Gelände mit einer Blockhütte gleich vorn beim Eingang, wo nur kaltes Wasser aus der Leitung kam. Angeblich lag der Platz nicht weit von den Geysiren entfernt, und auch nicht weit vom Gullfoss, dem Goldenen Wasserfall. Wir waren in das Land eingedrungen, ohne etwas davon zu sehen, wir mussten eben davon ausgehen, dass es hier tatsächlich diese Geysire und Wasserfälle gab und nicht nur Nebel und böse Geister. Irgendwann in der Nacht hörte der Regen auf. Die darauffolgende Stille machte die fremde, abwesende Dunkelheit noch unwirklicher. Isa drehte sich auf den Bauch. Sekundenlang streichelte ihr Fuß an meiner Wade entlang, zufällig. Wie wunderbar wäre es jetzt, meine Hand auf ihren Hintern zu legen und sie einmal liebevoll zu kneifen. Ob sie es wohl merkte, das mit der Hand? Aus Versehen, es ließe sich plausibel erklären, denn wir lagen wie die Ölsardinen nebeneinander. Jonathan schlief fünf Meter entfernt auf seiner Pritsche, aber das störte doch nicht? Das hier war meine Familie. Nicht kleinzukriegen.
Ich hatte noch immer nicht geschlafen.
Es muss schon gegen Morgen gewesen sein, als ich durch das schmale Fensterchen die Berge aufscheinen sah, die Wolken zogen allmählich weg. Die Beklemmung der Nacht verschwand, als ich die Umrisse der grünen Hänge sah, es war, als ob ich endlich atmen konnte. Mich überkam eine Leichtigkeit, ausgelöst vom Schlafmangel und von reiner, schlichter Heiterkeit. Ich konnte nichts dagegen tun. Sanft streichelte ich Isas Haar, kletterte dann vom Schlafabteil nach unten. Ich stellte Kaffeewasser auf und summte eine selbsterdachte Melodie. Die Uhr über der Tür zeigte halb sieben. Ich hörte zu summen auf, um Jonathan nicht zu wecken. In Gedanken summte ich weiter, denn wir waren in Urlaub in einem Land, das dalag, als müsse es erst noch entdeckt werden. Jedenfalls konnte ich mir das vorstellen, wenn ich hinaussah, auf die Berge – dass das Land noch unentdeckt war, dass man dort als erster Mensch Millionen von Schritten machen konnte.
6
Das Erste, was einem bei den Geysiren auffiel, waren die Chinesen. Um uns herum dampfte und qualmte die Erde, und aus jeder Wolke tauchten Chinesen auf. In Trauben drängten sie sich bis ans Seil, das die Touristen in sicherem Abstand zum Geysir halten soll. Sie streckten ihre Handys und Selfiesticks in die Höhe, minutenlang, denn der Geysir spuckte etwa alle fünf Minuten, aber sicher war das nicht, es konnte auch zehn dauern. Chinesen, die mit der Wassersäule auf dem Foto sein wollten, warteten mit festgefrorenem Lächeln auf den Ausbruch, mit ausgestrecktem Arm machten sie das V-Zeichen. Die große Geduld hatten sie bestimmt im Tao gelernt oder in ihren irrsinnig langen Staus, die Tage dauern können. Der Geysir hieß Strokkur, ein Name, den man nur Riesen oder Geysiren gibt. Ein Stück entfernt lag sein großer Bruder, der »alte« Geysir, der dem Naturphänomen den Namen gegeben hatte, aber inzwischen so gut wie erloschen war, weil man in der Zeit, als der Tourismus aufkam, große Mengen Seife hineingeschüttet hatte, um ihn noch höher und spektakulärer spucken zu lassen. Das wusste Isa, sie erwähnte auch die Quelle – den Reiseführer, den ich während des Flugs zu lesen versucht und kein Wort davon behalten hatte.
Wir erschraken alle drei, als eine Wassersäule mit dumpfem Dröhnen aus der Erde schoss, sicher vierzig Meter hoch. Der Dampf stieg langsam noch höher in den Himmel hinauf. Genau wie viele andere riefen wir »Aaah«, diese dümmliche Reaktion ließ sich nicht unterdrücken. Vor Schreck bewegten viele Chinesen ihr Handy, einer ließ es sogar fallen, oder ihr Lächeln erstarrte zu einer entsetzten Miene, so dass das Foto wiederholt werden musste. Es war bemerkenswert, dass uns ein Spektakel dermaßen beeindruckte, das eigens für die chinesischen Touristen erdacht zu sein schien. Jonathan wollte den Ausbruch mindestens fünfmal sehen und zeichnete dabei in sein Buch. Als wir endlich aufbrachen, hatten den ersten Chinesen schon dreimal andere Chinesen Platz gemacht. Ich fand nicht, dass sich alle Asiaten ähnlich sehen, wie manchmal behauptet wird, sie unterschieden sich vor allem durch ihre bunte Kleidung und die merkwürdigen Schuhe voneinander, ganz im Gegensatz zu den Europäern, die Rucksäcke trugen und sich allesamt für einen fahlen Outdoorlook entschieden hatten. Während mir solche Dinge auffielen, beäugte Isa den Boden, zerrieb rostfarbene Erde zwischen den Fingern und roch daran; sie ließ ihre Hand durch das türkisfarbene, heiße Wasser gleiten, schnupperte erneut, kostete und schoss unzählige Fotos von der Heißwasserquelle und dem umgebenden Erdreich. Jonathan zeichnete. Ich wollte sehen, was genau, aber er klappte sein Buch schnell zu.
»Wahnsinn, so viele Chinesen hier, nicht wahr?«, sagte ich.
Er reagierte nicht, also tat ich, als hätte ich Isa gemeint.
»Nicht wahr, Isa? Massenhaft Chinesen.«
»Woher weißt du das?«, fragte Isa.
»Was?«
»Dass es Chinesen sind. Nicht Koreaner oder Japaner.«
Kurz darauf sah ich eine alte Frau direkt vor mir gehen, die mich von hinten an meine Mutter erinnerte; sie lief richtig schnell in ihren rosaroten Sneakern. Als sie sich umdrehte, hatte sie ein echtes Trollgesicht. Plötzlich sah ich nur noch alte Leute mit Sportschuhen und Käppis, die Englisch mit stark amerikanischem Akzent sprachen. Der Geysir hatte die Chinesen verschlungen und dafür Amerikaner ausgespuckt, denn so merkwürdige Dinge konnten hier in diesem Land geschehen, oder schienen zumindest vorstellbar. Plausible Erklärungen, wie etwa, dass aus der Hauptstadt neue Busse eingetroffen waren, fielen einem erst später ein.





























