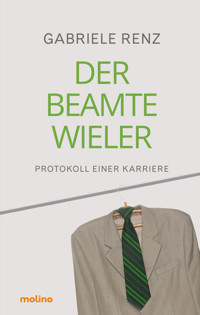
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Molino Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Beamte Wieler taucht nach der Wahl an der Seite der vielversprechenden Parteipolitikerin auf. Gebogen wie ein Kleiderbügel sieht man ihn der Chefin des Hohen Hauses nacheilen. Niemand kennt ihn. Keiner weiß etwas. Die Spekulationen über den Neuen schießen ins Kraut. Als Wielers Blitzbeförderung ruchbar wird, gerät der biegsame Verwaltungskarrierist unversehens in ein parteipolitisches Scharmützel. Nicht nur in der Ökopartei, die alles anders machen will als das Ancien Régime, regt sich Widerstand. Der Apparat schlägt zurück. Ein Roman über opportunistische Postenjäger, über Mobbing, Intrigen und die Verführung von Macht und Geld. Die Grünen, aber auch die Union als gefühlte Staatspartei geben die Folien ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Der Beamte Wieler
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Renz, Gabriele
Der Beamte Wieler
Protokoll einer Karriere
Roman
ISBN 978-3-948696-72-6
e-ISBN 978-3-948696-97-9
Satz und Gestaltung: Molino Verlag GmbH
Printed in Germany
© 2024 Molino Verlag GmbH, Schwäbisch Hall und Sindelfingen
Alle Rechte vorbehalten.
GABRIELE RENZ
Der Beamte Wieler
Protokoll einer Karriere
Roman
Inhalt
Wieler, der Neue
Der junge Wieler
Dr. Kalbmayer, Halbleiter
Herr und Frau Wieler
Der Beamte Wieler
Eckstein, Halbleiter
Rebmann-Klopfer, Protokoll
Weller, Redenschreiberin
Fußball-Allianz
Weckessers Trauma
Wielers Liste
Müller-Bleibel, Presse & ÖA
Urgestein Amann
Alles auf Rot
Dr. Bernauer, Oberleiter
Kleiderordnung
Wieler, der doppelte Stellvertreter
Parteifrösche
Causa P.E.N.
Humor ist
Sprechübungen im Chefzimmer
Reste des Ancien Régime
Vortragsübungen, Teil 2
Die B4 in Sicht
Biggi Lasker, die Altgediente
Wieler rechnet die B4
Natalie Charon, Vorzimmer Chefin
Dr. Bernauer, Oberleiter
Rosalind Weller, Redenschreiberin
Dr. Bernauer und der Rauswurf
Geheimtreffen der Siegersträßler
Wielers Traum
Weckesser im Wartestand
Parteisaat
Beratung für Wieler
Wielers Motivationspapier
Frau Wielers Traumimmobilie
Die Chefin und der Panzer
Frauen-Stammtisch
Causa ASF
Der Große Vorsitzende
Verlorene Unschuld
Siegerstraßenparteiwahltreffen
Wielers Wandlung
Wieler diktiert
Knödel beim Inder
Obst-Runde
Notiz am Rande
Schilderwechsel
Epilog
Die Autorin
Wieler, der Neue
Wieler konnte seine Art nicht verbergen. Nach vorne gebogen wie das Obere eines Kleiderbügels, rannte er hinter seiner Chefin her. Das Nacheilen folgte einer Choreografie, von der manche annahmen, dafür gebe es eine Vorschrift, ja es sei im Protokoll geregelt. Was die Leute sich so vorstellten, hoheitliche Sphären betreffend.
Wieler dagegen meinte, ein Laufen und Hetzen vorgeben zu müssen als Ausweis seiner Beflissenheit, indem er den Kopf weit vorstreckte und den Allerwertesten mit einigem Abstand nachfolgen ließ. Vermeinte er Augen auf sich gerichtet, konnte der Winkel, den sein Körper formte, an eine chinesische Dreiviertelverbeugung heranreichen. Aber wir wollen nicht übertreiben, es reicht zu wissen: Jener Wieler beeilte sich unter fremdem Blick doppelt, seine Chefin einzuholen, um wichtige Geschäfte vorzuschützen.
Der Anzug, in dem er steckte, glich dem Zweiteiler seiner politischen Anfänge – das war gerade zwei Jahre her – wirklich nur in diesem dunkelgrauen, für lange Tragestrecken angelegten Farbton. Aber die Passform! Welten! Obwohl Wieler gut gebaut war und in jungen Jahren sicher etwas hergemacht hatte mit seinem Körper: einem V aus breiten Schultern und schmalem Becken, waren Hose und Jackett, in denen er seine neue Arbeitsstelle angetreten hatte, mehr schlecht als recht an ihm gehangen. Der Anzug, den er in die ersten Wochen seines neuen Lebens hinüberrettete, war entschieden zu weit, zu schlabberig, der Stoff zudem ohne Qualität, an manchen Stellen mehr Netz als Gewebe, was darauf schließen ließ, dass er ursprünglich dazu auserwählt war, seinem löchrigen Ende auf dem alten Stuhl in Zimmer RB II 3.4 entgegenzuwetzen.
Doch nun war Wieler in der politischen Institution angekommen. Und mit ihm ein neuer Zweiteiler, der trefflich seine Dienstbarkeit und sein Bestreben im Hohen Haus anzeigte, denn der nicht mehr ganz junge Mann hatte Fährte aufgenommen und steuerte auf ein Ziel zu, das höchstens er selbst kannte. Vielleicht nicht einmal das.
Doch wen interessierte schon die Karriere eines x-beliebigen Beamten, der die Stufen zur Pension nimmt, so sicher wie das Amen in der Kirche? Im Laufe dieser Geschichte werden sich manche zuerst wundern und sich am Ende vielleicht mit der flachen Hand auf die Stirn schlagen vor Erstaunen, denn der Neuzugang überraschte sie alle.
Wieler war von einem Tag auf den anderen da. Woher er kam, was ihn angetrieben hatte, den Schritt zu wagen ins Gefolge der Chefin, blieb für die meisten Kollegen im Unklaren. Wir können jedoch auf allerhand Unterlagen und Materialsammlungen zurückgreifen, die belegen, dass es Wieler ziemlich genau zwei Wochen nach der Wahl herausdrängte aus der geschützten Stube des alten Amtes, wo die Pflanze neben dem Heizkörper gleichsam mit ihm, seinem Besitzer, Jahr für Jahr, ein wenig mehr eintrocknete.
Mehr als zwanzig Jahre tippte Wieler in einer Regionalbehörde am Rande der Stadt nach, was andere errechnet hatten, er war, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, kaum mehr als ein Zahlenkolonnenprüfer. Man konnte nicht sagen, dass seine Verrichtungen überflüssig gewesen wären, aber keine zwei, drei Jahre später und jede bierdeckelgroße Lötplatte hätte seine Arbeit ohne Urlaubsanspruch und Krankenbeihilfe, sogar ohne ein eigenes Zimmer übernommen. Es wurde also, wie man so sagt, höchste Eisenbahn, sich etwas zu suchen. Und wie er es fand! Dass Wieler einmal ein solcher Glücksritter werden sollte, war einfach zu unwahrscheinlich.
Niemals wäre zum Beispiel sein alter Nachbar Konzmann, der einen guten Riecher für Menschen auf der Überholspur hatte, auf die Idee gekommen, dass dieser Wieler einmal mit Präsidenten und Schriftstellern, mit den bekanntesten Menschen überhaupt an einem Tisch sitzen oder ein schnelles Telefonat führen würde. In der Waisenstraße 13, wo die Wielers eine recht komfortable Altbauwohnung zur Miete ergattern konnten, war ihm der freundliche Nachbar aus Etage drei nicht einmal im Hausbeirat aufgefallen, obwohl er ihn selbst aus Mangel an Alternativen hineingewählt hatte. Einer wie Konzmann konnte durch einen solchen Menschen geradezu hindurchsehen. Wieler war es nur recht, denn jeder Gang nach außen erforderte von ihm Überwindung, zu groß war die in ihm lauernde Vorahnung einer Blamage. Den meisten Menschen, die Wieler begegneten, war er ein Rätsel, als Individuum schwer zu fassen. Deshalb wohl hatte niemand die zarten Anfänge seiner Sichtbarwerdung auch nur im Geringsten wahrgenommen.
Als Held unserer Zeit war der Knabe wahrlich nicht angelegt. Und doch: Die Sensiblen unter den neuen Kollegen schnupperten den würzigen Geruch des Ehrgeizes an ihm, einen zarten Hauch nur, aber er lag in der Luft, wenn Wieler vorbeieilte.
Keine sechs Monate zuvor, an einem Abend im Oktober oder November, war Wieler völlig unvermittelt in der Stadtgruppenversammlung der Ökopartei gesessen. Lange stand er an der Wand neben der Garderobe, ein Bein ans Mauerwerk gestützt, die Arme wie zum Schutz verschränkt. Dann rückte er unbemerkt, wie auch sonst, an den Tisch zu den Repräsentanten der Siegerstraßenpartei vor, zuerst drei Stühle, dann zwei, dann bis direkt neben die Vorsteherin.
Wieler hatte sich eine Taktik zugelegt, auf die man erst einmal kommen musste: Wenn einer nach zwei Bieren aufs Örtchen ging, eine andere zum Stillen des Kindes schnell den gewärmten Sitz verließ, schob sich Wieler weiter, einen Platz nur, gerade so viel, dass die Wiederkehrenden eine kurze Irritation verspürten, aber wegen Wielers freundlicher Unscheinbarkeit an eine Erinnerungsschwäche glaubten. So bewegte sich Wieler seitlich in Krebsmanier immer näher zum Zirkel der Macht, um genau zu sein: Allein Wielers Gesäß brachte diese Leistung zustande.
Wieler mied so gut es eben ging das öffentliche Wort, aber als die Servicekraft seine Getränkewünsche abfragte, konnte er natürlich nicht vermeiden, einen Ton von sich zu geben. Da drehte die Vorsteherin ihren Kopf und erkundigte sich nach seinem Namen.
»Wühler?«, stutzte sie im Glauben, er schriebe sich wie das Antiatomdorf Wyhl, und schob einen Satz nach, der ihn kurz elektrisierte, wiewohl er nicht genau wusste, warum.
»Bei den Name mussd du ja was werden bei uns! Wir sind die Heimat der Widerständigen«, lachte sie nach der Abstimmung beim Sauvignon Blanc, an dem es freilich nicht lag, dass sie sön sagte.
Obwohl sie schon lange im deutschen Süden lebte, bekam sie den hohen Norden, aus dem sie stammte, nicht aus ihren Wörtern. Nach kurzem betretenem Schweigen schwenkte man auf ein anderes Thema, weil der, der die Vorlage hätte nutzen können, um sich mit einigen wenigen Aperçus bekannt zu machen, nur stumm am Glas nippte. Von Politik verstand Wieler recht wenig. Mit den Optionen der Macht, von der auch an diesem Abend ständig die Rede war, konnte er ebenfalls wenig anfangen. Und doch ging Wieler an jenem Abend verstört nach Hause, von dem Gedanken durchströmt, dieser Wieler müsse eine große Gestalt gewesen sein. Seine Frau, wer sonst, kam ihm zu Hilfe: »Die Vorsteherin konnte ja nicht wissen, dass man dich anders schreibt.«
Es folgte eine kleine Geschichtsstunde über den Kampf von Bürgern gegen ein geplantes Atomkraftwerk im Badischen. Man sollte meinen, Wieler sei damit aufgewachsen, dass Leute, die den Namen zum ersten Mal hörten, reagierten wie die Vorsteherin.
Aber im Wieler’schen Elternhaus war Ahnenforschung der anderen Art betrieben worden: Dem Vater genügte die Feststellung, die Vorfahren seien in den Adelsstand erhobene Radmacher gewesen, um in der Familie den Ehrgeiz zum Standesmerkmal auszurufen. Wieler Junior litt schwer unter dem dominanten Mann, der den verkümmerten Willen seines Sohnes, ein berufliches Fortkommen in Aussicht zu nehmen, bis zu seinem letzten, röchelnden Atemzug als Schmach empfand.
Doch jetzt, da seine Frau über die von der Polizei weggetragenen Bauersfrauen und Winzer erzählte und von dem Ministerpräsidenten der Beharrlichen, dessen größte Blamage keineswegs die Prophezeiung war, ohne die Atomspaltung werde bald das Licht ausgehen im Land, jetzt stiegen in ihm nach und nach Erinnerungen auf, die er am liebsten in der Versenkung gelassen hätte. Sein Sprössling trage seinen Namen, aber nicht sein Skelett, pflegte der Vater zu sagen, wenn er die Vorstandskollegen privatissime in seiner Jagdhütte um sich scharte und sich einer unvorsichtigerweise nach dem Herrn Sohnemann erkundigte.
Und wenn sich einmal im Jahr die weitläufige Verwandtschaft traf, dröhnte der Vater nach dem zweiten Cointreau, ein Wieler gebe nicht klein bei.
»Wir sind Kämpfer – mit Ypsilon oder ohne!«
Die Idee, sich auf der Stadtteilversammlung sehen zu lassen, stammte selbstredend von Wielers Frau. Sie überhörte sein kleinlaut geäußertes Bedenken und blieb stur. Wenn er je auf eine Liste gewählt werden wolle als Kandidat, schade es gewiss nicht, wenn die Leute von der Siegerstraßenpartei sein Gesicht wenigstens einmal gesehen hätten, oder, dachte er bescheiden, wenigstens seine Brille.
Wieler selbst glaubte nicht daran, dass sie ihn bemerken würden. Hatte man ihn etwa die zwanzig Jahre im Regionalamt gesehen? Hatte ihn Konzmann auch nur einmal zur Kenntnis genommen? Mit den Machthungrigen konnte er sowieso nicht mithalten, denen die Hormonschübe den Schritt breit und die Stimme laut machten. Wielers Drang in die Sichtbarkeit glich eher nanogroßen Stupsern eines mit weniger als 2.000 Volt durchströmten Koppelzauns. Tick, tick, tick.
Aber es war ein Anfang. Wieler hatte es tatsächlich geschafft, neben der Stadtteilvorsitzenden auf der Bank zu sitzen. Ohne sein Zutun stellte sie ihn der kandidierenden Parteikollegin vor, die nicht lange fackelte und Wieler – ausgerechnet einen, der drei Anläufe brauchte, um ins kleine Gespräch zu kommen – für den Straßenwahlkampf rekrutierte. Wieder wirkte seine Frau segensreich. Schon bald stand Wieler an Wochenenden zwischen Kirche und Karstadt vor dem Flagshipstore mit französischen Taschen, deren Kauf sein verfügbares Monatseinkommen auf null gesetzt hätte, und verteilte Rosen und Sonnenblumen. Man wächst mit den Aufgaben, hämmerte Frau Wieler ihrem Gatten ein, wobei genau dieses, wie wir inzwischen wissen, keineswegs für alle gelten musste.
Das alles ist unerheblich. Wichtig ist nur zu wissen, dass Wieler seine alte Trägheit überwand und eine Stelle im Hohen Haus antrat, deren exaktes Aufgabentableau diffus blieb, ihn jedoch diensteifrig hinter der Vorgesetzten herrennen ließ. Erkundigten sich die angestammten Kollegen bei ihren Vorgesetzten, um welche Stelle es sich genau handelte und was das Profil sei, stießen sie auf Achselzucken. Im angestaubten Organisationsplan standen Namen längst Verblichener. Also einigten sich die Etablierten kurzerhand darauf, ihm den Status eines Assistenten zuzuweisen.
Dann saß Wieler in ihren Besprechungen mit der Chefin, das Bein übergeschlagen, Stift und Notizbuch in der Hand für spontane Aufschriebe. Die Halb- und der Oberleiter redeten über ihn hinweg, trugen Vermerke vor und berieten wichtige Ersturteile und Klagewege.
Als sich Wieler erstmals zu Wort meldete, brachte er einen Paragrafen zur Kenntnis, denn das Rechtswesen war auch Wielers Metier, aber bei ihm von einer Leidenschaft zu sprechen, wie er sie als junger Mann für die niedrigen Motorräder aufbrachte, wäre in gröbstem Maße übertrieben.
Der junge Wieler
Der Juristerei war die Nummer sicher, auf die die Wieler-Eltern gepocht hatten.
»Juristen werden immer gebraucht!« tönte der Erzeuger nicht nur einmal und zwinkerte mit seinem rechten Auge bei dem Hinweis, damit könne der Junior auch »auf Frauenfang« gehen.
Doch die Direttissima zum Karrieregipfel war nichts für den jungen Wieler. Er verließ die Schule ohne Ambition. Ihn zog es zu den Schraubern und Drehern der nahen Mopedfabrik, zu jenen, auf deren Haut sich im Sommer glänzende Perlen legten und denen die Mädchen trotz der schwarzen Ölreste unter den Fingernägeln nie abgeneigt waren.
Wielers Sohn sah sich in den kühnsten Träumen, zu denen er fähig war, in Jeans mit angerissenen Shirts und einer Sozia, der das lange Haar aus dem Helm wehte. Also schrieb er sich ein als Lehrling auf drei Jahre.
Wenn der Patriarch wieder anhob, vom Ehrgeiz zu schwadronieren, der als Grundlage einer jeden Karriere angesehen werden sollte, auch vom lieben Herrn Sohn, stellte Wieler Junior sich taub und aß ungerührt weiter. Einmal ließ er sich gehen und murmelte etwas von den vielen Wegen nach Rom, was ihm nicht guttat, weil der Vater die naiv gewählte Vorlage zu nutzen wusste, indem er ihn zuerst mit lateinischer Grammatik traktierte, ihm dann das Bekenntnis abrang, die Hochschule im Blick zu behalten als fernes Ziel und schließlich wutschnaubend, oder eher: angewidert den Raum verließ.
Aber auch in der großen Motorradfabrik lief es nicht wie geschmiert. An den Stammtischen, das hatte Wieler zuvor nur gehört, aber nie leibhaftig erfahren, wurden die Vorurteile gegenüber den Studierten mit großen Schlucken weggesoffen. Jurist und auch sonst von mäßigem Verstand, dichteten sie in den Brezelpausen, da hatte Wieler längst dem Vater, unter dem Eindruck eines kleinen Schlaganfalls, versprochen, einmal an die Hochschule und in seine Stapfen zu treten. Es gab keinen in der Maloche, dem er das anvertraut hätte, ohne dauerhaft Gefahr zu laufen, abgedrängt zu werden aus dem verschworenen Kreis der Muskelshirts.
So begann Wielers Laufbahn als gedoppelter Mensch, der nach verschiedenen Seiten hin ein anderes Gesicht zeigen konnte und in höchstem Ausmaß verträglich war mit den unterschiedlichsten Sphären. Weil er eine Seite in sich immer verleugnen musste, verkümmerten seine Äußerungen zum Notwendigsten.
Wieler wurde ein Adabei, wie er im Buche stand: einer, der überall dabei, aber selten mittendrin war. Wielers nacheilender Charakter galt nicht wenigen als sonniges Gemüt: Er lachte, wenn die anderen lachten, und schwieg, wenn sich hergemacht wurde über die da oben oder die da drüben oder wen auch immer. Es fanden sich immer welche, die nicht hineinpassten in das Schema F der Kollegen, die sich für einen Logenzirkel hielten, der über Wohl und Wehe eines ganzen Landes bestimmte.
»Schrauberkönig« nannten sie den obersten Chef. Zu jener Zeit, als Wieler sich anschickte, den Ruß der Rohre zu schnuppern, wurden die Bizeps und Schenkel aufgepumpt wie Baumstämme. So viel Kraft! Im Windschatten der Männer, die die Politik der Straßen diktierten, tankten auch die Werkskollegen Bedeutsamkeit und führten das große Wort. Wieler schlüpfte durch die Lästereien und Schmähgesänge hindurch wie ein kleines Silberfischchen durch die Fliesenfugen. Er hatte nun zwar auch das schwarze Schmierfett unter den Nägeln, hatte Jeans an und Shirts ohne Ärmel, aber die Ernte blieb aus. Die dicken Rohre der Auspuffe und seine Scheu lebten als Gegensatzpaare vor sich hin wie ein altes Ehepaar.
Wieler saß allein auf dem Bock. Wenn sich alle aufmachten für die große Wochenend- oder Feierabendausfahrt, wagte auch er es, sich zu den auf Hochglanz polierten Motorrädern zu stellen, doch auf der Ausfahrt bog er in die erstbeste Straße ab, um aus dem Blickfeld der Schraubenkollegen zu kommen.
Einmal, ein einziges Mal, nahm er eine junge Frau mit. Als er ihr den Helm überstreifte, stellte er sich vor, es sei sein Mädchen – eine blumige Wunschvorstellung, von der er noch lange zehren musste, denn die junge Frau saß hinter ihm in Ermangelung einer Alternative. Wieler war als Lenker nützlich.
In diesem Moment dräute ihm, dass es wohl nichts mehr werden würde mit dem wilden Biker-Leben. Aus Enttäuschung legte er den Kippschalter seines Lebensplans um und erwog, was sein Senior gepredigt hatte, ja, er begann sich sogar von der Idee eines Berufs mit Pensionsanspruch zu nähren. Die Kollegen wiederum schienen, wiewohl erst das zweite Lehrjahr beendet war, Wielers Planänderung zu riechen.
Noch musste er das schmierige schwarze Öl auf der Haut mit einer Bürste abschmirgeln in der Sanitärflucht seiner Fabrik, einem kahlen Raum mit Duschkopfreihen. Jeden Tag versuchte er, seine Nachmittags- und Schichtendetoilette nach den anderen zu machen, um in der Nasszelle allein zu sein mit Deo und Kamm, am Schluss kurz mit Klopapier über die Schuhspitzen zu wischen und mit der Pilotensonnenbrille auf der Nase das Werksgelände unbemerkt und unbehelligt zu verlassen. Aber einer kam immer.
»Ach, der Wieler, will was werden. Wieler! Wie sieht’s aus? Schon eine Boss-Tochter angewärmt? Wie riechen die? Immer Chanel zwischen den Lippen?« Da lachten sie, im Kreis stehend, und Wieler stand dazu und lachte mit.
Ein Jahr darauf überreichte ihm der Meister das Blatt mit seinem Namen und der Überschrift »Urkunde«. Als der Vater den Sohn mit dem gerahmten Zeugnis des berühmten Zweiradherstellers durch die Haustüre kommen sah, nickte er in Richtung des Stammhalters, was weit mehr war, als er die Jahre zuvor an Anerkennung zu geben bereit war. Der junge Wieler, an homöopathische Dosen von Zuneigung gewöhnt, beendete schon ein Jahr darauf die Zeit der glänzenden Haut unter Schweißperlen. Er schrieb sich an der Hochschule zur quälenden Rechtslehre ein.
Der Vater sollte recht behalten mit seiner Auffassung eines »Studiums als Allzweckwaffe«: Obschon sein Abschluss viele Meilen von einem Summa-Lob entfernt war, ermöglichte er Wieler Wege, die seine Begabung nicht unbedingt vorgesehen hätte. Die Mutter und die Verwandtschaft gratulierten herzlich – er hatte die Formalanforderung bestanden. Wieler hatte gehofft, die letzte Wendung seines Lebens, das juristische Examen, dem harschen Erzeuger noch vorführen zu können in der Vorstadtstraße, die einmal sein Zuhause war. Doch der Vater war nicht mehr, und Wieler suchte sich alsbald eine Ersatzinstanz, die ihm streng und gut bedacht den Weg wies: seine Frau.
Dr. Kalbmayer, Halbleiter
Kalbmayer stand auch heute wieder oben am Fenster und amüsierte sich über Wielers Beuge. Wie in einer Prozession eilte die Chefin mit ihrem Tross in die Kantine gegenüber.
Wieler kam als letzter aus der Türe und musste sich deshalb ausnahmsweise wirklich etwas sputen. Mit fliegenden Jackettschößen, den Mantel über dem einen Arm, die braunen Aktenschober unter der Achsel des anderen, wieselte er hinterher.
Eine arme Wurst, dachte Kalbmayer – ein hoch gewachsener Mann mit Fuchsaugen und schmalen Lippen, der so schallend lachen konnte, dass es bis zur Pforte ein Stockwerk darunter zu hören war. Aber jetzt lachte er nicht, sondern zog die Augenbrauen in die Höhe. Wie kann ein Mann, nein, ein Mensch nur so servil sein? Irgendetwas machte ihn misstrauisch.
Kalbmayer war Jurist. Ein echter, betonte er bisweilen in den Sitzungen, was auf Neue in der Institution völlig unmotiviert gewirkt hätte, in den kleinen Zirkeln aber wusste jeder, worauf der gewiefte und in den schwarzen Jahren auf dem Hügel abgehärtete Kalbmayer anspielte. Nur einer wusste es nicht – einer, der im Fall der Fälle die Lage für sich entschärfte, indem er einfach mal die Mundwinkel zu einem Lächeln hochzog, dazu ein knappes Nicken, zuerst zu Kalbmayer, dann in alle Richtungen, als sei er der Schiedsrichter, der die Punktetafel hochhielt. Dieser eine war Wieler.
Kalbmayer war eine Institution im Hohen Haus nicht etwa, weil er mit den Paragrafen auf du und du stand, dafür war er gar nicht zuständig, sondern weil er eine ganze Batterie Chefs überlebt hatte und jeden Winkelzug der Beamten kannte, und selbst solche Manöver, die noch der Umsetzung harrten.
Sein Halbleiterkollege Eckstein trat aus seinem Büro mit einem Packen Unterlagen, darunter auch der schwarze Juristenwälzer mit einschlägigen Paragrafen aus dem öffentlichen Sektor. Er hätte ihn auch im Büro stehen lassen können neben dem Schönfelder und einer Batterie Gesetzesauslegungen durch das Bundesverfassungsgericht.
Es schien ihm jedoch angezeigt, die Papierstöße als sichtbare Argumentationshilfe dabei zu haben in dem Besprechungstermin bei der Vorgesetzten. Das schiere Volumen an Sekundärliteratur musste herhalten, Eindruck zu schinden, denn wieder einmal sollte es nicht darum gehen, was Recht ist, sondern, wer den Sieg davontragen würde.
Eckstein war willens, der Chefin die Flausen auszureden, zwei Mitarbeitern zu kündigen, weil sie auf der Website »Neger« geschrieben hatten, genauer: »Macht euch nicht zum Neger!«
Eckstein hatte die Rechtsauffassung in wenigen Minuten auf ein Blatt geschrieben, freie Meinungsäußerung, Artikel soundso, Satz 1, in Verbindung mit Artikel soundso. Rassismus greife nicht, weil der Begriff »Neger« eine Metapher und keine persönliche, schon gar keine gruppenbezogene Beleidigung darstelle.
»Wir kommen in Teufels Küche«, würde er seinen Kurzvortrag abschließen. Eckstein war gerüstet und bog in diesem Bewusstsein ab in den Flur, wo das Büro der Chefin lag.
Als er um die Ecke bog, stieß er mit Wieler zusammen, was ungewöhnlich war, denn Wieler erwartete die Vorgeladenen meist nur wenige Zentimeter neben der Chefin stehend.
»Na, läuft’s?«, versuchte Wieler den kleinen Schwatz, worauf Eckstein nicht weniger ambitioniert mit »muss ja« antwortete und man zusammen das Besprechungszimmer betrat.
Mehr mochte Eckstein nicht loswerden, denn seit Monaten hatte sich das Gerücht bis in den letzten Winkel der Postverteilungsstelle vorgearbeitet, Wieler trage alles Gesagte weiter zur Chefin, mehr noch, er berichte nicht etwa nur haarklein, sondern gebe unter Hinzufügen kleiner Beiwörter oder Nachsätze dem berichteten Inhalt jene Färbung, die den Zitierten nicht eben glanzvoll aussehen ließen.
Wieler, mit einem Wort, frisiere alles ihm Anvertraute auf derart perfide Weise, dass sich bei der Chefin langsam, aber sicher der Eindruck verdichtete, von einem wachsenden Heer Minderbegabter umgeben zu sein.
So kam es, dass sich die Kollegen auf den Fluren, in den Stuben, bei Sitzungen und auf den wenigen Festivitäten in »Soso« und »Ach, was« flüchteten, sobald sie Wielers Rockschoßes angesichtig wurden.
Herr und Frau Wieler
Zwanzig Jahre später war Wieler zwar noch immer ein Mensch, der in seinen gesetzten Grenzen lebte. Doch der Anzug, den er sich für den neuen Job zugelegt hatte, war erheblich an der Taille geschrumpft wie auf der anderen Seite sein Selbstbewusstsein Woche für Woche zu wachsen schien.
Ungezählte Abende hatte er mit seiner geliebten Frau am Küchentisch verbracht, der zum Reißbrett wurde für seinen Weg nach oben. Viele Male übermalten und radierten sie auf den Transparentpapieren der Planer, zogen mal mit grünem, mal mit rotem Stift mögliche Linien zum Ziel, und mit jeder Sitzung in der Küchenzentrale wuchs in Wieler die – vornehmlich von seiner Gattin vorangetriebene – Zuversicht, es vielleicht sogar bis ganz nach oben zu schaffen, wenn er es nur geschickt anstellte.
Des Nachts ertappte sich Wieler sogar bei dem einlullenden Gedanken, wie es wohl wäre, beim großen Vorsitzenden selbst ein warmes Stühlchen für seine berufliche Restlaufzeit zu ergattern.
Die Idee, bald auch tags geträumt, brachte ihn auf Trab. Mens sana …, ein bisschen Latein war hängengeblieben. Wieler trieb nun Sport, aß zu Mittag Salat mit Eiweißgabe und abends nichts mehr. Unter seinen Hemden, die auffallend dunkler und schmaler wurden, zeichnete sich nicht das kleinste Rund ab. Wieler trug nur mehr schwarze Modelle aus matt glänzendem Baumwollchintz, die Schuhe waren handgenäht. Die Anzüge hatten eine zweite Steppnaht am Revers, die speckige Aktentasche des alten Amtes wurde durch eine Henkeltasche aus Straußenleder ersetzt.
Seine neue Optik wurde in den Kaffeeecken der Institution bald als deutliches Zeichen einer Wesensveränderung diskutiert. Aber keine – es waren fast nur Frauen – konnte Konkretes anführen, vielmehr ergingen sich die Kolleginnen in dem typischen Mix aus Vermutung und anekdotischer Beweisführung.
»Sieht so aus, als hätte…«, sagte die eine. »Habt ihr gesehen …?«, die andere.
Doch in welcher Zusammensetzung man sich auch traf, es herrschte große Einigkeit, dass Wieler irgendetwas im Schilde führe. Die einen spekulierten ernsthaft, Wieler werde es mit seiner Besoldungsstufe nicht bewenden lassen. Andere machten sich einen Spaß daraus, in Anspielung auf das ehemalige Grandhotel im Schwarzwald zu spotten, bald sei »Wieler-Höhe« erklommen. Sie konnten ja nicht wissen, wie recht sie hatten.
Wie es dazu kam, ist nicht mehr nachvollziehbar, aber schon in den ersten Wochen erkundigte sich ein Journalist bei Rosalind Weller nach dem Werdegang Wielers, denn der nacheilende Schatten der Chefin fiel offenbar auf. Bald wurden die Gerüchte angereichert um Details, nach allem, was die vorliegenden Aufzeichnungen hergeben, gut möglich, dass Wieler sie selbst in die Welt setzte, jedenfalls wurde erzählt, es handle sich bei dem völlig unbekannten Neuzugang um einen von der Chefin speziell rekrutierten Fachmann fürs politische Säbelfechten, vielleicht sogar für Duelle mit dem Florett.
Er stamme aus der Hauptstadt, habe dort am Aufstieg eines gewissen Politikers mitgearbeitet, hieß es. Wieler verfüge über ein Riesennetzwerk, sei sogar bei Gerhard Schröder in der sogenannten Bier-und-Stumpen-Runde gesessen.
In Wahrheit wusste niemand etwas über den Beamtenneuzugang. Er war im politischen Zirkus der Landeshauptstadt unbekannt, was nichts heißen musste. Die Stadt war groß. Doch gerade, weil ihn niemand kannte und das politische Biotop doch sehr zu Geschwätzigkeit neigte, konnte jeder etwas anderes in seine Person hineingeheimnissen: Einer, der in einem anderen Gebäude untergebracht war und Wieler noch nie begegnet war, wollte erfahren haben, dass er mit dem großen Vorsitzenden ein Bier trinken gewesen sei in einer, naja, etwas zwielichtigen Pinte im Rotlichtviertel.
Sofort ging die Saga, er stehe ganz oben auf der Anwärterliste für ein Staatssekretärsposten oder gar ein Ministeramt, weil er von den Leichen im Keller des politischen Zwölfenders wisse und deshalb mit manchem zu drohen imstande war. Aber das vermuteten solche, die in den Mustern der alten Machtausübung dachten. Wer wollte es ihnen übelnehmen?
Eine andere, die ihn wenigstens einmal kurz gegrüßt hatte vor dem Fahrstuhl, berichtete von klugen Aufsätzen Wielers für das Magazin der Siegerstraßenpartei. Auch meinte sie von einem Intellektuellennetzwerk zu wissen, dem Wieler vorgestanden haben solle, eine Runde in Art der Literatengruppe 47. Wieder andere nannten ihn tatsächlich graue Eminenz und meinten damit keineswegs sein mit silbernen Fäden durchwirktes Haar. Kurz und gut: Wieler konnte rundum zufrieden sein.
Obwohl er kein anderer war wie der, den seine Frau im Studentenclub der Universität aus der Schüchternheit auf die Tanzfläche gezogen hatte, gab seine Person nach allen Seiten hin eine prima Projektionsfläche ab. Zwar gab es auch welche, denen Wieler nicht ganz geheuer vorkam und die ihrerseits früh Warnungen formulierten, man werde schon sehen, aber Genaues dann doch nicht benennen konnten. Ein Ort in der Bauchgegend sprach zum Zweifler. Dann wieder: Vielleicht täusche ich mich. Nur Wieler selbst wusste, wie wenig an den Ausdeutungen wahr war.
Hinweise auf den Menschen im Beamten fanden sich spärlich. Aber es gab ihn, den privaten Wieler. Ein paar Freunde waren aus der Schulzeit, andere aus dem Studium in seinem Dunstkreis hängengeblieben, allesamt weit weg von Politik und Amtsstuben. Es waren honorige Menschen, die ihr Urteil allerdings bevorzugt aus eigenem Erleben und Vorurteil speisten. Nicht wenige von ihnen hielten auf Festen beschwipste Schmähreden auf die fehleranfälligen Gestalter des Staatswesens, gern auch über die Krötentunnelprediger der Siegerstraßenpartei, die – so dröhnte einmal ein Bauingenieur aus Wielers Clique – »uns demnächst sicher auch noch das Furzen verbieten ohne CO2-Filter«.
Wieler war umgeben von Menschen, die immer eine Meinung hatten, sich aber der Mühe verschlossen, auch nur eine Zeile über den Sachverhalt zu diesem oder jenem Thema zu lesen. Das war, bevor Wieler seine Zuneigung zur Siegerstraßenpartei entdeckte und die Person fand, die ihm den Marsch durch die Institutionen ersparen konnte.
Wenn in den privaten Runden hergezogen wurde über die Stadtplaner, über die Politiker, über Abgase, Traktordiesel und allgemeine Unfähigkeit einer als amorph begriffenen Masse in Behörden und Ämtern, staunte Wieler über die meinungsstarken Weggefährten. Sie galten ihm als Bestätigung eines gelingenden Lebens. Wenn es hoch her ging, hoffte er, etwas von deren Beherztheit und der Fähigkeit zur pointierten Darstellung abzubekommen. Aber nie hätte er selbst sich so weit aus dem Fenster gelehnt, mit einer eigenen Meinung womöglich auch mal dagegenzuhalten.
Seine Einlassungen verließen selten das Terrain des Allgemeinen, waren mal auf das Wetter, mal auf das Essen bezogen, sodass sie im Moment des Aussprechens bereits ohne Nachhall verpufften. Von den Teilnehmern der gemütlichen Runden würde sich keiner auch nur an ein – es wurde vielleicht schon erwähnt – einziges inspirierendes Wort Wielers erinnern können, das ein Gespräch in Gang gebracht oder gar einen Reigen leidenschaftlicher Bekenntnisse ausgelöst hätte. Gleichwohl erfreute sich Wieler einer gewissen Beliebtheit.
Der Grund war den Gästen mindestens so viel wert wie ein zündender Gedanke: Wieler konnte an solchen Abenden seiner Neigung als Mundschenk nachgehen, eilte von Glas zu Glas, transportierte die Biere und das Wasser an den Tisch, goss Weine in die Kelche. Manchem fiel auf, wie sehr das Dienende seine zweite Haut war, wie Wieler aufging im Holen und Bringen: Noch Erdnüsse oder einen doppelten Verkürzten? Den Rest besprachen sie mit seiner Frau.
Seit Wieler mit rundem Rückenbogen hinter der Hoffnungsträgerin herrannte, verkniffen sich die Freunde ihre Wutbürgersprüche, sie wollten – man wusste ja nie – in nichts hineinkommen, denn im Amt mochte er der scheue Lächler sein und sich nie auf eine Haltung festlegen lassen, die Bekannten vermochte er durchaus zu beeindrucken durch ein, zwei Nennungen von Namen, mit denen er nun durch seine Stellung in der Institution verkehrte.
Und nicht nur sie. Sogar seine Frau fiel jedes Mal, sobald ihr Mann einen illustren Namen fallenließ, eine kribbelnde Erregung an und sie träumte sich weg: In ihr stiegen dann Bilder vom Leben an der Seite der Reichen und Mächtigen auf wie kleine Baiserwolken, von denen sie in ihren Tagträumen anfangs wie ein Mäuschen mit den Schneidezähnen kleinste Stückchen Zukunft abknabberte, schließlich aber immer größere Stücke herausriss und mit dem Ausdruck größter Zufriedenheit am Auxerrois nippte.
Ihre Bekannten bekamen davon nichts mit. Sie strebten nicht mehr, sie hatten schon. Der Freundeskreis der Wielers hatte sich über die Jahre zu einem stabilen, engmaschigen Gewebe der Möglichkeiten geflochten.
Wie sein Notizbuch Schwarz auf Weiß belegt, bevorzugten die Wielers solche, die materiell gut gebettet waren und etwas anzubieten hatten. Im Wesentlichen Frau Wieler hatte – das war im Hohen Haus weitgehend unbekannt – die unentgeltliche Zweitverwertung des Eigentums anderer schon früh zur Perfektion gebracht. Hier ein Wochenende in der Jagdhütte von Jugendfreunden, zu denen das Paar über die Jahre absichtsvoll Kontakt gehalten hatte, dort ein Chalet im Elsass von neuen Bekannten.
Im Portfolio fehlte nur noch eine attraktive Großstadtresidenz. Wieler und seine Frau drängte es, selbst etwas anbieten zu können. Mit dem Wechsel ins Hohe Haus erreichten die verblüfften Freunde plötzlich Gratiseinladungen in die Institution oder in die Regierungsburg. Es schadet nie, einen zu kennen, der einen kennt. So ist es ja angelegt in unserem Land. Wieler jedenfalls kam montags gut gelaunt in die Besprechungen.
Wenn die höheren Dienstränge Sätze wie »Wir waren in Berchtesgaden bei Freunden« oder »Es war schön in Düsseldorf!« fallen ließen, konnte das vielleicht im Heer der Niederen Neid und Bewunderung hervorrufen, nicht so bei Wieler, der nach einem langen Wochenende strahlenden Gesichts mithalten konnte.
Wer ihn nur oberflächlich kannte, musste annehmen, die Wielers seien umgeben von Schönen und Reichen. Ja, doller: als buhlten die Schönen und Reichen geradezu um die Gesellschaft der Wielers. Ein Glückspilz, dachten manche Kollegen dann. Wie macht der das nur?
Der Beamte Wieler
Auf seiner letzten Stelle in der unteren Regionalbehörde war Wieler wenig aufgefallen, was beinahe untertrieben scheint. In Wahrheit blieb er fast unsichtbar. Wann immer einer einen Platz in der Hierarchie freimachte: Wieler stand nicht zur Debatte.
Für den schon gärend lange vakanten Posten des Viertelleiters nicht, auch nicht für den des Halbleiters, schon gar nicht für die Stelle des Oberleiters. Wäre ein Beobachter beauftragt worden, gegen Geld die Entwicklung zu betrachten und alles haarklein niederzuschreiben, hätte er melden müssen, die Karrierebewegungen seien nach den Regeln eines jeden Amtes im Land, wonach die Herren und Damen Beamten nur eine Weile sitzen mussten, um wieder einen Stuhl höher gesetzt zu werden und wieder ein paar Taler mehr zu bekommen.
Es sei nachgerade unverständlich, geradezu mysteriös, wie um Wieler herum eine Art Beförderungsbannmeile gezogen worden sei, hätte der Beobachter erstaunt zu Protokoll gegeben. Natürlich handle es sich offenbar um einen nicht sichtbaren, eher um einen gläsernen Zaun, der es nicht erlaube, Wielers Stuhl auch nur einen Zentimeter zu verrücken. Ja, mehr noch, es scheine dem Beobachter, der Beamte werde bewusst übersehen für höhere Weihen, obwohl er seine Aufgaben, nach allem, was der Ämterbeobachter kenne, sehr passabel erledige. Die Kladde Wieler wäre von ihm, hätte er einen Auftrag gehabt, geschlossen worden mit einem Fragezeichen.
So war es um Wielers Fortkommen im alten Regionalamt gestanden: Es war ein Auf-der-Stelle-treten. Wieler erledigte die Dinge ordentlich, aber in gemäßigter Eile. Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, ein Mittagessen zu verschieben, weil die Akte Bauernfeind oder der Fall Moser, nur zum Beispiel, der Fertigstellung harrte. Sprachlich konnte er zudem keine Sprünge machen. Wer seine Akten auf Fehler hin las, das traf meistens seine nur zur Hälfte für ihn tätige Vorzimmerfrau, gab häufig schon nach der dritten Seite seinem Drang zu gähnen hemmungslos nach. Die Sätze verloren sich in schöner Regelmäßigkeit in einer Anhäufung behördlich genormter Substantive, die von Wieler nie, auch nicht ein einziges Mal, durch leichtfällige Wörter umkränzt worden wären, einfach nur um des Gefallens willen.
Nein, auch ein Romancier war an Wieler nicht verloren gegangen. Aber das störte nicht nur niemanden in seinem alten Amt, es war vielen gerade recht. Da trat einer auf der Stelle wie die Winzerin im Traubenfass – der war keine Gefahr. In schleppender Regelmäßigkeit wurde er mit ein oder zwei Dienstreisen ans andere Ende der Republik belohnt. So interpretierte Wieler die Gaben von oben. Die geschenkten Bahnfahrkarten und Hotelübernachtungen fütterten in ihm die Gewissheit, dass die Superleiter schon noch auf ihn schauen würden, ihn auserwählen würden für eine herausragende Position. Hatte er nicht die Hotelbuchung als deutlichen Hinweis?
Nie durchschaute Wieler, dass Bonusgaben, wie er sie erhielt, nicht wenigen seiner Kollegen – zwei allein in seinem Flur – ebenfalls zugestanden wurden.
In der staubigen Hierarchienschmiede waren Brot und Spiele angesagt. Um alle Münder feucht zu halten, aber nicht allzu durstig werden zu lassen, hielten die Oberoberleiter nasse, mit Versprechungen getränkte Schwämme vor die Ausgedörrten, die ihre Hände nach einer Beförderung wie nach einem Wasserloch in der Wüste ausstreckten.





























