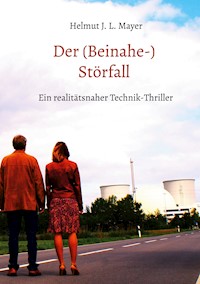
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein Roman, in dem die Menschen in einem Kernkraftwerk einer höchst kritischen Situation ausgesetzt werden, eine Situation, die wie ein Brennglas in der glühenden Sonne wirkt und die Gefühle aufheizt, wodurch Spannungen und Verstrickungen verschärft werden und sich die Charaktere der Protagonisten offenbaren. Dies ist aber auch ein Roman, dessen Hintergrund-Szenario im realen Leben die deutsche Nuklearcommunity über Jahre intensiv beschäftigt hat. Der Störfallablauf wurde erstmals im von Helmut J. L. Mayer 2012 veröffentlichten Roman "Der Störfall" technisch beschrieben und anschließend ausgiebig von vielen Institutionen und Nuklearexperten untersucht und diskutiert, ohne eine abschließende, einfache Lösung zu finden, die dem Kerntechnischen Regelwerk gerecht werden konnte. Die neuen Erkenntnisse brachten die für die nukleare Sicherheit Verantwortlichen in arge Bedrängnis: Ein bisher nicht bekannter Störfallablauf? Mit einer relativ hohen Eintrittswahrscheinlichkeit? Und im Extremfall mit gewaltigen Auswirkungen? Also mit einem hohen nuklearen Risiko, denn Risiko ist die Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit mit den möglichen Auswirkungen. Zu dem technischen Ablauf dieses Romans wurden ausgiebige Analysen und Tests in Versuchsreaktoren durchgeführt. Viele Institutionen und Experten waren mit dem Thema beschäftigt: BMUB, RSK, RSK-AST, GRS, ISR, INRAG, IAEA, BfA, ROCOM, HZDR, Ökoinstitut, DER SPIEGEL und andere. Auch wurde hierzu von Katrin Göring-Eckhardt, Dr. Anton Hofreiter, Annalena Baerbock, Steffi Lemke und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Regina, Ralf, Anke, Jan und Mark
INHALT
Anmerkungen
Der Autor
Vorwort
Prinzipskizze der Räume und Systeme
DER STÖRFALL
ANBAHNUNG
KLEINER GAU
EPILOG
ANHANG
5.1 Zusammenfassung des Störfalls Dampferzeuger-Heizrohrleck (DEHL) mit Zusatzstörung
5.2 Literaturverzeichnis (Auszug)
Anmerkungen des Autors
Dies ist ein Roman,
in dem die Menschen in einem Kernkraftwerk einer höchst kritischen Situation ausgesetzt werden, einer Situation, die wie ein Brennglas in der glühenden Sonne wirkt und die Gefühle aufheizt, wodurch Spannungen und Verstrickungen verschärft werden und sich die Charaktere der Protagonisten offenbaren.
Dies ist aber auch ein Roman,
dessen Hintergrund-Szenario in der realen Welt die deutsche Nuklearcommunity über Jahre intensiv beschäftigt hat. Der Störfallverlauf wurde erstmals in meinem 2012 veröffentlichten Roman „Der Störfall“ technisch beschrieben und anschließend über mehrere Jahre ausgiebig von vielen Institutionen und Nuklearexperten untersucht und diskutiert, ohne eine abschließende, einfache Lösung zu finden, die dem Kerntechnischen Regelwerk gerecht werden würde.
Wer sich ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen und seine Kenntnisse vertiefen möchte, der sei auf die gemeinverständlich formulierte Zusammenfassung und das Literaturverzeichnis im Anhang verwiesen.
Die neuen Erkenntnisse brachte die für die nukleare Sicherheit verantwortlichen Behörden - verständlicherweise - in arge Bedrängnis: Ein bisher nicht bekannter Störfallablauf? Mit einer relativ hohen Eintrittswahrscheinlichkeit? Und im Extremfall gewaltigen Auswirkungen? Also mit einem sehr hohen Risiko, denn: „Risiko ist die Multiplikation der Eintrittswahrscheinlichkeit mit den möglichen Auswirkungen.“
Die hohe Eintrittswahrscheinlichkeit eines Heizrohrbruchs ist unbestreitbar. Ein deutscher Druckwasserreaktor ist im Primärkreislauf mit ca. 16.000 Heizrohren bestückt, die in der Praxis enormen Wanddickenschwächungen durch Korrosion und Erosion unterliegen und in verschiedenen Kernkraftwerken auch bereits Leckagen aufgewiesen haben.
Ebenfalls unbestreitbar sind die möglichen Auswirkungen, wenn nicht aufboriertes Deionat konzentriert in den Reaktorkern eindringt. Dies kann zu einem unkontrollierbaren Anstieg der Reaktivität und infolgedessen zu einer nuklearen Leistungsexkursion führen, die technisch nicht mehr gemäß dem nuklearen Regelwerk zu beherrschen ist.
Zu dem technischen Ablauf dieses Romans wurden ausgiebige Analysen und Tests in Versuchsreaktoren durchgeführt. Viele Institutionen und Experten waren mehrere Jahre mit dem Thema beschäftigt: BMUB, RSK, RSK-AST, GRS, ISR, INRAG, IAEA, BfA, ROCOM, HZDR, Ökoinstitut, DER SPIEGEL, BUND und andere. Auch wurde hierzu von Katrin Göring-Eckhardt, Dr. Anton Hofreiter, Annalena Baerbock, Steffi Lemke und der Fraktion der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine ‚Kleine Anfrage‘ an die Regierung gestellt. (Siehe Literaturverzeichnis im Anhang).
Helmut J. L. Mayer
Der Autor
Dipl.-Ing. Helmut Jakob Leonhard Mayer arbeitete lange Jahre im Kernkraftwerk Biblis unter anderem auf den Gebieten Störfallanalysen, Erstellung von Betriebshandbüchern, Ausbildung der Reaktoroperateure, Simulator-Training und andere Sonderaufgaben. Später wurde ihm die Verantwortung für den Betrieb des Blockes B übertragen. Vom Bundesminister für Forschung und Technologie war er als deutscher Sachverständiger zur Mitarbeit bei der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien berufen worden, die die weltweit ersten Richtlinien zur Störfallbehandlungen in Kernkraftwerken erstellte. Er war Dozent an der Schule für Kerntechnik in Karlsruhe und Lehrbeauftragter für Kraftwerkstechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.
Den vorliegenden Roman schrieb er aus Lust am Schreiben über Menschen in extremen Stresssituationen. Zugleich nutzte er die Möglichkeit, den bis dahin unbekannten Störfallverlauf ‚Dampferzeuger-Heizrohrleck mit Zusatzstörungen‘ für sich selbst zu verarbeiten und sowohl den Kernkraftwerksexperten als auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Vorwort
Dieser Roman erzählt eine fiktive Geschichte von Menschen in einem Kernkraftwerk und ihrem Umfeld, ihrem Umgang miteinander und gegeneinander, ihren Machenschaften, ihren Problemen und Gefühlen.
Die technischen Anlagen und Verfahren sind sehr realitätsnah beschrieben und auch die dargestellte Aufbau-Organisation entspricht weitgehend den tatsächlich bestehenden Strukturen. Der beschriebene Störfall einschließlich der Risikobetrachtung und des möglichen Ablaufs sind, wie aus dem Literaturverzeichnis (hier nur ein kleiner Auszug) zu erkennen ist, sehr realitätsnah ausgearbeitet.
Im Gegensatz dazu sind sowohl die Charaktere wie auch die Menschen und ihre Verhaltensweisen rein fiktiv und nur der Fantasie des Autors entsprungen. Alle Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
1. DER STÖRFALL
MONTAGMORGEN, 8. November 1993
Zweifellos war es die wichtigste und unruhigste Nacht seines Lebens, vom Sonntag auf Montagmorgen, 8. November 1993. Seine Gedanken geisterten durch die letzten Wochen wie durch einen nebligen Irrgarten, dessen Ausgang ihm noch für viele Stunden verhüllt bleiben würde. Corinne schlief neben ihm offenbar in tiefer Behaglichkeit mit ruhigen, gleichmäßigen Atemzügen, die trotz der Stille der Nacht kaum zu hören waren. Die Zeit verging unglaublich zäh und langsam. Das Bild von Salvador Dalis weichen Uhren schwirrte in seinem Kopf und schien ihn zu verspotten.
Den Anruf aus dem Kraftwerk erwartete er um etwa 06:00 Uhr, aber spätestens um 06:15 Uhr, wenn Gebhardt die Schicht von Rapolter übernommen haben würde. Er kannte seine direkten Mitarbeiter. Gebhardt würde sich sofort absichern wollen und seinen Vorgesetzten ‚unverzüglich‘ informieren, wie es die Vorschrift forderte.
Vorsichtig und leise drehte er sich zur Seite und griff nach seinem Wecker. Es war ein Designer-Modell, das ihm Karin vor einigen Jahren geschenkt hatte, ein kleiner schwarzer Kasten, auf allen sechs Seiten nahezu identisch außer den unauffälligen Bedienungselementen auf der Rückseite. Seine Ziffern konnten durch ein lautes Geräusch oder durch eine Berührung zum Aufleuchten gebracht werden. Kurz verharrte seine ausgestreckte Hand über dem Wecker, vorher wollte er überlegen, ob er richtig lag mit seiner Abschätzung der Uhrzeit. Er vermutete etwa 03:00 Uhr. Als er den Wecker berührte, strahlten die Ziffern mit 01:03 Uhr auf und erhellten das Zimmer für zehn lange Sekunden, bevor sie wieder in schwarzer Nacht erstarben. Grausam! Noch mindestens fünf Stunden! Corinne atmete leise und gleichmäßig neben ihm, ihre Kontur war nur schemenhaft zu erahnen.
Seine Gedanken schweiften im Dämmerzustand ab und sprangen unkontrollierbar von einem Ereignis der letzten Monate zum nächsten. Seine ehemals ach so solide Welt und seine Lebensstrategie waren ihm entglitten und existierten nicht mehr.
'Stabile Dreibein-Strategie': Familie – Beruf – Hobby.
Das war ihm vom Maschinenbau-Studium in Erinnerung geblieben: Nur ein Tisch mit drei Beinen steht immer stabil. Er wackelt nie. Aber nach seinem vierzigsten Geburtstag vor etwa zwei Monaten konnte er es vor sich selbst nicht mehr verleugnen: Seine drei Standbeine waren weich geworden und schließlich eingeknickt, alle drei. Zuerst sein Hobby als gefragter Abwehrspieler seines Fußballvereins FC 07 Bensheim. Gute Abwehrspieler waren beliebt, denn dann konnten sich die Mitspieler im Angriff beim Toreschießen profilieren, während er in der Abwehr nur negativ auffiel, wenn er Gegentore nicht zu verhindern vermochte. Doch mit zweiunddreißig Jahren war er zu langsam für die gegnerischen, jungen Stürmer geworden.
Die Grübeleien an sein gescheitertes, ehemals wichtigstes Standbein, mit Karin eine Familie mit Kindern zu gründen, belastete ihn jetzt zu sehr und er zwang seine Gedanken zu dem aktuellen Problem zurück.
Ob noch etwas schiefgehen konnte? Wie immer hatte er nach seinem Selbstverständnis als Ingenieur alle Vor- und Nachteile sowie Chancen und Risiken logisch durchdacht. Allerdings konnte er die Situations- und Entscheidungsanalysen wegen des Zeitdruckes nur theoretisch im Kopf und nicht wie üblich in einem Excel-Sheet konsequent schriftlich ausführen. Unerheblich, die Entscheidung war gefallen. Es ist befreiend, wenn die Entscheidung gefallen ist.
Jetzt sah er seinen Lebensweg klar vor sich, kurz-, mittel- und langfristig. Und er hielt alle Trümpfe in der Hand, das war beruhigend. In der kommenden Woche würde er kündigen, sich einen neuen Job außerhalb der Nuklearcommunity suchen und ein normales und glückliches Leben führen, da war er sich ganz sicher.
Die Oberbosse Eicher und Scheidecker würden das automatische Herunterfahren des Kernkraftwerkes nicht mehr verhindern können. Zu raffiniert hatte er seine Eingriffe vor Ort an den nuklearen Systemen manipuliert. Während des erzwungenen Stillstandes konnten die notwendigen Reparaturen und technischen Änderungen durchgeführt werden. Das Abschalten und die damit verbundenen Kosten von schätzungsweise dreißig Millionen D-Mark würden Eicher und Scheidecker gegenüber dem Vorstand als ‚störungsbedingt‘ gut verkaufen können, und um diese Argumentation nicht zu gefährden, würden sie ihm, Martin Gravenhoff, keine Steine in den Weg legen, sondern ihn geradezu gerne mit einem sehr guten Zeugnis und einer angemessenen Abfindung ziehen lassen.
Seine Fußballfreunde würden ihn für verrückt erklären, aber sie mussten es nicht verstehen. Er zwang seine Gedanken weg von den beunruhigenden Geschehnissen im Kraftwerk hin zu dem regelmäßigen und unaufgeregten Kicken mit seiner Altherrenmannschaft des FC07 Bensheim, um mit diesen langweiligen Gedanken endlich Ruhe und vielleicht doch noch etwas Schlaf zu finden. Doch es war aussichtslos. Fußballspielen mag zwar die schönste Nebensache der Welt sein, aber es war zu unbedeutend, um sich in dieser Nacht ablenken zu können. Vielleicht sollte er Schlaftabletten nehmen? Noch nie hatte er welche benötigt, doch das Risiko war zu groß. Er wusste nicht, wie sie auf ihn wirken würden, und während des kommenden Arbeitstages musste er hellwach sein. Das Leben konnte so kompliziert sein, aber auch so wunderbar. Er war Gott dankbar für sein bisheriges Leben und all das, was gewesen war, und für die Lösung, die er gefunden hatte, und für das, was er sich von der Zukunft abseits der Nuklearindustrie erwartete.
Er war dankbar, dass er dankbar sein durfte.
Auch im Kraftwerk und mit seinen Leuten würde alles gut werden. Sicher war niemandem aufgefallen, dass er am Samstagnachmittag in den Sicherheitsbereich seines eigenen Kraftwerks unerkannt eingedrungen war. Nannte er es noch ‚sein eigenes Kraftwerk‘? Der Zugangsrechner hatte ihn natürlich erfasst, aber das konnte kein Problem werden. Niemand würde ohne Anlass das Zugangsprotokoll kontrollieren. Außerdem war es üblich, dass Manager manchmal auch samstags in ihr Büro kamen, und das Eindringen in den inneren Sicherheitsbereich hatte ganz bestimmt kein Mensch und auch keine der vielen Überwachungskameras mitbekommen, schließlich kannte er seinen Kraftwerksblock wie sonst keiner.
Auch seine Manipulationen an den Ventilkombinationen des Volumenregelsystems konnten weder das Personal noch die Meldesysteme bemerkt haben, denn sonntags ging niemand freiwillig bis in das Innere des radioaktiven Anlagenbereichs. Er war sich sicher, die Endschalter der Ventile, die die Stellung der Armaturen in die Zentralwarte signalisierten, vor Ort sorgfältig in ihrer ursprünglichen Stellung festgeklemmt und zusätzlich festgeklebt zu haben, bevor er die Absperrventile umgestellt hatte. Somit konnte auch der Überwachungscomputer die Veränderungen nicht bemerken. Kurzzeitig durchzuckten ihn Bedenken, weil durch seine Aktion nur die Hälfte der Nachspeisemenge des Volumenregelsystems zur Verfügung stand, doch das sollte bei dem stationären Betrieb während des Wochenendes keine Auswirkungen haben.
Er dachte an seine Schichtmannschaft, insgesamt sieben Männer, die jetzt in tiefster Montagnacht im Kraftwerk ihren Dienst taten. Und er dachte an die Zeit, während der er selbst noch die endlos erscheinenden, aber lukrativen Nachtschichten bewältigen musste, in denen nur überwachende Routinetätigkeiten anstanden, die ermüdend und langweilig waren. Er erinnerte sich an seine vergeblichen Versuche, sich in diesen öden Nächten weiterzubilden und die Zeit bis zur Ablösung irgendwie totzuschlagen.
Konnte man Zeit totschlagen?
DER ANRUF
Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Überlegungen. Schlaftrunken tastete er nach dem Wecker: 04:22 Uhr. Das schreckte ihn auf, denn das war früher als er erwartet hatte, viel früher, viel zu früh! Hecktisch beugte er sich weit nach der anderen Seite über den Körper neben ihm und grapschte nach dem Telefonhörer. „Gravenhoff.“
Rapolter war am Apparat. Seine Stimme bebte. „Guten Morgen Herr Gravenhoff! Entschuldigen Sie bitte die Belästigung um diese frühe Zeit. Es lässt sich leider nicht vermeiden. Wir haben eine größere Störung. Schnellabschaltung. Außerdem steht die ganze Kette der Notkühlsignale an. Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber vielleicht sollten Sie kommen. Im Moment versuchen wir, den Anlagenzustand zu stabilisieren.“
„Notkühlsignale? Wieso Notkühlsignale?“ Das war eine idiotische Frage, aber diese Signale hatte Martin Gravenhoff nicht erwartet, absolut nicht. Eine kleine Betriebsstörung hatte er geplant. Eine derzeit noch unerklärliche, aber harmlose Einspeisung von zu viel neutronenabsorbierender Borsäure sollte ein langsames Abfahren der Anlage verursachen, gewissermaßen ein sanftes Einschlafen des Reaktors, aber das durfte keine automatische Schnellabschaltung mit Notkühlung zur Folge haben. Er würgte etwas hinunter, das plötzlich in seiner Speiseröhre hochgestiegen war und ihm Probleme beim Sprechen bereitete. „Gibt…, äh, gibt es Besonderheiten an Dampferzeuger 4?“
„An Dampferzeuger 4? Nein. Da ist uns nichts aufgefallen.“
„Der Druck in Dampferzeuger 4, was ist damit?“
„Äh, ja, ganz normal! Auch die anderen Betriebswerte. Deswegen sind die Notkühlsignale unverständlich. Aber wir haben die Anlage noch nicht vollständig durchgecheckt. Für eine sichere Aussage ist es noch zu früh. Der Anlagenzustand ist noch nicht stabil! Vielleicht sollten Sie kommen?“
Gravenhoff ignorierte Rapolters Ungeduld: „Kontrollieren Sie Dampferzeuger 4 noch einmal! Bevor Sie auflegen! Besonders die Druckanzeigen!“
Der Hörer auf der anderen Seite wurde hart auf einem Gegenstand geknallt. Während Gravenhoff wartete, hatte er Zeit, gegen seine Übelkeit und Schlaftrunkenheit anzukämpfen. Der Körper unter ihm bewegte sich und grummelte ärgerlich etwas Unverständliches. Ein Ellbogen bohrte sich in seinen Magen und drückte das Eklige in seiner Speiseröhre noch weiter nach oben bis zu seinen Geschmacksnerven. Er hatte ein Gefühl, als wühle sich ein Maulwurf aus seinem Magen durch die Speiseröhre und verstopfe ihm die Kehle.
Ihm war übel. Nicht nur körperlich. Er drückte den Hörer fest an sein Ohr und konnte dennoch nur leise und undeutliche Wortfetzen aus dem Hintergrund der Zentralwarte seines Kraftwerks vernehmen. „… normal … Zusammenbrechen der Dampfblasen … HD-Red weit offen …“ Kurze Zeit später näherte sich Rapolters hektische Kommandostimme wieder dem abgelegten Telefonhörer in der Steuerungszentrale, und seine Anweisungen an sein Personal wurde trotz der Hintergrundgeräusche verständlich. „Nein, vorerst keinerlei Handmaßnahmen! Erstmal alles den Automatiken überlassen! Alles exakt nach Betriebshandbuch, nur kontrollieren!“
Dann sprach Rapolter wieder in das Telefon. „Herr Gravenhoff, hören Sie? Wie gesagt: Am Dampferzeuger 4 ist alles in Ordnung! Auch der Druck.“
„Radioaktivität? Und der Reaktor, was macht der Reaktor? Ist er sicher unterkritisch?“ Gravenhoff ärgerte sich über die erkennbare Schwäche seiner Stimme und seine unqualifizierte Fragerei.
Rapolter antwortete genervt: „Alle Schutzziele werden eingehalten. Der Reaktor ist unterkritisch. Keine Aktivitätsfreisetzung. Die Abschaltstäbe sind alle drin. Füllstände und Drücke sind auf normalen Werten, den Umständen entsprechend, nur eben leicht abgesunken. Wegen der Abkühltransiente nach dem Abschalten. In diesem Fall ist das normal. Aber der Zustand ist noch nicht stabil. Und die Ursache ist natürlich noch nicht geklärt. Deshalb sollten Sie vielleicht kommen.“
„Haben Sie den Krisenstab alarmiert?“
„Den Krisenstab? Nein, so viel Zeit habe ich jetzt nicht!“
„Sie haben doch den automatischen Alarmruf! Das kostet Sie nur einen Knopfdruck und dann macht das der Computer für Sie!“
„Wir brauchen keinen Krisenstab! Es ist bestimmt doch nur wieder eine dieser blöden Fehlanregungen. Aber Sie sollten vielleicht kommen. Als wir die Leistung wie von Ihnen vorgegeben anheben wollten, ist uns aus irgendeinem Grund der Druckhalterfüllstand zu weit abgesackt und hat das Reaktorschutzsystem angeregt. Kann ja sein, dass Purkert am Reaktorpult noch etwas verschlafen war! Der ist ziemlich neu in meiner Schicht und hat das noch nicht im Griff. Der hat noch nicht die Erfahrung. Wenn es wieder nur eine Fehlanregung ist, kann ich doch keinen Krisenstab alarmieren! Schon gar nicht um diese Zeit!“ Rapolter unterbrach sich kurz und fuhr dann fragend fort: „Es sei denn, Sie geben mir die Anweisung dazu? Dann mache ich das natürlich. Auf Ihre Verantwortung! Aber die würden jetzt nur stören. Das kennen wir doch von früheren Situationen!“
Gravenhoff holte tief Luft. Er wollte aufatmen, aber er erzeugte nur ein Stöhnen und das verstärkte seine Übelkeit. Der Körper halb unter ihm bewegte sich wieder und bohrte den Ellbogen noch stärker in seine Magengrube. Gravenhoff schloss die Augen, sammelte Spucke, schluckte sie herunter und versuchte, sich zu beruhigen: „Meinetwegen auch ohne Krisenstab, aber informieren Sie wenigstens Eicher, unbedingt! Ich bin gleich da.“
Er legte den Hörer auf. Das Sprechen war ihm schwergefallen. Schlaftrunkene Benommenheit, der Ellbogen im Magen, das eklige Gefühl in der Kehle und eine nicht erklärbare Last auf seiner Brust hatten ihm die Luft zum Atmen genommen. Es war anders eingetreten als er geplant hatte, aber Fehlanregungen mit Schnellabschaltungen konnten in einer so komplexen und auf Sicherheit ausgelegten Anlage durchaus vorkommen.
Vorsichtig kroch er über den Körper unter ihm und tastete im Dunkeln auf dem Nachttisch nach seiner Brille. „Ich muss ins Kraftwerk, wir haben eine Störung.“
Diesmal verstand er Corinnes schläfrige Stimme: „Jetzt, um diese Zeit? Du hast doch höchstens vier Stunden geschlafen!“
„So was passiert immer montagsmorgens. Wegen der Leistungssteigerung“, murmelte er, aber das würde sie jetzt nicht verstehen können, und für Erklärungen hatte er keine Zeit. Beim Aufstehen trat er auf einen Schuh mit Stöckelabsatz. Sein Fuß knickte um und erzeugte einen heftigen Schmerz im Fußgelenk. Als er sich im Dunkeln um das Bett herumtastete, bemerkte er die Schwäche in seinen Knien. Halt suchend stützte er sich am Fensterbrett und dann an der Schrankwand ab und tapste aus dem Schlafzimmer. Im Bad hielt er den Kopf unter den Wasserhahn und wühlte in seinen Haaren, bis sie durchtränkt waren. Einige wenige Minuten nahm er sich Zeit zum Föhnen, denn im Kraftwerk durfte er keinen verwirrten Eindruck mit zerzausten Haaren erzeugen.
Um Normalität beim Schichtpersonal auszustrahlen, zog er wie im normalen Berufsalltag seine sportlichen schwarzen Nobel-Jeans, ein hellgraues Hemd und eine dunkelgraue Jacke an. Auf eine Krawatte verzichtete er. Als er aus seinem Wohnblock hinaus auf den Berliner Ring trat, um zu seinem am Straßenrand geparkten Wagen zu gehen, empfing ihn ein unangenehmer Nieselregen in der novemberkalten Morgendämmerung, der ihm die Brille beschlug und ihm die Sicht auf die nassglänzende Straße erschwerte.
Auf der Strecke von Bensheim nach Biblis, die er schon so oft gefahren war, versuchte er, sich auf die Situation im Kraftwerk vorzubereiten. Er überlegte, ob seine Veränderungen der Ventilstellungen irgendwelche Auswirkungen auf den unerwarteten Störungsverlauf gehabt haben könnten.
„So was passiert immer montagsmorgens. Wegen der Leistungssteigerung“, hatte er zu Corinne gesagt. Ihm fiel ein, dass er vergessen hatte, sich von ihr zu verabschieden. Vielleicht würde er es ihr später einmal erklären können.
Montagmorgens, wenn die ersten Facharbeiter in den Fabrikhallen die Lichterbahnen anschalten, die großen Elektromotoren starten und die Produktionsanlagen für den Betriebsbeginn der Frühschichten aufheizen, steigt der Strombedarf drastisch an. Strom kann praktisch nicht gespeichert werden. Selbst in Batterien ist kein Strom, sondern chemische Energie enthalten, die bei Anforderung in Strom umgewandelt wird. Deshalb muss Strom in dem Moment erzeugt werden, in dem er verbraucht wird. Montagsmorgens wird Strom in besonders großen Mengen aus dem Netz entzogen. Die fehlende Energie wird vorübergehend aus den Schwungmassen der angeschlossenen Maschinen entnommen, die Motoren und Generatoren laufen kurzzeitig minimal langsamer und die Frequenz sinkt ab: 50,05 Hertz, 50,03 Hertz, 50,02 Hertz. Die für die Frequenzstützung zuständigen Kraftwerke registrieren das abfallende Signal und steigern automatisch die Stromproduktion. Kurze Zeit später erhalten die an der Sekundärregelung beteiligten Kraftwerke von der Netzleitzentrale die Anweisung zur Leistungssteigerung und drücken den fehlenden Strom zusätzlich in das Netz.
Martin Gravenhoffs Kraftwerk hatte die Anweisung, ab vier Uhr morgens die Stromproduktion von dem Halblastbetrieb am Wochenende bis auf 96 % seiner maximalen Leistung anzuheben. Die restlichen 4 % sollten zur Ausregelung von Lastschwankungen vorgehalten werden. Durch die Laststeigerung und die damit verbundenen Zustandsänderungen musste etwas Unvorhergesehenes geschehen sein, aber anders als er es geplant hatte.
Morgens um diese Zeit waren in Bensheim nur wenige Frühaufsteher unterwegs. Während der Fahrt durch den Berliner Ring am Rande der Stadt und anschließend durch die weit ausladenden Felder um das Vorort Schwanheim und später durch den Jägersburger Wald versuchte Gravenhoff, über mögliche Ursachen für die Störung nachzudenken, doch die Erinnerungen an die Ereignisse der letzten Wochen ließen sich kaum verdrängen. Erst als am Ende des Waldes hinter einer Kurve die Bäume unvermittelt zur Seite wichen und den Blick freigaben auf die riesigen Kuppeln der beiden Reaktorgebäude und auf die alles überragenden Kühltürme konnte er sich auf das konzentrieren, das ihn dort erwarten würde. Im Morgengrauen wirkten die grauen Gebäude bedrohlicher als je zuvor. Der hintere Kühlturm schwaderte nur noch leicht; ein sicheres Zeichen, dass der Reaktor seines Blockes 2 abgeschaltet war und nur noch die Nachzerfallsleistung abgeführt werden musste. Der hell erleuchtete, graue Betonzaun und das Pförtnergebäude kamen näher. In wenigen Minuten würde er in der Schaltzentrale seines Atommeilers stehen.
VERSAMUNGSANLAGE
Die beiden äußeren Flügel der großen LKW-Schleuse im Zugangsgebäude des Kernkraftwerks fuhren langsam auseinander und öffneten sich wie ein riesiges Maul. Gravenhoff ließ den Wagen hineinrollen und verdrängte das Gefühl, verschluckt zu werden. Die Werkschützer waren von der Schichtmannschaft über die Störung informiert worden. In Ausnahmefällen war es den Mitgliedern der Betriebsleitung erlaubt, direkt in das Kraftwerksgelände einzufahren, um den Umweg über den weitläufigen Parkplatz und den damit verbundenen Zeitverlust zu vermeiden.
Während sich das äußere Schleusentor wieder hinter ihm schloss, stieg Gravenhoff aus dem Wagen und betrat durch den äußeren Personeneingang das Pförtnergebäude. Dort nahm er seinen Kraftwerkausweis entgegen, den ihm ein Werkschützer ungefragt in das Schubfach der mit Panzerglas gesicherten Empfangsdiele geschoben hatte. Gravenhoff führte ihn in den Ausweisleser ein, und sobald die grüne Freigabediode aufleuchtete, drückte er sich durch das enge Drehkreuz. Von dort eilte er durch den inneren Personeneingang wieder zurück zu seinem Wagen. Ungeduldig musste er warten, bis das äußere Schleusentor vollständig geschlossen war, und sich die Flügel des inneren Tores öffneten, um den Weg in das Kraftwerksgelände freizugeben, damit er bis zu dem kleinen Parkplatz mit den lediglich zehn Stellplätzen fahren konnte. Zu Fuß hetzte er im Nieselregen durch die als Panzersperren aufgebauten Betonpfeiler und die anschließende Grünanlage weiter zum Schaltanlagengebäude und unterdrückte dabei das dringende Gefühl, rennen zu müssen. Rennen im Kraftwerksgelände entsprach nicht dem Image eines souveränen Betriebsleiters, genauso wenig wie atemlose Erschöpfung beim Erreichen seines Schichtpersonals in der Leitwarte.
Das Schaltanlagengebäude war ein 60 Meter langer und 22 Meter hoher Betonblock, dessen eintönige graue Außenfassade nur durch das ebenerdige rote Eingangstor und eine Reihe von Bürofenstern am oberen Rand unterbrochen war. Hier waren alle hochkomplexen elektrischen Schaltanlagen einschließlich der zentralen Warte sowie in der obersten Etage die Büros des Betriebspersonals untergebracht.
Am Eingangstor des Schaltanlagengebäudes wartete Gravenhoff ungeduldig auf den Fahrstuhl, mit dem er hoch in die 18-Meter-Etage fahren konnte. Als er dort aus dem Aufzug trat, atmete er tief durch und ging mit bewusst kraftvollen, großen Schritten durch den langen, in hellbeiger Dekontaminationsfarbe gestrichenen und mit grauen, krankenhausüblichen Kautschuk-Fließen ausgelegten Flur in Richtung der Leitwarte. Am Ende des Flurs befand sich ein enges Drehkreuz, durch das sich die Personen nur einzeln hindurchdrängen konnten, dahinter eine Stahltür, deren Stabilität und Schwere schon von weitem zu erkennen war. Das waren die Abschottungen zum inneren Sicherheitsbereich. Nur Personen mit einer Spezialkodierung im Ausweis durften diesen Bereich betreten.
Gravenhoff führte seine Karte in den Ausweisleser ein. Mit einem leisen Klicken wurde das Drehkreuz freigegeben. Mit kleinen Schritten tippelte er hindurch, und wie immer an dieser Stelle kam er sich lächerlich vor. Er hasste es, im Kraftwerk eine lächerliche Figur abzugeben. Niemand war zu sehen, dennoch waren jetzt viele Augenpaare seiner Mitarbeiter auf ihn gerichtet. Eine Videokamera übertrug ständig das Bild des Zugangsbereichs auf einen überdimensionalen Bildschirm in einer Ecke der Leitwarte. Bei Freigabe des Drehkreuzes leuchtete dort ein Rotlicht auf und lenkte die Aufmerksamkeit des Personals auf den Bildschirm.
‚Engrockkreuz, Vereinsamungsanlage, Versamungsanlage, Rotlichtzeit, Gängelei!‘ Wie fast immer an dieser Stelle dachte Gravenhoff an die Schimpfnamen, die das Schichtpersonal der Vereinzelungsanlage gegeben hatte.
Auf Knopfdruck wurde die schwere Stahltür langsam von zwei großen Hydraulikzylindern geöffnet. Seine Leute nannten sie SEL600, weil jemand angeblich herausgefunden hatte, dass diese Sonderanfertigung damals, als sie vor zwei Jahrzehnten installiert worden war, etwa so viel wie ein neuer Achtsitzer-Mercedes SEL600 Pullmann gekostet hätte.
Gravenhoff betrat einen leeren, beige angestrichenen Raum, in dem sich außer den stählernen Eingangs- und Ausgangstüren nur noch ein Leuchtfeld befand. Da das Feld jetzt dunkel war und nicht blinkte, war die Schrift nur schemenhaft zu entziffern:
BEI AUFLEUCHTEN SICHERHEITSBEREICH NICHT VERLASSEN
Er wartete, bis sich die erste Stahltür hinter ihm wieder automatisch geschlossen hatte. Dann erst konnte er langsam mit beiden Händen und mit Unterstützung der Schulter die zweite schwere Stahltür öffnen und den kleinen Raum verlassen, der als Schleuse für die lufttechnische Trennung des inneren Sicherheitsbereichs gegenüber dem Schaltanlagengebäude diente. Von hier aus war der Blick frei durch eine große Glastür in die zentrale Leitwarte, ein großer Raum von 22 x 12 Metern, in dem an einer Stirnseite und an einer Längsseite lange Pulte mit einer Unzahl von Schaltelementen und Meldesymbolen standen. In der Mitte des Raumes war ein Telefonpult mit mehreren, farblich unterschiedlichen Telefonen und Bedienungselementen aufgebaut.
Es herrschte eine Atmosphäre von nahezu atemloser Stille. Nur das leise Tackern hunderter von Schreibern an den Wartenwänden hinter den schallgedämmten Scheiben und das ununterbrochene Hämmern des Störfalldruckers waren zu hören. Sechs Männer standen im Raum verteilt vor ihren Leitständen und am Telefonpult, sprachlos, fast regungslos, und starrten wie gebannt auf die vielen Anzeigeinstrumente und die grünen, gelben, roten und weißen Diodenlämpchen auf den Schaltpulten. Der Leitstandsfahrer am Reaktorsteuerpult presste seinen linken Daumen auf den Knopf der Dauerquittierung, um das nervenzersägende Hupen der zwei Warn- und Alarmmeldeanlagen zu unterdrücken, die immer wieder kurz aufheulten, wenn neue Alarme auf den Bildschirmen oder den Gefahrmeldeanlagen aufliefen.
Alle Gesichter wandten sich jetzt Gravenhoff zu, als er die Warte betrat. Rapolter, ein großer hagerer Ingenieur mit einem immer verkniffenen Gesichtsausdruck, kam ihm langsam entgegen. „Wir wissen immer noch nicht genau, was es ist. Aber es ist bestimmt nur eine Fehlanregung, die zur RESA geführt hat. Dabei ist uns der Druckhalterfüllstand unter den Grenzwert abgesackt. Der Reaktorschutz hat das als Kühlmittelverlust gewertet und die Notkühlsignale angeregt. Es gibt keinen Hinweis auf ein echtes Leck oder ...“
„Gut.“ Ungern unterbrach Gravenhoff Rapolters Report. Auch in dieser Situation wollte er nicht unhöflich sein. Doch dass die ‚RESA‘-genannte Reaktorschnellabschaltung angesprochen hatte, war unübersehbar. „Ich sehe mir den Anlagenzustand selbst an. Es ist besser, wenn ich mir unvoreingenommen ein Urteil bilde. Ist der Zustand inzwischen stabil?“
„Ja, er ist stabil. Maßnahmen haben wir noch keine ergriffen, weil die Sicherheitsautomatiken noch in Eingriff sind. Bisher ist alles automatisch abgelaufen. Wir kontrollieren alles noch einmal konsequent auf Übereinstimmung mit dem Betriebshandbuch. Wenn wir die Ursache wissen, fahren wir wieder an. Unser Strom wird schließlich montagsmorgens gebraucht. Wie üblich waren wir gerade beim Hochfahren der Leistung. Aber vorher wollen wir natürlich ...“
„Haben Sie Eicher informiert?“
„Wir haben es versucht. Aber es hat niemand das Telefon abgenommen.“
„Um diese Zeit?“ Gravenhoff versuchte vergeblich, seinen Ärger zu unterdrücken. „Montagsmorgens um halb fünf sollte eigentlich jeder erreichbar sein! Versuchen Sie es noch einmal. Wenn er sich nicht meldet, lassen Sie einen Werkschützer zu seiner Wohnung fahren und ihn herausklingeln!“
„Wenn Sie das sagen, dann sollen die das halt machen!“ Verächtlich schnaubend drehte Rapolter ab und gab einem Mitarbeiter die Anweisung, den Werkschutz zu informieren.
Gravenhoff ging zuerst zu den Anzeigen des Dampferzeugers 4. Auch er erkannte auf Anhieb keine Abweichungen von den Werten, wie sie nach einer Reaktorschnellabschaltung üblich waren. Viele sicherheitstechnisch wichtige Anlagenteile wurden von einer Vielzahl von Messsignalen ständig überwacht, wobei die wichtigen Betriebsgrößen anhand von jeweils drei Messwertgebern kontrolliert wurden, die sich wiederum selbst gegeneinander überwachten. Viele dieser Messwerte konnten zu einer schnellen, automatischen Abschaltung des Kraftwerks führen, wenn vorgegebene Grenzwerte verletzt wurden.
Gravenhoff registrierte, dass einer von drei Druckmesswerten im Dampfraum des Dampferzeugers 4 leicht von den beiden anderen abwich. Eine Messung driftete in letzter Zeit häufig nach oben, sie zeigte höhere Werte an als sie wirklich waren. Das war bekannt, auch die Ursache war bekannt. Sie konnte aber während des Betriebes nicht beseitigt werden, da hierzu die Anlage abgefahren und abgekühlt werden musste, was zu einem mehrtägigen Stillstand und somit zu Kosten von mindestens sieben Millionen D-Mark geführt hätte. Systematisch sah er sich danach die wichtigsten anderen Anzeigen an, besonders die Borkonzentration im Reaktorkühlkreislauf. Sie war nicht erhöht, nahm er überrascht zu Kenntnis. Offenbar war seine Manipulation an der Boreinspeisung fehlgeschlagen.
Er versuchte, den Störungsablauf nachzuvollziehen. Eine Abschaltung hatte er erwartet, aber anders, als sie eingetreten war. Den momentanen Anlagenzustand konnte er nicht mit den Erkenntnissen der letzten Wochen und seiner Aktion vom letzten Samstag in Einklang bringen. Vielleicht lag es aber auch nur an seiner Konzentrationsschwäche infolge der fast schlaflosen Nacht.
Der Anlagenzustand hatte sich mittlerweile automatisch stabilisiert, ohne dass die Leitstandsfahrer hatten eingreifen müssen. Eine Fehlanregung, nichts weiter, wie sie eben in komplexen technischen Anlagen vorkommen konnte. Gemäß Betriebsvorschrift musste die Störfallursache anhand der Protokolle, Meldungen und Schreiberstreifen ermittelt und beseitigt werden. Sobald der Vorgang zweifelsfrei geklärt und dokumentiert war, durfte das Kernkraftwerk wieder in Betrieb genommen werden, sofern keine konträren Erkenntnisse dagegensprachen.
Rapolter trat an Gravenhoff heran. „Wir machen jetzt die formale Zustandskontrolle.“ Drei der sechs Männer gingen bereits mit vorgefertigten Checklisten in der Hand durch die Warte, kontrollierten Schaltzustände und Messwerte und hakten sorgfältig die Kriterien ab. „Wenn das erledigt ist, heben wir den Druck wieder auf 155 bar an, steigern die mittlere Kühlmitteltemperatur wieder auf Normalwert 303,6 °C und bringen so die Anlage wieder in Nulllastzustand. Dann können wir in aller Ruhe die Ursache suchen. Sobald das klar ist, können wir den Reaktor wieder kritisch machen. Das ist nach Betriebshandbuch so vorgesehen. Sind sie einverstanden?“
Gravenhoff nickte wortlos. Das war formal korrekt. Deshalb hatte er keine Gegenargumente. Aber er war verunsichert. Alles war anders abgelaufen, als er es erwartet hatte.
Rapolter kommandierte mit lauter Stimme. „Okay, Leute! Zustand auf Nulllast normalisieren! In aller Ruhe! Exakt nach Betriebshandbuch! Aber bevor wir den Reaktor wieder kritisch machen, halten wir den Zustand konstant, bis wir die Ursache eindeutig identifiziert und dokumentiert haben. Wir können anfangen!“
Gravenhoff blieb inmitten des großen Raumes unschlüssig und nachdenklich stehen. Das war alles richtig, von hochqualifizierten Wissenschaftlern und Technikern durchdacht und berechnet, in Betriebshandbüchern vorgeschrieben, von der Schichtmannschaft gelernt und am Simulator trainiert, eine vielfach bewährte Vorgehensweise. Aber die Ereignisse der letzten Wochen hatten seine Sicht auf die atomare Welt verändert. Er schaute seinen Leuten zu. Sie arbeiteten ruhig und sachlich, einfach professionell. Selbstzweifel begannen ihn wieder zu quälen. Eicher hatten ihn ‚Problemscheißer‘ genannt. Vielleicht war er tatsächlich gar nicht der große Durchblicker, für den er sich hielt. Vielleicht hatten Eicher und alle anderen recht und nur er lag falsch mit seiner Einschätzung.
Gravenhoff versuchte, seine Souveränität zurückzugewinnen und die Herausforderungen sportlich zu sehen. ‚Weniger eingebildete Probleme haben - und dafür mehr echte in Kauf nehmen!‘ Das hatte er sich schon mehrfach vorgenommen. Er war sich nicht sicher, ob er diesen Gedanken eben nur gedacht oder auch leise vor sich hingemurmelt hatte.
Die Männer in der Zentralwarte arbeiteten zielgerichtet. Anfahren des Kraftwerks, damit waren sie vertraut, das hatten sie nicht nur in der Theorie und am Simulator geübt. Das war ihre Praxis, ihre Erfolgserlebnisse, wenn die riesige Anlage ihren Befehlen gehorchte und nach einigen Stunden wieder in das öffentliche Netz eine ungeheure Menge Strom einspeiste, die für viele Großstädte und Fabrikanlagen ausreichte. Halb Hessen konnten die beiden Atommeiler von Biblis mit Strom versorgen, das hatten sie in der Zeitung gelesen, und es machte sie stolz, trotz aller politischen Kritik an der Atomkraft.
„Ich schalte die erste Volumenregelpumpe wieder ein! Ist die RED klar?“ Kommandos und Informationen hallten jetzt durch den Raum.
„Die RED ist durchgeschaltet und auf Regelung.“ Als RED bezeichneten die Männer die Hochdruck-Reduzierstation, die den hohen Reaktordruck von 155 bar auf den atmosphärischen Druck des Reinigungssystems herunter regelte. „Denkst du daran, dass du besser zuerst die TA42 nimmst, wegen des Schwingungsverhaltens der TA41?“
„Klar! Ich bin schließlich heute nicht zum ersten Mal hier!“
„Ich kneife jetzt die RED! In etwa zehn Minuten sind wir bei 150 bar. Macht schon mal die erste Hauptkühlmittelpumpe YD 10 startklar!“
„Die Öltemperaturen sind noch zu tief. Das dauert wieder! Das ist einfach nur Mist! Unsere Mess-und-Regel-Heinis werden es wohl nie hinbekommen, dass diese Regelung nicht mehr so träge arbeitet. Aber was soll` s! In etwa fünfzehn Minuten werden wir die Öltemperatur von 43 Grad wieder erreicht haben, dann kann ich die erste Pumpe zuschalten.“
„Okay. Ich reduziere leicht den Durchsatz im Zwischenkühlkreis, dann steigt die Öltemperatur schneller. Wir können halt von Hand doch einiges besser machen als die Automatiken.“
„Okay, alle Werte sind jetzt gut. Ich schalte die YD 10 ein!“
Kurze Zeit später flackerte das Licht und die Warte war für Sekunden fast dunkel. Nur die Tausenden von Diodenlämpchen an den Wänden und auf den Schaltpulten verwandelten den Raum in ein gespenstiges Dämmerlicht. Die Männer waren es gewohnt. Der gewaltige Elektromotor der Hauptkühlmittelpumpe zog beim Anlaufen kurzzeitig eine enorme elektrische Spitzenleistung von fast 40.000 Kilowatt aus dem Netz, soviel Leistung wie etwa 400 Mittelklasseautos mit je 130 PS gleichzeitig aufbringen konnten. Im Dauerbetrieb hatte der Motor immer noch eine Leistungsaufnahme von 6.000 Kilowatt, also so viel wie etwa 60 Autos. Vier dieser Pumpen waren nötig, um im Normalbetrieb ununterbrochen das Kühlmittel, ein Gemisch aus aufbereitetem Wasser und Borsäure, mit der gewaltigen Menge von 72.000 Tonnen pro Stunde durch den Reaktorkühlkreis zu treiben und die im Reaktor produzierte Wärmemenge zu den Dampferzeugern zu transportieren.
Bei voller Leistung des Kraftwerks wurde das Kühlmittel auf 318 Grad Celsius erhitzt. Um zu vermeiden, dass das Wasser bei dieser hohen Temperatur verdampfte, musste der Reaktorkühlkreislauf ständig auf dem hohen Druck von 155 bar gehalten werden, also etwa der 70-fache Druck eines Autoreifens. Bei zu geringem Druck würde sich im Reaktorkern Dampf bilden, und die radioaktiven Brennstäbe könnten ihre gigantische Wärmemenge nicht schnell genug abgeben. Sie würden überhitzen, nach einiger Zeit schmelzen und enorme Schäden verursachen.
Ein kompliziertes Reaktorschutzsystem überwachte deshalb ständig alle sicherheitstechnisch wichtigen Betriebsgrößen und schaltete die Anlage bei Abweichungen von vorgegebenen Werten sofort automatisch ab. Doch der Reaktorkern musste auch nach dem Abschalten weiter gekühlt werden. Der Reaktorbrennstoff produzierte auch dann noch Nachzerfallswärme in einer erheblichen Größenordnung von bis zu 100.000 Kilowatt, mit der man eine Kleinstadt im Winter hätte heizen können. Diese Wärme musste über die Kühltürme oder den vorgelagerten Fluss abgeführt werden.
„RKL-Druck 155 bar erreicht! Ich nehme die Druckregelung in Betrieb!“
Gravenhoff ließ sich jetzt doch wieder von der Faszination der Technik einfangen und vergaß seine Selbstzweifel. Noch einmal ging er zu den Anzeigen der Dampferzeuger. Die vier riesigen Apparate trennten den radioaktiven Primärkreislauf systemtechnisch vom radioaktivitätsfreien Sekundärkreislauf. In jedem Dampferzeuger befanden sich 4.000 Heizrohre, über die die Wärme an die Sekundärseite übertragen wurde. Da im Sekundärkreis der Druck sehr viel niedriger gehalten wurde, konnte dort das Wasser verdampfen, und mit dem Dampf konnte die Turbine zur Stromerzeugung angetrieben werden.
Jetzt mussten die nur 1,3 Millimeter starken Wände der Heizrohre einer Druckdifferenz von 83 bar standhalten, 155 bar auf der Innenseite und 72 bar auf der Sekundärseite. Wasseranalysen hatten den Verdacht aufkeimen lassen, dass radioaktives Kühlmittel von der Primärseite auf die Sekundärseite überströmte. Das hätte bedeutet, dass ein Heizrohr eine Vorschädigung in Form eines Risses hatte und die Gefahr eines vollständigen Versagens bestand, ein Verdacht, der sich bisher nicht beweisen ließ und der der Anlass für die Auseinandersetzungen der vergangenen Wochen gewesen war. Gravenhoff suchte an allen denkbaren Anzeigen und Schreibern nach irgendwelchen belastbaren Hinweisen auf solch einen Schaden, denn dann hätte die Anlage nicht ohne vorherige Reparatur wieder angefahren werden dürfen. Doch er konnte keine Anhaltspunkte einer solchen Leckage festmachen, und für eine langwierige chemische Analyse war in der jetzigen Situation keine ausreichende Begründung gegeben.
Rapolters Kommandos rissen ihn aus seinen Gedanken. „Ist die zweite Hauptkühlmittelpumpe einschaltbereit? Wir nehmen als nächstes natürlich die gegenüberliegende, nämlich die YD 30. Öltemperatur in Ordnung? Sperrwasser in Ordnung?“
„Alles klar! Kann ich zuschalten?“
„Warte noch, bis die Druckregelung stabil ist. Die paar Minuten nehmen wir uns noch! Lasst jetzt keine Hektik aufkommen!“ Rapolter demonstrierte seine Souveränität und behielt dabei seinen Chef Martin Gravenhoff im Auge. Er schaute noch einmal konzentriert auf seine Checkliste, machte einige Haken auf dem Papier und gab dann das Kommando: „Alles klar! Einschalten!“
Das Licht in der Warte flackerte erneut, wurde dunkel, dann schnell wieder hell, viel zu schnell wieder hell. Zwei Alarmhupen heulten gleichzeitig auf, kurz darauf die dritte. Anzeigen auf den Leitständen sprangen um von Grün auf Rot, Schlitze auf der Notgefahrmeldeanlage begannen zu blinken, auf den Bildschirmen erschienen Meldungen in rasender Geschwindigkeit.
Die Männer erstarrten in ihren Bewegungen. Dann drehten sich alle Köpfe in Richtung des Reaktorschutzsystems. Auf der großen Reaktorschutztafel leuchteten zuerst gelbe und dann rote Lämpchen auf, erloschen wieder, andere leuchteten auf, wechselten ihre Farben von grün auf gelb und rot. Die Männer standen regungslos, Fassungslosigkeit in den Gesichtern.
Für einige Sekunden war auch Gravenhoff wie gelähmt. Er glaubte, sein Herz habe ausgesetzt, aber er hatte nur aufgehört zu atmen. Schwer zog er die Luft wieder in seine Lungen. Das plötzliche Überangebot von Sauerstoff erzeugte ein Schwindelgefühl und überlagerte das Dröhnen in seinem Kopf. Also doch! Er hatte es vorausgesehen, gekämpft, an der Anlage manipuliert, seinen Job riskiert und jetzt doch verloren.
Jetzt war es eingetreten und doch war alles anders.
Dann fiel alle Anspannung von ihm ab. Er wurde ruhig und nahm es einfach hin, akzeptierte die Realität. Jetzt hatten die Automatiken sowieso wieder Vorrang vor den Menschen. Er schaute zu den Schreibern. Im Dampferzeuger 4 war der Füllstand stark angestiegen. Dampfblasen, Aufschäumeffekt. Das passierte immer, wenn der Druck im Dampferzeuger schnell abgesenkt wurde und das Wasser, das sich im Sattdampfzustand befand, teilweise schlagartig verdampfte und ein Wasser-Dampf-Gemisch nach oben schleuderte.
Die Aktivitätsanzeige auf der normalerweise aktivitätsfreien Sekundärseite des Dampferzeugers 4 war nach rechts gesprungen, fast bis an das Anzeigenende. Also doch! ‚Ich habe es geahnt. Ich habe alles getan, um es zu vermeiden. Ich habe mehr getan, als ich durfte. Ich habe zu wenig getan‘, dachte er und ein kurzzeitig aufflackernder Triumph wich sofort wieder einem Schuld- und Panikgefühl. ‚Man muss die Konsequenzen tragen für das, was man tut oder unterlässt.‘ Diesen schlauen Satz hatte er oft seinen Leuten in unangenehmen Situationen gesagt.
Es war leicht, ruhig und gelassen zu sein, wenn die Entscheidung gefallen war.
Gravenhoff konnte nicht klar denken, aber er beherrschte die Routine, schließlich hatte er längere Zeit als Ausbilder am Kernkraftwerkssimulator die Reaktoroperateure unterrichtet: „Dampferzeuger-Heizrohrbruch in Dampferzeuger 4! Okay, Leute, wie wir es trainiert haben. Keine übereilten Eingriffe! Anlagenzustand kontrollieren, zuerst die Reaktorschutzsignale überprüfen, dann die automatischen Maßnahmen abchecken. Jeder an seine Position!“
Fast gelang es ihm, seiner Stimme den gewohnten, sachlichen Klang zu geben. Die Schichtmannschaft löste sich aus der Erstarrung. „Die Druckabsprühung ist in Betrieb. Der Kühlmitteldruck sinkt!“
„Okay! In wenigen Minuten haben wir in den Dampferzeugern Druckausgleich zwischen Primär- und Sekundärseite! Dann strömt kein radioaktives Kühlmittel mehr vom Reaktor in den Frischdampfkreis!“
„Also, jetzt wissen wir wenigstens, was es ist!“ Rapolter nahm wieder seine Funktion als Schichtleiter wahr. „Dampferzeugerheizrohrbruch in Dampferzeuger 4! Alle Maßnahmen exakt, wie es im Betriebshandbuch steht!“
Er hatte etwas Greifbares gefunden, an das er sich klammern konnte.
DEIONATTEUFEL
Im Reaktor des Kernkraftwerks wurde durch Kernspaltung Wärme mit der enormen Leistung von bis zu 3.733 Megawatt erzeugt. Mit dieser Wärme wurde das Kühlmittel bis auf 318 Grad Celsius aufgeheizt. Das Kühlmittel, das eine Mischung aus demineralisiertem Wasser, Deionat genannt, und neutronenabsorbierender Borsäure war, wurde in vier sogenannten Loops von den Hauptkühlmittelpumpen mit der nahezu unvorstellbaren Menge von 72.000 Tonnen pro Stunde zu den vier Dampferzeugern und im Kreislauf wieder zurück zum Reaktorkern gepumpt. In jedem Dampferzeuger befanden sich 4.000 Heizrohre, über die die Wärme an die Sekundärseite übertragen wurde. Dabei sank die Temperatur des Kühlmittels auf 288 Grad Celsius und konnte dann im Reaktorkern wieder auf 318 Grad Celsius aufgewärmt werden. Somit waren die Heizrohre die Barriere zwischen dem radioaktiven, nuklearen Primärkreislauf und dem radioaktivitätsfreien Sekundärkreislauf. Auf der Sekundärseite der Dampferzeuger wurde die Wärme genutzt, um Wasser zu verdampfen. Mit dem Dampf wurde die Turbine angetrieben, an der der Generator angeschlossen war, der den Strom wie bei einem Dynamo erzeugte.
Der Bruch eines dieser Heizrohre war von Technikern analysiert und die erforderliche Vorgehensweise in den Betriebshandbüchern festgeschrieben worden. Die Leitstandsfahrer in der Warte waren durch intensive Schulungen und Training am Simulator mit der Situation vertraut, wie Piloten mit dem Ausfall eines Triebwerks vertraut waren. Die Männer funktionierten wieder. Und sie besaßen mit den schrittweise beschriebenen Betriebshandbüchern eindeutige Anweisungen, waren sich also sicher, was zu tun war. Es herrschte jetzt eine angespannte, aber dennoch sachliche, konzentrierte Arbeitsweise. Selbst die verwendeten Fachbegriffe waren festgelegt. Die antrainierten Vorgehensweisen wirkten und vermittelten den Eindruck von Bekanntem und nahezu von Normalität. Auch in dieser Situation.
„Kühlmitteldruck?“
„Knapp unter 100 bar, weiter sinkend!“
„Gut, das ist so vorgesehen. Achtet darauf, dass die Druckhaltersprühung bei 80 bar automatisch schließt! Unbedingt! Der Druck darf nicht zu tief absinken, sonst bekommen die Hauptkühlmittelpumpen Probleme. Laufen die beiden noch?“
„Nein! Nur die YD 10 ist in Betrieb. Die YD30 war sofort beim Einschalten wieder in Schalterfall gegangen.“
„Scheiße! Läuft die YD10 wenigstens stabil?“
„Ähh... Naja, ….“ Der Leitstandsfahrer, der die Anzeigen der Hauptkühlmittelpumpe YD 10 kontrollierte, zögerte. „Die Stromaufnahme schwankt ungewöhnlich. Sie schwankt stärker! Sehr stark! Das ist doch nicht normal!“
Rapolter rannte zum Leitstand der Hauptkühlmittelpumpen. „Kavitation! Sie läuft in Kavitation! Ist der Kühlmitteldruck zu tief?“
„82 bar, weiter sinkend!“
„Die Stromaufnahme schwankt extrem! Sie geht zurück. Sie ist aber viel zu tief! Normalerweise zieht sie viel mehr Strom!“
„Dann läuft die Hauptkühlmittelpumpe voll in Kavitation! Warum denn das? Hoffentlich fällt sie nicht aus! Das darf doch nicht sein! Wie weit ist der Kühlmitteldruck?“
„77 bar! Das ist doch zu tief! Viel zu tief!“
„Mach die Sprühung zu!“
„Sie schließt schon automatisch! Aber der Druck sinkt noch weiter ab!“
„Das ist der Nachlaufeffekt! Beobachte es weiter!“
„Schalterfall YD10!“, schrie plötzlich der Leitstandfahrer mit unüberhörbarer Panik in der Stimme.
Betroffenes Schweigen. Das Ausfallen aller Hauptkühlmittelpumpen war eine Zusatzstörung, die in den Analysen und deshalb auch in den Betriebshandbüchern nicht berücksichtigt worden war. Die Verunsicherung der Betriebsmannschaft war unübersehbar. Das Hauptkühlmittel wurde jetzt nicht mehr mit den Pumpen durch den heißen Reaktorkern gedrückt, sondern nur noch durch einen langsamen Naturumlauf, der durch das Erwärmen des Wassers im Reaktorkern und durch das Abkühlen in den Dampferzeugern aufrechterhalten werden musste. Ein schnelles Wiedereinschalten der Pumpen war nicht möglich, da sie aufgrund der hohen Anforderungen extrem kompliziert waren und viele Voraussetzungen erfüllt sein mussten, zum Beispiel die richtige Öltemperatur, der richtige Druck im Kreislauf, ausreichend Sperrwassermenge, elektrische Freigabesignale und vieles andere mehr.
Rapolter hatte sich als Erster wieder gefangen. „Okay, dann eben ohne Hauptkühlmittelpumpen! Sonst noch irgendwelche ‚besonderen Vorkommnisse‘?“, fragte er und benutzte bewusst den geschwollenen Begriff mit zynisch verzogenen Mundwinkeln.
Leise und zögernd antwortete ein Leitstandsfahrer: „Die RED hat sehr weit geöffnet.“
Lauter als nötig polterte Rapolter ärgerlich: „Das ist doch normal bei Erwärmung des Kühlmittels im Naturumlauf! Da dehnt sich das Kühlmittel aus! Und die RED speist aus, damit der Füllstand im Druckhalter nicht zu sehr ansteigt!“
Sein Mitarbeiter erwiderte noch leiser und unsicherer: „Aber sie speist wirklich ungewöhnlich viel aus!“
Gravenhoff registrierte die Aussage und hetzte zur Anzeige der Hochdruckreduzierstation. Tatsächlich wurde aus dem Primärkreis sehr viel mehr Kühlmittel abgelassen als durch die Volumenregelpumpen nachgespeist wurde. Normalerweise hätte dann der Wasserstand des Druckhalters, ein an Primärkreis angeschlossener, etwa zur Hälfte gefüllter Behälter, abnehmen müssen. Er blieb aber konstant, schließlich war er die Regelgröße für die Reduzierstation.
Es gab nur zwei mögliche Erklärungen für dieses Phänomen: Entweder verdampfte Kühlmittel irgendwo im Primärkreis oder es strömte unkontrolliert Wasser aus dem Sekundärkreis ein. Beides durfte nicht sein.
Rapolter trat neben Gravenhoff. Seine Stimme drohte zu versagen, und seine Aussagen wurden zu piepsigen Fragesätzen. „Das ist so nicht vorgesehen? Wir haben keine Anweisung im Betriebshandbuch, wie das zu handhaben ist, wenn alle Hauptkühlmittelpumpen ausgefallen sind?“
„Wir haben keine Wahl. Einfach weiter nach Betriebshandbuch. Dazu sind wir verpflichtet.“
Die Anweisung seines Vorgesetzten und die Checkliste gaben Rapolter wieder Halt: „Wir machen alles nach Betriebshandbuch! Unabhängig von den Hauptkühlmittelpumpen! Der Dampferzeuger 4 muss jetzt abgesperrt werden! Dann ist der Austritt von Radioaktivität beendet.“ Einfach etwas tun, etwas in Angriff nehmen, sich an irgendetwas klammern, an etwas Überschaubares, das man beherrscht.
Aktionismus bewahrt vor dem Zwang zum Nachdenken. Bewährte Problem-Bewältigungs-Strategie. Sie konnte schnell zur Problem-Verstärkungs-Strategie werden.
Rapolter deutete auf die drei untereinander angeordneten kleinen Druckanzeigen des Dampferzeugers 4 und schüttelte den Kopf: „Die Druckmessung RA04 P052 weicht wieder von den anderen beiden ab! Das ist eine Sauerei ersten Grades, dass die Werkstatt die immer noch nicht ausgetauscht hat! Die wollen doch nur vor den Behörden nicht zugeben, dass sie Scheiße mit den neuen Messungen gebaut haben!“
Gravenhoff schaute auf die Beschriftung des Instruments. „Nein, die P053 weicht ab.“
„Seltsam, es war doch sonst immer die P052!“
Sie starrten auf die Messinstrumente. Gravenhoff spürte die Schwäche in seinen Knien. Er lehnte sich an den hinter ihm befindlichen Arbeitstisch an und hielt sich krampfhaft daran fest. Die beiden Männer starrten verwirrt auf die drei Anzeigen.
Rapolter sprach wieder als Erster. „Die 51 und die 52 sind fast gleich. Die 53 weicht ab! Nach unten?“ Er hatte die Auswirkungen noch nicht ganz erfasst. „Dann ... Dann stimmt der Mittelwert doch nicht? Dann ist der Druck in Wirklichkeit viel höher! Oder? Oder tiefer? Moment: Wenn die Messung nach unten driftet, dann ... Nein, sie driftet ja nach oben? Bisher ist sie doch immer nach oben gedriftet? Oder? Es war ja auch die andere! Also nochmal, ganz langsam: Die Messung ist immer nach unten gedriftet, ... Aber, es sind jetzt doch zwei! Und vorher die 52, nach oben. Und jetzt die 53, nach unten?“ Verzweifelt gab er den Versuch auf, in der momentanen Stresssituation die richtigen Schlussfolgerungen ziehen zu wollen. Er dachte offensichtlich nach und sprach dann weiter. „Wir haben das doch in der letzten Schulung kurz angesprochen? Wenn der Dampferzeugerdruck zu hoch ist, höher als der Primärdruck, dann ...?“
Gravenhoff löste sich von der Wartentafel und ging nachdenklich quer durch die Warte an den Hauptleitstand. Rapolter folgte ihm. Die HD-Reduzierstation, die den Druckhaltefüllstand regelte, war immer noch weit geöffnet. Die Ausspeisemenge aus dem Reaktorkühlkreis betrug 83 Tonnen pro Stunde, die Einspeisemenge lediglich 65 Tonnen pro Stunde, der Füllstand war dennoch konstant. 18 Tonnen pro Stunde flossen aus dem Reaktorkühlkreis mehr heraus als hineingepumpt wurde, und der Füllstand blieb dennoch konstant. Wie konnte das sein?
Gemeinsam hasteten sie wieder zu den Messinstrumenten der Dampferzeuger. Der defekte Dampferzeuger 4 war inzwischen von der Betriebsmannschaft allseitig abgesperrt worden, alle hinein und herausführenden Leitungen waren durch die Absperrarmaturen geschlossen wie es im Betriebshandbuch vorgeschrieben war. Trotzdem sank sein Füllstand stetig ab.
Langsam begriff auch Rapolter. „Dann ... Dann haben wir Rückströmung vom Dampferzeuger in den Reaktorkühlkreislauf. Dann haben wir Deionat im Reaktorkühlkreis! Und die Hauptkühlmittelpumpen laufen nicht! Dann haben wir doch keine Durchmischung im Reaktorkühlkreislauf! Wenn das Deionat in den Reaktorkern gerät, dann ...“
Rapolter wurde blass. Er schwankte, griff Halt suchend nach dem hinter ihm stehenden Arbeitstisch, seine Hand rutschte auf der Kante ab, er verlor das Gleichgewicht, schrammte mit der Stirn an der Warteninstrumentierung entlang und riss sich die Haut an den Schaltknöpfen auf.
Gravenhoff schob Rapolter zu Seite und rief dem Reaktorfahrer, der das Hauptsteuerpult bediente, mit lauter Stimme zu: „Reaktordruck anheben! Sofort! Aber langsam!“ Konzentriert beobachtete er den Dampferzeuger-Füllstand. Die Anzeige wanderte immer noch fast unmerklich nach unten. Er wartet ab. Die Zeit schien ihm unendlich lang zu werden, doch endlich blieb die Anzeige konstant und begann dann ganz langsam wieder anzusteigen. „Stopp! Den Reaktordruck wieder leicht absenken! Und dann genau konstant halten!“
Rapolter trat zögernd wieder zu ihm. Er hatte ein kleines Blutrinnsal auf der Stirn, das über den Augenbrauen hässlich verschmiert war, weil er sich mit dem Handrücken darübergewischt hatte. „Das ist doch eine Katastrophe? Reines Deionat im Reaktor, ohne Durchmischung durch die Hauptkühlmittelpumpen, das ist doch gefährlich, im Reaktorkern ist das doch Teufelszeug?“, sagte er fast unhörbar leise und packte seine Aussage in eine Frage, wohl in der Hoffnung, dass Gravenhoff ihm widersprechen und ihn beruhigen werde.
„Nein, noch nicht“, antwortete Gravenhoff genau so leise, „noch ist es keine Katastrophe. Das Deionat kommt von der Sekundärseite durch das gebrochene Heizrohr, seine Temperatur ist niedriger als im Primärkreis. Es ist also etwas schwerer. Deshalb sammelt es sich in der tiefsten Stelle des Leitungssystems. Dort muss es bleiben! Es muss einfach dort bleiben und darf nicht zum Reaktorkern gespült werden. Es darf sich nicht bewegen!“
Rapolter flüsterte mit fast erstickter Stimme: „Dort gibt es keine Absperrung zum Reaktorkern.“
Gravenhoff drehte sich entschlossen zur Schichtmannschaft um: „Achtung, alle herhören! Wir haben einen nicht eindeutig definierten Zustand! Deshalb: Anlagenzustand konstant halten, so wie er jetzt ist. Absolut konstant! Kein Abkühlen, keine Druckänderungen! Keine Pumpe einschalten! Stationären Zustand beibehalten. Nichts, absolut nichts darf sich jetzt noch ändern!“
„Aber das Betriebshandbuch schreibt das Abkühlen vor, und ...“, versuchte Rapolter wieder etwas zum Festhalten zu finden.
„Nein!“, schrie Gravenhoff. „Stationärer Anlagenzustand! Sonst nichts! Auch kein Abkühlen! Absolut keine Änderungen!“ Er fasste Rapolter leicht am Arm und zog ihn in eine Ecke der Warte, außer Hörweite aller anderen Mitarbeiter. „Ich fasse kurz zusammen: Wegen der fehlerhaften Druckmessungen ist der Primärdruck automatisch zu tief abgesenkt worden. Deshalb sind die Hauptkühlmittelpumpen in Kavitation gelaufen und sind ausgefallen. Und weil der Primärdruck tiefer als der Sekundärdruck war, ist Deionat über das defekte Heizrohr vom Sekundärkreis in den Primärkreis eingedrungen.“ Er hielt kurz inne, damit Rapolter seinen Gedanken folgen konnte, und fuhr dann eindringlich fort: „Wenn das Deionat in den frisch beladenen Reaktor kommt, dann kann der Reaktor wieder kritisch werden. Unkontrolliert kritisch oder sogar überkritisch! Obwohl die Steuerstäbe ordnungsgemäß eingefallen sind! Und weil die Steuerstäbe bereits eingefallen sind, können wir nichts mehr dagegen tun!“ Gravenhoff sah das Entsetzen in Rapolters Augen und sprach dann das Undenkliche aus: „Da droht eine Katastrophe! Unkontrollierte Überkritikalität! Und wir sind kurz davor! Im wahrsten Sinn des Wortes, denn das Deionat sitzt kurz vor dem Reaktorkern!“
Rapolter wurde leichenblass und begann wieder zu schwanken. Gravenhoff hielt ihn am Arm fest und wartet die Wirkung seiner Worte ab. Er dachte an die Diskussionen, die er in den letzten Wochen geführt hatte, an die Auseinandersetzungen, an die Auswirkungen auf sein Privatleben. Und er fragte sich, warum seine Manipulationen an der Anlage, mit denen er ein harmloses Abfahren erzwingen wollte, nicht rechtzeitig funktioniert hatten.
Als Rapolter wieder einen gefassten Eindruck machte, sagte Gravenhoff noch einmal eindringlich: „Stationärer Anlagenzustand! Sonst nichts! Auch kein Abkühlen! Keinerlei Änderungen! Halten Sie den Zustand absolut konstant!“
Auf unsicheren Beinen schwankte er zum zentralen Telefonpult und drückte den Knopf zur Alarmierung des Krisenstabes. Der Ereignis-Drucker dokumentierte den Zeitpunkt: Montag, 08. Nov. 1993, 05:23:09 Uhr.
2. ANBAHNUNG
INSTABILE DREIBEIN-STRATEGIE
Drei Wochen vor diesem Ereignis, am 18. Oktober 1993, war Martin Gravenhoff wie an fast jedem Arbeitstag früh um sieben Uhr mit gemäßigtem Tempo zu seinem Kraftwerk gefahren. Er genoss die Ruhe, das Nichtstun und die Gedankenfreiheit während der Fahrt aus seiner Heimatstadt Bensheim heraus über die so vertrauten Straßen durch Felder und Wiesen durch Schwanheim und dann durch den Jägersburger Wald, dessen mächtigen Buchen sich wie schützende Hände über die Straße beugten. Die herbstliche Oktoberstimmung in der Morgendämmerung gab ihm ein behagliches Gefühl von Geborgenheit und Harmonie. In weiter Ferne der kerzengeraden Straße am Ende des Waldes schien die Straße unglaublich schmal zu werden und in einen hellen Lichtpunkt zu münden. Heute fuhr Gravenhoff noch gemächlicher als sonst, so als könne er den Lauf der Zeit verzögern, um seine Überlegungen vor dem Erreichen des Kraftwerks zu Ende bringen zu können.
Es hatte sich etwas verändert in der vorher so stabilen Welt des Martin Gravenhoff. Sie war instabiler geworden. Aber auch freier, interessanter, lebendiger.
Er fand, dass er ein gutaussehender Mann war, nicht schön, aber interessant, wie ihn seine langjährige Verlobte Karin öfters mit einem nachsichtigen Lächeln beschrieb. Mittelgroß, mittelschlank, mittlerer Bauchansatz, der auch mit etwas ausgeschnittenen Hemden nicht mehr ganz zu vertuschen war, dunkelblondes Haar, markante Gesichtszüge, und vor Kurzem hatte er zugestehen müssen, dass er eine Brille benötigte, nicht nur zum Lesen, daher hatte er sich eine Gleitsichtbrille mit dunklem Rand zugelegt. Seinen vierzigsten Geburtstag hatte er vor zwei Monaten gefeiert. Nein, gefeiert hatte er ihn nicht. Er hatte ihn an sich vorüberziehen lassen. Von seinem Freundeskreis hatte er sich gratulieren und drängen lassen, die Zeche des Abends zu bezahlen. Eine Feier wollte er nicht, dennoch war es unvermeidlich gewesen, sich die mehr oder weniger witzigen Reden seiner Freunde anzuhören. Ständig wurde über sein Alter gesprochen. Und plötzlich war er sich seines Alters bewusst geworden.
Karin hatte ihm ein Geschenk überreicht, eine Armbanduhr, unauffällig, schlicht, schön. Unsicher war sie dabei gewesen, denn ihr Geschmack unterschied sich recht stark von seinem. Er hatte das Päckchen geöffnet, die Uhr in seine linke Handfläche gelegt, und sie dann wortlos angestarrt. „Gefällt sie dir nicht? Dann können wir sie wieder umtauschen“, hatte sie angeboten.
„Doch.“ Er hatte die Frage nicht wirklich wahrgenommen, denn er sah die Uhr weich werden, sich verbiegen, sich den Konturen der Hand angleichen und dann zwischen seinen Fingern zerrinnen. Vielleicht hatte Salvador Dalí auch die hängenden Uhren gemalt, als man ihm zu seinem vierzigsten Geburtstag gratuliert hatte.
Vierzig. Statistisch war die Hälfte seines Lebens vorbei. Vielleicht noch einmal die gleiche Zeitspanne. Er musste darüber nachdenken. Doch zuerst musste seiner Pflicht nachkommen, mit seinen Freunden scherzen, lachen, trinken, die Zeche zahlen, die besonders teuer war in seinem sehr großen Altherrenfreundeskreis des Bensheimer Fußballclubs FC07. Erst dann durfte er nachdenken. Doch danach war sein Kopf benebelt und sein Magen rumorte, seine Glieder gehorchten nicht mehr seinen Befehlen; keines seiner Glieder, wie Karin vorzeitig witzelte. Der Witz schmerzte. Jetzt wurde er sich bewusst, dass es die Nacht vor vier Wochen war, in der sie zum letzten Mal miteinander geschlafen hatten, Quasipflicht am Geburtstag.
Vierzig. Eine Schwelle war überschritten. Ein Lebensabschnitt war vorüber. Wie sollte der Nächste aussehen? Weitergleiten; sich von der Zeit an das Ende schwemmen lassen; die Erwartungen der Anderen erfüllen?
Schule, Ingenieurstudium, Kraftwerksbau in Venezuela und Saudi-Arabien, dann zurück nach Deutschland, große Liebe Karin, acht Jahre zusammen, davon vier Jahre in offizieller und altmodischer Verlobung mit ernsthafter Heiratsabsicht. Der Weg war vorgezeichnet: Gute Ausbildung, etwas von der Welt gesehen, jetzt Karriere, Traumpaar, er und Karin, vollständig integriert und herzlich willkommen in beidseitigen Familien, Verwandtschaften und Freundeskreisen. In absehbarer Zeit heiraten, er weiter Karriere machen und gutes Geld verdienen, sie Mutter und Hausfrau, später wieder einsteigen in ihren Job, jedoch nur als Halbtagskraft, ein gutes Leben, sehr viel später nach der Pensionierung ein Wohnmobil als Hobby und Pflichtreisen in die Welt. Das war es dann. War es das?
Sein wahrscheinlich am stärksten überschätztes Standbein war sein Hobby Fußball gewesen. Einst war er ein geachteter und begehrter Abwehrspieler in seiner Heimatmannschaft, denn seine Kameraden wollten lieber im Mittelfeld und im Angriff spielen, dort wo man Tore schießen und positiv auffallen konnte. In der Abwehr konnte er nur negativ auffallen, wenn er Gegentore nicht verhindert hatte. Die berufliche Auslastung und zu wenig Zeit hatten dieses Hobby vom aktiven Spielen auf aktives Zuschauen reduziert. An den Spuren seines Lieblingsgürtels konnte er es ablesen: In den letzten Jahren hatte er drei Zusatzlöcher in Richtung Erweiterung hineinstechen müssen.
Auch in seinem Beruf waren Zweifel aufgekommen: Drohende Kernschmelze 1978 im Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg in den USA, aber noch ohne Auswirkungen nach außen. Dann die Atomkatastrophe von Tschernobyl.
Das Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine war für ihn nicht vergleichbar mit seiner eigenen Anlage, zu groß waren die Unterschiede. Tschernobyl war im Grunde technisch ausgelegt worden zur Gewinnung von atombombenfähigem Plutonium, dass man aus dem Reaktorkern herausholen konnte, ohne den Betrieb unterbrechen zu müssen; sein eigenes Kraftwerk in Biblis war einzig zum Zweck reiner Stromerzeugung mit einem physikalisch inhärent sicheren Reaktor gebaut worden.
Einerseits nervten die ständigen politischen Diskussionen zum Ausstieg aus der Atomkraft. Andererseits waren diese Meinungen ein konkreter Anlass, über seinen weiteren Werdegang nachzudenken: Ingenieur mit vierzig, Führungserfahrung, vielleicht der richtige Zeitpunkt, Freiheit zu gewinnen, noch einmal etwas Neues wagen: Seinen persönlichen Ausstieg aus der Atomkraft, dieser faszinierenden, interessanten Technik?
Die in seiner professionellen Denkweise unqualifizierten Debatten seiner Freunde waren schwer zu ertragen. Mit der Begründung, dass eine sachliche Argumentation weder möglich noch gewünscht sei, verweigerte er sich während der letzten Jahre bei diesen Diskussionen und das wurde akzeptiert. Aber die Zweifel nagten an seinem Selbstverständnis.
Auf der kerzengeraden Straße durch den Jägersburger Wald schweiften seine Gedanken ab zu Karin. Sie war der Mittelpunkt seines dritten, nein, eigentlich seines ersten und absolut wichtigsten Standbeins gewesen. Es war ihm weggebrochen, oder hatte er es weggetreten? Mit Karin war er acht lange Jahre ein Paar, und schließlich hatten sie sogar offiziell Ringe getauscht und eine Verlobung gefeiert, sehr zur Freude ihrer Eltern. Zusammengezogen waren sie nicht, denn jeder wollte noch seinen Freiraum. Sie war eine sehr hübsche Frau, mit schulterlangen blondierten und leicht gewellten Haaren und ebenmäßigen Gesichtszügen. Ihre leicht bläulich angefärbten Kontaktlinsen konnte man nur erkennen, wenn man ihr aus der Nähe seitlich in die Augen schaute. Mit ihren fünfunddreißig Jahren hatte sie eine hervorragende Figur, die sie sich mit viel Sport und Yoga in Form hielt. Bei dem Gedanken an ihre Figur wurde ihm gewahr, dass er sie auch schon lange vor ihrer Trennung nicht mehr bewusst angeschaut hatte. Den aufkommenden Gedanken an ihr über Jahre hinweg langsam dahinsiechendes Sexualleben verscheuchte er ärgerlich. Ob Karin auch die fließenden Uhren sah?
Die Erinnerungen an den bis dahin schwersten Tag seines Lebens drängten sich auf, und er ließ sie zu, ließ sie schweifen, zurück zu jenem Abend, als er sein wichtigstes Standbein verlor.
MILCHWEISE FLECKEN
Auch damals, vor vier Wochen, auch damals war es ein Montag, der 20. September 1993, als seine langjährige Beziehung zerbrach, endgültig zerbrach. Es war ein sonniger Spätsommertag, eigentlich ein Tag, um Helden zu zeugen, den er allerdings nur kurz auf den Wegen über das Kraftwerksgelände hatte genießen können, weil er den Tag fast ausschließlich in Besprechungszimmern und Anlagenräumen zugebracht hatte. Aber war es tatsächlich der Tag, an dem die Beziehung zerbrach? Oder war es lediglich der Tag, an dem sie endete?
Der Abend hatte begonnen wie so viele Abende zuvor. Es war ein langer und zermürbender Arbeitstag mit vielen Kleinkämpfen gewesen. Er sehnte sich nach Vertrautheit, Verständnis und Wärme und wählte Karins Telefonnummer. Es hatte lange gedauert, bis sie abhob. Ihre Stimme klang müde und erschöpft. „Hallo.“
„Hallo, ich bin's. Entschuldige, dass ich nicht früher angerufen habe, aber ich ...“
„Ja, ist okay.“
„Es war wieder recht stressig.“
Sie reagierte nicht. Er fuhr fort: „Bist du sehr beschäftigt?“
„Nein.“ Es entstand eine unangenehme Pause. „Willst du kommen?“
„Gerne, also dann bis gleich.“ Er legte den Hörer auf und bereute sofort seine Ankündigung. Denn er hatte keine Lust auf weitere Gespräche, sondern nur Verlangen nach Ruhe und Entspannung. Montags, nach gemeinsamen Wochenenden, trafen sie sich normalerweise nicht. Und dennoch hatten sie sich jetzt verabredet.
Wie immer, wenn Gravenhoff das Kraftwerksgelände verlies, vollzog er das gleiche Procedere: Er grüßte den Werkschützer hinter dem Panzerglas freundlich - die Freundlichkeit machte sich manchmal bezahlt - und dann schnitt er bewusst das hinter ihm liegende Kraftwerk mit all seinen Problemen gedanklich ab und löste sich von den betrieblichen Geschehnissen. Er zwang seine Gedanken in eine positive Richtung nach vorne, an das, was ihn heute noch erwarten würde. Es war wie Autogenes Training im Gehen. Er übte es täglich. Es funktionierte meistens und brachte ihn in eine gehobene Stimmung.
Der Weg zu Karin führte nicht durch den Jägersburger Wald, sondern auf einer kurvigen Landstraße durch Felder und Wiesen nach Bürstadt, wo sie in einem Neubaugebiet hinter dem Schwimmbad in der Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses im Dachgeschoss wohnte. Diese Strecke fuhr er oft sehr schnell, sportlich, wie er es selbst nannte, aber nur, wenn er allein im Auto war. In den übersichtlichen Kurven im flachen Ried nutzte er beide Fahrstreifen aus, die Reifen quietschten, die Bäume huschten knapp an ihm vorbei. Als ihm die Lichter eines Motorades entgegenkamen, ging er vom Gas, fuhr langsam und beschleunigte sofort wieder, als sie vorbei waren. Er stellte sich vor, was passieren würde, wenn unmittelbar hinter einer Kurve Sand oder Ackererde aus den Feldern die Griffigkeit der Straße verringern würden. Zwischen seinem Auto und den vorbeirasenden Bäumen am Straßenrand war wenig Platz. Vielleicht war sein Leben dann innerhalb weniger Sekunden vorbei. Was kam dann? Gott? Ein Leben danach? Ja, da war er sich einigermaßen sicher. Wie, ohne eine höhere Macht, konnte diese Welt so großartig funktionieren? Das war undenkbar.
Das Leben war zu wertvoll, um es für einen kurzen Kick und Nervenkitzel zu riskieren. Er schaltete einen Gang hoch und ging gleichzeitig fast vollständig vom Gas, so dass sein 5er BMW langsamer wurde und gemütlich und leise über die ruhigen Landstraßen nach Bürstadt zu Karin rollte.
Als er ihr Wohnzimmer betrat, saß sie in ihrem Fernsehsessel zusammengekauert unter einer dunkelblauen, flauschigen Decke, nur die hellen Haare schauten wie ein wirres Knäuel zwischen den Falten der Decke hervor. Der Fernseher lief bei Kerzenlicht, ein Wasser- und ein Cherryglas standen vor ihr auf dem Couchtisch. Sie wandte ihm den Kopf leicht zu, als er zu ihr ging, um sie mit einem flüchtigen Kuss auf die Lippen zu begrüßen. Hilfsbedürftig sah sie aus, frierend unter der Decke, die Arme um ihre auf den Sessel gezogenen Beine geschlungen.
„Hallo.“
„Hallo.“
„Müde?“
„Ja, geht so.“





























