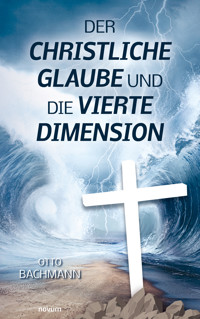
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Mathematik und Physik haben sich im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts von einer mit Intuition und Metaphysik behafteten zu einer wissenschaftlich strengen Disziplin entwickelt. Die Vorstellungen über grundlegende Themen des christlichen Glaubens – wie Gott, die Wahrheit der Bibel, die Beziehung zwischen Glauben und Wissenschaft, Sinn des Lebens, die Theodizee-Frage – beruhen hingegen oft auf überholten Weltbildern und Denksystemen sowie unbewiesenen Hypothesen und ungenauen Definitionen. Das Buch liefert wichtige Argumente zur Wahrheit der Bibel und führt zu einem vertieften Zugang zu Grundbegriffen der Theologie und zu einer Stärkung des christlichen Glaubens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-893-6
ISBN e-book: 978-3-99146-894-3
Lektorat: Katja Wetzel
Umschlagabbildungen: Empipe, Golfmhee,Andrei Anishchenko | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildung: Otto Bauchmann
www.novumverlag.com
Vorwort
Als Mathematiker, der sich vorwiegend mit den Grundlagen der Geometrie beschäftigt, bin ich immer wieder fasziniert von der Art und Weise, wie sich die Mathematik im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts von einer mit Intuition und Metaphysik behafteten zu einer wissenschaftlich strengen Disziplin entwickelt hat. Dies geschah dadurch, dass unzureichende Definitionen ersetzt, ungerechtfertigte Hypothesen beseitigt und neue Strukturen als denkmöglich und in sich widerspruchsfrei erkannt wurden. In der Folge konnten offene Probleme gelöst, bestehende Widersprüche aufgelöst und verschiedene Gebiete der Mathematik auf eine solide Grundlage gestellt werden.
Auch in der Physik erfolgten im 19. und 20. Jahrhundert Veränderungen, die zu einer Ablösung des klassischen physikalischen Weltbildes führten. Die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie sowie die Quantenphysik bedeuteten den Abschied von einem Weltbild, das durch das Prinzip von Ursache und Wirkung geprägt war. Die neuen Theorien ermöglichten es, für offene Probleme Lösungen zu finden und experimentelle Ergebnisse einzuordnen, die im Widerspruch zu bestehenden Theorien standen. Wir werden dies in Kap. 2 näher erläutern.
Ähnliche Entwicklungen haben in der Theologie nicht stattgefunden. Argumentationen über Themen des christlichen Glaubens – wie Gott, Teufel, Schöpfung und Evolution, die Beziehung zwischen Glauben und Wissenschaft, Sinn des Lebens, das Leid und die Theodizee-Frage, Israel – beruhen oft auf einem überholten Denksystem und Weltbild, auf Begriffen, die unzureichend definiert sind, und auf unbewiesenen Hypothesen. Diese Grundproblematik hatte zur Folge, dass sich in der Theologie in den letzten zwei bis drei Jahrhunderten ganz verschiedene Richtungen entwickelt haben. Die Überzeugung, dass eine Klärung in dieser Situation zu einem besseren Verständnis und einer Vertiefung des Glaubens beitragen wird, war der Auslöser zum Schreiben dieses Buches.
Ich versuche nachzuweisen,
dass den Argumentationen, die die Bibel und den christlichen Glauben betreffen, häufig ein eingeschränkter Denkrahmen, fragwürdige Hypothesen und unzureichende Definitionen der verwendeten Begriffe zugrunde liegen und daher die Schlussfolgerungen oft nicht eindeutig und nicht stichhaltig sind,dass es zahlreiche Vernunftgründe gibt, die die Echtheit des christlichen Glaubens und die Wahrheit der Bibel bezeugen,dass der christliche Glauben und die Naturwissenschaften nicht einen Gegensatz darstellen und die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften helfen können, Glauben zu stützen und zu stärken.Zum Nachweis der zweiten Aussage wird aufgezeigt,
dass sich der Inhalt des christlichen Glaubens und der Bibel in vielem so sehr von dem Inhalt anderer Religionen und Philosophien und von dem, was sich Menschen ausdenken, wünschen und ersehnen, unterscheidet, dass er unmöglich von Menschen erfunden und bloßes Menschenkonstrukt sein kann,dass sich verschiedene Prophetien der Bibel im Verlauf der Geschichte erfüllt haben,dass das Weltgeschehen je länger, desto offensichtlicher auf einen Zustand hin konvergiert, der in der Bibel vorausgesagt ist.Ich bin mir bewusst, dass das Buch keinen mathematischen Beweis für die Existenz des in der Bibel vorgestellten Gottes und die Wahrheit des christlichen Glaubens liefert. Der letzte entscheidende Schritt bleibt der Glaube. Aber es will bei Christen und Theologen zu einem fundierten Umgang mit der Bibel und den Grundinhalten des christlichen Glaubens und zu einer Stärkung desselben beitragen. Es will Atheisten und religiöse Skeptiker zum Nachdenken anregen und dazu ermutigen, sich auf den in der Bibel vorgestellten Gott einzulassen, sich selbst mit dem Evangelium zu befassen und sich auch dann, wenn man nicht alles in der Bibel versteht, der vonMark Twain(1835–1910) erwähnten Herausforderung zu stellen: «Es sind nicht die Teile der Bibel, die ich nicht verstehe, die mich herausfordern, sondern jene Teile, die ich verstehe.»Es will helfen, Enttäuschungen durch negative Erfahrungen mit Christen oder im kirchlichen Unterricht zu überwinden.
Das Buch ist wie folgt aufgebaut:
Kapitel 1 und 2 befassen sich mit der grundsätzlichen Bedeutung der oben erwähnten Grundproblematik für die Wissenschaft, die Theologie und den christlichen Glauben sowie für das Verhältnis von Glaube und Wissenschaft.
Kapitel 3 weist die hohe Wahrscheinlichkeit der Wahrheit der Bibel nach und dient damit als Vorbereitung für die folgenden Kapitel.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Gottesverständnis, Kapitel 5 mit der Schöpfung und Evolution, Kapitel 6 mit verschiedenen Inhalten des christlichen Glaubens und Kapitel 7 mit dem Volk Israel und seiner Bedeutung für die Christenheit.
Da die Bibel die wichtigste Informationsquelle für den christlichen Glauben und die in den Kapiteln 4–7 behandelten Themen ist, beschäftigen wir uns schon in Kapitel 3 mit der Frage nach der Wahrheit der Bibel. Es liefert die entscheidende Grundlage für die Inhalte der nachfolgenden Kapitel.
Zur Verdeutlichung und Klärung sind in jedem Kapitel spezifische Beispiele eingebaut mit Aussagen von Theologen, Philosophen und Wissenschaftlern und mit Situationen aus Kirchen, Glaubensgemeinschaften, Staat und Gesellschaft.
1.: Herausforderungen des menschlichen Denkens
1.1: Einleitung
Bei Diskussionen über ein bestimmtes Thema treten häufig Unklarheiten und Missverständnisse auf, die durch eine oder mehrere der folgenden Ursachen bedingt sind:
P1: Der zugrunde liegende Denkrahmen ist nicht klar festgelegt und damit sind die Denkvoraussetzungen nicht einheitlich.
P2: Es werden Hypothesen zugrunde gelegt, die nicht klar als solche deklariert sind.
P3: Es werden Begriffe verwendet, die unzureichend definiert sind.
Diese drei Problemkreise können sich teilweise überschneiden. Der Einfachheit halber bezeichnen wir den gesamten durch sie gegebenen Problembereich mitP123.
Die Entwicklung der Mathematik und der Physik wurde in den letzten zwei Jahrhunderten dadurch entscheidend gefördert, dass die Berücksichtigung dieses Problembereichs viel zur Klärung der Grundlagen beigetragen hat. Wir werden in Kapitel 2 näher darauf eingehen.
In der Theologie blieb eine ähnliche Entwicklung aus. Dies führte bei theologischen Themen und Fragen des christlichen Glaubens immer wieder zu Missverständnissen und zur Entstehung verschiedener theologischer Strömungen. Ich werde in den folgenden Kapiteln näher darauf eingehen, u. a. im Zusammenhang mit dem BegriffGottin Kapitel 4, der Frage«Was ist Wahrheit?»und derWahrheitsfragein Bezug auf die Bibel in Kapitel 3, dembiblischen Gottesbildin Kapitel 4, dembiblischen Schöpfungsberichtin Kapitel 5, sowie generell mit Aussagen, zu deren «biblischer Begründung» Bibelverse aus dem Zusammenhang herausgerissen und isoliert betrachtet wurden.
Bei dem Problembereich P123 geht es nicht um eine Frage derLogik. Dem Denken des Menschen liegt eine allgemeingültige Logik zugrunde. Sie ist notwendig, damit Kommunikation unter Menschen überhaupt sinnvoll ist und die gesendete Botschaft vom Empfänger überhaupt verstanden werden kann. Sender und Empfänger haben dieselbe Logik. Probleme bei der Kommunikation hängen meist mit dem Problembereich P123 zusammen. So ist es z. B. nicht korrekt, eine Aussage der Bibel als «nicht logisch» zu bezeichnen; es geht vielmehr darum, dass die Aussage mit der allgemeingültigen Logik innerhalb des zugrunde gelegten Denkrahmens und mit den zugrunde gelegten Hypothesen und Definitionen zu einem Widerspruch führt.
1.2: Denkrahmen
Meine Enkel kannten meine Frau nur mit grauen Haaren. Auf einem Foto war sie als junges Mädchen mit schwarzen Haaren abgebildet. Da fragte einer der Enkel:«Großmutter, hattest du damals die Haare gefärbt?»Die Art, wie wir über unsere Umwelt denken und sie erklären, hängt von dem zugrunde gelegten Denkrahmen ab.
Das folgende Beispiel soll verdeutlichen, dass sich bei Erweiterung unseres Denkrahmens durch Übergang zu einer höheren Dimension neue Möglichkeiten eröffnen und scheinbar unlösbare Probleme gelöst werden können.
Denken wir uns Lebewesen, die auf einer ebenen Fläche, d. h. in einer 2D-Welt leben. Sie stehen vor der Aufgabe, die beiden Puzzleteile links in der unten stehenden Figur lückenlos zusammenzufügen. Sie kommen zu dem Schluss, dass diese Aufgabe unlösbar ist. Eines Tages begegnen sie einem Menschen. Er lebt in einer 3D-Welt und löst das Problem, indem er den zweiten Teil um 180° dreht und dann die beiden Teile zusammenschiebt. Die Lebewesen stehen vor einem Wunder.
Unser Denkrahmen wird mitbestimmt von unserem Weltbild. Das klassische Weltbild ist von der Aufklärung und dem griechisch-humanistischen Denken geprägt und beruht auf dem, was mit unseren Sinnen wahrgenommen und mit der Vernunft daraus abgeleitet werden kann. Die Entwicklung der Physik im 19. und 20. Jahrhundert hat gezeigt, dass die uns umgebende Wirklichkeit komplizierter ist, als bisher angenommen wurde, dass die Gesamtwirklichkeit wesentlich komplizierter ist als die stoffliche, sinnlich-wahrnehmbare Raum-Zeit-Welt, dass mehr Dimensionen als die 3 räumlichen Dimensionen nötig sind, um die uns umgebende Wirklichkeit zu beschreiben. Spätestens seit derRelativitätstheoriewissen wir, dass die wahre Realität nicht die ist, die wir in den 3 räumlichen Dimensionen wahrnehmen; die Welt ist 4-dimensional. Die Hinzunahme der Zeit als vierte Dimension und die Beschreibung der Welt als ein 4-dimensionales Raum-Zeit-Kontinuum ermöglicht es, verschiedene experimentell bestätigte Befunde (wie z. B. die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit in gleichmäßig bewegten Systemen), die im Widerspruch zu der 3-dimensionalen klassischen, newtonschen Mechanik stehen, einzuordnen.
Diese Entwicklung ließ viele Aussagen der Bibel in einem neuen Licht erscheinen und sie hat dadurch auch zur Entspannung im Verhältnis von Glauben und Wissenschaft beigetragen. Sie hat zu einem Weltbild geführt, das es häufig leichter macht, biblische Aussagen zu akzeptieren und scheinbare Widersprüche zwischen Glaube und Naturwissenschaft zu überwinden. So fällt es einem Naturwissenschaftler heute leichter, ohne intellektuelle Verrenkungen an Wunder, Gebetserhörungen, gewisse Aussagen in der Bibel, an ein Eingreifen Gottes in der Welt zu glauben. Die Entwicklung hat ein vertieftes Verständnis von Glaubensinhalten und weiterführende Antworten auf Fragen des Glaubens ermöglicht, von Inhalten und auf Fragen, die Themen wieGott,Wahrheit,Schöpfung,Evolution, dieExistenz von Leiden betreffen.
Die in der Relativitätstheorie erfolgte Erweiterung von 3 auf 4 Dimensionen hat mich zum Titel dieses Buches inspiriert. Er soll zum Ausdruck bringen, dass eine Erweiterung des Denkrahmens des Menschen durch eine «göttliche Dimension» mithelfen kann, eine universale Realität anzuerkennen, die unsere sinnlich-wahrnehmbare Welt übersteigt, scheinbare Widersprüche zwischen Glaube und Naturwissenschaft oder Glaube und Erfahrung zu überwinden und Gott Wirkungsmöglichkeiten zuzugestehen, die über unseren Verstand hinausgehen. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden beim menschlichen Denkrahmen bzw. bei Einbezug der göttlichen Dimension symbolisch auch vom3D-bzw.4D-Denkrahmensprechen.
In der Bibel finden sich zahlreiche Situationen, die zeigen, dass der Mensch mit seinem 3D-Denkrahmen der göttlichen Dimension des 4D-Denkrahmens nicht gerecht wird und dadurch die Tragweite der göttlichen Offenbarungen und des mit Jesus Christus angebrochenen neuen Gottesreiches nicht zu erfassen vermag. Eindrückliche Beispiele sind das Gespräch von Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus (Joh 3.1–8) über die«Wiedergeburt» als Voraussetzung für den Zugang zum Reich Gottes, der Hinweis von Jesus im Gespräch mit der Samaritanerin auf das«lebendige Wasser»,das den geistigen Durst stillt (Joh 4.1–41), sowie das Wort Jesu vom«Essen des Fleisches und Trinken des Blutes des Menschensohnes»im Hinblick auf das Abendmahl (Joh 6.31–59).
Die prinzipielle Begrenztheit das menschlichen Denkrahmens in Bezug auf das Verständnis der Welt hat der Astrophysiker und PhilosophHarald Lesch(* 1960) [43] treffend ausgedrückt: «So wie ein Fisch im Aquarium vermutlich nie verstehen wird, wo er sich befindet und was außerhalb seiner Welt ist, so hat gewiss auch der Mensch seine Grenzen in Bezug auf sein Verständnis vom Universum.»und«Möglicherweise werden wir die letzten Geheimnisse des Universums nie lüften. Ein Grund dafür ist, dass wir Menschen letztlich auf unser ‹Aquarium› begrenzt sind, ein anderer vielleicht, dass das Universum die Eigenschaft haben könnte, dass einige seiner Rätsel nicht mit den Mitteln, die das Universum selbst bereitstellt, gelöst werden können.»Bei Missachtung dieser möglichen prinzipiellen Begrenzung und Beschränkung unserer Denkfähigkeit besteht die Gefahr, dass der Mensch die hochkomplexe Realität der Schöpfung Gottes und damit auch Gott selber und sein Wirken in den 3D-Denkrahmen hineinzupressen versucht und damit der Größe Gottes und seiner Werke nicht gerecht wird. Darauf weisen auch mehrere Stellen der Bibel hin (z. B. Hiob 42.3, Ps 145.3, Jes 40.28 und 55.8).
1.3: Hypothesen, Definitionen und Zirkelschlüsse
Eine Schwierigkeit bei Diskussionen und Analysen ergibt sich häufig dadurch, dass die Argumentationen nicht explizit erwähnte und nicht näher begründeteHypothesenundunzureichend definierte Begriffeverwenden. Ich möchte dies anhand einiger Beispiele verdeutlichen:
Die Aussage«Das Gute und Göttliche existiert jenseits allen Seins und Denkens»des römischen Philosophen des NeuplatonismusPlotin(205–270) ist ohne Präzisierung des BegriffesSeinohne inhaltliche Bedeutung.Der mittelalterliche Philosoph, Theologe und MathematikerNikolaus von Kues(1401–1464) lehrt, dass der Mensch Schöpfer des geistlich Seienden und der künstlichen Formen ist, so wie Gott der Schöpfer des wirklich Seienden und der natürlichen Formen ist. Eine solche Aussage macht nur Sinn, wenn der Mensch mit seiner schöpferischen Kraft nicht als Teil des von Gott geschaffenen wirklich Seienden und damit nicht als Schöpfungswerk Gottes betrachtet wird.Bei Statistiken führen nicht klar deklarierte Hypothesen zu Fehlinterpretationen. Als Beispiel sei eine schwedische Studie erwähnt, die zu belegen versuchte, dass Handynutzer mit 40 % höherer Wahrscheinlichkeit an Hirntumoren erkranken als Nicht-Handynutzer. Bei dieser Studie wurde jedoch nicht eine Gruppe von Handynutzern mit einer solchen von Nicht-Handynutzern verglichen, sondern eine Gruppe von Menschen mit Hirntumoren zu ihrer Handynutzung befragt!In der Mathematik hat man im Verlaufe des 19. Jahrhunderts erkannt, dass gewisse implizite Hypothesen explizit als Axiome deklariert werden müssen und dass eine Theorie nur unter Hinzunahme dieser Axiome Gültigkeit hat. Man hat auch erkannt, dass man auf eine Definition gewisser Grundbegriffe verzichten muss und diese nur implizit durch bestimmte Axiome beschreiben kann. Wir werden im nächsten Kapitel näher darauf eingehen.Unzureichende Definitionen und nicht deklarierte Hypothesen führen oft zuZirkelschlüssen, d. h. die herzuleitende Aussage wird ganz oder teilweise schon als Voraussetzung verwendet. Dies kann mit der widersprüchlichen Vorstellung eines Menschen, der sich selbst aus dem Sumpf zieht, verglichen werden. Zirkelschlüsse werden meist nicht sofort als solche erkannt. Sie entstehen häufig dadurch, dass ein bei der Herleitung eines Resultates verwendeter Begriff in seiner Definition schon Teile des Ergebnisses enthält. So werden wir z. B. in den folgenden Kapiteln sehen, dass oft in Aussagen über Begriffe wieGott,Wahrheit,Sinn des Lebens,ZufallEigenschaften hergeleitet werden, die per definitionem diesen Begriffen zugeordnet wurden. Hier sei nur auf einen solchen Zirkelschluss in Bezug auf den BegriffGotthingewiesen. Der katholische TheologeKurt Mahnig[53] vertritt in seinem Buch«Theologische Relativitätstheorie»die Ansicht, dass Gott etwas Relatives ist und dass jeder Mensch sich sein eigenes Gottesbild zurechtzimmert. Gott wird so per definitionem zu einem Gedankenkonstrukt des Menschen. Bei einem solchen Vorgehen wird die Existenz des Menschen mit seiner Denkfähigkeit bereits vorausgesetzt, um sich ein Bild von Gott zu machen, und damit enthält ein so definiertes Gottesbild nur dann keinen Zirkelschluss, falls der Mensch nicht selbst schon ein Schöpfungswerk Gottes ist. Falls der Mensch nicht als Schöpfungswerk Gottes verstanden wird, wird zwar der Zirkelschluss vermieden; es stellt sich dann aber die Frage nach der Herkunft des Menschen und seines geistigen (und körperlichen) Potenzials.
Diese Frage und der Zirkelschluss werden uns in den drei nächsten Kapiteln im Zusammenhang mit dem biblischen Gottesbild und Schöpfungsbericht noch näher beschäftigen.
1.4: Griechisches und hebräisches Denken
In der christlichen Theologie hängt der Problembereich P123 wesentlich mit dem Unterschied zwischen dergriechisch-analytischenundder hebräisch-ganzheitlichen Denkweisezusammen.
Die Bibel erzählt die Geschichte Gottes mit dem Volk der Juden und sie enthält die Lehre des Juden und Hebräers Jesus Christus. Sie und der christliche Glaube sind daher stark von hebräischem Gedankengut geprägt.
Die westeuropäische Denkweise ist wesentlich von den griechischen PhilosophenPlaton(428/427–348/347 v. Chr.) undAristoteles(384–322 v. Chr.) beeinflusst – das entsprechende Weltbild ist dualistisch: Die Welt ist gespalten in einen sichtbaren physischen Teil, der die Materie und den Körper enthält und vergänglich ist, und einen unsichtbaren Teil, der aus den Ideen, dem Geist und den Seelen besteht und unvergänglich ist. Im Gegensatz dazu geht das hebräische Denken nicht von einer Spaltung der Wirklichkeit in einen sichtbaren und unsichtbaren Bereich aus, sondern von einem Bruch der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Das hebräische Denken ist auf Beziehungen ausgerichtet, es ist bildhaft und bringt oft durch Übertreibungen Dinge auf den Punkt; das griechische Denken fragt nach dem Wesen der Dinge und Personen und es zeichnet sich durch Genauigkeit, Sachlichkeit und exakte Beweisführung aus. Der katholische TheologeHerbert Vorgrimler(1929–2014) [76] präzisiert den BegriffWesenwie folgt:«Das ‹Wesen› ist das nicht der Erfahrung und den Sinnen, sondern nur dem Denken zugängliche Was-Sein; die Wesensfrage lautet: Was ist das? Was macht das zu dem, was es ist und was es von allem anderen unterscheidet?»
Das griechische Denken ist – wie das vieler anderer Kulturen und Religionen – ein zirkulares Denken; die Abläufe in der Geschichte und in der Natur wiederholen sich. Das hebräische Denken ist linear und zielgerichtet.
Es ist unumgänglich für ein tieferes Verständnis des christlichen Glaubens und der Bibel, dass wir Menschen der abendländischen Kultur mit einem griechisch-analytisch geprägten Hintergrund die hebräische Denkweise miteinbeziehen. Dies wird sich im Folgenden mehrmals als hilfreich erweisen, u. a. im Zusammenhang mit den BegriffenWort,Leib,Seele,Geist,Strafe,Schöpfung, derEinstellung zum menschlichen Körperund demVerständnis der Zeit. Die tiefere Bedeutung biblischer Aussagen wird oft deshalb nicht voll erfasst, weil dem Unterschied dieser beiden Denkweisen zu wenig Rechnung getragen wird.
1.5: Offene Probleme – Grenzen unseres Denkens
In der Mathematik und Physik gibt es auch heute noch zahlreiche offene Probleme und es ist durchaus denkbar, dass nicht alle dieser Probleme vom Menschen gelöst werden können, weil die in 1.2 erwähnte Aquarium-Situation vorliegt.
Ein Beispiel eines einfach zu formulierenden noch offenen Problems in der Mathematik liefert die sogenannte Goldbach-Vermutung. Sie besagt, dass jede gerade Zahl größer als 2 gleich der Summe zweier Primzahlen ist (z. B. 10=3+7, 18=11+7, 32=3+29). Die Gültigkeit dieser Vermutung ist für alle Zahlen bis 4·1018nachgewiesen. Der Beweis, dass sie für jede gerade Zahl gilt, steht noch aus.
Ein Beispiel eines noch offenen Problems in der Physik finden wir in der Theorie über den Aufbau der Materie. Sie wurde im Verlaufe des vergangenen Jahrhunderts immer mehr verfeinert. So nahm man früher an, dass die kleinsten Bausteine der Materie, die sogenannten Elementarteilchen, die Atome und Moleküle sind; später entdeckte man, dass diese Teilchen aus noch kleineren Bestandteilen bestehen, wie z. B. aus Elektronen, Protonen und Neutronen. Heute kennt man 37 Elementarteilchen, unter Einbezug der Antiteilchen sind es sogar 61. In theoretischen (z. T. plausiblen, z. T. aber auch sehr spekulativen) Modellen wurden weitere Elementarteilchen postuliert, die bislang nicht durch Experimente nachgewiesen werden konnten.
Bei allen Erklärungsversuchen für den Aufbau der Materie bleibt letztlich immer die Frage nach der Herkunft der Elementarteilchen – eine Frage, die die Theologie ins Spiel bringt und mit der wir uns im Kapitel 5 beschäftigen werden. Der Nobelpreisträger der PhysikWolfgang Pauli(1900–1958) bringt es auf den Punkt, wenn er die Grenzen der Naturwissenschaft dort markiert, wo Herkunftsfragen ins Spiel kommen.
Die Thematik der offenen Probleme im christlichen Glauben und in der Theologie wird geprägt von all denExistenz-,Woher-undWarum-Fragen:«Gibt es einen Gott?»,«Gibt es eine Schöpfung ex nihilo?»,«Woher kommt das Böse in der Welt?»,«Wie ist das Leid in der Welt mit einem allmächtigen Gott der Liebe vereinbar?»,«Warum entsprechen die Erfahrungen oft nicht den Verheißungen in der Bibel?»Wir erwarten Antworten innerhalb des menschlichen 3D-Denkrahmens, die zu jedem Geschehen eine Ursache angeben und Widersprüche auflösen. Meistens werden die gelieferten Antworten aber der Komplexität der Thematik nicht gerecht, da sie den Problembereich P123 unzureichend berücksichtigen. Auch hier müssen wir uns der Aquarium-Situation bewusst sein und die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit anerkennen und es aushalten, dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort haben.
2.: Wissenschaft und Glauben
2.1: Einleitung
In Gesprächen über den christlichen Glauben fallen immer wieder Äußerungen wie: «Der Glaube ist inkompatibel mit der Vernunft.», «Der Glaube beginnt dort, wo das Denken aufhört.», «Entweder jemand denkt rational oder er glaubt einfach.», «Die Bibel ist nicht zeitgemäß, sie entspricht nicht mehr dem heutigen naturwissenschaftlichen Weltbild.»
Wir treffen oft folgende Einstellung an: Glaube und Vernunft, Glauben und Denken, Glaube und Wissenschaft stellen unvereinbare Gegensätze dar – Begriffe wieUrknall,Evolution,Schöpfungführen zu Widersprüchen zwischen Naturwissenschaft und Glauben. Die Abläufe im ganzen Kosmos sind deterministisch durch feste, naturwissenschaftliche Gesetze bestimmt. Die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse lassen sich mit einem Eingreifen Gottes in den Geschehensablauf nicht vereinbaren. Es kann nichts geschehen, was von unseren Erfahrungen abweicht. Der Ablauf der Menschheitsgeschichte wird durch den Menschen bestimmt.
Deutlich ausgedrückt hat dies der britische Zoologe und BiologeRichard Dawkins(* 1941) in seinem Buch«Der Gotteswahn»,wenn er sagt, dass religiöser Glaube ein Wahn ist, der von der modernen Naturwissenschaft widerlegt ist. Er sieht die Welt als Ergebnis eines sinn- und ziellosen Entwicklungsprozesses auf der Basis der Naturgesetze und des Zufalls und die Eigenschaften von Lebewesen als Ergebnis eines sinn- und ziellosen Prozesses der Evolution. Der Glaube ist ein blindes Akzeptieren von dogmatischen Lehraussagen, die man nicht hinterfragen darf. Ähnlich argumentiert der britische Chemiker und AtheistPeter Atkins(*1940), ein Kollege vonDawkins.
2.1.1: Der Homo-Mensura-Satz und der verborgene Zirkelschluss
Zu dieser Sicht trugen die stark vom griechisch-humanistischen Denken geprägte Aufklärung und die vonCharles Darwin(1809–1882) begründete Evolutionstheorie bei. Diese lehrt, dass die Entstehung und Veränderung der Arten auf Zufall beruhen und Leben aus toter Materie durch Zufall entsteht. Da ist kein Platz mehr für einen Schöpfergott. Da fehlt auch jeglicher Bezug zu moralisch-ethischen Werten und zu einem Gott, der Ansprüche an den Menschen bezüglich solcher Werte hat, sowie jegliches Bewusstsein von Verantwortung des Menschen gegenüber einem Gott.
Diese Sicht basiert auf dem sogenanntenHomo-Mensura-Satz, den der SophistProtagorasbereits im 5. Jahrhundert v. Chr. formuliert hatte:«Der Mensch ist das Maß aller Dinge.»Dieser Satz geht von der Vorstellung aus, dass der Mensch grundsätzlich mit seiner Vernunft, mit seinem Wissen und Können imstande ist, seine Probleme zu lösen und diese Welt zu erklären. Diese Vorstellung prägte besonders die Epoche Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals führten die zahlreichen Möglichkeiten, die sich dem Menschen durch die Fortschritte in Wissenschaft und Technik eröffneten, zu einem verbreiteten Fortschrittsglauben.
Die Haltung hinter diesem Satz führt auch dazu, dass der Mensch selbst sein Gottesbild bestimmt, selbst entscheidet, wie seine Beziehung zu diesem Gott gelebt und seine Verantwortung ihm gegenüber wahrgenommen wird, dass der Mensch selbst über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit urteilt, sich zum Richter macht und den biblischen Gott wegen all der Ungerechtigkeit und all dem Leid in der Welt auf die Anklagebank setzt.
Der Homo-Mensura-Satz setzt die Existenz des Menschen mit seinem ganzen geistigen Potenzial voraus, um sich ein Bild von Gott und der Schöpfung zu machen. Damit liegt dem Satz der in Kapitel 1.3 im Zusammenhang mit dem Gottesbild vonMahnigerwähnte Zirkelschluss zugrunde, falls der Mensch als ein Schöpfungswerk Gottes verstanden wird.
2.1.2: Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Theologie in der Geschichte
Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Theologie hing im Verlaufe der Geschichte entscheidend davon ab, wie weit beim Wissenschaftsverständnis und bei der Interpretation der Bibel dem Problembereich P123 Rechnung getragen wurde. Lange Zeit war diese Beziehung von einem überholten naturwissenschaftlichen Denken und einem diffusen Verständnis gewisser Inhalte der Bibel geprägt.
In der Scholastik (800–1400) wurde versucht, die Glaubenswahrheiten vernünftig zu begründen und Einwände gegen den christlichen Glauben mit rationalen Argumenten zu beseitigen. Ab dem 14. Jahrhundert erwies sich diese von der Scholastik angestrebte Synthese von Glauben und Vernunft infolge der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse als immer schwieriger. Durch das veränderte Wissenschaftsverständnis erhielten Beobachtungen und Erfahrungen Vorrang und dies hatte zur Folge, dass neben Deduktion auch Induktion als wissenschaftliche Methode zugelassen wurde.
Seit der Aufklärung wurde auch die Bibel im Lichte des veränderten Weltbildes immer kritischer betrachtet. Wegbereiter der Bibelkritik in der Frühzeit der Aufklärung war der GymnasiallehrerHermann Samuel Reimarus(1694–1768). Für ihn war historisch nur möglich, was naturwissenschaftlich möglich und erklärbar war. Als absolute Hintergrundannahme diente ihm das naturwissenschaftliche Weltbild seiner Zeit.
Die Entmythologisierung des Neuen Testaments, wie sie vom TheologenRudolf Bultmann(1884–1976) begründet wurde, die bibelkritische Theologie, ist auch eine logische Folge des Weltbildes des 19. Jahrhunderts. Demnach kann nichts geschehen sein, was unseren Erfahrungen widerspricht – damit auch nicht die Wunder der Bibel. Der TheologeHeinz Zahrnt(1915–2003) [86] schreibt:«Es gibt für uns nur noch eine Wirklichkeit, die uns umgibt und in der wir leben.»Wie sich die Sicht von der Bibel seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Lichte der Wissenschaft entwickelt hat, wird in Kapitel 3 näher betrachtet.
Wir werden im nächsten Abschnitt 2.2 sehen, dass die Entwicklung der Naturwissenschaft und der Mathematik im 19. und 20. Jahrhundert zu einer Wandlung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens geführt hat, die das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Theologie entscheidend beeinflusst hat. Diese Wandlung hat dazu beigetragen, Widersprüche zwischen Glauben und Naturwissenschaft zu klären. Ein Ausdruck dieser Wandlung ist die wachsende Zahl von Biografien gläubiger Naturwissenschaftler.
Für vielechristliche Wissenschaftlerist die Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine physikalische Realität und nicht nur ein«Schatten»dieser Realität im SinnePlatonsoder eine «Illusion» oder ein«Schein»(«maya»)dieser Realität im Sinne der indischen Philosophie. Sie waren und sind überzeugt, dass sich die Ordnung in der Natur nicht aus einem Chaos oder aus sich selbst heraus entwickelt hat, sondern dass sie von einem Gott gewirkt wurde.Es ist der Glaube an eine schöpferische Ordnung in der Natur, die den Menschen veranlasst, Wissenschaft zu treiben.Menschen werden kein Verständnis für Naturgesetze haben und nach solchen suchen, wenn sie überzeugt sind, dass die Natur direkt durch Götter, Geister und Dämonen beherrscht wird. So waren chinesische Mönche und hinduistische Weisen aufgrund ihrer Philosophie nicht motiviert, Wissenschaft zu treiben; sie strebten vielmehr nach innerer Glückseligkeit und danach, den ewigen Kreislauf des Lebens, Sterbens und Wiedergeborenwerdens zu durchbrechen und im Nirwana anzukommen. Es waren christliche Wissenschaftler, die die wissenschaftliche Entwicklung des 16. und 17. Jahrhunderts maßgeblich gefördert und so die westliche Wissenschaft entscheidend mitgeprägt haben. Als Beispiel sei auf den bedeutenden englischen Physiker, Mathematiker und NaturwissenschaftlerIsaak Newton(1643–1727) hingewiesen. Er glaubte, dass das Sonnensystem nur durch göttliches Eingreifen zu seiner Ordnung kam.
2.1.3: Unterschiedliche Fragestellung von Naturwissenschaft und Theologie
Naturwissenschaft und Theologie stellen unterschiedliche Fragen an die Welt und liefern unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Methoden und sie haben unterschiedliche Ziele. Die Naturwissenschaft interessiert sich mit ihrer empirischen Herangehensweise für Kausalitäten, während sich die Theologie eher mit der Zielgerichtetheit der fraglichen Phänomene befasst.
In den Naturwissenschaften versucht der Mensch sich ein Bild von der Wirklichkeit zu machen, indem er die Natur mithilfe von Messgeräten beobachtet und misst und dann die Ergebnisse mithilfe der Mathematik in Form von Gesetzen beschreibt. Er setzt dabei voraus, dass die aus den Ergebnissen abgeleitete Theorie allgemeingültig ist, d. h. für alle Phänomene Gültigkeit hat, die denjenigen entsprechen, die den Beobachtungen und Messungen zugrunde liegen. Damit wird die Allgemeingültigkeit der Naturgesetze vorausgesetzt. Sie lässt sich weder durch die Erfahrung noch durch wissenschaftliche Forschung beweisen.
Die Theologie versucht mithilfe der Bibel die Welt zu deuten. Der Theologe und PhilosophAnselm von Canterbury(1033–1109) drückt es so aus:«Theologie ist Glaube, der nach Einsicht sucht.»Sie setzt dabei Gott als Schöpfer der Welt und als den voraus, der der Welt Heil bringt. Ihr geht es um die Frage «Wer ist Gott?», um die Frage nach Sinn und Bedeutung des menschlichen Daseins, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch.
Während der Naturwissenschaftler danach fragt,wiedas All entstanden ist, fragt der Theologe,warumundwozues entstanden ist. Naturwissenschaft und Theologie können sich gegenseitig in befruchtender Weise ergänzen, sofern sie sich ihrer Grenzen bewusst sind und anerkennen, dass sie je nur einen Teil der Wirklichkeit erfassen, und sofern sie zum Dialog bereit sind.
2.1.4: Kompatibilität von Naturwissenschaft und Theologie
Unglücklicherweise reagieren Christen im Gespräch mit Menschen, die die Bibel oder den christlichen Glauben aufgrund vermeintlich wissenschaftlicher Argumente kritisch hinterfragen, häufig mit der Feststellung:«Man muss Gott und der Bibel mehr vertrauen als menschlicher Erkenntnis und bei unterschiedlichen Sichten dem Wort Gottes den Vorrang geben.»Dabei wird oft auf gewisse Bibelstellen hingewiesen – z. B. auf den (falsch interpretierten)Vers: «Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand.»(Spr 3.5 LU) Eine solche Reaktion finde ich für fragende Kritiker nicht sehr hilfreich. Meistens hängen ihre Fragen mit dem Problemkreis P123 zusammen und führen, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, dazu, den eigenen Standpunkt zu hinterfragen.
Wir werden sehen, dass Glauben möglich ist, ohne dass das intellektuelle Gewissen vergewaltigt wird und wissenschaftliche Fakten ausgeblendet werden, dass es nicht nötig ist, der Interpretation der Bibel Gewalt anzutun und«eine trügerische doppelte Buchführung zu betreiben, indem man das, was man glaubt, auf das eine und das, was man wissenschaftlich für wahr erkennt, auf das andere Konto schreibt»[31]. Ich werde nachweisen, dass Vernunft und christlicher Glaube nicht nur kompatibel sind, sondern dass sie sich gegenseitig befruchten können, dadurch, dass die Vernunft zu einem tieferen Verständnis des Glaubens führt und der Glaube der Vernunft in ihrer Funktion hilft, gute Ziele zu erreichen und das Richtige zu tun.
2.2: Der Wandel des klassischen Weltbildes
Die Grundlage für die klassische Mathematik und Physik wurde in der antiken Welt der griechischen Naturforscher und Philosophen gelegt. Die von ihnen erarbeiteten Denkansätze bestimmen das Paradigma der Grundlegung einer wissenschaftlichen Disziplin schlechthin. Die um 300 v. Chr. entstandenen «Elemente» des griechischen Mathematikers und PhilosophenEuklidwurden während 2000 Jahren als Lehrbuch der Geometrie benutzt. Dieses Werk konnte nur unter dem Einfluss des rationalistischen Geistes der griechischen Philosophie geschrieben werden, möglicherweise warEuklidsogar selbst Schüler anPlatonsAkademie.
DasgeozentrischeWeltbild, gemäß dem nach Annahme des griechischen Mathematikers und AstronomenAristotelesMond, Sonne, Planeten und Fixsterne sich mit konstanter Geschwindigkeit auf Kreisbahnen um die Erde als Mittelpunkt bewegen, war in Europa (und auch in China und in der islamischen Welt) für etwa 1800 Jahre die vorherrschende Auffassung. Zur Zeit der Renaissance wurde es durch dasheliozentrischeWeltbild abgelöst. Mit der Weltumsegelung vonFernando de Magellan(1480–1521) im 16. Jahrhundert waren die letzten Zweifel an der Kugelgestalt der Erde beseitigt. Die vom AstronomenJohannes Kepler(1571–1630) entdeckten Gesetze ermöglichten die mathematische Berechnung der Planetenbahnen.
Der größte Fortschritt für die Mathematisierung der Naturwissenschaft, vor allem der Physik und Astronomie, erfolgte im 17. Jahrhundert mit der Entdeckung desGravitationsgesetzesdurchNewtonund der Erfindung derInfinitesimalrechnungdurchNewtonund den Philosophen und MathematikerGottfried Wilhelm Leibniz(1646–1716). In der Folge veränderte sich das Verhältnis des Menschen zur Natur grundlegend, indem sich seine Sichtweise der Natur von einer rein kontemplativen zunehmend in eine sachlich-praktische und utilitaristische wandelte. Dadurch wurde auch die Entwicklung der Technik entscheidend gefördert.
Die Entwicklung der Mathematik und Physik im 19. und 20. Jahrhundert führte zu einer Aufarbeitung der Grundlagen, zu einer Wandlung des physikalischen Weltbildes und zu einer Änderung in der Denkweise der Mathematiker und Physiker. DieUnschärferelationin der Physik und derUnvollständigkeitssatzin der Mathematik sind eindrückliche Zeugen dieser Entwicklung!
2.2.1: Der Wandel in der Physik
Die vonNewtonbegründete klassische Physik sieht das Weltall als unendlichen absoluten Raum, der durch die uns vertraute, anschauliche Geometrie beschrieben wird und der mit einer Materie gefüllt ist, deren Grundbausteine unzerstörbare und unveränderliche Atome sind (griechischatomos«unteilbar»). Die aus diesen Atomen zusammengesetzte Welt hat eine vomBeobachter unabhängige und für ihn objektiv erkennbare Wirklichkeit. Die Ereignisse in der Natur laufen gemäß den Gesetzen von Ursache und Wirkung (Kausalität) und der Vorbestimmung (Determinismus) ab, d. h.: Es gibt für jeden Vorgang eine Ursache in der Vergangenheit und das Verhalten eines physikalischen Systems kann bei einem bekannten Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt für jeden späteren Zeitpunkt vorhergesagt werden. In diesem mechanistischen Weltbild ist das Universum vergleichbar mit einer Maschine, die nach festen Gesetzen funktioniert. Aus Sicht der klassischen Physik ist dieZeit unabänderbar,gleichförmigundkontinuierlichdahinfließend, unabhängig von dem zugrunde liegenden Bezugssystem.
Die Naturwissenschaftler des 19. Jahrhunderts waren überzeugt, dass die Naturgesetze die ganze Wirklichkeit vollständig beschreiben. Die vollständige Vorhersagbarkeit durch naturwissenschaftliche Gesetze ließ keinen Raum für Wunder, Gebetserhörungen und ein Eingreifen Gottes.
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gab es Erkenntnisse, die das naturwissenschaftliche Weltbild revolutionierten und offenbarten, dass die Realität unserer Welt komplizierter ist, als wir sie mit unseren fünf Sinnen auf den ersten Blick wahrnehmen und sie durch das klassische Weltbild wiedergegeben wird. Die revolutionären Erkenntnisse führten zu zwei neuen Theorien, der vonAlbert Einstein(1879–1955) entwickelten (speziellenundallgemeinen)Relativitätstheorieund der vonMax Planck(1858–1947) begründeten und bis heute in ihrer Entwicklung nicht abgeschlossenenQuantenmechanik(auchQuantentheorieoderQuantenphysikgenannt). Diese Theorien wurden entwickelt, um Widersprüche aufzulösen, die sich durch Abweichungen der Vorhersage durch die klassische Physik von den gemessenen Ergebnissen ergaben.
(Spezielle) Relativitätstheorie
Ende des 19. Jahrhunderts wurde experimentell festgestellt, dass dieGeschwindigkeit des Lichtes, im Widerspruch zu den Gesetzmäßigkeiten der klassischen Physik,konstant, d. h. unabhängig von der Geschwindigkeit des zugrunde gelegten Bezugssystemsist. Dieser Widerspruch ist theoretisch nur mit der Annahme erklärbar, dass es nicht, wie dies die klassische Physik lehrt, einen absoluten Raum und unabhängig davon eine absolute Zeit gibt, sondern dass weder Raum noch Zeit absolut sind – sie sind untrennbar miteinander verknüpft und abhängig vom jeweiligen Bezugssystem. Diese neue Sicht von Raum und Zeit wurde von Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner (speziellen) Relativitätstheorie entwickelt. Wir leben nicht in einer3D-Welt mit einem dreidimensionalen Raum und einer absoluten von ihm unabhängigen Zeit, sondern in einer4D-Welt, dem sogenannten 4D-Raum-Zeit-Kontinuum,mit der Zeit als vierter Dimension. Diese Tatsache führt zu seltsamen Phänomenen: Länge und Zeit sind vom Beobachter abhängig, sind relativ. Die Zeit im fahrenden Zug ist gegenüber der Zeit eines ruhenden Beobachters verlangsamt (Zeitdilatation) und die Länge des fahrenden Zuges ist verkürzt gegenüber der Eigenlänge des ruhenden Zuges (Längenkontraktion). Da die im Alltag auftretenden Geschwindigkeiten verschwindend klein sind im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, sind die Effekte der Relativitätstheorie (auf Raum, Zeit und Masse) im normalen Alltag so winzig, dass sie unser Leben nicht beeinflussen.
Quantenmechanik
Die deterministische Weltsicht der klassischen Physik wurde mit der Quantenmechanik aufgehoben, in ihr wurde der Indeterminismus, das Unvorhersagbare zu einem wichtigen Bestandteil. Die Quantenmechanik erlaubt grundsätzlich nurWahrscheinlichkeitsaussagenüber das Eintreten von Ereignissen in der atomaren und subatomaren Welt. Hier gibt es keine festen Naturgesetze mehr wie in unserer makroskopischen Welt, in der wir leben und denken. Die Kausalgesetze der alten klassischen Physik gelten nur in der Makrowelt.





























