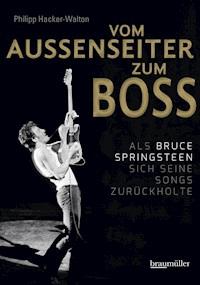19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als die junge Journalistin Bine in den Kleinlaster zur Milliardärin Iris P. steigt, ahnt sie nicht, dass dieser Hilfstransport ein Himmelfahrtskommando wird. Ihr Ziel, undercover über die Eröffnung des Hunderte Kilometer langen Großen Damms in Nordeuropa und jene Klimaflüchtlinge zu berichten, die in der vermeintlich sicheren neuen Heimat als billige Arbeitskräfte ausgebeutet werden, scheint in weite Ferne gerückt. Denn Iris plant die Zerstörung des monumentalen Baus, was für Tausende Menschen den sicheren Tod bedeutet. Bine muss den Coup verhindern. Was sie noch nicht weiß, Proben tödlicher Viren aus dem Permafrost sind in Iris Hände gelangt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Fünf Tage zuvor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
EPILOG
Ein Jahr später
Ende
Impressum
Für Benjamin und Oscar
You got a one-way ticket to the Promised Land
You got a hole in your belly and a gun in your hand
Well the highway is alive tonight
But nobody’s kidding nobody about where it goes
Bruce Springsteen, „The Ghost of Tom Joad”
Prolog
Mit den Sicherheitschefs der diversen Kanzler und Präsidenten ist Jacques Pecheur – wieder einmal – den Ablauf der feierlichen Zeremonie durchgegangen. Eine Woche noch bis zur Eröffnung des Damms. Auch nach Jahren als Sicherheitskoordinator für Großprojekte ist er nicht sicher, ob in den Schaltzentralen der Macht eigentlich die Fachleute oder die PR-Beauftragten das Sagen haben. Man kann die Staats- und Regierungschefs entweder so platzieren, dass man Scharfschützen, Selbstmordattentätern und Kamikaze-Drohnen keine Chance gibt, oder so, dass die offiziellen Bilder des Festaktes besonders schmeichelndes Licht und einen möglichst malerischen Hintergrund bieten. Beides gleichzeitig, das weiß Jacques aus Erfahrung, ist nur ganz selten möglich.
Der Touchscreen, der die ganze Wand gegenüber seinem Schreibtisch einnimmt und dessen Größe selbst für heutige Standards als überdimensional beschrieben werden kann, zeigt laufend Livebilder vom Dammbau. Vierundzwanzig Stunden am Tag fliegen Drohnen den fast fertigen Damm entlang, die Aufnahmen werden von Hochleistungscomputern ausgewertet, zusätzlich von einem gemeinsamen Team von Europol und FBI analysiert und pausenlos in sein Büro übertragen.
Jacques schüttelt den Kopf. Er kennt die Pläne für den Damm in- und auswendig. Die Dimension des Vorhabens ist dennoch selbst ihm schwer begreiflich. Mehr als sechshundert Kilometer lang und mehrere Meter breit ist der Betonklotz geworden, der künftig die Nordsee abriegeln und damit verhindern wird, dass Westeuropa an der Atlantikküste das Schicksal Kaliforniens erleidet – und untergeht. Jacques verbietet sich eine persönliche Meinung darüber, ob der Dammbau sinnvoll ist oder doch eher einen größenwahnsinnigen Eingriff in die Natur darstellt. Für ihn als pflichtbewussten Polizeibeamten zählt einzig und allein der Schutz des Bauwerks und seiner hochrangigen Eröffnungsgäste, koste es, was es wolle.
Sein Assistent stellt ihm wortlos einen Kaffee und einen Teller mit einem Croissant auf den Schreibtisch, daneben legt er das Tablet mit den Morgenberichten der diversen Nachrichtendienste. Während Jacques mit der rechten Hand das Croissant zum Mund führt, beginnt er mit der linken zu scrollen. Jacques hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die Berichte zuerst auf ihre Quellen zu scannen. Ein erprobter Weg, die wichtigsten Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung aus der Masse der Informationen herauszufiltern. Sein Blick bleibt an einem Bericht hängen, der rechts oben mit einem rot eingekreisten M markiert ist. M für Müller. M für … „Merde!“, flucht Jacques und legt sofort das angebissene Croissant zurück auf den Teller.
Sein Assistent zuckt zusammen. „Monsieur, alles in Ordnung? Habe ich das falsche Croissant gebracht? Mir wurde versichert, dass es sich um eines mit Aprikosenfüllung handelt.“
„Reden Sie keinen Unsinn, Dubois“, fährt Jacques ihn an. „Sehen Sie lieber nach, ob sich das Sicherheitsteam von Madame La Présidente noch am Gelände befindet.“ Mit einem Mal hat sich die Bedeutung des Countdowns für Jacques gedreht: Sosehr er bis vor ein paar Minuten noch herbeigesehnt hat, D-Day möge möglichst rasch kommen und vorübergehen, sosehr wünscht er sich nun ein paar zusätzliche Tage, um zu verhindern, worauf er soeben einen Hinweis aus sehr guter Quelle erhalten hat: einen Anschlag. Auf den Damm und die, die ihn haben bauen lassen.
Fünf Tage zuvor
1
Wie viele Schüsse braucht es, um nach mehreren Jahrhunderten das finale Kapitel einer Familienchronik zu schließen? Zwei? Drei? Ab dem vierten würde sie nachladen müssen. Zwei sollten reichen. Sicherheitshalber wirft Iris einen Blick durch die Heckscheibe ihres Volkswagens. Scheint alles ruhig zu sein: Toby sitzt regungslos auf der Rückbank – in welche virtuelle Welt auch immer er vertieft ist, der VR-Helm leistet ganze Arbeit. Ihr Sechsjähriger wird ebenso wenig etwas von der Pistole in ihrer Hand bemerken wie ihre Mutter, die auf dem Beifahrersitz eingeschlafen ist.
Das sollte ihr Zeit geben für einen abschließenden Check. Ein allerletztes Mal einen Fuß in die Villa setzen, die seit Kindertagen ihr Zuhause war. Danach würde sie sich nicht mehr umdrehen, nur noch nach vorne blicken. Nicht mehr zurück ins große Berlin, dieses überhitzte, verdorrte Drecksloch, in dem es im Winter kaum auszuhalten und im Sommer unerträglich geworden ist; nicht mehr zurück ins kleine Neustadt, das im Schatten der Hauptstadt langsamer, aber ebenso unaufhaltsam verwelkt.
Zwei Schlüsselbunde liegen in der Küche auf dem Tisch, sie legt ihren dazu. Die Aufnahmen der Sicherheitskameras der vergangenen vierundzwanzig Stunden gelöscht? Check. Die Kameras deaktiviert? Check. Sie blickt auf die Fotos an der Wand, die in den elektronischen Bilderrahmen jede Minute automatisch wechseln. Mit der Frau, die hier regelmäßig erscheint – mal jünger, mal älter, an der Seite ihrer Eltern, ihres Mannes, ihres Sohnes –, hat sie nichts mehr gemein. Wer warst du damals nur?, denkt sie.
Iris pfeift zweimal kurz und laut, die Hunde hören ihr Signal und kommen sofort angerannt. Ein letztes Mal noch durch das wuschelige Fell fahren als Belohnung für den treuherzigen Blick und das freudige Gehechel, das die beiden Spaniel so lieblich wie belämmert zugleich wirken lässt.
Einmal abgedrückt. Zweimal abgedrückt. Es kann losgehen.
Wieder zurück im Auto, legt sie die noch warme Pistole in die Ablage der Mittelkonsole zurück. „Gute Reise, Iris Paschulke“, murmelt sie in sich hinein.
Drei Häuserblöcke sind sie gerade einmal gekommen, schon scheitert Iris’ Plan, die Stadt zu verlassen, ohne stehen zu bleiben, ohne in Versuchung zu geraten, doch zu bleiben. Toby verlangt nach Essen – oder dem, was er dafür hält, Zucker und künstliche Aromen – und ihre Mutter nach einer Toilette.
Der erste Stopp ihrer Reise ist also der Gigamart am Anfang der Straße der Einheit. Iris schickt Großmutter und Enkel hinein; sie will auf keinen Fall einer Bekannten über den Weg laufen. Wenn man die ersten dreiundvierzig Jahre seines Lebens in einer mittelgroßen Stadt verbracht hat, sind die Chancen dafür schließlich hoch. Dass die Paschulkes über Generationen hier in Neustadt gelebt und das Geschick der Gemeinde immer wieder gelenkt hatten, trägt sein Übriges dazu bei.
Iris‘ Blick im Rückspiegel bleibt an der Statue hängen, die auf der anderen Seite der Kreuzung thront: Alfred Frederick Paschulke der Dritte – in all seiner kupfernen, von Starkregen, Hitze und Tauben verwaschenen Pracht. Den Goldenen Stadtschlüssel, das traditionelle Symbol der (gewählten) Macht in Neustadt, in der einen Hand und einen Eisblock in der anderen. Ururopa Alfred hatte erst mit dem Wiederverkauf von Kühleis, das er von Fischhändlern am Ende des Markttages zur Entsorgung erhielt, ein Vermögen verdient, war dann mit dem Versprechen von Gratiseis zum Bürgermeister gewählt worden und hatte sich als solcher in der Region das Monopol auf den Verkauf der ersten Kühlschränke gesichert. Was sich in Echtzeit als Kombination glücklicher Umstände und Kaltschnäuzigkeit entwickelt hatte, ließ sich im Rückblick wunderbar als Rags-to-Riches-Story erzählen. Ganz so, als ob Alfreds Erfolg ein Ergebnis seines Unternehmergeists und vor allem seines Fleißes gewesen wäre.
Das für Alfred Frederick Paschulke III. und die Geschichtsschreibung von Neustadt gleichsam Wunderbare an der ganzen Episode war die Vielfalt an möglichen Interpretationen, aus der sich jeder seine eigene zurechtbasteln konnte. Für die einen war Alfred der lebende Beweis dafür, dass sich harte Arbeit und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten zwangsläufig auszahlten. Am anderen Ende des politischen Spektrums feierte man ihn als einen Pionier des Recyclings und spirituellen Vater der No-Waste-Bewegung. Iris verspürte beim Gedanken an ihren berühmten Vorfahren stets weniger Bewunderung als tiefe Dankbarkeit. Hauptsächlich gegenüber dem Universum, das ausgerechnet aus ihrem Ururgroßvater einen Glückspilz gemacht hatte. Und natürlich auch gegenüber Alfred selbst, der für die nachfolgenden Paschulke-Generationen ausreichend Kapital hinterlassen hatte, sodass sie ein unbeschwertes Leben führen konnten. Um unberührt zu bleiben von den meisten Dingen, vor denen der Großteil der Menschen nicht mehr flüchten konnte. Mit genug Geld ließ sich schließlich jedes Haus kühlen, heizen und nach einem Starkregen reparieren. Mit den nötigen finanziellen Reserven blieb man zudem – wenn auch nicht ganz legal – von den Beschränkungen verschont, die seit Langem für den Verbrauch von Wasser und Energie galten.
Zur Dankbarkeit mischte sich bei Iris allerdings immer öfter Ärger. Darüber, dass ihre Vorfahren am Ende doch immer nur an das kurzfristige Wachstum – von dem sie profitierten – gedacht hatten, und nicht an die langfristigen Folgen, die Iris, Toby und künftige Generationen nun ausbaden mussten. Von heute auf morgen ein Geschäft gründen? Klar doch! In kurzer Zeit damit reich werden? Bitte sehr! Ressourcen ver(sch)wenden ohne Rücksicht auf Verluste oder gar künftige Generationen? Sowieso! Die riesigen Autos! Die riesigen Häuser! Die viel zu schmutzig hergestellte, viel zu billig verkaufte Energie! Wie war es möglich, dass so viele Menschen sich so lange Zeit so wenig dabei gedacht hatten?
Iris wäre es lieber gewesen, ihre Vorfahren hätten ihr kein Vermögen, sondern eine intakte Umwelt hinterlassen. Jetzt muss sie die Dinge selbst in die Hand nehmen und mit Ururopas Erbe die Kriegskasse der militanten Klimaschützer füllen.
Toby und seine Großmutter sind zurück, gewappnet mit Süßkram, der für mehrere Wochen reichen sollte. Iris wartet kaum, bis sich die Gurte geschlossen haben, drückt den Startknopf und schließt die Augen. Bis der Autopilot sie ans Ziel gebracht hat, kann sie noch eine Stunde schlafen.
2
„Fuck!“ Die Hitze trifft ihn wie ein Schlag ins Gesicht, der Staub brennt in seinen Augen, noch bevor er einen Blick auf seine Umgebung werfen kann. Tom kramt mit halb geöffneten Augen in seiner Tasche und holt unter einigem Fluchen eine Sonnenbrille und eine Mund-Nasen-Maske heraus. Insgeheim wünscht er sich zurück ins kalte Grönland, wo Temperaturen über fünfzig Grad und Feinstaubbelastung (noch) kein Thema sind.
„Sie sind wohl neu hier?“, ruft ihm eine alte Frau von der Bank bei der Bushaltestelle zu, die ihm den Schock offensichtlich ansieht. „An die Hitze müssen Sie sich gewöhnen, oder Sie nehmen besser den nächsten Flieger dahin, wo Sie hergekommen sind!“
Hustend setzt sich Tom auf den freien Platz neben sie auf die Bank. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus seiner Wasserflasche, ehe er ihr antwortet. „Ich war ein paar Monate nicht hier, da vergisst man leicht, wie sich der Sommer in Phoenix anfühlt.“
Er blickt sich um. Der große Parkplatz vor dem Flughafen ist größtenteils abgesperrt. In der Sommerhitze der vergangenen Jahre ist der Asphalt an so vielen Stellen aufgebrochen, dass es aussieht, als wäre die Betonfläche von Maulwurfshügeln durchsetzt. Das tote Holz der kümmerlichen Jungbäume, die allesamt nicht mehr als ein oder zwei der extrem heißen Sommer überstanden haben, komplettiert das elende Straßenbild. Irgendwann hat die Stadtverwaltung die Sisyphusarbeit der Sanierungen und Baumpflanzungen aufgegeben, sodass mittlerweile von der Autobahn nur noch eine einzige Fahrbahn instand gehalten wird, die der Bus für den Transport der Fahrgäste zum Flughafen nutzt.
„Sie müssen einen guten Grund haben, wenn Sie sich Phoenix um diese Jahreszeit freiwillig antun“, meint die Frau neben ihm.
Tom grinst. „Das kann man so sagen. Ich bin hier, um der Liebe meines Lebens einen Antrag zu machen.“
Die alte Dame hebt die Augenbrauen, doch bevor sie weiter nachfragen kann, unterbricht der einfahrende Bus ihr Gespräch. Tom lässt ihr den Vortritt. Noch ein freier Platz, verkündet die Anzeige am Bus.
„Gehen Sie ruhig, Sie haben schließlich etwas Wichtiges vor.“ Sie deutet mit einer einladenden Geste zum Bus.
„Ich warte auf den nächsten. Mary-Anne geduldet sich seit Jahren, da kommt es nicht auf die Minute an.“
Tom setzt sich wieder hin, nimmt sein Notizbuch aus der Tasche und schlägt es auf der letzten Seite auf. Dort, wo er die Fotos eingeklebt hat, die mittlerweile abgegriffen und halb verblichen sind: Mary-Anne und er vor 15 Jahren beim Highschoolball; Mary-Anne mit Studiendiplom und Abschlusshut; Mary-Anne und er vor fünf Jahren beim Klettern im Nationalpark – der letzte gemeinsame Urlaub; Tom in Militäruniform. Er kann es kaum erwarten, die nächsten Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte zu schreiben. Er schließt die Augen, geht in Gedanken durch, was er in den vergangenen Wochen x-mal durchgespielt hat.
Ein Hupen stört seine Gedanken. Tom versucht, den Lärm zu ignorieren, lässt die Augen geschlossen, doch das Gehupe hört nicht auf. Himmel, wer hat es denn da so eilig? Er versucht sich zu konzentrieren.
„Hey, Soldat, aufwachen!“
„Mary-Anne!“
Tom wirft seinen Rucksack auf die Rückbank und gibt seiner Freundin einen Kuss. „Woher wusstest du, dass ich schon einen früheren Flug genommen habe?“ Sie quittiert seine Frage mit einem geheimnisvollen Lächeln und startet den Motor.
„Wie du bald merken wirst, bin ich voller Überraschungen!“
An der roten Ampel bei der Auffahrt zur Autobahn schenkt sie ihm einen liebevollen Blick. Sie setzt an zu einem Satz, den sie nicht ausspricht.
„Spuck’s aus, was ist los? “, sagt Tom.
„Nicht, dass ich neugierig wäre, aber …“
„Aber?“
„… du bist jetzt seit einem Jahr in Grönland, und ich habe den Verdacht, dass du dort nicht nur Robben beobachtest und Blutproben der Soldaten auswertest. Willst du mir nicht endlich verraten, welches Geheimprojekt dort wirklich läuft?“ Kaum hörbar seufzt er auf. Weniger der Frage wegen, sondern weil er wieder nur die immer gleiche Antwort geben kann: „Du weißt doch, dass ich nicht darüber reden darf.“
„Dann lässt du mir wohl keine andere Wahl“, sagt Mary-Anne und grinst frech.
„Was meinst du?“
„Na ja. Wenn du mir nichts verrätst, werde ich dich wohl mal im Ewigen Eis besuchen müssen, um herauszufinden, was du dort so streng Geheimes anstellst.“ Mary-Anne blickt zu Tom hinüber und zwinkert ihm zu: „Ich kann mich doch darauf verlassen, dass du mich in der Nacht wärmst, wenn es kalt wird?“
„Himmel, was ist denn da drüben los? Ist heute ein Spiel?“ Tom deutet auf die Eishockey-Arena, vor der sich eine so lange Menschenschlange gebildet hat, dass sie von der Autobahn aus gut sichtbar ist. „Haben die Kojoten in diesem Jahr Chancen auf die Play-offs?“
„Schön wär’s“, gibt Mary-Anne zurück. „Erinnerst du dich an die Hitzewelle vom letzten Sommer? Dieses Jahr soll es noch heißer werden. Wenn die Kojoten Pech haben, können sie wieder wochenlang nicht trainieren, weil in der Eishalle die Leichen der vielen Hitzetoten aufbewahrt werden, bis sie beerdigt werden können. Außerdem sollen nicht alle in den Einkaufscentern herumlungern, also hat das City Council beschlossen, dass jeder eine Stunde pro Tag zum Runterkühlen in die Eishalle kommen darf. Alte und Kranke bekommen – in einem eigenen Teil der Halle, durch einen Sichtschutz getrennt von den Leichen – dreimal die Woche eine zweite Stunde. Nett, oder?“
Tom schluckt. Dass die Hitze in seiner Heimatstadt mittlerweile derartige Ausmaße angenommen hat, ist ihm nicht bewusst gewesen. Vielleicht sollte er sich den Abschied aus Grönland doch noch einmal überlegen.
„Stört es dich, wenn wir noch schnell bei mir vorbeischauen, bevor wir zu deiner Mutter fahren?“, fragt Mary-Anne. „Ich würde gern schnell duschen und mich umziehen. Dauert auch nicht lange, versprochen.“
„Klar, kein Problem.“ Erst jetzt fällt Tom auf, dass seine Freundin ihre Arbeitskleidung trägt, die voll mit Mehl und Teigresten ist. Sie muss direkt aus der Backstube zum Flughafen gefahren sein.
„Du kannst auch gerne mitkommen unter die Dusche“, sagt Mary-Anne, nachdem sie in ihrer Wohnung angekommen sind. „Wobei, bei den Wasserbeschränkungen würde es sich kaum lohnen.“ Sie wirft ihm ihren BH an den Kopf und verschwindet im Bad.
Tom sieht ihr genüsslich nach, schließt die Augen und ist glücklich bei der Vorstellung, bald nicht mehr die meiste Zeit von Mary-Anne getrennt zu verbringen, gemeinsam alt zu werden.
„Nicht einschlafen!“ Mary-Anne ist aus dem Bad ins Schlafzimmer gekommen und verpasst Tom mit einem gezielten Schütteln ihrer blonden Locken eine kleine Dusche. Tom lächelt, er öffnet die Augen, sieht Mary-Anne beim Anziehen zu. Vorfreude ist bekanntlich die schönste …
Was ist das? Neben dem grünen Sommerkleid, das Mary-Anne gerade aus dem Schrank geholt hat, entdeckt er eine sandfarbene Armeeuniform. Er kneift die Augen ein wenig zusammen, um sicher zu gehen, dass die Müdigkeit ihn nicht täuscht. Es ist eindeutig eine Uniform. Hast du etwa eine Affäre mit einem anderen Soldaten? Die Worte liegen ihm auf der Zunge, doch er schafft es nicht, sie laut auszusprechen – schon allein, weil er ihr es nicht zutrauen würde.
„Komm, fahren wir!“, ruft Mary-Anne. „Deine Mutter wird nur einmal sechzig.“ Sie hat es eilig, ihn aus dem Zimmer zu bekommen.
„Was hast du uns aus der Bäckerei mitgebracht?“, quietschen Aaron und Jake mit der ungezwungenen Ehrlichkeit, die Vierjährigen vorbehalten ist. Ihr Onkel Tom, den sie seit Monaten nicht gesehen haben, bekommt im Vorbeilaufen ein kurzes „Hallo“ zugeworfen, sogleich klammern sich die beiden an je ein Bein von Mary-Anne.
„Hätte ich euch etwas mitbringen sollen?“, fragt Mary-Anne mit gespielter Entrüstung. Sie zieht eine der beiden Tüten hinter ihrem Rücken hervor und sieht zu, wie die Buben mit ihrer Beute davonflitzen.
Mit der zweiten, größeren Tüte voller Donuts folgt Mary-Anne Tom, der bereits bei seiner Mutter in der Küche sitzt. „Hallo Angela, kann ich auch helfen?“
Toms Mutter blickt kurz vom Gemüseschneiden auf und lächelt Mary-Anne an, während sie ohne Unterbrechung weiter ihrem Sohn einen kompakten Newsflash aller Neuigkeiten der vergangenen Monate präsentiert. „… jedenfalls sind damit jetzt alle drei Söhne der Millers verheiratet und Mrs. Miller, Judy – du kennst sie doch noch –, also Mrs. Miller und ich, wir haben uns schon gefragt, wann wohl die nächste Hochzeit stattfinden wird.“
„Sehr subtil, Mom, danke“, knurrt Tom. „Wo ist Julia eigentlich? Wollte sie nicht schon hier sein?“
„Du kennst deine Schwester“, sagt Angela. „Sie hat die Kinder gebracht und ist dann gleich wieder verschwunden. Hat etwas von einem dringenden Fall in der Ordination gemurmelt. Sie wird sicher zum Essen zurück sein.“
Es läutet an der Tür.
„Mom, erwarten wir noch jemanden?“
„Wahrscheinlich hat Julia ihren Schlüssel vergessen. Du kennst deine Schwester.“
Tom geht zur Tür und öffnet sie.
„Major Richards, Sir, es geht um das Labor. Es gab einen Zwischenfall.“
3
Langsam beschleunigt Iris aus der Einfahrt, im Rückspiegel sieht sie Toby fröhlich winken. Er dürfte also nicht bemerkt haben, dass sie ihn heute ein wenig länger, ein wenig fester umarmt hat als sonst. Zwei Wochen Urlaub mit Oma an der Nordsee – die Aussicht war für ihn offenbar so verlockend, dass er gar nicht hinterfragte, wieso Mama nicht dabei sein kann. Und ihre eigene Mutter hatte mit dem Hinterfragen von Dingen aufgehört, bevor Iris geboren war.
Ein Schmerz bohrt sich messerscharf in Iris‘ Brust, wenn sie daran denkt, für wie lange sie Toby tatsächlich zurücklässt. Sie wird ihn vermissen – und er sie umgekehrt noch viel mehr. Ob er sie je verstehen wird? Schwer zu sagen. Sie tut es schließlich für ihn, tröstet sie sich. Zum Abschied hat sie ihm zwei Briefe geschrieben. Einen, den er jetzt schon als Sechsjähriger lesen kann. Und einen längeren, den er erst in ein paar Jahren begreifen wird, wenn überhaupt. Im Innenfach seines Spidermankoffers hat sie einen Packen mit Unterlagen versteckt. Zugangsdaten zu den Konten, Verfügungen für die Stiftungen, Kontaktdaten zu den wichtigsten Anwälten und Notaren. Adresse und Anfahrtsplan zu einem neuen Haus in einer neuen Stadt, in der er mit Oma ein neues Leben anfangen kann. Mit neuem Pass und neuem Namen. Alles, was er tun muss: den Mund halten. Die Welt im Glauben lassen, dass die drei Leichen, die die Polizei in – Iris blickt auf die Uhr – ziemlich genau 70 Stunden und 24 Minuten in ihrem alten Haus finden wird, Toby Paschulke, seine Mutter und seine Großmutter sind, die bei einem tragischen Unfall – die Ursache für das Feuer wird nicht geklärt werden können – ums Leben gekommen sind.
Iris lehnt an der Motorhaube des Volkswagens, sie sieht den Kleinlaster schon von Weitem den Rastplatz ansteuern. Pünktlich auf die Minute, das muss man Armin lassen. Pech nur, dass Pünktlichkeit seine einzig gute Eigenschaft ist, doch wer seine Mitstreiter unter Kleinkriminellen sucht, darf nicht wählerisch sein. Armins Rolle in ihrem Plan beschränkt sich schließlich darauf, Iris‘ Auto verschwinden zu lassen – und Armin selbst wird ebenfalls verschwinden, auch wenn er das noch nicht weiß.
Iris setzt ein Lächeln auf, winkt den Laster heran. „Na, alles in Ordnung?“ Sie tauschen wie geplant die Fahrzeuge, Küsschen links, Küsschen rechts, dann steigt Iris in den Laster und fährt los. Armin setzt sich hinter das Steuer des Volkswagens und übergibt direkt an den Autopiloten. Er wird es sich in ein paar Stunden auf einem Rastplatz in Iris‘ Volkswagen gemütlich machen für eine kleine Pause. Von ihm unbemerkt wird ein Nervengas aus dem Lüftungssystem des Wagens strömen, das sein Nickerchen bis in alle Ewigkeit verlängert. Irgendjemand wird ihn finden, wenn der Autopilot das Ziel der Reise, den Parkplatz eines 24-Stunden-Supermarktes am Rand von Hamburg, erreicht hat. Es wird aussehen wie ein Herzinfarkt.
Der VW ist bereits als gestohlen gemeldet. Das müsste der Polizei zumindest vorläufig als Erklärung reichen, wieso Iris‘ Auto nicht in der Garage stand, als ihr Haus explodierte, obwohl sie doch – wie man nach dem Fund der Leichen vermuten wird – daheim war.
Keine halben Sachen mehr, hat sie sich geschworen.
4
Ein zaghaftes Klopfen an der Tür holt Pavel langsam aus seinen Gedanken zurück in die Wirklichkeit. Einen Augenblick lang bleibt er noch über seinem Modell gebeugt sitzen. Es schmerzt ihn, dass seine perfekt geplante Green City 3.0 nie die triste Stadt ersetzen wird, die vor dem Fenster seines Büros liegt. Dass die ausgefeilte Theorie nicht Realität werden darf. Dabei würden die Bewohner davon Tag für Tag profitieren. Ein ausgeklügeltes Beschattungssystem würde die Sommer, in denen vierzig Grad und mehr mittlerweile normal sind, halbwegs erträglich machen. Ein Netz von Bewässerungskanälen unter dem großflächig entsiegelten Boden würde nicht nur dafür sorgen, dass das Wasser beim immer öfter auftretenden Starkregen geordnet abfließt, sondern es auch speichern und in den sich ausdehnenden Trockenperioden die Versorgung der Pflanzen sicherstellen. Seufzend legt Pavel die Modellbäume weg, die er gerade im Begriff war, rund um das Rathaus seiner Miniaturstadt zu platzieren.
„Herein!“ Er trinkt einen Schluck und fühlt sich schuldig, obwohl es nur Wasser ist – und nicht Hochprozentiges wie bei manchem Kollegen. Doch er weiß, dass selbst das – sauberes, stets verfügbares Trinkwasser – für viele Menschen im Land bereits zum Luxus geworden ist.
„Herein!“, ruft er noch einmal deutlicher. Kerzengerade steht er mitten im Raum, die Hände hinter dem Rücken, die Füße zusammen – weniger wie ein Architekturprofessor, sondern wie ein Soldat, der auf Befehle wartet.
Die Tür wird geöffnet, seine Assistentin tritt in sein Büro: „Herr Professor, es ist Zeit für Ihre 14-Uhr-Vorlesung. Ihre Studenten warten sicher schon auf Sie.“
Pavel blickt auf seine Armbanduhr: 14:20 Uhr, er hat über seinem Modell die Zeit übersehen. „Natürlich, die Vorlesung“, murmelt er in sich hinein, „danke, Natascha, das hatte ich völlig vergessen.“ Er nimmt den Datenträger, den sie ihm hinhält, nickt ihr zum Dank zu und macht sich schnellen Schrittes auf den Weg zum Vorlesungssaal.
Als er diesen nach der Vorlesung verlässt, ist er in Gedanken schon längst wieder bei den Gebäuden, Pflanzen und Bewohnern im Miniaturformat, die seine Modellstadt bevölkern. Ihnen will er sich in den kommenden Stunden widmen – ungestört, nach Möglichkeit.
„Professor Litkow, antreten zum Rapport!“, hört er eine laute, ihm vertraute Stimme hinter ihm rufen. Pavel weiß, dass seine Modellstadt ein paar Minuten wird warten müssen. Er atmet tief durch, ehe er sich umdreht und übertrieben ernsthaft salutiert: „Jawohl, Professor Tristanov!“ Der andere erwidert den militärischen Gruß und bedeutet ihm, in sein Büro zu kommen. Beim Hineingehen wirft Pavel einen Blick auf das Türschild – er ist immer noch nicht sicher, ob es echt ist oder ob sein ältester Freund sich hier einen Scherz erlaubt hat: Ondrej Tristanov, Fakultätsleiter Musikalische Feindbeobachtung.
„Pavel, alter Freund, darf ich dir einen Willkommensdrink anbieten, nachdem du es endlich in mein kleines Reich geschafft hast? Du weißt ja, in unserer Disziplin gehört das zur Forschung dazu.“ Während Ondrej noch auf Pavels Antwort wartet, schenkt er sich selbst ein Glas ein. Whiskey, schätzt Pavel, wohl nicht der erste an diesem Nachmittag. Er selbst winkt dankend ab. „Mehr für mich“, meint Ondrej und lässt sich mit dem Glas in der Hand auf die weiße Ledercouch fallen. Pavel begutachtet derweil die Regale an den Wänden, die vom Boden bis zur Decke mit Festplatten und CDs gefüllt sind, das Eckregal ist voller Schallplatten; neben Abspielgeräten, die in einem Antiquariat nicht fehl am Platz wären, stehen zwei große Lautsprecherboxen, einige Kopfhörer liegen im Zimmer verstreut. Auf Bildschirmen unterschiedlicher Größe sind Bands aus mehreren Jahrzehnten bei Auftritten zu sehen, an die sich kaum noch jemand erinnert. Pavel meint, Taylor Swift bei ihrer Abschiedstournee erkennen zu können. Daneben in Schwarz-Weiß die Beatles? Oder doch die Stones?
„Keine schlechte Sammlung, was?“, lacht Ondrej. Pavel schüttelt den Kopf. Er hat es bislang bewusst vermieden, Ondrejs Büro aufzusuchen, als wäre nicht real, was er nicht sieht.
„Ist mir immer noch unbegreiflich, dass du einen Professorentitel und Geld dafür bekommst, dass du den ganzen Tag hier sitzt und Musik hörst. Feindliche, subversive Musik noch dazu, für deren Besitz normale Bürger mit etwas Pech hinter Gitter wandern würden“, murmelt er.
Ondrej richtet sich auf. „Natürlich handelt es sich hier um gemeingefährliches Kulturgut, Professor Litkow“, sagt er gespielt ernst und bricht im nächsten Moment in schallendes Gelächter aus. „Genial, nicht? Die Eierköpfe in der Regierung halten die Musik aus dem Westen für so gefährlich, dass sie ganz genau beobachtet werden muss. Ich leiste also streng genommen unter hohem persönlichem Einsatz wichtige Dienste für unser geliebtes Vaterland. Und kann endlich den ganzen Tag hören, was ich will. Fast ein wenig seltsam, dass vor mir niemand auf die Idee gekommen ist, sich den besten Job der Welt einfach selbst zu schaffen, nicht?“