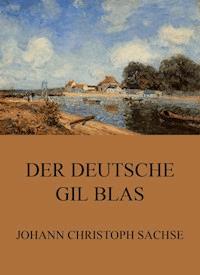
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leben, Wanderungen und Schicksale Johann Christoph Sachses, eines Thüringers
Das E-Book Der Deutsche Gil Blas wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Deutsche Gil Blas
Johann Christoph Sachse
Inhalt:
Der Deutsche Gil Blas
Vorwort
Erster Abschnitt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Zweiter Abschnitt
Dritter Abschnitt
Vierter Abschnitt
Eilftes Kapitel
Fünfter Abschnitt
Der Deutsche Gil Blas, J. C. Sachse
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634537
www.jazzybee-verlag.de
Der Deutsche Gil Blas
Eingeführt von Goethe
Oder Leben, Wanderungen und Schicksale Johann Christoph Sachses, eines Thüringers von ihm selbst Verfasst
Vorwort
Indem wir eine schon früher angekündigte Handschrift, welche das Jahr- und Tagebuch eines von Kindheit an hin und wider getriebenen Mannes enthält, unter dem Titel »Der deutsche Gil Blas« nunmehr gedruckt einführen, so müssen wir, um nicht übermäßige Hoffnungen zu erregen, diesen Schritt sogleich bevorworten und vor allen Dingen erklären: daß der französische »Gil Blas« ein Kunstwerk, der deutsche dagegen ein Naturwerk sei und daß sie also in diesem Sinne durch eine ungeheure Kluft getrennt erscheinen.
Allein sie lassen dem Inhalt nach gar wohl eine Vergleichung zu; denn auch bei dem deutschen ist der Charakter gut von Haus aus, läßlich, wie es einem Untergeordneten geziemet, der sich von Kindheit auf zu fügen hatte. Wer die Menschen braucht, von ihnen abhängt, nimmt's nicht genauer, als sie es selbst haben wollen, und so ist denn unser Held latitudinarisch gesinnt, bis zur Intrige, bis zum Kuppeln. Weil er aber durchaus seine rechtlichbürgerlichen Anlagen nicht verleugnen kann, so verdirbt er sich jederzeit seinen Zustand, wenn er streng-sittlich und pflichtgemäß handeln will. Weil nun dieses alles, den Umständen zufolge, ganz natürlich zugeht und nicht etwa eine kunstreiche Ironie uns zum besten hat, so besticht der gute, ruhige Vortrag von immer menschlich bedeutenden, wenn auch nicht wichtigen Ereignissen. Jedoch ist auch das wachsende Leben des Mannes in äußern Beziehungen merkwürdig, indem der Umgetriebene, sich selbst Umtreibende von mancherlei neueren Weltereignissen Zeuge wird.
Ähnliche Bücher finden sich in Bibliotheken und Lesegesellschaften sehr vergriffen, und auch dieses würde sich den Bücherverleihern wohl rentieren; man dürfte es die Bibel der Bedienten und Handwerksbursche nennen, denn es ist in den untern Ständen wohl niemand, der seine Schicksale nicht hie und da abgespiegelt fände. Auch der Mittelstand wird angenehm belehrende, häusliche Bürgerlichkeiten gewahr werden; besonders nimmt sich die Wohltätigkeit der Frauen gegen solche privilegierte junge Landstreicher gar löblich aus und charakterisiert sich verschieden in den verschiedenen Landen. In Niederdeutschland und Holland kommt dem vagierenden Gesellen die Erinnerung an Gatten und Söhne, auf und über dem Meere, gar sehr zustatten, und wenn wir ähnliches Wohlmeinen weiter nach Oberdeutschland gefunden, so bringt uns zuletzt eine Französin zum Lächeln. Unser Abenteurer kehrt, als Bedienter eines Emigrierten, aus der unglücklichen Kampagne zurück; die verarmten Herren entlassen ihre Leute, und diese, um nicht zu verhungern, müssen sich aufs Plündern legen. Der unsrige wird von einem französischen Landmann, aus dessen Hof er eben eine Henne wegträgt, festgehalten und mit großem Geschrei ins Haus geschleppt. Die Frau sieht der Sache geruhig zu und spricht: »Laß ihn doch, es ist ein armer deutscher Bedienter, der auch einmal von einer französischen Henne kosten wollte.«
Selbst die obern Stände werden nicht ohne Erbauung das Büchlein durchlesen, besonders wenn es ihnen auffällt: wie es wohl aussehen möchte, wenn ihre Bedienten auch dergleichen Bekenntnisse schrieben. Und so gestehen wir denn ebenfalls, daß wir, bei Lesung dieses ziemlich starken Bandes, zu frommen Betrachtungen angeregt worden; denn man glaubt doch zuletzt eine moralische Weltordnung zu erblicken, welche Mittel und Wege kennt, einen im Grunde guten, fähigen, rührigen, ja unruhigen Menschen auf diesen Erdenräumen zu beschäftigen, zu prüfen, zu ernähren, zu erhalten, ihn zuletzt durch Ausbildung zu beschwichtigen und mit einer geringen Ruhestelle zu entschädigen.
In diesem Sinne kann man solche Bücher wahrhaft erbaulich nennen, wie es der Roman, moralische Erzählung, Novelle und dergleichen nicht sein sollen; denn von ihnen als sittlichen Kunsterscheinungen verlangt man mit Recht eine innere Konsequenz, die, wir mögen durch noch so viel Labyrinthe durchgeführt werden, doch wieder hervortreten und das Ganze in sich selbst abschließen soll.
Das Leben des Menschen aber, treulich aufgezeichnet, stellt sich nie als ein Ganzes dar; den herrlichsten Anfängen folgen kühne Fortschritte, dann mischt sich der Unfall drein, der Mensch erholt sich, er beginnt, vielleicht auf einer höheren Stufe, sein altes Spiel, das ihm gemäß war, dann verschwindet er, entweder frühzeitig, oder schwindet nach und nach, ohne daß auf jeden geknüpften Knoten eine Auflösung erfolgte.
Wie man nun aber von keinem Roman, groß oder klein, sagen soll, hier sei viel Lärmen um nichts, denn dies könnte man auch von der Ilias behaupten, noch weniger verdient ein Menschenleben verächtlich behandelt zu werden, weil es offenbar im Leben aufs Leben und nicht auf ein Resultat desselben ankommt und wir den Geringsten mit Achtung anzusehen haben, wenn wir in seiner einfachen Geschichte bemerken, daß eine höhere Hand sich vorbehalten hat, unsichtbar einzugreifen und dem Verdüsterten, Trübseligen, im Augenblick Hülflosen über einige Schritte hinweg auf eine glatte Bahn zu helfen.
Wie denn auch Johann Kaspar Steube, Schuhmachermeister in Gotha, seine unruhigen Irrfahrten erzählend, so wie Plutarch, ein weiser, gelehrter Mann von Chäronea, die größten Helden vorführend, beide sich nicht anders zu helfen wissen, jener in eigenen, dieser in weltgeschichtlichen Begebenheiten, als daß sie ein über alle waltendes, höchstes, unerforschliches Wesen annehmen.
Indem wir nun wünschen, daß unsere Leser von dem Büchlein, das wir ihnen anbieten, nicht ganz unbefriedigt scheiden mögen, so empfehlen wir ihnen ein anderes, wo der Held auf einem beweglichem Elemente sich bedeutender hin- und hertreibt: Joachim Nettelbecks Leben, von ihm selbst aufgezeichnet. Zu Kolberg, an der See, zur See geboren, wirft er sich als Knabe schon, der Ente gleich, auf das gefährliche Element und gibt uns Anlaß, jene oben schon berührten Betrachtungen abermals zu wiederholen und auf mancherlei Weise hin und her zu wenden; deshalb wir auch weder durch Erzählung noch Urteil dem Leser vorgreifen, sondern nur soviel sagen: daß es keinem Bewohner des festen Landes unbekannt bleiben dürfe, damit er, bei so vielfachen Unfällen, die auch ihm begegnen, des grenzenlosen Jammers gedenke, dem der Seemann täglich entgegensieht.
Wenn uns nun auch dieses Büchlein in kurz vergangene und doch schon beinahe verschwundene Zustände versetzt, so ist ein anderes, das uns einige Jahrhunderte rückwärts ruft, gleichfalls hoch zu schätzen; wir wenigstens bekennen gern, daß uns nie so deutlich geworden, wie es in Deutschland in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts ausgesehen, als durch die Begebenheiten eines schlesischen Ritters Hans von Schweinichen, von ihm selbst aufgesetzt. (Herausgegeben von Büsching, 1. Band, Breslau 1820.)
Dem für das deutsche Altertum so löblich bemühten Herausgeber sind wir schon so manche Mitteilung von alten Gerätschaften, Waffen, Geschirren, Siegeln und Bildwerken schuldig, deren Anblick uns immer ein Mitgefühl gibt, wie es zu der Zeit ausgesehen haben mag, da sie gefertigt und gebraucht wurden. Nun aber verbindet er sein Publikum doppelt und dreifach, indem er die wunderlichsten Menschen, wie sie vor mehr als zweihundert Jahren in Deutschland gehaust, unmittelbar zur handgreiflichsten Nähe bringt! Wie wundersam hatten sich die Zeiten seit Götz von Berlichingen und Schertlin von Burtenbach geändert, in welcher andern, aber widerwärtigern Verwirrung finden wir das liebe Deutschland in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. Genanntes Buch, dessen Fortsetzung wir wünschen, wird gewiß jeden Deutschen höchlich interessieren, aber ihm auch gar manches Kopfschütteln ablocken; wie denn auch die unwandelbare tätige Treue eines wackern Edelmanns gegen den wunderlichsten aller fürstlichen Gebieter gewiß eine beifällige Teilnahme bewirken wird.
In Gefolg alles dieses enthalt ich mich nicht einer allgemeinen Betrachtung. Die Geschichte denkt uns vor, der Roman fühlt uns vor, und so genießen wir an beiden völlig zubereitete Speisen. Die Schrift aber, die uns nur Stoff überliefert, fordert von uns, ihn zu verarbeiten, eigene Tätigkeit, zu der wir nicht immer aufgelegt sind, eigene freie Übersicht und Fertigkeiten, das Gewonnene zurechtzustellen, die nicht einem jeden gegeben sind; deswegen auch ein französisches Buch, »Voyage de Montaigne par Querlon 1772«, in Frankreich ungeachtet des berühmten und gefeierten Namens bei seinem Erscheinen Mißfallen erregt hat, und zwar ganz natürlich, weil Stoff und Gehalt tagtäglich nebeneinander stehen, aufeinander folgen und erst einen Geist erwarten, der seinen Vorteil daraus zu ziehen weiß.
Ein Franzose selbst findet unbillig, daß dieses Buch keine gute Aufnahme gefunden, und drückt sich darüber folgendermaßen aus: »Da man aber köstliche Stellen darin findet, die sich auf Sitten, Künste und Politik beziehen, auch solche, woran man den Geist und den Charakter des Verfassers deutlich erkennen mag, so hat man wohlgetan, diese Reise abdrucken zu lassen. Man trifft darin gar manche Dinge, die man gern beschrieben sieht durch einen Gleichzeitigen, durch einen Augenzeugen, und zwar einen solchen wie Montaigne. Die einzelnen Posten der Geldausgaben unterwegs können das Verhältnis des Geldeswerts in unsern Tagen zu beurteilen diensam werden.«
Ein solcher Mann ist fast merkwürdiger in seinem täglichen Handeln, als wenn er schreibt: der lebendige Mensch erklärt auf alle Fälle den Schriftsteller. Montaigne unternimmt 1580 eine Reise zu Pferde; mit einem anständigen Gefolge zieht er aus, und wenn ihm schon Unglaube, ja Haß gegen die Ärzte und Medizin eingefleischt ist, so glaubt er doch an die Wirksamkeit der Gesundbrunnen, besucht und kostet sie, auch läßt er uns, da seine Steinschmerzen dadurch und durch Bewegung gelindert werden, jederzeit wissen, wie er von Sand und Gries und sonstigen Übeln befreit worden. Aus Frankreich durch Lothringen und Elsaß zieht er bis Baden in der Schweiz, von da auf deutscher Seite bis Augsburg und München, durch Tirol und Italien und sieht sich endlich in Rom.
Wie unter solchen Umständen ein stracker, feiner, zartgesinnter, sich selbst beobachtender, neugieriger, mit einer gewissen anmutigen Eitelkeit behafteter französischer Edelmann in fremden Ländern hervortritt, ist wohl auf keine andere Weise zu schauen und zu erfahren.
Wenn ein deutscher gewandter, unterrichteter Schriftsteller dieses Werk sich zu eigen machte, das Bedeutende hervorhübe, das Allgewöhnliche, sich Wiederholende beseitigte, dagegen aber die Besonderheiten der damaligen Zeitgeschichte klüglich einzuschalten und mit diesen Tagebüchern zu verbinden wüßte, so würde gewiß ein erheiterndes und nützliches Lesebüchlein daraus entstehen.
Zwei Betrachtungen zum Schluß werden das empfohlene Buch dem Kenner noch wichtiger erscheinen lassen.
Montaigne, ein der römischen Kirche wie dem Königtum treulich und eifrig zugetaner Ritter, unternimmt die Reise acht Jahre nach der Pariser Bluthochzeit und sucht in Deutschland eifrige freie Unterhaltung mit katholischen sowohl als protestantischen Geistlichen und Schullehrern über abweichende Glaubensbekenntnisse und Meinungen, wozu er sich der ihm geläufigen lateinischen Sprache zu bedienen weiß.
Sodann, obgleich fest an gewissen Vorurteilen und Gewohnheiten hangend, betrachtet er ganz freigesinnt, mit der heitersten Gerechtigkeit und Billigkeit, weltfremde Zustände und weiß sie dergestalt zu schätzen, daß er die deutschen Einrichtungen, es sei nun an Baulichkeiten, Hausrat, Bedienung und Tafel sowie polizeiliche Ordnung und Reinlichkeit, durchaus der französischen Lebensweise vorzieht. Mehr dürften wir zur Empfehlung eines solchen Werkes wohl nicht hinzufügen.
Kehren wir jedoch zu unsern Zeitgenossen zurück und bemerken: daß an unsere Naturprosaisten sich auch Naturpoeten unmittelbar anschließen, welche zusammen wohl eine besondere Rubrik in der deutschen Literatur verdienten, weil die sich vermehrende Erscheinung aller Aufmerksamkeit und Ermunterung wert ist.
Unsere Naturpoeten sind gewöhnlich mehr mit rhythmischen als dichterischen Fähigkeiten geboren, man gesteht ihnen zu, daß sie die nächste Umgebung treulich auffassen, landesübliche Charaktere, Gewohnheiten und Sitten mit großer Heiterkeit genau zu schildern verstehen, wobei sich denn ihre Produktion, wie alle poetische Anfänge, gegen das Didaktische, Belehrende, Sittenverbessernde gar treulich hinneigt. Wir machen vorläufig aufmerksam auf einen schon vorübergegangenen Mann dieser Art: Diederich Georg Babst, geboren in Schwerin 1741. Er ließ in seiner Jugend Anlagen zur Poesie hervorschimmern, indem er bei dargebotner Gelegenheit kleine Verse in hochdeutscher Sprache dichtete und sich hiedurch, so wie durch seine musikalischen Talente, beliebt zu machen, Gönner und Freunde zu erwerben wußte. Früh verwaist, sah er sich genötigt, selbst während der akademischen Studien, mittelst seiner musikalischen Talente sich Unterhalt zu verschaffen, und genoß durchaus, wegen geprüfter Rechtschaffenheit, die Achtung und Liebe seiner nunmehrigen Rostocker Mitbürger. Da aber ein sehr geringer Dienst ihn und die Seinigen nicht ernährte, begann er wieder durch poetische Versuche und den damit verknüpften Gewinn seine bürgerliche Existenz mehr zu sichern; feierliche oder merkwürdige Vorfälle besang er teils in hochdeutscher, teils in plattdeutscher Sprache. Im Jahr 1789 gab er eine Sammlung lustiger, aber wahrer Schwänke plattdeutsch in drei Teilen heraus, verfaßte nachher noch manches kleine Gelegenheitsgedicht in beiden Mundarten, worin er merkwürdige, für Rostocks Bewohner interessante Begebenheiten besang. Eine besser nährende Stelle, die ihm gegönnt ward, bekleidete er nicht lange und starb den 21. April 1800, betrauert und beweint von allen, die ihn kannten und liebten.
Wir besitzen durch Freundes Gunst einen nach seinem Ableben edierten Oktavband: »Uhterlesene pladdütsche Gedichte«, Rostock 1812, der mehrere höchst anmutige, größere und kleinere Dichtungen enthält, welche sämtlich die guten Eigenschaften besitzen, die wir oben von dem ganzen Geschlechte gerühmt. Ergötzlich ist es zu sehen, wie ein Mann, in dem bürgerlichen Wesen selbst befangen, sich durch geniale Betrachtung darüber erhebt und dasjenige, was wir sonst als Philisterei, Bocksbeutel, Schlendrian und alberne Stockung zu verachten pflegen, in seiner natürlichen anmutigen Notwendigkeit sehen läßt und uns solche beschränkte Zustände dulden, schätzen und lieben lehrt.
Und so sei denn zum Schlusse gesagt, daß wir eine ähnliche Gabe, jedoch höherer Art, zu erwarten haben. August Hagen, von Königsberg, Verfasser von »Olfried und Lisena«, hat, wie wir hören, mehrere kleine Gedichte eigentümlichen Zuständen seiner vaterländischen Gegend gewidmet, wir wünschen solche bald gedruckt zu sehen. Uns wenigstens ist es höchst erfreulich, wenn ein wahres dichterisches Talent sich dem Besondern widmet und das, was dem Menschen als gemein und alltäglich vorkommt, in aller Eigentümlichkeit glänzend hervorzuheben weiß, wovon in dem genannten Heldengedichte schon die schönsten Beispiele vorhanden sind; wie wir denn überhaupt von der Ostsee her kräftigen Sukkurs für die reale Dicht- und Darstellungsweise nächstens zu hoffen haben.
Weimar, am 8. April 1822
Goethe
Erster Abschnitt
Erstes Kapitel
Daß der Mensch, gleich dem Vogel, da, wo er lebt, öfters Nachkommenschaft hinterläßt, ohne zu wissen, in welchen Erdteilen sie in der Folge zerstreut leben werde, ist eine bekannte Sache.
So hauseten die wohlhabenden Vorfahren meines Vaters in dem durch »Die deutschen Kleinstädter« berüchtigten Orte Crawinkel, der früher nur wegen der großen Mühlsteine im Rufe stand, welche daselbst gebrochen werden; mein Vater aber lebete schon im Jahr 1746 in Thüringen, mit seiner ersten, wohlbegüterten Frau, die ihm sechs Kinder geboren hatte, ihm aber 1758, als er eben als Proviantkommissär bei der hannöverschen Armee stand, durch den Tod entrissen wurde. Hiedurch geriet er in die peinlichste Verlegenheit, in der er auf den Einfall kam, zu Abfindung der Kinder eins seiner Häuser zu verkaufen und sich wieder zu verheuraten.
Hätte mein Vater den Besitz ansehnlicher Ländereien gehörig benutzt, so hätte er davon mit seiner Familie recht gut leben und noch etwas erübrigen können; aber bei aller wirtschaftlichen Kenntnis war er nicht der Mann, der Fleiß auf Landwirtschaft wenden mochte, sondern ein unruhiger Kopf und vielwissender Spekulant, welcher sich nur durch Handel und Wandel zu bedeutender Wohlhabenheit glaubte emporschwingen zu können, weshalb er die größten Geschäfte unternahm.
Das Haus wurde wirklich verkauft, eine zweite Frau, meine Mutter, geheuratet und sein bisheriges Lieferantengeschäft zum Teil von meiner Mutter Vermögen und zu ihrem Nachteil fortgesetzt, wie der Erfolg lehren wird.
Nun kommt die Reihe an meine Wenigkeit. – Nach meinem Taufzeugnisse und der mehrmaligen Erzählung meiner Mutter war es der 13. August des Jahres 1761, als ich zu Cobstädt, einem thüringisch-sächsischen Dorfe bei Gotha, das Licht der Welt erblickte.
Hätten die Gestirne und Zeichen, unter welchen man geboren wird, wirklich Einfluß auf die Fähigkeiten und künftigen Schicksale der Neugebornen, so dächt ich, daß ich unterm Merkur und im Zeichen des Wassermanns geboren sein müßte, da der Frühling, Sommer und Herbst meines Lebens ein fast ununterbrochenes Umhertreiben gewesen ist, bei welchem mir das Weinen gar oft näher als das Lachen war.
Der Herr Pastor, Wilhelm Meister zu Cobstädt, mußte mir, meiner Schwächlichkeit wegen, die Nottaufe geben, in der ich den Namen Johann Christoph erhielt. Wer meine Paten wissen möchte, dem muß ich sagen, daß einer derselben Herr J.C. Gleine, Hauslehrer des Herrn Pastors, der andere aber der Herr Schulmeister Cott zu Reichenbach war.
Der Reihe nach war ich das achte von den zwölf Kindern meines Vaters und das zweite meiner Mutter, seiner zweiten Frau, einer gebornen Thomassin aus Reichenbach. Wäre mein Vater nur halb so wirtschaftlich und für das Glück seiner Kinder so zärtlich wie sie besorgt gewesen, so würde das Schicksal unserer Familie vielleicht eine freundlichere Wendung genommen und ich nicht nötig gehabt haben, eine Art von Abenteurer in der Welt zu spielen.
Vergebens bemühete sich mein Vater, meine Mutter zu bereden, mit ihm auf gut Glück im Kriegsfelde herumzuziehen und ihr ganzes beträchtliches Vermögen seinen leichtsinnigen Spekulationen preiszugeben; sie war durch einige bedeutende Aufopferungen gewarnt worden, seinen Vorspiegelungen Glauben beizumessen.
Hierdurch entstanden zwischen beiden verdrießliche Verhältnisse, welche meine Mutter plötzlich veranlaßten, von Cobstädt wieder hinweg und auf ihr Gut nach Reichenbach zu ziehen, wohin sie mich als Wickelkind mitnahm.
Nach geendigtem Kriege kehrte mein Vater zu meiner Mutter mit einer reichen Beute, d.h. einer abgetragenen Uniform, einem Degen, einem alten Pfeifenkopf und leerem Tornister zurück, womit er unmöglich die Vormünder meiner Stiefgeschwister befriedigen konnte. – Nun war guter Rat teuer! Verklagt von den Vormündern, mit Vorwürfen von meiner Mutter überhäuft, mißvergnügt über seine mißlungene Spekulation, suchte er sich so gut als möglich zu helfen und legte eine Brauerei und Branntweinbrennerei an, die ihm aber ebensowenig als der Handel abwarf, welchen er nebenbei trieb.
Unter dergleichen häuslichen Verhältnissen hatte ich das fünfte Jahr erreicht und wurde nun zu meinem vorgenannten Paten in die Schule geschickt, worin ich solche Fortschritte machte, daß ich bis zum neunten Lebensjahre nicht nur einen guten Grund im Christentum, Rechnen, Schreiben und in der Weltgeschichte gelegt, sondern es auch in der Musik so weit gebracht hatte, daß ich auf dem Chor ziemlich fertig ein Rezitativ oder eine Arie vortragen konnte. Diese Vorkenntnisse kamen mir in der Folge sehr wohl zustatten.
Während dieser Schuljahre gab mein Vater seine Brennerei und Brauerei auf und legte sich bloß auf Handelsgeschäfte, in denen er öfters abwesend war.
Die häufigen Tränen, welche meine Mutter vergoß, wenn er, ohne Geld mitgebracht zu haben, Geld zu einer neuen Reise einpackte, ließen mich vermuten, daß es mit seinem Handelsglück nicht zum besten stehen müsse; aber diese Vermutung wurde zur Gewißheit, als meine Mutter ihm vorwarf, daß er seinen ungewissen Spekulationen nicht nur sein eignes beträchtliches Vermögen, sondern auch einen ansehnlichen Teil ihres Eingebrachten aufgeopfert habe.
Dieses häusliche Mißverhältnis stieg im Jahr 1768 fast aufs höchste, indem meine Mutter durch das Ableben ihrer Mutter nicht nur ihre beste Stütze gegen die Geldforderungen meines Vaters, sondern dieser selbst auch durch eine unglückliche Feuersbrunst sein letztes Haus in Cobstädt verlor.
Die drückende Teurung, welche im Jahre 1771 in Thüringen herrschte, erregte in meinem Vater die Hoffnung, sich durch Fruchtaufkauf wieder zu helfen. Deswegen verband er sich mit einem weitläufigen Verwandten, dem bekannten Hofjäger Hauptmann in Weimar, der oft bei meinen Eltern gewesen war, und holte, auf gemeinschaftliche Gefahr, Getreide aus dem Hessischen.
Wirklich hatt er anfangs einen so vorteilhaften Absatz, daß er meiner Mutter, die ihrer Niederkunft entgegensah, ansehnliche Geldunterstützung senden konnte.
Zweites Kapitel
Erste Wanderung, um den Vater aufzusuchen
Einst blieb er ungewöhnlich lange aus; dies beunruhigte meine Mutter so sehr, daß sie mir und meinem Unglücksbruder Simon zumutete, ihn in Karlshafen, einem neuangelegten hessischen Städtchen, aufzusuchen, weil er ihr geschrieben hatte, daß er zu Tietelsen, unweit Karlshafen, eine Wirtschaft gekauft habe.
Unsere unerfahrne Jugend machte uns sogleich bereitwillig, und die Begierde, bald unsern Vater zu sehen, siegte über alle Bedenklichkeiten, die einige bedachtsamere Freunde dem Vorhaben meiner Mutter entgegensetzten. Es war im Juni des Jahres 1771, als wir uns, von den Segenswünschen unsrer guten Mutter begleitet, leicht bepackt auf den uns unbekannten Weg machten. Nach einer Reiseroute, welche der Vater meiner Mutter zugeschrieben hatte, nahmen wir unsern Weg über Langensalza, Mühlhausen und Heiligenstadt, ohne uns aufzuhalten.
Eine Tagreise von Karlshafen hatten wir uns eben am Wege niedergesetzt, um unsre Barschaft zu überzählen, als mein Bruder folgendes Gespräch einleitete:
Simon: Was fangen wir an, wenn unsere paar Groschen alle sind und wir den Vater nicht fänden?
Ich: Je nun, dann sagen wir, wir sind Hannegörge Sachsens Kinder, dann werden uns die Leute schon so viel geben, daß wir wieder nach Hause kommen können.
Eben wollte mir mein Bruder einen Einwurf machen, als zwei Reisende zu uns traten und uns frugen, wo wir hinwollten.
Wir: Nach Karlshafen.
Sie: Was wollt ihr denn da machen?
Wir: Unsern Vater aufsuchen.
Sie: Wer ist denn euer Vater?
Wir: Er heißt Hannegörge Sachse.
Sie: Wo seid ihr denn her?
Wir: Aus Sachsenland.
Sie: Daß Gott, ihr Kinder, wir kennen euern Vater; ihr werdet ihn schwerlich antreffen, denn er ist in Wanfried.
Jetzt brachen wir in bittere Tränen aus und wollten wieder umkehren; aber die beiden Männer sprachen uns wieder Mut ein und sagten, wir sollten mit ihnen gehen, sie wollten uns nach Karlshafen zu Herrn Kümmel bringen, bei welchem unser Vater einzukehren pflege.
Als wir dahin kamen, erfuhren wir leider, daß diese Leute uns die Wahrheit gesagt hatten, denn man versicherte uns, daß unser Vater in Geschäften auf der Weser sei und wohl so bald nicht kommen würde. – Schon flossen unsre Tränen von neuem; da legte sich die Frau Wirtin ins Mittel und sagte: »Weinet nicht, Kinder, bleibt bei mir, bis euer Vater kömmt; er wird so lange nicht aus sein.« Diese mitleidige gute Frau bewirtete uns auf das beste, und um uns zu beschäftigen, gab sie uns Erbsen, Linsen, Buchnüsse und dergleichen zu lesen, welches wir mit Freuden taten.
Da der Vater nach vierzehn Tagen noch nicht da war, mußten wir von diesem und jenem Spottreden darüber anhören, die uns durch die Seele gingen, deswegen benutzten wir mit Freuden eine Gelegenheit, die sich uns darbot, frei mit nach Wanfried zu kommen. – Des schlechten Wetters wegen mußten wir den ganzen Tag über im Schiffsraume stecken und des Nachts auf dem harten, feuchten Boden schlafen, ohne daß irgend jemand nach uns gefragt oder sich um uns bekümmert hätte, da die Mannschaft vollauf zu tun hatte.
Den andern Tag kamen wir zwar nach Wanfried, erfuhren aber auch hier mit Entsetzen, daß der Vater nicht da wäre. Zum Glück trafen wir in dem Gasthofe, wo wir einkehrten, Fuhrleute an, die sich unserer erbarmten und uns bis Mühlhausen mitzunehmen versprachen. Diese guten Leute warfen uns unterweges so viel von ihren Mahlzeiten zu, daß wir uns immer sättigen konnten; wo sie einkehrten, hatten wir freie Herberge und dankten Gott, als wir durch sie unsrer Heimat wieder näher kamen.
Vor Mühlhausen verließen wir sie unter Tränen des Dankes und setzten an demselben Tage unsern Weg noch bis Großengottern fort, wo wir gegen Abend ankamen. – Am Ende des Dorfes hatten wir uns ermüdet niedergesetzt und klagten eben einander unsern Hunger, als eine betagte Frau mit einem Wassereimer auf uns zukam und uns frug, wohin wir wollten. – »Heim«, antworteten wir, »wir haben unsern Vater verloren!«
»Daß Gott erbarm«, rief sie, ging nach dem Brunnen, schöpfte Wasser und hieß uns auf dem Rückwege, ihr zu folgen, welches wir uns nicht zweimal sagen ließen. Kaum waren wir in ihrer Stube, so hieß sie uns setzen und brachte bald darauf jedem von uns einen Schmierkäsefladen, den wir mit dem größten Heißhunger verzehrten, während sie sich hinter das Spinnrad setzte und allerhand Fragen an uns tat, die wir ihr mit der größten Unbefangenheit beantworteten. – Das gute Mütterchen hatte gewähnt, unser Vater sei gestorben; als wir ihr aber diesen Irrtum benommen und uns für ihre Mahlzeit bedankt hatten, sagte sie: »Heute kommt ihr doch nicht mehr nach Hause, und da ihr kein Geld habt, wo wollt ihr denn bleiben?« – »Unter einem Baume, wenn es nicht anders ist«, war unsre Antwort. »Nein«, erwiderte sie, »das sollt ihr nicht! Ich will euch schon ein Nachtlager machen und morgen noch einen Matzfladen mit auf den Weg geben, wo ihr wohl noch andere mitleidige Herzen finden werdet, die euch ein Stückchen Brot mitteilen.«
Dankbar nahmen wir ihr Anerbieten an und verließen sie früh unter guten Wünschen. Sie hatte wahr gesprochen; von gutherzigen Menschen unterstützt, kamen wir, nach dreiwöchentlicher Abwesenheit, wieder in unsrer Heimat an.
Ohne rechts oder links zu blicken, gingen wir dem Dorf entlang stumm und in uns gekehrt unserm Hause zu; wehmütig und angstbeklommen traten wir in den Hof, und das Haar sträubte sich mir zu Berge, als ich die Stubentüre öffnete und die Überraschung der erstaunten Mutter gewahr wurde. Wir vermochten kein Wort hervorzubringen als: »Mutter, wir haben den Vater – nicht gefunden!« – »Nicht?« rief sie mit einem herzdurchschneidenden Schrei und sank fast ohnmächtig auf einen Stuhl.
Nach einer langen Pause wagten wir es erst, ihr in abgebrochnen Sätzen unsre Reiseabenteuer zu erzählen; tausendmal wurden wir durch gegenseitiges Weinen und Schluchzen und durch Zweifel der Mutter unterbrochen, ob unsre Erzählung auch wahr sei und ob wir wirklich in Karlshafen gewesen wären. Erst als wir unsre Reisegeschichte zehnmal wiederholt und jeden Einwurf wie Katechismusfragen beantwortet hatten, fing sie an, uns Glauben beizumessen, und versank in melancholischen Schmerz. In dieser Stimmung blieb sie wohl vierzehn Tage lang, wo ein Brief meines Vaters eintraf, in dem er ihr schrieb, wie leid es ihm tue, daß wir ihn nicht angetroffen hätten; er sei während unsrer Anwesenheit auf dem Lande gewesen, um Frucht aufzukaufen, mit welcher er nächstens nach Thüringen kommen würde. – Einige Tage darauf kam er wirklich, und als meine Mutter ihm die Unmöglichkeit schilderte, sich und die fünf Kinder in der großen Teurung zu erhalten, so brachte er wieder die Zumutung aufs Tapet, daß sie ihr Haus und sonstiges Eigentum verkaufen und ihm mit uns nach Tietelsen, seiner neuerkauften Meierei, folgen möchte.
Da sie aber erklärte, daß sie lieber in ihrer Heimat mit den Kindern Hungers sterben als in ein Land ziehen wollte, wo, wie sie gehört hätte, Leibeigenschaft herrsche, so sagte er: »Nun so bleib und behalte drei Kinder, den Hannetöffel und den Simon will ich mitnehmen.«
Dieser Beschluß blieb unabänderlich und nötigte die gute Mutter, das Nötige zu unsrer Abreise selbst instandzusetzen.
Abreise mit dem Vater nach dem angeblich gelobten Lande
Kaum hatten wir uns von den Strapazen unsrer ersten Reise erholt, so mußten wir schon wieder unsre Reisepäckchen schnüren, welche diesmal weit größer und schwerer wurden. An einem heißen Julimorgen des Jahres 1772 nahmen wir zum zweiten Male von unsern Geschwistern und unsrer trostlosen Mutter mit tränenden Augen Abschied und wanderten an der Seite des Vaters unsrer neuen Heimat zu. Um uns zu zerstreuen, war derselbe sehr gesprächig und spiegelte unsrer jugendlichen Einbildungskraft liebliche Szenen der Zukunft vor.
Auch kam er auf die Vergangenheit zurück und erzählte uns unter andern, daß er im Siebenjährigen Kriege als hannöverscher Proviantkommissär außerordentlich viel erworben, aber alles auf einmal wieder verloren hätte. Er hätte nämlich Auftrag erhalten, einige Oxhoft Wein, welche man bei Hameln dem Feinde abgenommen, unter die Truppen zu verteilen. Da es ihm zu beschwerlich gewesen wäre, eine ganz mit Gold gespickte Katze um den Leib mit sich herumzutragen, so hätte er sie in dem Hintergrunde seines Zeltes in die Erde vergraben. Als er es nach vollendetem Geschäft wieder ausgraben wollen, habe statt der Katze voll Gold ein Stein an der Stelle gelegen. Ferner habe er bei Thamsbrück ohnweit Langensalza eine beträchtliche Lieferung von Fourage auf eigne Rechnung durch die Feinde verloren, wodurch sein Vermögen den härtesten Stoß erlitten hätte. – Dergleichen trauliche Erzählungen aus dem Munde unsers Vaters gegen uns waren uns nichts Neues, doch flößten sie uns Vertrauen auf seine Versicherung ein, daß die zu Tietelsen angekaufte Meierei durch Anlegung einer Stärkenmanufaktur, Brennerei, Mast und dergleichen daselbst ihm größere Vorteile als das beste Baurengut anbiete, daß ihm die Sonne des Glücks daselbst gewiß aufgehen und alles wieder ersetzen würde, was er verloren habe. Kaum konnten wir die Zeit erwarten, dieser Glückssonne nahe zu kommen; mutig ertrugen wir Sonnenhitze, Hunger und Durst, bis wir Karlshafen erblickten, in dessen Nähe unser künftiges Paradies sein und daselbst Milch und Honig fließen sollte.
Vor Karlshafen mußten wir uns umkleiden, waschen, kämmen und unsern Sonntagsstaat anlegen, in welchem wir darauf dem Herrn Gastwirte Kümmel, den wir schon kannten, vorgestellt wurden. Wir alle wurden freundlich von ihm und seiner Frau bewillkommt, welche uns, während sich mein Vater mit ihrem Mann unterhielt, eine Kammer anwies, um darin unsre Reisepäckchen abzulegen.
Nachdem wir uns etwas erholt und gesättiget hatten, sahen wir uns in der Stadt und in der Gegend um, die wegen der mit Walde bewachsenen Berge, zwischen welchen die Weser dahinfließt, und wegen verschiedener alter Burgruinen über der Weser recht angenehme Ansichten darbietet.
Kaum waren uns unter solchen Zerstreuungen einige Tage verflossen, als mein Vater uns erklärte, daß wir uns nun selbst unser Brot mitverdienen müßten. Damals war ich zehntehalb und mein Bruder kaum acht Jahr alt.
Unser Herr Wirt trieb starke ökonomische Geschäfte, Brauerei und Branntweinbrennerei, und hatte auch Geschäfte bei der Saline; in all diesen Zweigen stand mein Vater ihm hülfreich bei, weshalb er oft acht bis vierzehn Tage für ihn abwesend sein mußte. Außer mancherlei häuslichen Verrichtungen, die man uns zuteilte, mußten wir während der Heuernte mit an die Hand gehen, nach des Vaters Anleitung Fische in der Weser fangen und allerhand Waldbeere[n] eintragen, welche dort in Menge wuchsen.
Waren wir fleißig gewesen, so bekamen wir dafür täglich einen Weißpfennig, oder neun Pfennige, zum Lohn, welchen wir, bei manchmal sehr spärlicher Kost, uns zu Spielgelde sparten, das wir sonntags mit den Jungen der Nachbarschaft vertaten, denen unser thüringischer ländlicher Dialekt ebenso komisch als uns ihre plattdeutsche Mundart klang, welche wir unter ihnen bald verstehen lernten.
Den Sommer über hatten wir mehr gute als böse Tage daselbst verlebt. Aber als nach Michaelis die Witterung rauher wurde und meines Vaters Verdienst abnahm, da begannen auch unsre Trauertage. Eines Tages, wo die Witterung äußerst ungünstig war, wurden wir von dem Vater mit den Angeln ausgesandt; all unsre Mühe war und blieb vergebens, wir mochten ächzen, beten, seufzen, weinen, so fingen wir doch keinen Fisch und mußten, von Kälte erstarrt, nach Hause zurücke kehren. Der Vater, der schon seit einigen Tagen sehr mißlaunig war und auf einen guten Fang gerechnet hatte, wurde über unser langes Außenbleiben und darüber, daß wir nichts mitbrachten, so jähzornig, daß er wütend über uns herfiel und uns auf das unmenschlichste mißhandelte. Er würde uns zu Krüppeln geschlagen haben, hätte sich Herr Kümmel nicht unsrer barmherzig angenommen und meinem Vater ernstlich ins Gewissen geredet. Die Folge davon war, daß ich einige Wochen lang krank blieb, wo ich keinen Trost als den der sorgfältigsten Pflege und Wartung meines guten Bruders hatte, welcher mit der innigsten Liebe an mir hing. O warum mußt ich ihn so früh verlieren!
Drittes Kapitel
Abgang von Karlshafen und Einzug in die Meierei zu Tietelsen
Während meiner Krankheit hatte der Vater sich mit den Vorkehrungen zum Einzug in seine Meierei beschäftigt und, zur Anlegung der Stärkemanufaktur, ein paar Säcke Weizen und Kartoffeln angeschafft, welche damals außerordentlich geraten waren.
Kaum war ich genesen, so mußte ich mit meinem Bruder mich zum Abgang nach Tietelsen anschicken, wo wir künftig uns wenigstens drei Kühe halten, jährlich unsre Schweine und anderes Vieh schlachten, Holz in Überfluß, alle Woche unsern Braten und – mit einem Worte – die besten Tage von der Welt haben würden.
Unvergeßlich ist mir der Montagsmorgen, wo wir unsern bisherigen braven Wirtsleuten unser Lebewohl sagen und dem Vater nach seinem angeblichen Paradies folgen mußten. Unterweges dahin machte uns derselbe auf die treffliche Weide und außerordentliche Waldung aufmerksam, in welche man sein Rind- und Schweinevieh treiben könne; er schilderte uns den Nutzen, welchen die Buchen wegen des Öls und die Eichen wegen der Schweinemast gewährten; aber er verschwieg uns, daß man zum Ankauf des Viehes Geld haben müsse, daß nur in strengen Wintern, aber nicht im Sommer das Holz aus den mit Morast umgebenen Wäldern geschafft werden könne und daß mehr davon verfaule, als geschlagen werde.
Endlich kamen wir in das gerühmte Paradies, das, von andern Häusern isoliert, ringsum mit Leede umgeben war.
Schon in den ersten Tagen unsers Einzugs wurde der Vater gewahr, wieviel ihm fehle und daß er mit unsrer Hülfe allein seine Glücksplane nicht ausführen könne. Er beschloß daher, noch einen Sturm auf das Herz unsrer Mutter zu wagen, um sie zu bewegen, mit den übrigen Geschwistern zu uns zu ziehen und durch ihre Hülfe das Geschäft in Gang zu bringen. Nachdem er daher mir und meinem Bruder unsre Arbeiten während seiner Abwesenheit angewiesen und uns bei einem Freunde in einstweilige Beköstigung verdingt hatte, machte er sich ungesäumt, von unsern guten Wünschen begleitet, auf den Weg.
Der herannahende Winter und die verschiedenartigen Einwohner des Orts, die aus Franzosen, Juden und Katholiken bestanden, machten, daß wir uns wenig aus dem Hause wagten und sehnsuchtsvoll der Ankunft unserer Mutter und Geschwister entgegensahen.
Rückkehr des Vaters ohne unsre Mutter;
Annahme einer Haushälterin
Nach zehntägiger Abwesenheit kehrte der Vater zurück, aber ohne unsre Mutter. Auf unsre Frage nach ihr sagte er: »Kinder, ich kann nicht anders glauben, als daß sie mich und euch ganz aus dem Sinne geschlagen hat; denn sie war schlechterdings nicht zu bewegen, mir zu folgen, ob sie gleich zu Hause Hunger und Kummer leidet.«
Er untersuchte nun, was wir während seiner Abwesenheit fertiggemacht hätten, und fand, daß er mehr verloren als gewonnen habe. »Nein«, rief er endlich, »so geht es nicht; das muß ich ändern.«
Bald darauf brachte er eine Haushälterin ins Haus, unter deren tyrannischem Kommando das Leben uns vollends ganz zur Hölle gemacht wurde. Das Empörendste für uns war, daß wir, nach hessischer Landessitte, in die Militärliste mit eingetragen und sonach militärpflichtig gemacht wurden. Dies hatte der Vater selbst nicht vermutet und fing nun an, den unüberlegten Ankauf zu bereuen. Der harte Winter, der geringe Absatz seiner Fabrikate, die Unreinlichkeit der Haushälterin, die sich unsrer Reinigung fast gar nicht unterzog, alles dieses vermehrte den Mißmut meines Vaters in dem Grade, daß er sich entschloß, sein Haus wieder feilzubieten und, da er keinen Käufer fand, es mit uns auf einige Zeit zu verlassen.
Das Haus wird verlassen, und wir ziehen mit dem Vater herum
Im Dezember des Jahres 1772 machte der Vater uns seinen Entschluß bekannt, eine Reise nach Amsterdam zu unternehmen. Ehe wir abzogen, wurde erst alles in Ordnung gebracht: das Hausgeräte einem Freunde in Verwahrung gegeben, die Haushälterin entlassen, auch nicht einmal dem Haushahn Quartier gegeben. Beim Einfang desselben war der Vater in so blindem Eifer, daß er meinem armen Bruder mit der Mistgabel den rechten Fuß durchstach, wodurch unsre Abreise um einige Tage verschoben werden mußte.
Endlich erschien der Tag, an welchem wir unserm bisherigen Paradiese Valet sagten; das Haus wurde verschlossen, und fort ging die Reise.
Die täglich abnehmende Barschaft unsers Vaters nötigte ihn, unsere Anlagen in Anspruch zu nehmen, um uns die nötigen Lebensbedürfnisse zu verschaffen. Wir wanderten daher Neujahr singend durch Paderborn, Münster, Nienborg und durch ganz Westfalen und wurden so reichlich belohnt, daß die Einnahme manchen Tages unsre dreitägigen Ausgaben deckte. Den Leuten gefiel die thüringische Sitte des Neujahrsingens, ob sie gleich wenig von unserm Singsang verstanden.
Reise des Vaters nach Amsterdam;
Zurückkunft desselben; Rückkehr nach
Tietelsen und Wiederabzug von da
An der holländischen Grenze sagte mein Vater, daß er nun seinen als Metzger in Amsterdam etablierten Bruder besuchen und, wenn er eine günstige Aufnahme bei demselben fände, zu uns zurückkommen und uns dahin abholen wolle, wir möchten uns indes auf der Grenze, in der Gegend von Schwoll, verweilen.
Die schnelle Rückkehr meines Vaters von Amsterdam mit trübem Blick und hinkenden Füßen ließ uns vermuten, daß er nicht gekommen sei, um uns dahin abzuholen. Diese Meinung bestätigte sich jedoch nicht. Sein Bruder hatte zwar große Augen gemacht, als er ihn in der schlechten Witterung überraschte; aber er hatte ihm alle mögliche Beweise seiner Bruderliebe gegeben und ihm erklärt, daß er mich zu sich nehmen wolle. Er brach nur darüber in Klagen aus, daß er seine Füße auf dieser Reise erfroren hätte. Dieser Unfall nötigte uns, bis zu seiner Genesung im Wirtshause stille zu liegen, wo die wenigen Dukaten verzehrt wurden, die er von seinem Bruder erhalten hatte, um mich zu ihm zu bringen, und die zweite Reise nach Amsterdam unterblieb. Sobald er wieder gehen konnte und seine Barschaft überzählte, sagte er: »Kinder, es bleibt mir kein Mittel übrig, als nach Tietelsen zurückzukehren und zu hören, ob sich noch kein Käufer zu meiner Manufaktur gefunden hat.« Wie die Schafe dem Hirten folgten wir ihm dahin und fanden, daß Ratten und Mäuse während unsrer Abwesenheit von dem verlaßnen Paradiese Besitz genommen hatten und daß fast das ganze Wesen vom Wind und Wetter zerstört war. Da war kein Kübel, kein Faß mehr ganz, Dach und Fach zerstört, als ob der Feind daselbst gehauset hätte. Dieser Anblick ging dem Vater zu Herzen, und jammernd rief er aus: »Herr, laß mich nicht ganz verderben! Zwar bin ich nicht wert der großen Güte, die du schon oft an mir getan hast, aber erbarme dich meiner!«
Durch die Nachlässigkeit seines Kompagnons, der sich seit unserm Abzuge nicht weiter um die Sache bekümmert hatte, war das Haus so in Verfall geraten, wie wir es fanden, und nun sah sich mein Vater genötigt, es dem Verkäufer wieder anzubieten, welcher sich endlich unter der Bedingung dazu verstand, daß mein Vater auf Entschädigung für alles verzichte, was er hineingewandt habe. Hiedurch erlitt mein Vater einen Verlust von einigen hundert Talern, und ärmer als jemals, ja ganz leer zogen wir von dannen ab nach Karlshafen.
Der Herr Gastwirt Kümmel schien an dem Mißgeschick meines Vaters innigen Anteil zu nehmen und riet ihm, sowohl seine in frühern Jahren erlangten tierärztlichen Kenntnisse als auch gewisse Ansprüche, die er sich im Siebenjährigen Kriege als hannöverscher Proviantkommissär auf ein eisernes Kapital von tausend Talern erworben hatte, geltend zu machen und deshalb eine Reise nach Hannover zu unternehmen.
Viertes Kapitel
Verfolgung des erteilten Rates, Reise von Karlshafen
Auf einmal hing bei meinem Vater der Himmel wieder voller Geigen; das verlorne Paradies war vergessen und der dabei erlittene Verlust so ganz verschmerzt, daß er, als wir am Folgetage Karlshafen verließen, uns hoffnungstrunken zurief: »Frischauf, Kinder, munter, lustig! Verlier ich hier zwar Haus und Gut, so hab ich doch noch frohen Mut!« etc. Die gute Laune unsers Vaters teilte sich uns mit, und uneingedenk der Vergangenheit wanderten wir guten Mutes mit ihm nach Hannover zu.
Unterweges hatten wir einen Auftritt, an den ich ohne Lachen nicht zurückdenken kann. Wir kamen in ein Wirtshaus, in welchem Werber und Musikanten waren, mit denen der Vater Bekanntschaft machte. Bald wurde man vertraut, das Gläschen ging im Kreise, so oft und so lange, bis mit den Werbern selbst die Stube im Kreise gehen mochte. Die Musikanten wurden aufgefordert, zu gewissen damals bekannten Gassenhauern, die ihnen vorgeträllert wurden, zu spielen. Einer der Werber sang ihnen das Lied vor: »Zwei Köpfe sind nicht gut zu bringen unter einen Hut«, während der andere verlangte zu spielen: »Fröhlich soll das Herze springen!« etc. – »Nein«, rief mein Vater auch dazwischen, »spielt lieber: ›Sooft ich meine Tabakspfeife mit gutem Knaster angefüllt!‹« etc. – Indem nun die Musikanten jedem sein Recht tun wollten, so spielte ein Musikant die Melodie des ersten, der andere die des zweiten und der dritte die Melodie des dritten Liedes, wodurch ein solches Quodlibet und ein solcher Lärm entstand, daß endlich alle Zuhörer die Ohren zuhielten und zum Zimmer hinausliefen. Mit vieler Mühe gelang es dem Wirte, diesem Katzenkonzert dadurch ein Ende zu machen, daß er sagte: »Ei was Singen und Spielen! Vorm Essen wird kein Tanz! – Der Tisch ist gedeckt, ein jeder an seinen Platz!« – »Es ist wahr«, sagte der Vater, »nach dem Essen, nach dem Trinken werden wir uns wohlbefinden.«
Nach dieser Losung ging man zur Mahlzeit, während welcher allerhand Späßchen gemacht wurden, wie sie unter dergleichen Gästen Mode sind. Nach Tische wurden wir





























