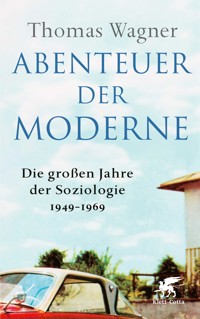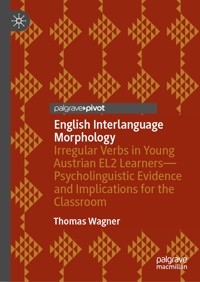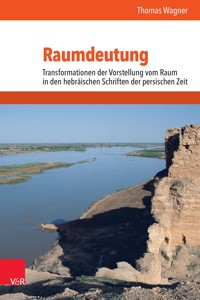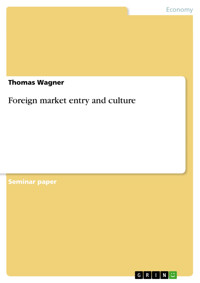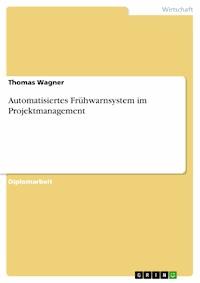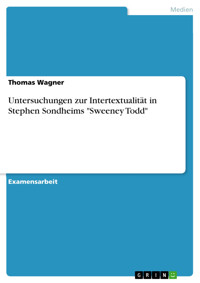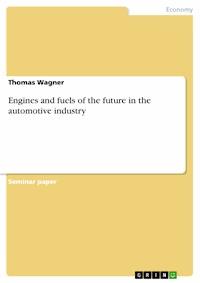15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
21. Januar 1983: Eine unwahrscheinliche Begegnung bahnt sich an. Michael Kühnen – Wortführer der Neonazi-Szene – und Erich Fried – jüdischer Dichter und glühender Antifaschist – sollten sich in einer Fernsehtalkshow begegnen. Doch kurzfristig wurde Kühnen ausgeladen. Die Überraschung war groß, als gerade Fried erklärte, dies sei ein Fehler gewesen. Es war der Beginn einer unglaublichen, ja verstörenden Freundschaft. Thomas Wagner erzählt die verblüffende Geschichte, wie aus einer unerwarteten Wendung ein über Jahre andauernder Austausch entstand. Die ungleiche Beziehung zwischen dem verurteilten Neonazi und besessenen Hitlerverehrer und dem Dichter, dessen Großmutter in Auschwitz ermordet worden war. Wagner nähert sich dabei einer der zentralen gesellschaftspolitischen Fragen unserer Zeit an: Wie soll man umgehen mit dem Wiedererstarken des Faschismus in Deutschland, Europa und der Welt? Zudem lernen wir zu seinem 100. Geburtstag Erich Fried neu kennen: als einen Linken, der unverbrüchlich an die Möglichkeit des politischen Austauschs zwischen Links und Rechts glaubte. Als den Verfechter einer offenen Streitkultur, die auch dort nicht zurückschreckt, wo radikale, teils schwer zu ertragende Positionen aufeinandertreffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thomas Wagner
Der Dichter und der Neonazi
Erich Fried und Michael Kühnen – eine deutsche Freundschaft
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild – Behr, ullstein bild – amw
Alle Zitate Erich Frieds mit freundlicher Genehmigung des Verlags Klaus Wagenbach.
Datenkonvertierung: Tropen Studios, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98357-9
E-Book: ISBN 978-3-608-12039-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Der verhinderte Fernsehauftritt
Kampf gegen die Barbarei
Der Anruf
Worte der Zuneigung
Jugend in Wien
Wunderkind mit Handicap
Der erste politische Auftritt
Siegeszug des Faschismus
Mit Nazis reden
Gemeinsam verboten
Ein verliebter Hitlerjunge
Sie nannten ihn »Hummel«
Begeisterung für den Faschismus
Die SS als Sündenbock
Verehrung Adolf Hitlers
Brauner Aktionismus
Eine ungewöhnliche Widmung
Der zweite Teil der Seele
Nachträglich eingefügt
Ein privater Austausch
Den Feind verstehen: Der Fall Irmgard Grese
Der Todesengel von Auschwitz
Geteiltes Echo
Zwischen den Stühlen: Ein undogmatischer Linker
Antifaschist, aber kein Feind der Deutschen
Außenposten der APO
Ulrike Meinhof und die RAF
Der Seelenmist der anderen
Kampf gegen die Entfremdung
Neigung zur Selbsterforschung
Das Beispiel Rudi Dutschkes
Der heiße Herbst
Gegen den Atomtod
Keine Querfront
Das Rätsel der Freundschaft
Wunsch nach Nähe
Antibürgerliche Gemeinsamkeit
Eine Form von »Adoption«
Engagement für den Inhaftierten
Kameradschaft des Schmerzes
Angriffe aus dem eigenen Lager
Politische Soldaten
Ein Kriegsverbrecher als Lehrmeister
Gefährliches Netzwerk
Kühnens Charisma
»Ich habe Propaganda immer minimalistisch gesehen.«
Antisemitisches Verschwörungsdenken
»Zersetzender Einfluss«
Judenfeindliche Angriffe
Leugnung des Holocaust
Zum Muttertag
Zweck und Mittel
Ausländerhass als Sprengsatz
Das verschollene Gedicht
Ein unwillkommener Rat
Aus der Geschichte lernen
Frieds Glaube an den Menschen
Epilog: Kein Schrebergartenverein
Danksagung
Anhang
Quellen
Literatur
Anmerkungen
Der verhinderte Fernsehauftritt
Hatte er das gerade wirklich gesagt? Michael Kühnen konnte kaum fassen, was sich gerade im Fernsehen vor seinen Augen abspielte. Da beklagte sich der prominente Dichter Erich Fried – Linker, Jude und entschiedener Antifaschist –, dass man ihn – Deutschlands bekanntesten Neonazi – von der Teilnahme an der gerade laufenden TV-Diskussion kurzfristig wieder ausgeschlossen hatte. »Ob man den einladen soll oder nicht«, so Fried, »darüber kann man streiten. Wenn man ihn eingeladen hat, ihn auszuladen, ist ganz bestimmt falsch und kleinkariert.«[1]
Dass seine Person in der Talkshow »III nach 9« unerwünscht war, hatte Kühnen erst erfahren, als er bereits vor den Studio-Türen in Bremen-Osterholz stand. Das war am 21. Januar 1983. Mobiltelefone für den Privatgebrauch gab es noch nicht. Der verhinderte Talkshow-Gast ließ sich seine Ausladung schriftlich bestätigen, verlangte eine Aufwandsentschädigung in Höhe von etwa 300 DM und trat gemeinsam mit den beiden ihn begleitenden Kameraden die Heimreise an. Nun saß er mit einem kleinen Kreis von Gesinnungsgenossen, darunter sein enger Mitstreiter Thomas Brehl, in einer Wohnung im hessischen Städtchen Rodgau und schaute sich die Sendung im Fernsehen an.
Die Entscheidung, den Neonazi auszuladen, war am Tag zuvor gefällt und von Fernsehprogrammdirektor Hans-Werner Conrad intern kommuniziert worden. Vorhergegangen war eine rund eineinhalbstündige Debatte im Rundfunkrat. Der Beschluss veränderte den Charakter der Sendung: Ursprünglich hatte man über die Gefahr eines neu aufflammenden Rechtsextremismus diskutieren wollen. Doch jetzt stand das Für und Wider von Kühnens Teilnahme als Talkshow-Gast im Mittelpunkt der Debatte. Vor dem Sender-Gebäude hatte sich eine Gruppe von Frauen und Männern jeden Alters versammelt, um zu demonstrieren.
Das Transparent der Deutschen Friedensunion verkündete: »Nie wieder Faschismus! Gemeinsam für die Verteidigung der Grundrechte und Sicherung des Friedens.« Die Schilder der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) forderten das sofortige »Verbot aller faschistischen Organisationen« und »Freundschaft mit Ausländern«. Während ein Sprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) begrüßte, dass Kühnen »fünfzig Jahre nach der In-die-Macht-Setzung der Nazis kein Rederecht« bekam, erklärte Programmdirektor Conrad, er sei persönlich und im Prinzip nach wie vor ein Befürworter der Diskussion mit einem Neonazi. Er habe mit der Ausladung Kühnens jedoch dem Umstand Rechnung tragen wollen, dass es eine richtige »Angst davor gibt, dass solche Leute wieder in die Öffentlichkeit treten«. Eine klare und in sich stimmigere Position bezog Moderatorin Lea Rosh. Sie erklärte, von Anfang an gegen die Einladung Kühnens gewesen zu sein. Die Journalistin zeigte sich erleichtert, dass es genügend Menschen gebe, die verhinderten, »dass diese Leute sich überall artikulieren können«.[2]
Ein gewichtiges Argument gegen die Einladung Kühnens in eine Sendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens brachte der Talkshow-Gast Dietrich Güstrow vor. »Hitler wäre gar nicht der geworden, wenn er nicht das Radio zur Verfügung gehabt hätte«, sagte der Wahlverteidiger von Angeklagten des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler vom 20. Juli 1944. Nun hege er eine gewisse Sorge, solchen wegen Volksverhetzung und neonazistischer Umtriebe verurteilten Fanatikern »das Medium des Fernsehens zur Verfügung zu stellen«. Sie werden, hielt er Fried entgegen, »Fanatiker nicht überzeugen können und zu Geständnissen bewegen, sich zur Menschlichkeit zu bekennen. Das ist nicht möglich.«
Kampf gegen die Barbarei
Der Dichter wiederum machte deutlich, nun seinerseits keinesfalls irgendwelche Sympathien für den Hitler-Faschismus oder sonst irgendeinen Faschismus zu hegen. Er sei durch die Nazis zum Flüchtling gemacht und seine halbe Familie von diesen vergast worden. Das Erstarken nationalistischer Kräfte hatte Fried seit seiner Vorschulzeit als hochbegabtes und politisch außergewöhnlich interessiertes Kind in Wien als Abfolge blutiger Gewalttaten erlebt, die von einem Abbau demokratischer Rechte von Seiten der Regierung begleitet war. Den nachfolgenden Terror der Naziherrschaft hat er im Nachhinein weder vergessen können noch in irgendeiner Weise relativieren wollen. Ganz im Gegenteil: Er stellte seine Arbeit als Schriftsteller ausdrücklich in den Dienst der Erinnerung an diese Schreckenszeit. Nie wieder sollte so etwas geschehen. Dazu wollte er seinen Beitrag leisten.
Im Eingangsbereich seines Londoner Hauses erinnerte eine Reproduktion von Picassos Gemälde »Guernica« an die Zerstörung der baskischen Stadt durch die Faschisten.[3] Sie war von den Bomben der deutschen Legion Condor zerstört worden, die an der Seite des rechtsgerichteten Putschisten General Francisco Franco im Spanischen Bürgerkrieg gegen die Verteidiger der Republik kämpften. Über dem Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer an der Wand war eine Fotografie des Vaters zu sehen. Hinter der Glastüre eines Bücherschranks wiederum bewahrte er ein Stück rostigen Stacheldraht aus dem KZ Esterwegen und eine Messerklinge auf, die er bei einem Besuch der Gedenkstätte in Auschwitz aufgesammelt hatte. Hier war seine Großmutter ermordet worden. Fried sah es als seine Aufgabe an, »gegen diese Barbarei und alles vom gleichen Schlag zu kämpfen, solange ich lebe«,[4] wie er am 5. Juli 1972 in einem Brief an den Schriftsteller Heinrich Böll schrieb. Den Entschluss hatte er gefasst, kurz nachdem sein Vater an den Folgen seiner Misshandlung in der Gestapo-Haft verstorben war. Daran, dass der Dichter ein entschlossener Antifaschist war, kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Er wollte den Feind aber nicht nur bekämpfen, sondern – um gegen die in seinen Augen längst nicht gebannte faschistische Gefahr besser gewappnet zu sein – auch verstehen.
Wie hatte es geschehen können, dass aus ganz normalen Jugendlichen überzeugte Nazis wurden? Das war eine der Fragen, die den Schriftsteller bis zum Ende seines Lebens beschäftigten. In der Fernsehsendung »III nach 9« erzählte er von Mitschülern, die seinerzeit zum großen Teil Mitglieder der von der austrofaschistischen Regierung verbotenen Nazi-Partei waren. Dann sagte er etwas Überraschendes: »Ich glaube, dass das nicht wesentlich schlechtere oder dümmere Jungen waren als ihre jüdischen oder antifaschistischen Mitschüler. Was einer geworden ist, das hing von unwägbaren Dingen ab. Der Nazismus und der Neonazismus ist eine der gefährlichsten Irrlehren und unmenschlichsten Lehren. Aber deswegen würde ich noch lange nicht sagen, dass ich mit einem, der darauf hereingefallen ist, mich nicht an einen Tisch setze. Wenn ich hoffen kann, dadurch diese Dinge zu desavouieren oder ihn vielleicht zweifeln zu machen.« Über das Motiv, das der Ausladung Kühnens zugrunde lag, spekulierte er: »Wir trauen uns offenbar nicht zu, mit so etwas fertig zu werden, wenn er auch herkommt.« Auf Seiten derer, die sich über die Neonazis empört zeigten, glaubte der Schriftsteller zudem viel Heuchelei erkennen zu können. Die neuen Faschisten würden in brutaler und unverblümter Ehrlichkeit vertreten, was auch viele CSU- und manche CDU-Anhänger in halbbewusster Form unterstützten.
War das übertrieben? Schaut man sich die näheren Umstände von Kühnens Ausladung an, so waren diese eher dazu geeignet, den Heuchelei-Verdacht zu untermauern als ihn zu entkräften. »Zum Thema des Rundfunkrates hatte Bernd Neumann, Chef der Bremer CDU-Fraktion, den Fernsehauftritt Kühnens gemacht, indem er öffentlich dessen Ausladung gefordert hatte und zu bedenken gab, dass andernfalls auch die Bürgerschaft verärgert sein würde, die in der nächsten Woche über die Erhöhung der Fernseh- und Rundfunkgebühren zu befinden habe.«[5] Sechs Jahre zuvor hatte der Politiker noch eine unrühmliche Rolle im Streit um Frieds Gedicht »Die Anfrage« gespielt, das von einer Bremer Lehrerin im Unterricht behandelt worden war.
Die Verse setzen sich mit den gesellschaftlichen Ursachen des Linksterrorismus auseinander und hinterfragen die Verhältnismäßigkeit der im staatlichen Kampf gegen diesen verwendeten Mittel. Am Ende heißt es: »Wieviel Tausend Juden/muss ein Nazi ermordet haben/um heute verurteilt zu werden/zu so langer Haft?« Einigen Eltern gefiel das nicht. In dieser Zeit brachte eine Reihe von zum Teil tödlichen Anschlägen der Rote Armee Fraktion (RAF) die öffentliche Meinung gegen die inhaftierten Terroristen und die sogenannte Sympathisanten-Szene auf. Die Eltern beschwerten sich über die Verwendung von Frieds Gedicht im Klassenzimmer. Neumann schwang sich zu ihrem Fürsprecher auf und sagte in der Bürgerschaft: »So etwas würde ich lieber verbrannt sehen.«
Eine Äußerung, bei der nicht wenigen Zeitgenossen unwillkürlich der Gedanke an die von den Nazis am 10. Mai 1933 durchgeführte Verbrennung der Bücher verfemter Autoren in zahlreichen deutschen Universitätsstädten in den Sinn kam. Dem Vorwurf, er habe dabei vergleichbare Absichten gehegt, entgegnete der konservative Politiker, er habe keine literarische Bewertung der Gedichte von Fried vornehmen wollen. Dabei unterschlug er, dass auch die Nazis und ihre begeisterten Unterstützer unter der Studenten- und Professorenschaft bei ihrer Aktion weniger von ästhetischen als von politischen Motiven angetrieben waren. Dem CDU-Mann haftete infolge der Auseinandersetzung mit Fried in Teilen der Öffentlichkeit der Geruch eines Ewiggestrigen an. Er hatte also allen Grund, sich als entschiedener und besonders energischer Kämpfer gegen den Neonazismus zu inszenieren. Ist so der Nachdruck zu erklären, mit dem er auf die Ausladung Kühnens aus der Talkshow drängte? Plausibel wäre es. Dass er auf diese Weise erneut den Unmut von Erich Fried erregen würde, konnte Neumann damals nicht wissen. Es hätte ihn wohl auch nicht weiter gestört.
Der Anruf
Fried, das machte der Dichter in der Talkshow mehrmals klar, ging es darum, der faschistischen Ideologie den gesellschaftlichen Nährboden zu entziehen. Er war der Meinung, dass die sich Anfang der achtziger Jahre zuspitzende Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion sowie den von ihnen angeführten Militärbündnissen Nato und Warschauer Pakt ein solcher Nährboden war. Fried war ein radikaler Linker, aber alles andere als ein Freund der Sowjetunion und des von ihr angeführten sozialistischen Staatenblocks. Das autoritäre System der Parteidiktatur war ihm verhasst. Mit den Stalin-Anhängern unter den Kommunisten hatte er schon in seinen ersten Jahren im Londoner Exil so manchen Streit ausgetragen. Seit 1952 geißelte er als politischer Kommentator des gezielt auf die Bewohner der DDR ausgerichteten deutschsprachigen »German Soviet Zone Programme« der BBC in seiner Sendung »Persönliche Betrachtung« den undemokratischen Charakter von Staat und Partei in der Sowjetunion[6] und polemisierte – teils in äußerster Schärfe – gegen von ihm als »Lügen- und Verleumdungspropaganda«[7] bewertete Presseveröffentlichungen in der DDR.[8]
»Fast jeden Morgen gegen fünf Uhr«, erinnert sich der damals noch als überzeugter Kommunist im sozialistischen Teil Deutschlands lebende Liedermacher Wolf Biermann, »standen Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen in den osteuropäischen Ländern auf, nur, um seine Radiosendungen über Kurzwelle zu hören.«[9] 1968 hatte sich Frieds Sicht auf den real existierenden Sozialismus zu verändern begonnen. Zum einen registrierte er, dass sich nach Stalins Tod hinter dem Eisernen Vorhang manches zum Besseren gewendet hatte. Zum anderen bewertete er die Außen- wie die Innenpolitik westlicher Staaten nun zunehmend kritischer. Unter dem Eindruck der militärischen Interventionspolitik der USA in Vietnam und Lateinamerika, des KPD-Verbots sowie innen- und außenpolitischer Entscheidungen der Labour-Regierung in Großbritannien war er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bereit, den von der BBC im Kalten Krieg eingeschlagenen Konfrontationskurs weiter mitzutragen und beendete nach 17 Jahren die Zusammenarbeit.[10] Eine Distanz zur Politik der sozialistischen Staaten behielt er zwar zeit seines Lebens bei, doch dem antikommunistischen Feindbild des »Russen« wollte sich Fried nicht anschließen. In seinen Augen stand dieses ganz eindeutig in der »kulturellen Kontinuität der Nazi-Zeit«. Die daran anknüpfende Politik des Wettrüstens hielt er in hohem Maße für gemeingefährlich.
»Ich glaube wirklich«, erklärte er in der Talkshow »III nach 9«, »dass die Nato-Rüstung eines der schwersten Verbrechen ist gegen die Menschheit.«[11] Zahlreiche Politiker beteiligten sich an der Vorbereitung eines atomaren Erstschlags, also an einem Massenmord, der – wie der Dichter betonte, »viel mehr Leute umbringen würde, als die Nazis umgebracht haben«. In seinen Augen war dadurch ein gefährliches »Heuchel-Klima« entstanden, das viele verirrte Jugendliche erst auf den Weg des Neofaschismus gebracht habe.
Ob man mit Nazis reden dürfe, mit neuen und mit alten, so stellte sich im Verlauf der Sendung mehr und mehr heraus, schien für Fried nie eine Frage gewesen zu sein, über die er sich den Kopf zerbrach. Der offen geführte Streit, aber auch das Gespräch, um ihre Motive besser zu verstehen, gehörten für ihn selbstverständlich zum antifaschistischen Kampf. Von der Dämonisierung von Menschen, die der Ideologie der Nazis anhingen, hielt er nichts. Man dürfe nicht tun, als ob sie völlig andere Menschen seien. Auch sie würden lachen und weinen. »Sie sind«, erklärte er dem Fernsehmoderator Günter Nenning im Zwiegespräch, »Menschen mit zum Teil ganz ehrlichen Ansichten, die nur verderblich sind.« In der Schlussrunde, in der alle zuvor in ausführlichen Einzelgesprächen vorgestellten Talk-Gäste mit den Moderatoren beisammensaßen, berichtete er schließlich von Gesprächen, die er »mit alten SS-Männern« geführt hatte. Mehrmals sei ihm geschehen, dass jemand von denen nach einiger Zeit sagte: »Ich habe bisher nur mit Leuten gesprochen, die entweder gesagt haben: Kamerad, ich denke ähnlich wie du, aber das darf man heute nicht laut sagen, oder mit Leuten, die gesagt haben: So jemand wie du gehört zertreten. Aber dass jemand mir ernste Argumente entgegenstellt und ich die ganze Zeit gleichzeitig das Gefühl habe, der meint es nicht schlecht mit dir, ist mir nicht geschehen. Und jetzt will ich dir sagen, was ich alles auf dem Gewissen hab.«
Wenig überraschend stießen Frieds Ausführungen bei einigen Zuhörern im Studio – und sicher bei einer noch größeren Menge vor dem heimischen Bildschirm – auf Unverständnis. Insbesondere Lea Rosh ließ keinen Zweifel daran, dass sie mit Fried in dieser Angelegenheit alles andere als einer Meinung war. Ein paar Minuten zuvor hatte sie ihre ablehnende Haltung gegenüber der Einladung des Neonazis Kühnen mit dem Hinweis unterfüttert, dass dieser – ohne dafür belangt zu werden – in einem Gerichtssaal habe sagen können: »Die Kopfhaut einer Judenstirn ergibt ’nen prima Lampenschirm, Fiderallala.« Nun brachte sie ihr Unbehagen über Frieds gerade erklärte Redebereitschaft mit ehemaligen Angehörigen der SS zum Ausdruck, zumal wenn so einer zum Mörder geworden war: »Aber was bringt denn das, wenn er vorher so und so viel Leute umgebracht hat?« Fried konterte: »Das zeigt etwas über unsere Zivilisation und über die Möglichkeit der Leute, die Vergangenheit zu bewältigen.«
Ein ins Studio eingeladener Vertreter der vor dem Sender demonstrierenden Antifaschisten war entsetzt. Bisher habe er immer gedacht, dass er mit Fried in einer Reihe stünde. Angesichts neofaschistischer Schmierereien, der Anschläge auf das Münchner Oktoberfest und auf Ausländerheime könne er dessen Haltung überhaupt nicht verstehen.
Michael Kühnen hingegen, erinnert sich der Neonazi Thomas Brehl, war von den Worten des Dichters wie elektrisiert. Als die Talkshow zu Ende war, habe dieser ausgerufen: »Und jetzt setz’ ich noch einen drauf, ich ruf’ im Sender an!« Er wolle mit Erich Fried sprechen und sich bei ihm für seine Worte bedanken. Gesagt, getan. Der Telefondienst von Radio Bremen reagierte auf sein Ersuchen zunächst zögerlich, aber Kühnen ließ sich nicht abwimmeln. Er war ja kein gewöhnlicher Anrufer, der einfach nur mal mit einem Prominenten sprechen wollte. Die Causa Kühnen war Dreh- und Angelpunkt der Fernsehsendung. In einem großen Teil der Talkshow war es einzig und allein um seine Person gegangen. Dies könnte er seinen zögerlichen Gesprächspartnern am anderen Ende der Leitung zu verstehen gegeben haben. Schließlich wurde er tatsächlich in die Kantine des Senders durchgestellt, wo Gäste, Moderatoren und die Redaktion von »III nach 9« wie nach jeder gemeinsam absolvierten Sendung bereits den gemütlichen Teil des Abends eingeleitet hatten. Dank eingeschalteter Mithörtaste wurden Kühnens Kameraden nun zu Zeugen der folgenden höchst ungewöhnlichen Unterredung.
Da plauderte der bekennende Nationalsozialist, so Brehl, »seelenruhig mit jenem Mann, dessen Gedichte uns die linken Gegendemonstranten mitunter ins Ohr grölten«.[12] Das Erstaunliche war: Die beiden Männer – so stellt es Brehl dar, und anders wären die dem Telefonat folgenden Geschehnisse kaum nachvollziehbar – hatten offenbar auf Anhieb einen persönlichen Draht zueinander. Dabei waren sie – der dem Zugriff der Nazi-Häscher durch Flucht ins englische Exil entronnene jüdische Dichter und der sehr viel jüngere Neonazi – nach landläufiger Meinung alles andere als dazu bestimmt, in irgendeiner Form Gefallen aneinander zu finden. Der eine ergriff Partei für die Täter des Holocaust, der andere hätte – so wie es vielen seiner Verwandten widerfahren war – von diesen ermordet werden sollen. Auschwitz, die planmäßig erfolgte Vernichtung der europäischen Juden, stand zwischen ihnen. Über diesen Graben konnte kein Steg führen. Oder doch? Am Ende des Gesprächs soll es Fried gewesen sein, der schließlich sagte: »Wir müssen uns noch viel öfter und eingehender unterhalten, Herr Kühnen.«
Vielleicht sind es nicht genau diese Worte, die der Dichter wählte. Dem Inhalt nach werden sie sicherlich stimmen. Jedenfalls waren sich die beiden politisch so gegensätzlichen Gesprächspartner in einer Sache schnell einig. Sie wollten sich möglichst bald noch einmal treffen, um ihre Unterredung fortzusetzen. An diesem Abend wurden die Weichen für eine selbst für Eingeweihte nur schwer zu verstehende Beziehung gestellt.
Worte der Zuneigung
Rasch wird sich eine so große emotionale Nähe zwischen dem linken jüdischen Dichter und dem Neonazi entwickeln, dass das Wort »Freund« – so abwegig es zunächst erscheinen mag – als eine angemessene Bezeichnung für ihr außergewöhnliches Verhältnis erscheint.[13] Beide Männer suchten den Freund im jeweils anderen und haben ihn – trotz ihres für Fried wohl schwer erträglichen Disputs über das Thema Holocaust und die angebliche »Auschwitz-Lüge« – in der nie aufgegebenen gegenseitigen Zuwendung wohl auch gefunden.
Deutlich wird das in den Briefen, die sie einander schrieben, nachdem Kühnen, der bereits mehrere Jahre Knasterfahrungen gesammelt hatte, erneut inhaftiert worden war. Ihr Inhalt ist der breiten Öffentlichkeit bis heute weitgehend unbekannt geblieben. Nur eines der sechzehn überlieferten Schreiben, ein Brief aus der Feder Frieds, wurde posthum im Rahmen eines schmalen Auswahlbands aus der Korrespondenz des Dichters in Gänze veröffentlicht – und dies erst 2009, also zwanzig Jahre nach dem Tod des Schriftstellers. Zu diesem Zeitpunkt war – die Anhänger seiner Dichtkunst mögen mir verzeihen – dessen einst hell leuchtender Stern am Literaturhimmel bereits ein wenig verblasst. Der durch seine Debattenbeiträge und eine Reihe von politischen Skandalen einst weithin bekannte Intellektuelle war – zumindest für die breite Öffentlichkeit – schon etwas in Vergessenheit geraten. Doch allein dieser eine Brief vom 18. Januar 1985 hat es in sich – und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Geht es doch um die von Kühnen stets bestrittene Vernichtung der europäischen Juden durch die Nazis, ihre Helfer und Helfershelfer sowie um die glühende Verehrung, die der nachgeborene Jungfaschist ausgerechnet Adolf Hitler entgegenbrachte.