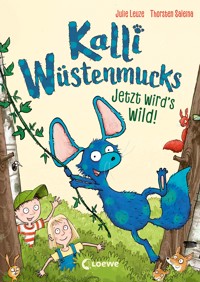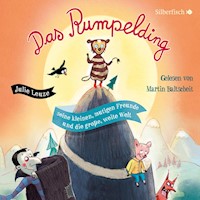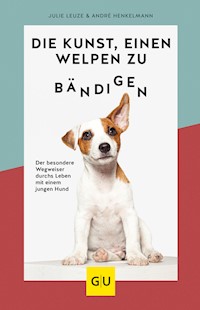9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Als ihre Mutter erkrankt, muss die junge Pariserin Camille auf den elterlichen Apfelhof in der Normandie zurückkehren. Dort heißt es kräftig mitanpacken – es ist ja nur für sechs Wochen, wie Camille sich sagt. Doch die Arbeit bereitet ihr unerwartet Freude. Schließlich hat sie sogar die Idee, wieder eigenen Cidre herzustellen wie zu Lebzeiten ihres Vaters. Und dann ist da noch dieser attraktive Feriengast aus Paris: Antoine sieht nicht nur gut aus, er kann auch gut zuhören! Doch als der wahre Grund für Antoines einfühlsames Interesse herauskommt, fühlt sich Camille verraten und ist zutiefst enttäuscht. Ist ihre Liebe stark genug, um Antoine diesen Vertrauensbruch zu verzeihen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Ähnliche
Buch
Als ihre Mutter erkrankt, muss die junge Pariserin Camille auf den elterlichen Apfelhof in der Normandie zurückkehren. Dort heißt es kräftig mitanpacken – es ist ja nur für sechs Wochen, wie Camille sich sagt. Doch die Arbeit bereitet ihr unerwartet Freude. Schließlich hat sie sogar die Idee, wieder eigenen Cidre herzustellen wie zu Lebzeiten ihres Vaters. Und dann ist da noch dieser attraktive Feriengast aus Paris: Antoine sieht nicht nur gut aus, er kann auch gut zuhören! Doch als der wahre Grund für Antoines einfühlsames Interesse herauskommt, fühlt sich Camille verraten und ist zutiefst enttäuscht. Ist ihre Liebe stark genug, um Antoine diesen Vertrauensbruch zu verzeihen?
Informationen zu Julie Leuze sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Julie Leuze
Der Duft
von Apfeltarte
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe August 2019
Copyright © 2019 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: Schild, Landschaft, Himmel (1/3 U1): FinePic®, München
Baum unten + Leiter (1/3 U1): Gettyimages/Publisher Mix/Anna Kern
Baum oben (1/3 U1): Gettyimages/Westend61
Redaktion: Ilse Wagner
BH · Herstellung: ik
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-23609-0V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Petra
Camille
Camille Rosière wischte sich über die Stirn. Die Tür des Reisebüros stand weit offen, doch trotz der abendlichen Stunde herrschten drinnen wie draußen noch immer vierunddreißig Grad Celsius.
Sie warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr. Eigentlich hätte sie längst Feierabend, und sie sehnte sich nach einer kalten Dusche, einem Glas Cidre und einem Stück Obst. Aber noch standen zwischen Camille und diesen Genüssen ihre beiden letzten Kunden, und Monsieur und Madame machten nicht den Eindruck, als wollten sie in absehbarer Zeit das Feld räumen. Seit geschlagenen anderthalb Stunden saßen sie vor Camilles Schreibtisch und trieben sie langsam, aber sicher zur Verzweiflung.
Gerade sagte Madame, ein mageres Wesen im dunkelblauen Kostüm, mit missbilligendem Blick: »Ich verstehe wirklich nicht, wo das Problem liegt! Im Oktober will doch keinMensch in den Urlaub fahren … außer uns, natürlich. Weshalb also können Sie uns kein vernünftiges Hotel anbieten? Ein einfaches, aber gepflegtes Haus, etwas, das unseren Wünschen entspricht und für das man nicht im Lotto gewonnen haben muss. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das wirklich nicht!«
»Nun, Madame,ich habe Ihnen bereits über zwanzig Vorschläge unterbreitet.« Camille zwang sich zu einem Lächeln. »Und es war schon einiges dabei, das Ihren Wünschen sehr nahekam, wenn ich das bemerken darf.«
»Nahekam, nahekam!«, knurrte Monsieur. »Wir geben unser gutes Geld doch nicht aus, um Abstriche zu machen! Hören Sie, es ist ganz einfach: Wir möchten ein ruhiges Hotel, in dem dennoch ein bisschen was geboten wird, zum Beispiel, äh, Ausflüge. Oder Shows. Ja, genau, Show-Abende! Die würden mir gefallen.« Monsieur lockerte verwegen seine Krawatte. Dann fuhr er fort: »Das Ganze sollte selbstverständlich am Meer liegen …«
»Aber nein, Chéri, auf dem Land«, unterbrach Madame ihn pikiert. »Darüber waren wir uns doch einig!«
»Nicht auf dem Land. In einer ländlichen Gegend!« Monsieur warf seiner Frau einen ärgerlichen Blick zu. »Und eine ländliche Gegend kann sehr wohl am Meer liegen. Oder willst du das etwa leugnen?«
Madame verdrehte die Augen. »Sie haben es gehört«, wandte sie sich barsch an Camille, »wir möchten ans Meer, aber in eine ländliche Gegend. Am liebsten würden wir in eine Ecke reisen, in der wir noch Ursprünglichkeit finden, Wildnis, unberührte Natur …«
»Aber auch Unterhaltung«, beharrte Monsieur. »Ich möchte mich in meinem hart verdienten Urlaub nicht in irgendeinem Kaff zu Tode langweilen, damit das mal ganz klar ist!«
»Können Sie uns denn nun endlich etwas in dieser Richtung zeigen?«, fragte Madame mit einem gereizten Blick auf Camille. »Wir haben nicht ewig Zeit, wissen Sie?«
Ich auch nicht, dachte Camille erschöpft. Und ihr zwei bleibt am besten zu Hause.
Bilder von Hotels zogen ihr durch den Kopf, unzählige schöne, preiswerte Häuser, die sie ihren anspruchsvollen Kunden in den letzten anderthalb Stunden präsentiert hatte und die allesamt für untauglich befunden worden waren. Hier war das Bad nicht groß genug, dort die Anreise zu lang. Einmal sagte die Farbe der Sonnenschirme nicht zu, ein andermal gefielen die Tapeten des Frühstücksraumes nicht. Camille war mit ihrem Latein am Ende.
Monsieur und Madame starrten sie erwartungsvoll an. Von draußen wehte ein Luftzug herein, heiß wie Wüstenwind, mit dem Geruch von Smog. Hinter Camilles Stirn begann es zu pochen. Abrupt erhob sie sich.
»Wissen Sie, was?« Sie schenkte dem unzufriedenen Ehepaar ein strahlendes Lächeln. »Ich gebe Ihnen diese schönen Kataloge einfach mit! Dann können Sie sich ganz in Ruhe überlegen, was für Sie infrage kommt, und sobald Sie sich entschieden haben, kommen Sie wieder hierher. Alles Weitere erledige dann ich für Sie. Einverstanden?«
Madame schnappte nach Luft. Monsieur zog finster die Augenbrauen zusammen. Camille lächelte eisern weiter und packte die Kataloge in eine mit Palmen bedruckte Plastiktüte, auf der eine lachende Sonne »Bon voyage« wünschte. Keine drei Minuten später hatte sie Monsieur und Madame mit sanfter Gewalt hinauskomplimentiert.
Camille atmete auf.
Da sie heute die Letzte war – ihre Kolleginnen und der Chef waren schon vor einer guten Stunde gegangen –, räumte sie noch das Büro auf, zog die Jalousien herunter und schaltete den Anrufbeantworter ein. Dann trat sie in den schwülen Abend hinaus. Sie schloss die Tür des Reisebüros hinter sich ab und machte sich müde auf den Heimweg.
Es war Mitte August. Paris lag seit Wochen unter einer abgasgeschwängerten Hitzeglocke, die Luft war dick und fühlte sich klebrig an. In der schwülen Wärme hatte die sonst so hektische Stadt ihren Lebensrhythmus auffällig verlangsamt, und auch Camille ging sehr gemächlich nach Hause. Unter staubigen Pappeln schlenderte sie die Uferpromenade des Canal Saint-Martin entlang.
Das zehnte Arrondissement mochte nicht das schönste Viertel von Paris sein, ohne Zweifel gab es schickere, glamourösere Stadtteile. Doch das Zehnte bot den unschätzbaren Vorteil, dass Camille sich trotz ihres bescheidenen Gehalts hier eine Wohnung leisten konnte. Zwar nur ein winziges Appartement unter dem Dach – zwanzig Quadratmeter mit Schrägen und Sitzbadewanne –, aber dafür günstig gelegen: Camille konnte nicht nur ihr Reisebüro problemlos zu Fuß erreichen, sondern auch einen Bäcker, zwei tunesische Gemüsehändler und drei indische Imbisse. Vor allem aber lag gleich um die Ecke die Epicerie fine du Dixième, und dieses wunderbare Feinkostgeschäft versöhnte Camille mit vielem. Vielleicht sogar mit dem Aufzug in ihrem Haus, der in den vierzehn Jahren, die Camille nun schon in ihrer Dachwohnung lebte, kaum sechs Monate lang funktionstüchtig gewesen war.
Beim Gedanken an die Epicerie fine du Dixième wurden Camilles Schritte sofort beschwingter. Sie verließ die Uferpromenade und bog in die unscheinbare Seitenstraße ein, an deren Ende sich die Epicerie zwischen einen afrikanischen Friseursalon und ein ehemaliges, mit Brettern verrammeltes Yogastudio quetschte.
Als Camille durch die Tür in den Laden trat, bimmelte eine gusseiserne Glocke. Es roch nach exotischen Gewürzen, nach Käse und reifen Äpfeln, und wie so oft, wenn Camille sich den Luxus gönnte, hier einzukaufen statt im günstigeren Supermarkt, wurde sie von einem bittersüßen Gefühl übermannt, einer merkwürdigen Mischung aus Heimweh, Glück und Appetit. Unwillkürlich fragte sie sich, ob sie deshalb immer wieder zu Madame Dubois kam. Leisten konnte sie es sich nämlich eigentlich nicht: Paris war verflucht teuer! Allein die Miete für die Dachwohnung verschlang nahezu ihr ganzes Gehalt.
»Guten Abend.« Die Ladeninhaberin, eine runzelige alte Dame, blickte Camille freundlich an. »Sie haben Glück, ich wollte gerade schließen. Womit kann ich Ihnen denn heute eine Freude machen, Mademoiselle?«
Camille verkniff sich ein Grinsen. Dass sie mit ihren zweiunddreißig Jahren längst keine »Mademoiselle« mehr war, nahm Madame Dubois ebenso wenig zur Kenntnis wie den in ihren Augen neumodischen Unsinn, auch unverheiratete Frauen grundsätzlich »Madame«zu nennen.
»Eine Tüte Obst hätte ich gern«, sagte Camille. »Egal, was. Nur reif und süß muss es sein!«
»Verstehe. Es war wohl ein unangenehmer Arbeitstag?« Madame Dubois kam hinter der Theke hervor und trippelte zu den Obststeigen. Im Vorübergehen tätschelte sie mitfühlend Camilles Arm. »Verzagen Sie nicht, Mademoiselle! Solche Tage gibt es eben. Ich stelle Ihnen jetzt eine schöne Mischung aus Feigen, Birnen und Aprikosen zusammen, und dann geht es Ihnen gleich besser.«
»Danke, das klingt gut.«
»Und zu dem frischen Obst vielleicht noch eine Handvoll getrockneter Apfelringe?«, schlug Madame Dubois vor. »Glauben Sie mir, es gibt nichts Besseres als getrocknete Apfelringe, um nach einem anstrengenden Tag zu entspannen! Ich selbst esse manchmal eine ganze Tüte davon.«
Getrocknete Apfelringe statt Sport oder Meditation? Warum nicht, dachte Camille amüsiert.
»Gern, packen Sie mir die Apfelringe bitte ein. Apropos Äpfel, ich brauche für heute Abend unbedingt noch einen Cidre!«
Eine leuchtend gelbe Birne in der Hand, hielt die alte Dame inne. Sie warf Camille über den Rand ihrer Brille hinweg einen besorgten Blick zu, und man brauchte kein Hellseher zu sein, um zu erkennen, was sie dachte: Aber junge Frau, Alkohol ist doch keine Lösung!
»Keine Sorge, Madame.« Camille überflog mehrere Etiketten, dann nahm sie eine dickwandige Flasche aus dem Regal und trug sie zur Kasse. »Mein Vater hat auf unserem Hof jahrelang Cidre produziert. Er sagte immer: ›Wer sich mit Cidre betrinkt, der hat ihn nicht verstanden!‹ Und das hat sich mir eingeprägt.«
Erleichtert folgte Madame Dubois ihr mit der Obsttüte zur Kasse. »Ein kluger Mann, Ihr Vater.«
Sie wies auf die Flasche in Camilles Hand und schmunzelte. »Sie haben übrigens gut gewählt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Zielsicher nach dem besten Tropfen gegriffen!«
Camille lächelte schwach.
Alles, fuhr es ihr durch den Kopf, habe ich eben doch noch nicht vergessen.
Der Gedanke tat weh.
Mit Cidre, Obst und Apfelringen bepackt, stieg Camille die fünf Stockwerke zu ihrer Dachwohnung hinauf. Schwer atmend schloss sie die Tür auf, trat ein und stand sogleich in der Wohnküche, denn für einen Flur wurde bei zwanzig Quadratmetern Gesamtfläche kein Platz verschwendet. Immerhin: Nach dem Essen konnte Camille theoretisch direkt vom Stuhl in das neben dem Tisch stehende Bett fallen! Auch eine Art von Luxus. Das jedenfalls pflegte Camille sich tapfer zu versichern, wenn sie in ihrem Wohnklo wieder einmal unter akuter Platzangst litt.
Sie hievte ihre Einkäufe auf die Arbeitsplatte neben der Spüle, warf einen Blick in den Spiegel und stöhnte. Du lieber Himmel, wie sie aussah! Das halblange karamellbraune Haar ein einziges Durcheinander, die Bluse verschwitzt und zerknittert. Als käme sie nicht aus dem Reisebüro, sondern geradewegs vom Apfelpressen. Zu allem Übel waren zwei Knöpfe aufgesprungen, und nun gewährte die Bluse peinlich tiefe Einblicke auf Camilles üppige Oberweite. So hatte die alte Madame Dubois sie also geradegesehen … und ihre mäkeligen Kunden im Reisebüro natürlich auch. Camille verzog das Gesicht.
Am besten nahm sie auf der Stelle eine kalte Dusche in der Sitzbadewanne, und danach würde sie etwas essen und trinken und diesen blöden Tag ganz einfach vergessen! Nur vorher noch rasch den Anrufbeantworter abhören. Camille griff nach dem Telefon.
Sie bereute es sofort.
»Ich bin’s, ma puce«, hörte sie die resolute Stimme ihrer Mutter. »Es tut mir schrecklich leid, aber du musst nach Hause kommen. Kannst du dir freinehmen? Es müsste allerdings für mehrere Wochen sein, mindestens für sechs, sagt der Arzt. Sicher ist es furchtbar schwierig für dich, so lange Urlaub zu nehmen, noch dazu spontan, aber ich habe einen Bandscheibenvorfall und schreckliche Rückenschmerzen und weiß beim besten Willen nicht, wie ich das alles hier schaffen soll! Die Bäume und die Wiesen und der Markt und die Katzen und das Gemüse … ach, Camille, es hilft nichts, du musst nach Hause kommen! So schnell wie möglich. Ruf mich bitte an, ja? Küsschen.«
Camille starrte auf das Telefon.
Freundlich verkündete der Anrufbeantworter: »Keine weiteren Nachrichten.«
Sechs Wochen, hallte es in Camille nach. Sechs Wochen, mindestens.
Sie stellte das Telefon zurück auf die Station, ging die drei Schritte bis zum Fenster und öffnete es. Wie betäubt blickte sie über die Dächer von Paris, ein graublaues Meer aus Kaminen, Zink und Schiefer. Gerade erst setzte die Dämmerung ein, doch schon vertrieben funkelnde Lichter die Schatten. Die erhitzte Stadt bereitete sich auf eine weitere ruhelose Nacht vor, auf unermüdliche Touristen, trinkfeste Studenten und schlaflose Büroangestellte. Das war Paris. Das war die Stadt, in der seit vierzehn Jahren Camilles Leben stattfand.
Zu Hause, in der Welten entfernten Normandie, wurden um diese Uhrzeit die Bürgersteige hochgeklappt.
Camille schloss die Augen. Ihr Chef würde ganz und gar nicht begeistert sein von ihrem Ansinnen – wenn er ihr überhaupt so lange unbezahlten Urlaub gab und sie nicht kurzerhand rauswarf. Sechs Wochen, verdammt!
Sechs Wochen in Vert-le-Coin.
Sechs Wochen auf dem elterlichen Hof.
Sechs Wochen mit Maman!
Es würden die längsten sechs Wochen ihres Lebens werden.
Jeanne
Vor Jahrhunderten war der Bauernhof ein Manoir gewesen, ein Herrenhaus, und trotz vieler Generationen von Menschen, Katzen und Schwalben hatte der Hof seine Schönheit nicht verloren. Inmitten weitläufiger Apfelplantagen gelegen, war er immer noch der Mittelpunkt von allem.
Im Viereck gebaut, schloss er einen sonnigen, windgeschützten Innenhof ein, um den sich das Wohnhaus, diverse Scheunen und Stallungen sowie die ehemalige Cidreriegruppierten. Auf der Wiese hinter dem Wohnhaus stand der alte Taubenturm, hinter einer der Scheunen erstreckte sich ein großer Beeren- und Gemüsegarten. Die Gebäude selbst waren dekorativ im Schachbrettmuster gemauert, sandfarbener Kalkstein wechselte sich ab mit dunkelroten Ziegeln.
Und überall um den Hof herum, so weit das Auge reichte, standen Apfelbäume.
Jeanne hatte diesen Hof auf den ersten Blick geliebt.
Wenn auch natürlich nicht so innig wie Régis, den hübschen Sohn des Hauses, ihren späteren Mann. Seufzend schüttelte sie den Kopf. Wie schrecklich lang waren diese ersten verliebten Blicke nun schon her! Vierzig Jahre, war das denn zu glauben? Vierzig Jahre, und an Jeannes Liebe hatte sich nicht das Geringste verändert.
Trotz der heftigen Schmerzen, die durch ihren Rücken schossen, überquerte sie mit festen Schritten den Innenhof, in dessen Mitte ein großer, alter Birnbaum stand, der einzige seiner Art weit und breit. An den Zweigen dieses Birnbaumes hatte früher Camilles Schaukel gehangen. Jeanne musste lächeln. Die wilde, fröhliche Camille! Hoch und höher war sie geflogen, dem sommerblauen Himmel entgegen …
So lange her auch das.
Kurz blieb Jeanne stehen, blickte durch den Rundbogen des Torhauses auf den Schotterweg, der durch die Wiesen zur Landstraße führte. Schon morgen würde Camilles altes Auto auf diesem Schotterweg auftauchen; gegen Mittag, hatte sie am Telefon gesagt. Freude breitete sich in Jeannes Herz aus, gemischt mit leisem Ärger. Das Mädchen war viel zu selten zu Hause!
Tja. Mit Paris konnte Vert-le-Coin es eben nicht aufnehmen.
Jeanne riss ihren Blick von der Schaukel los, ging die letzten Schritte zum Wohnhaus und stieg hinauf in den ersten Stock, wo das ehemalige Kinderzimmer ihrer Tochter lag. Sie wollte das Zimmer schon einmal herrichten, frische Luft hereinlassen, das Bett hübsch beziehen und einen Strauß Wiesenblumen aufs Fensterbrett stellen. Selten zu Hause oder nicht, es war lieb von Camille, dass sie noch gestern Abend zurückgerufen hatte, und vor allem: dass sie alles stehen und liegen ließ, um Jeanne aus der Bredouille zu helfen.
Nicht, dass Jeanne die Hilfe ihrer Tochter bisher oft in Anspruch genommen hätte. Um genau zu sein, war dies sogar das allererste Mal, denn bis vor drei Jahren war ja Régis an Jeannes Seite gewesen, und danach … ach, es war immer irgendwie gegangen! Sie hatte stets alles geschafft, was zu tun gewesen war.
Nur die Freude an der Arbeit, die war seit drei Jahren fort.
Die hatte Régis, wo auch immer er nun sein mochte, einfach mitgenommen.
»So ganz verzeihe ich dir das nicht, Régis«, grummelte Jeanne, »nur damit du’s weißt!«
Sie trat an Camilles alten Schreibtisch, über dem ein gerahmtes Foto hing. Es zeigte die sechzehnjährige Camille zwischen Jeanne und Régis, eine kleine, glückliche Familie.
»Nein«, wiederholte Jeanne leise, »so ganz kann ich dir das nicht verzeihen. Ich hatte mir mein Alter nämlich anders vorgestellt, hörst du?«
Natürlich hörte Régis nicht. Wie sollte er auch. Doch Jeanne konnte nicht anders, als ihn sich an ihrer Seite vorzustellen; sie musste mit ihm sprechen, als sei er noch da, denn nur so konnte sie es ertragen, ihn verloren zu haben. Vierzig Jahre Liebe, davon siebenunddreißig Jahre Ehe. Eine Zeit, die so wunderbar lang gewesen war und doch zu kurz, eine Zeit, in der Régis sich untrennbar mit ihr verwoben hatte, in der er hineingewachsen war in Jeannes Herz, so fest, dass ihn herauszureißen bedeutet hätte zu sterben.
Aber Jeanne wollte leben, trotz allem.
Sie mochte das Dorf, ihren Hof, die Katzen. Sie mochte die Apfelblüte und den warmen Geruch von Heu. Den Duft eines guten, starken Kaffees, ganz früh am Morgen, wenn alle Welt noch schlief. Den spontanen Plausch mit ihrer Nachbarin Valérie, deren Ziegenweiden an Jeannes Apfelplantagen grenzten.
Nein, Régis nachzufolgen war keine Option.
Unverwandt ruhte ihr Blick auf der Fotografie. Als die Aufnahme gemacht worden war, war Camille erst halb so alt gewesen wie jetzt, doch in Jeannes Augen hatte sie sich seither kaum verändert. Auch heute noch hatte ihre Tochter das gleiche schöne Haar, karamellfarben und sanft gewellt, und sie hatte die gleichen vollen, lachenden Lippen. Die gleichen braunen Augen mit den goldenen Sprenkeln. Sogar die gleiche Figur hatte die jugendliche Camille bereits gehabt. Von Jeanne, die klein und schmal war, hatte Camille ihre Kurven allerdings nicht geerbt; die kamen eher aus Régis’ Familie, in der die Männer groß waren und die Frauen üppig.
Warum ihre hübsche Camille immer noch Single war, konnte Jeanne sich beim besten Willen nicht erklären.
Vielleicht war das der Einfluss dieser flatterhaften Freundinnen? Camille hatte ihr nicht allzu viel von Geneviève und Céline erzählt, doch was sie erzählt hatte – polyamor die eine, mit dreißig schon zweimal geschieden die andere –, war für Jeanne genug gewesen, um sich ein Urteil zu bilden. Und es fiel nicht günstig für die beiden Pariserinnen aus.
Nun, Camilles Liebesleben ging Jeanne nichts an! Die jungen Frauen legten sich heutzutage eben später fest, und noch bestand ja durchaus Hoffnung. Hätte die Liebe sie selbst damals nicht wie ein Blitzschlag getroffen, so hätte wohl auch Jeanne nicht bereits mit zwanzig Jahren geheiratet.
Wobei es schon gut wäre, dachte Jeanne, wenn meine kleine Camille endlich ihr Glück finden …
Schluss damit! Streng verbot sich Jeanne ihre fruchtlosen Grübeleien. Sie hatte das Zimmer für Camilles Besuch herrichten wollen, und genau das würde sie jetzt tun. Mit ihrem lädierten Rücken dauerte das Beziehen des Betts sowieso eine kleine Ewigkeit, und die Katzen warteten bereits ungeduldig auf ihr Futter. Das Abendessen war auch noch nicht gekocht, und die Himbeermarmelade, die sie auf dem Markt nicht hatte verkaufen können, stand immer noch im Auto. Die vom Mehltau befallenen Apfelbaumzweige waren noch nicht verbrannt, und die Auberginen, Tomaten und Zucchini für die Ratatouille noch nicht geerntet, geschweige denn gekocht, und am nächsten Markttag wollte sie die Ratatouille doch verkaufen … lieber Himmel, wie sollte sie das bloß alles schaffen?!
Die Last der Arbeit, die Jeanne früher so mühelos gestemmt hatte, schlug über ihr zusammen, und sie war heilfroh, dass sie zumindest keinen Cidre mehr produzierte!
Obwohl Régis sich im Grab umdrehen würde, wenn er davon wüsste.
Denn seit seinem Tod verkaufte Jeanne die gesamten Äpfel an eine große Cidrerie, etwas, das für Régis niemals infrage gekommen wäre. Wie oft hatte er über den Fabrik-Cidre, wie er ihn genannt hatte, gespottet! Aber was nützte Jeanne der bäuerliche Hochmut? Wenn sie die Äpfel verkaufte, statt sie selbst zu verarbeiten, wurden sie gleich nach der Ernte abgeholt, und Jeanne hatte keine Arbeit mehr mit ihnen. Und dies, fand sie, war von unschätzbarem Wert.
Ein unangenehmer Gedanke durchzuckte sie: Sie war faul geworden, faul und lustlos. Mit Régis war das anders gewesen. Zusammen hatte ihnen beiden alles Freude bereitet – der Baumschnitt, das Mähen, die Ernte, das Pressen der Äpfel. Die Arbeit im Gemüsegarten, das Einkochen für den Markt, das Verkaufen selbst. Nicht einmal die Buchhaltung und den Haushalt hatten sie beide als Last empfunden, nichts war ihnen je zu viel geworden, denn es war ihr Leben gewesen, ihr gemeinsames, buntes, wundervolles Leben.
Bis Régis’ Herz aufgehört hatte zu schlagen, ohne Vorwarnung, mit noch nicht einmal sechzig Jahren.
Draußen, zwischen den Apfelbäumen, hatte Jeanne ihn gefunden.
Es hatte ausgesehen, als mache er ein Nickerchen im Gras.
Camille
Schon elf Uhr vorbei, und Camille hatte es immer noch nicht gewagt, ihren Chef um die sechs Wochen unbezahlten Urlaub zu bitten.
Vielleicht, weil sie so unglaublich wenig Lust auf diesen »Urlaub« hatte?
Schlecht gelaunt verabschiedete sie sich in die Mittagspause. Immerhin würde sie sich zum Essen mit ihren Freundinnen treffen. Diese Aussicht heiterte Camille ein wenig auf.
Beide, die kühle Geneviève und die quirlige Céline, hatten während ihres Studiums im zehnten Arrondissement gewohnt, und obwohl sie, was Viertel und Status betraf, längst aufgestiegen waren, kamen sie gern regelmäßig ins Zehnte zurück. Geneviève arbeitete mittlerweile als freie Architektin, Céline als Redakteurin bei einem Promi-Magazin, doch keine von beiden war sich zu schade dafür, wie früher mit Camille am Ufer des Canal Saint-Martin zu sitzen und indisches Curry vom Imbiss zu essen. Normalerweise plauderten sie dann über alles und nichts, über Luxushotels mit Schimmel hinter den Schränken, über vermessene Kunden, die sich von Geneviève ein Pseudo-Schlösschen mitten in Paris wünschten, oder über eine gewisse Schauspielerin, von der Céline extrem genervt war, weil sie zum wiederholten Mal das Interview mit Céline für ihre Zeitschrift hatte platzen lassen.
Heute jedoch war die Stimmung gedämpft. Camille hatte ihren Freundinnen erzählt, dass sie schon morgen abreisen musste, um der bandscheibengeplagten Mutter zur Hand zu gehen, und sowohl Geneviève als auch Céline spürten, wie ungern sie Paris verließ.
»Vielleicht werden es ja gar keine vollen sechs Wochen«, versuchte Céline, Camille zu trösten. »Es gibt doch auch Wunderheilungen, Spontanheilungen, dann ist deine Mutter in drei Tagen wieder gesund, so etwas passiert immer wieder! Wir haben mal über einen Sänger berichtet, der war todkrank, Krebs, glaube ich, und nachdem er dieses Urwald-Kraut genommen hatte …«
»Du lieber Himmel, Céline«, rügte Geneviève. »Du kannst doch Krebs nicht mit einem Bandscheibenvorfall vergleichen! Wir sollten ein bisschen sachlich bleiben, meinst du nicht?« Geneviève steckte sich eine vorwitzige Strähne ihres dunklen Haars fest, das auf dem Hinterkopf zu einer festen Banane gedreht war. Sie hasste es, wenn ihr lose Strähnen ums Gesicht fielen, denn sie hatte erklärtermaßen alles gern unter Kontrolle – ihre Frisur, ihre Baupläne und auch ihre drei Liebhaber.
An der selbstbewussten Céline jedoch perlte Genevièves Kritik ab wie Regen auf Wachs. Sie zuckte bloß die Schultern.
»Ich meine ja nur. Es muss nicht so schlimm werden, wie es im Moment aussieht. Natürlich kann es schlimm werden, sogar noch schlimmer, als …«
»Céline!«, stöhnte Geneviève.
»Schon gut, ihr beiden«, mischte Camille sich ein. »Ich werde die Zeit in der Normandie überleben, ob nun sechs Wochen oder drei Tage oder drei Monate. Schließlich muss ich ja nicht in den Knast.«
»Nein, aber fast.« Mitleidig verzog Céline die knallrot geschminkten Lippen.
»Du könntest eine Geschichte für deine Zeitschrift daraus machen, Céline«, witzelte Geneviève. »Verbannt aufs Land – ein Star zwischen Misthaufen und Schweinestall!«
»Fehlt nur noch der Star.« Céline grinste.
»Und die Schweine«, sagte Camille. »In der Normandie gibt es bloß Kühe und ein paar Ziegen.«
»Okay, vielleicht lassen wir das mit der Geschichte doch lieber bleiben.«
Sie lachten alle drei, und in diesem Moment war Camille sehr froh, ihre Freundinnen zu haben. Zwar änderte diese Mittagspause nichts daran, dass das unangenehme Gesprächmit ihrem Chef nach wie vor bevorstand; dass sie Paris verlassen musste; dass sie wünschte, sie hätte den blöden Anrufbeantworter einfach nicht abgehört. Aber mit ihren Freundinnen zu lachen machte das Herz gleich ein wenig leichter.
Camille mochte sie beide, und sie hätte nicht sagen können, wer ihr lieber war: die zweifach geschiedene Céline mit ihrem flippigen Outfit, dem platinblonden Pixie-Cut zu roten Lippen, der nie versiegenden Energie. Oder Geneviève, die ihre Stöckelschuhe ausgezogen und neben sich ans Ufer gelegt hatte, während sie im Tausend-Euro-Kostüm ganz selbstverständlich indisches Curry aus der Plastikschale aß.
Eigentlich, fuhr es Camille durch den Kopf, passe ich gar nicht zu ihnen. Zu keiner von beiden.
Das altbekannte Gefühl der Unterlegenheit stieg in ihr auf.
Sie unterdrückte es energisch. Dieses Gefühl war albern, und es gab überhaupt keinen Grund dafür! Bis auf sehr seltene Sticheleien wegen Camilles Herkunft oder ihres Gewichts – anders als ihre Freundinnen war Camille nun mal nicht in Paris geboren, und sie passte beim besten Willen nicht in Größe 34 –, ließen weder Céline noch Geneviève sie spüren, dass sie und Camille eigentlich zu verschiedenen Kreisen gehörten. Sie kannten sich seit mehr als einem Jahrzehnt, und irgendwie hatten sie es geschafft, ihre Dreier-Freundschaft über alle Unterschiede und Veränderungen hinweg aufrechtzuerhalten.
Camille wandte den Kopf ab und blickte über den Kanal. Eine lange Freundschaft, in der Tat.
Und doch ahnten weder Geneviève noch Céline, welch immense Überwindung Camille diese Heimreise kostete.
Denn die Freundinnen wussten zwar, dass sie ihre Mutter kaum je besuchte, was auch nicht anders gewesen war, als ihr Vater noch gelebt hatte. Aber dass hinter ihrer Entscheidung etwas anderes steckte als eine schlichte Abneigung gegen das langweilige Landleben, das wussten sie nicht.
Weil niemand es wusste, nur Sandrine, und die hatte Camille seit Jahren nicht mehr gesehen. Es gab Dinge, die blieben besser dort, wo sie hingehörten: in der Vergangenheit.
»Vergesst mich nicht in den nächsten sechs Wochen«, sagte Camille und stand auf. Die Mittagspause war vorüber, sie musste zurück in die Höhle des Löwen und sich endlich ihrem Chef stellen.
»Dich vergessen, du spinnst wohl!«, rief Céline und umarmte sie.
Geneviève verdrehte die Augen. »So lange sind sechs Wochen nun auch wieder nicht. Pierre sehe ich manchmal über zwei Monate nicht!«
»Ist doch gut, dann hast du mehr Zeit für die beiden anderen.« Céline grinste.
Sie klopften sich alle drei den Staub von den Röcken, begutachteten sich gegenseitig, ob sie weder Schweiß- noch Curryflecken aufwiesen und somit weiterhin büro- und kundentauglich waren, und verabschiedeten sich voneinander.
Ob es inzwischen auch in Vert-le-Coin indisches Essen zu kaufen gab?, fragte sich Camille, während sie langsam zurück zu ihrem Arbeitsplatz ging. Wahrscheinlich nicht. Aber das war nun wirklich ihr geringstes Problem.
Sie seufzte.
Dann straffte sie die Schultern, zog die Tür zum Reisebüro auf und machte sich bereit, ihrem Chef gegenüberzutreten.
Jeanne
Früh am nächsten Morgen ging Jeanne zum Bäcker. Sie wollte Brot und Petits Fourskaufen, eine süße Köstlichkeit, die sie sich nicht oft gönnte. Aber heute kam ja Camille! Außerdem war Pascal Varin ein Meister seines Fachs, und sich sein süßes Gebäck niemals zu gönnen, das wäre eine Sünde gewesen, davon war Jeanne überzeugt. Nicht umsonst war man in Vert-le-Coin der einhelligen Meinung: Bessere Backwaren als bei Pascal konnte man nicht einmal in Paris bekommen! Unter den Händen dieses Bäckers verbanden sich blassrosa Zuckerguss und luftiger Biskuit, zarte Marzipanschichten und sommersüße Aprikosenkonfitüre zu wahren Kunstwerken, verführerisch anzusehen und auf der Zunge ein Fest. Von Zeit zu Zeit fragte sich Jeanne, warum er nicht in die Stadt gegangen war, dieser mehr als begabte Mann; bestimmt hätte er dort Karriere gemacht, viel Geld verdient mit seinen klitzekleinen Kuchen, seinen knusprigen Broten, seinen verführerischen Törtchen. Vielleicht hätte Pascal sogar in Paris Filialen eröffnen können.
Aber solcher Ehrgeiz schien ihm fremd zu sein. Selbst nachdem seine Frau ihn verlassen hatte, zehn Jahre war das nun schon her, hatte Pascal sich nach einem kurzen Absturz wieder aufgerappelt. Er hatte die Hände im Teig versenkt und weitergemacht. Pascal schien schlichtweg zufrieden zu sein mit sich und der Welt. Ob seine Brote, Brioches und Petits Foursdeshalb so gut schmeckten – weil er seine heitere Gelassenheit auf alles übertrug, was er anfasste?
Jeanne lachte in sich hinein. Heiteres Gebäck, also wirklich! Man konnte schon auf seltsame Gedanken kommen, wenn einem der Duft von Hefe und warmem Obst entgegenschlug.
»Guten Morgen, Madame Rosière.«
Claire, Pascals neue Angestellte, strich sich die rot-weiß gestreifte Schürze glatt. Sie war erst achtzehn Jahre alt und immer etwas nervös, wenn Pascal in der Backstube war und sie ohne ihn verkaufen sollte. Jeanne spürte, wie sich mütterliche Gefühle in ihr regten, und sie lächelte das junge Mädchen beruhigend an.
»Guten Morgen, Claire. Wie geht es Chouchou?«
Chouchou war Claires Hündchen, ein schneeweißes Geschöpf, das sich vor allem durch anhaltendes Kläffen auszeichnete. Claire liebte den kleinen Rüden abgöttisch, und ihr Gesicht hellte sich bei der Frage nach ihm augenblicklich auf.
»Danke, Madame, mit Chouchou ist alles in Ordnung. Er hat gestern einen Hasen gejagt, der größer war als er selbst. Können Sie sich das vorstellen?«
Sie lachte, und Jeanne lachte höflich mit.
In diesem Moment kam Pascal aus der Backstube in den Laden. Er war Ende fünfzig, hatte ein kleines Bäuchlein und freundliche blaue Augen.
»Habe ich mich doch nicht verhört!«, sagte er erfreut. »Du bist das, Jeanne.«
Er klopfte sich das Mehl von den Händen. »Ist gut, Claire, ich bediene Madame Rosière. Holst du bitte die Macarons?«
Claire nickte und huschte davon, und während Pascal ein Kürbiskernbrot in ein Blatt Papier einschlug – Jeanne wählte stets sein Kürbiskernbrot –, erkundigte er sich: »Na, wie geht es deinem Rücken? Tut er noch sehr weh?«
»Ja, leider«, antwortete Jeanne. »Aber das Schlimmste ist, ich kann nicht anständig arbeiten mit den Schmerzen, und das ist wirklich unpraktisch! Gott sei Dank kommt heute Camille, um mir zu helfen. Sie wird bleiben, bis ich wieder ganz auf dem Damm bin.«
»Das ist sehr nett von ihr. Kann deine Tochter sich denn so lange Urlaub nehmen?«
»Nun … offensichtlich.« In Jeanne regte sich das schlechte Gewissen. »Ich wollte sie eigentlich gar nicht fragen, es ist furchtbar umständlich für sie, aber es geht eben nicht anders. Die Äpfel und das Gemüse reifen nicht langsamer, nur weil ich diesen dummen Bandscheibenvorfall habe. Wie auch immer, ich möchte Camille einen schönen Empfang bereiten, ein gutes Essen, danach Petits Fours …«
Um Pascals Augen bildete sich ein dichter Kranz aus Lachfältchen. »Ein gut gefüllter Magen soll also ihren Ärger darüber vertreiben, dass sie kommen musste?«
Jeanne lächelte schief. »So könnte man es ausdrücken.«
»Na denn, tun wir unser Bestes! Ich erinnere mich, dass deine Tochter Johannisbeergelee mochte … wie wäre es also mit denen hier?« Pascal deutete auf cremeweiße Kuchenwürfel, auf denen rote Marzipanblumen thronten. »Die sind mit Johannisbeergelee und weißer Schokolade.«
»Wunderbar! Ich nehme acht. Oder nein, lieber gleich zehn.«
Pascal packte die winzigen Johannisbeerküchlein in eine flache Schachtel und verschnürte diese sorgfältig mit einem hellblauen Band.
»Es ist gut, dass Camille dir hilft«, sagte er. »Ich habe gehört, du wirst demnächst für längere Zeit einen Feriengast aufnehmen, dann hast du ja noch mehr Arbeit. Dabei solltest du dich schonen.«
Jeanne hob eine Braue. »Du warst wohl in der Boule d’Or?«
Pascal grinste nur. Die Boule d’Or war zugleich Tabakladen, Bar, Bistro und Café, doch vor allem war sie der unangefochtene Umschlagplatz für Neuigkeiten und Tratsch. Claude, der Besitzer der Boule d’Or, war ein netter Kerl. Aber er war auch eine unverbesserliche Plaudertasche.
»Es stimmt, was du gehört hast. Ich bekomme einen Feriengast«, sagte Jeanne, während sie bezahlte. »Für ganze vier Wochen, Pascal!«
»Und, freust du dich?«
»Ich weiß nicht. Einerseits passt es mir gar nicht mit diesen Schmerzen, andererseits bin ich sehr froh über das Geld. Du weißt ja selbst, wie selten Touristen nach Vert-le-Coin kommen … es gibt eben nichts zu sehen bei uns.« Jeanne griff nach ihren Einkäufen. »Aber ich habe keine Lust zu jammern. Heute freue ich mich auf meine Tochter! Und mit diesem Gast aus Paris werde ich auch noch fertig, Bandscheibenvorfall hin oder her. Vielleicht ist er ja gar nicht so anspruchsvoll.«
»Wenn er aus Paris ist? Alle Pariser sind anspruchsvoll, meine liebe Jeanne.«
»Und du hast Vorurteile, mein lieber Pascal.«
Sein gutmütiges Lachen klang ihr noch in den Ohren, als sie schmunzelnd nach Hause lief.
Das freundschaftliche Geplänkel mit Pascal hatte Jeanne gutgetan. Alles war eine Spur leichter zu ertragen, wenn man ein bisschen gelacht hatte; die Geldsorgen, die viele Arbeit, sogar die Trauer, die einfach nicht vergehen wollte, auch nach drei Jahren nicht.
Es gibt vielleicht nichts zu sehen in Vert-le-Coin, dachte Jeanne, aber es gibt an jeder Ecke einen alten, verlässlichen Freund! Ist das etwa nichts?
Und deshalb würde sie für immer hierbleiben, in Vert-le-Coin, auf ihrem Apfelhof. Denn hier hatte sie gelebt, die meiste Zeit davon glücklich, und hier würde sie auch sterben.
Genau wie du, Régis, dachte Jeanne und blickte in den klaren Morgenhimmel.
Wie du, mein Liebster.
Camille
Zuerst hatte sie Paris hinter sich gelassen. Dann die Banlieue,die tristen Vororte und Schlafstädte, die um die Metropole herum wucherten wie Geschwüre. Schließlich die Autobahn.
Nun fuhr Camille, die Zähne zusammengebissen, auf der Landstraße durch die Normandie. Gerade mal zwei, drei Stunden von der Hauptstadt entfernt, war das hier bereits tiefste Provinz.
Reglos lag das hügelige Land in der Spätsommersonne. Auf abgemähten Wiesen trocknete das Heu; an knorrigen Bäumen reiften Äpfel und Birnen. Kühe auf fetten Weiden glotzten dem vorbeifahrenden Auto nach. Ein Schild am Straßenrand lockte mit »Calvados ab Hof«, wenig später wies ein anderes den Weg zu Eiern, Sahne und Käse. Und mit jedem Kilometer wurde die Landschaft noch grüner, noch üppiger, noch stiller.
Camille ließ die Fenster nach unten gleiten und den Fahrtwind ins Auto strömen, und augenblicklich roch es nach frisch gemähtem Gras. Sie musste an den alten Spruch denken, den ihr Vater gern zitiert hatte, wenn sie zusammen durch die Apfelplantagen gegangen waren: Im Pays d’Auge sei ein Stock, der abends in der Wiese liegen geblieben war, schon am Morgen von Gras überwachsen.
Sie lächelte schwach. Das Pays d’Auge, ihre Heimat, das sanfte, fruchtbare Herz der Normandie. Camille fand es immer noch schön hier, in diesem Bauernland, auch nach vierzehn Jahren in Paris. Doch das änderte nichts daran, dass sie nicht auf dieser Landstraße sein sollte, sondern in ihrem Reisebüro in der Stadt.
Ihre Finger trommelten auf das Lenkrad. Wie erwartet war ihr Chef stinksauer gewesen. Sie konnte ihn sogar verstehen: Eine Angestellte, die sich für ganze sechs Wochen verabschiedete, von heute auf morgen … das ging gar nicht! Nur gut, dass er ihr nicht auf der Stelle gekündigt hatte und sie nun ohne Arbeit dastand.
Aber was nicht war, konnte ja noch werden.
Nach einer weiteren halben Stunde auf gewundenen Straßen kam endlich Vert-le-Coin in Sicht. Zuerst der Kirchturm mit seinem Schieferdach, die Wipfel der Eiben auf dem Friedhof, dann, nach einer letzten Kurve, das Dorf selbst. Die meisten Häuser in Vert-le-Coin bestanden aus Fachwerk, rotbraun oder hellblau gestrichenes Holz, weißer Putz, dunkelgraues Dach. Kein Gebäude hatte mehr als zwei Geschosse.
Paris und Vert-le-Coin, ging es Camille durch den Kopf, sind zwei vollkommen verschiedene Welten.
Langsam fuhr sie die Hauptstraße entlang. Da war das kleine Postamt, bei dem sie früher MamansBriefe abgegeben hatte, dort das Rathaus mit seinem Kriegerdenkmal, vor dem Camille sich als Kind so gegruselt hatte. Der kleine Lebensmittelladen. Die mittelalterliche Kirche – nicht aus Fachwerk, sondern aus hellem Kalkstein –, die Camille schon von der Landstraße aus gesehen hatte. Schließlich die Bäckerei. Ob es wohl immer noch Pascal Varin war, der dort backte?
Camille fiel auf, dass sie rein gar nichts mehr wusste über das Dorf, in dem sie aufgewachsen war. Bei ihren letzten Besuchen war sie nur so kurz geblieben, dass es nicht einmal für eine Stippvisite bei den Nachbarn, der Familie Grenier mit den Kindern Damien und Lilou, gereicht hatte.
Natürlich, vor drei Jahren … da war sie länger geblieben, für mehrere Tage.
Aber da musste sie ja auch ihren Vater beerdigen.
Damals hatte der Kummer sie für alle anderen Menschen blind gemacht. An den Tag der Beerdigung, den sie wie betäubt durchgestanden hatte, konnte sich Camille kaum mehr erinnern. Erst in Paris hatte sich der Nebel aus Trauer allmählich wieder gelichtet.
»Eh,ist das nicht die kleine Camille dort im Auto? Guten Tag, Camille, guten Tag!«
Gerade passierte sie die Boule d’Or, und an den Tischen auf der Terrasse des Bistros hoben sich mehrere Hände. Drei ältere Männer und eine uralte Frau winkten ihr zu und lächelten, und verwirrt winkte Camille aus dem offenen Autofenster zurück. Wer, zur Hölle, waren diese Leute?! Das war der Beweis: Sie war viel zu lang nicht mehr hier gewesen! Richtig hier gewesen, mit genügend Zeit, mit ihren Gedanken, ihrem Herzen, ihren Sinnen.
Aber diesmal wird es ja anders sein, dachte Camille, als sie das Dorf verließ, um auf der Landstraße das letzte Stückchen bis zum elterlichen Hof zu fahren. Wenn ich schon gezwungen bin, für sechs verdammte Wochen hier zu leben und zu arbeiten, dann kann ich diese Zeit auch nutzen!
Vielleicht wohnte sogar ihre alte Schulfreundin Sandrine noch im Dorf?
Sie hörte das ferne Meckern einer Ziege – bestimmt eines der Tiere der Greniers –, und überrascht erkannte Camille, dass sie sich fast ein bisschen auf Zuhause freute.
Schon als sie auf den Schotterweg einbog, konnte sie durch den Rundbogen des Torhauses den alten Birnbaum sehen, und während das Auto die letzten Meter bis zum Hof rumpelte, stiegen halb vergessene Bilder in Camille auf. Sie selbst als kleines Mädchen auf der Schaukel. Ihre Eltern, die Arm in Arm dastanden und ihr zusahen: die zierliche Jeanne mit den großen brauen Augen und dem kurz geschnittenen Haar, und daneben der hünenhafte Régis, der sie trotz seiner starken Arme und der kräftigen, an harte Arbeit gewöhnten Hände nie anders als sanft und zart umfasste. Camille schluckte. In Augenblicken wie diesen war die Welt vollkommen gewesen, für sie alle drei.
Dass ausgerechnet ihr Vater, ein Fels in der Brandung, vor seinem sechzigsten Lebensjahr hatte sterben müssen, kam ihr auch jetzt noch seltsam unwirklich vor.
Sie parkte das Auto im Innenhof neben einer der Scheunen. Hier würde es ihre Mutter nicht stören, und den Feriengast, von dem Jeanne ihr am Telefon erzählt hatte, hoffentlich auch nicht. Aber der Mann kam ja sowieso erst in ein paar Tagen hier an.
Camille stieg aus und reckte sich. War es in der Normandie weniger heiß als in Paris, oder kam ihr das nur so vor, weil die Luft frischer war? Sauberer, duftender, würziger und … Camille grinste. Was da gerade zu ihr herüberwehte, war nicht nur der Geruch nach sonnendurchfluteten Apfelplantagen, sondern eindeutig auch der von den Nachbarsziegen.
»Camille!« Ihre Mutter kam aus dem Haus gelaufen. Ihre Miene war vor Schmerzen angespannt, doch das hinderte sie nicht daran, Camille fest zu umarmen. »Das passt gut, in zehn Minuten ist das Mittagessen fertig. Wie war die Fahrt? Möchtest du einen Aperitif?«
Camille küsste sie auf die Wange. »Fang nicht schon in den ersten Minuten damit an, mich zu bedienen, Maman. Ich bin nicht gekommen, um Urlaub zu machen, sondern um dir zu helfen.«
»Ich weiß, ich weiß! Aber lass mich dich zumindest heute Mittag ein wenig verwöhnen, hm?«
Camille hievte ihr Gepäck aus dem Kofferraum, und ihre