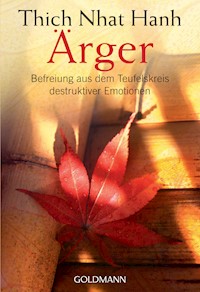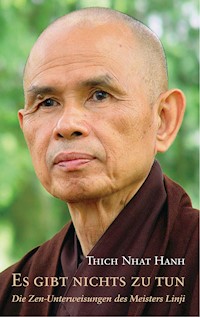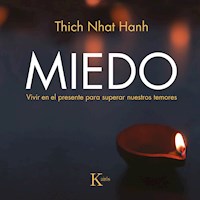17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: O.W. Barth eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiografie des Zen-Meisters Thich Nhat Hanh über die Anfänge eines beispiellosen spirituellen Lebenswegs Wie wurde Thich Nhat Hanh zu einem spirituellen Meister? Was sind die Schlüsselereignisse in seinem Leben? Nirgendwo werden diese Fragen so deutlich beantwortet wie in Der Duft von Palmenblättern. Der auf Tagebüchern Thich Nhat Hanhs beruhende Text aus den sechziger Jahren erzählt von dem Kontrast von Gewalt und Krieg in Vietnam und der Konsumgesellschaft in den USA. Vor allem lebt er aber von den berührenden und poetischen Passagen über seine ganz menschlichen Gefühle und seine außerordentlichen spirituellen »Durchbrüche«. Der einzigartige Weg des jungen buddhistischen Mönchs und seine Suche nach spiritueller Befreiung und authentisch gelebter Friedfertigkeit beginnt genau hier. In Phuong Boi "Duftende Palmenblätter" beginnt der spirituelle Weg Enttäuscht vom offiziellen Buddhismus in Vietnam baut eine Gruppe junger Mönche ein Kloster in den vietnamesischen Bergen, um ihr Ideal von einem kontemplativen und praktischen Leben zu verwirklichen. Phuong Boi "Duftende Palmenblätter" nennen sie diesen Ort, an dem alles anfängt. Inmitten der wilden Natur und zurückgezogen in die Abgeschiedenheit der Meditation macht Thich Nhat Hanh die ersten tiefen Erfahrungen der Einheit von völliger Leerheit reinen Gewahrseins und bei gleichzeitiger Verbundenheit mit allen und allem. Wie immer bei Thich Nhat Hanh zeigt sich dies auch in seinem praktischen Engagement, in diesem Fall für die notleidenden vietnamesischen Bauern. Achtsamkeit und Spiritualität - auch in der westlichen Welt Seine Aktionen zwingen Thich Nhat Hanh jedoch bald zur Ausreise ins die USA als Stipendiat in Princeton: Ein Kulturschock! Es ist spannend und rührend zugleich, wie er sich geduldig und aufmerksam an die Verhältnisse im Westen gewöhnt. Und auch hier macht er einschneidende innere Erfahrungen, deren Schilderung zum Schönsten gehört, was dieser authentische Meister je verfasst hat. Die Geburtsstunde einer großen spirituellen Berufung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Thich Nhat Hanh
Der Duft von Palmenblättern
Erinnerungen an schicksalhafte Jahre
Aus dem amerikanischen Englisch von Irene Knauf
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Wie wurde Thich Nhat Hanh zu einem spirituellen Meister? Was sind die Schlüsselereignisse in seinem Leben? Nirgendwo werden diese Fragen so deutlich beantwortet wie in Der Duft von Palmenblättern.
Der auf Tagebüchern Thich Nhat Hanhs beruhende Text aus den sechziger Jahren erzählt von dem Kontrast von Gewalt und Krieg in Vietnam und der Konsumgesellschaft in den USA. Vor allem lebt er aber von den berührenden und poetischen Passagen über seine ganz menschlichen Gefühle und seine außerordentlichen spirituellen »Durchbrüche«. Der einzigartige Weg des jungen buddhistischen Mönchs und seine Suche nach spiritueller Befreiung und authentisch gelebter Friedfertigkeit beginnt genau hier.
Enttäuscht vom offiziellen Buddhismus in Vietnam baut eine Gruppe junger Mönche ein Kloster in den vietnamesischen Bergen, um ihr Ideal von einem kontemplativen und praktischen Leben zu verwirklichen. Phuong Boi "Duftende Palmenblätter" nennen sie diesen Ort, an dem alles anfängt.
Inmitten der wilden Natur und zurückgezogen in die Abgeschiedenheit der Meditation macht Thich Nhat Hanh die ersten tiefen Erfahrungen der Einheit von völliger Leerheit reinen Gewahrseins und bei gleichzeitiger Verbundenheit mit allen und allem. Wie immer bei Thich Nhat Hanh zeigt sich dies auch in seinem praktischen Engagement, in diesem Fall für die notleidenden vietnamesischen Bauern.
Seine Aktionen zwingen Thich Nhat Hanh jedoch bald zur Ausreise ins die USA als Stipendiat in Princeton: Ein Kulturschock! Es ist spannend und rührend zugleich, wie er sich geduldig und aufmerksam an die Verhältnisse im Westen gewöhnt. Und auch hier macht er einschneidende innere Erfahrungen, deren Schilderung zum Schönsten gehört, was dieser authentische Meister je verfasst hat. Die Geburtsstunde einer großen spirituellen Berufung!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Vereinigte Staaten
26. Juni 1962
18. Juli 1962
16. August 1962
18. August 1962
20. August 1962
21. Dezember 1962
23. Dezember 1962
24./25. Dezember 1962
20. Januar 1963
Vietnam
5. Februar 1964
20. März 1964
12. Dezember 1964
11. Februar 1965
12. Juli 1965
11. Mai 1966
Praxiszentren
Der Titel des Buches spielt auf die duftenden Blätter der in Sri Lanka und im südlichen Indien beheimateten Talipot- oder Schattenpalme an, deren lange, zähe Blätter in früheren Zeiten so bearbeitet wurden, dass sie – wie die Papyrusblätter – beschrieben werden konnten. Unmittelbar bevor die Blätter sich voll auseinanderrollten und entfalteten, wurden sie gebleicht, getrocknet, poliert und zu Rechtecken geschnitten. Auf ihnen wurden – beidseitig – die Texte der buddhistischen Sutras niedergeschrieben.
Vereinigte Staaten
1962–1963
26. Juni 1962
Medford, New Jersey
Ich befinde mich in den Wäldern im nördlichen New Jersey in einer Hütte, der sogenannten »Pomona-Hütte«. Die Nacht, in der ich hier eintraf, war so dunkel, dass ich am ersten Morgen nach meiner Ankunft von der Schönheit und friedvollen Stille des Ortes völlig überrascht war. Die Morgenstunden erinnern mich an Phuong Boi, an unser Kloster, das wir im Hochland von Zentralvietnam errichtet haben. Phuong Boi war für uns ein Platz, an dem wir unsere Wunden heilen konnten und der es uns möglich machte, in das, was uns und unserer Lebenssituation widerfahren war, tief zu schauen. Der Wald war erfüllt von Vogelgesang, und die Sonnenstrahlen sammelten sich in großen Tümpeln.
Als ich vor Monaten in New York ankam, konnte ich überhaupt nicht schlafen. Es ist dort so laut, selbst um drei Uhr morgens. Ein Freund gab mir Ohrenstöpsel; ich aber fand sie höchst unangenehm. Nach ein paar Tagen gelang es mir, wenigstens ein bisschen Schlaf zu finden. Es ist eine Sache der Gewöhnung. Ich kenne ein paar Leute, die nicht schlafen können, wenn sie nicht das laute Ticken einer Uhr hören. Als der Romanschriftsteller Cuong einmal eine Nacht in Phuong Boi verbrachte, hielt die Stille des Dai-Lao-Waldes ihn wach, so sehr war er an die Geräusche des Saigoner Verkehrs gewöhnt.
Hier in Pomona wurde ich mir der gleichen tiefen Stille bewusst. Vogelgesang ist kein »Lärm«. Er verstärkt nur die Empfindung von Stille. Ich legte meine Mönchsrobe an, ging nach draußen und wusste, dass ich mich im Paradies befand. Pomona liegt am Ufer eines Sees, der größer ist als der See Ho Xuan Huong in Dalat. Sein klares Wasser glitzert im Morgenlicht, und das baumumsäumte Ufer lässt Blattwerk von jeglicher Form und Farbe erkennen und kündigt den Übergang vom Sommer in den Herbst an. Ich bin hierhergekommen, um der Großstadthitze zu entgehen und ein paar Wochen lang im Wald zu leben, bevor ich für das Herbstsemester an die Columbia-Universität gehen werde.
An jenem Morgen drang von ferne Gelächter an mein Ohr. Während ich noch meine Robe zuknöpfte, ging ich dem Klang nach. Bald öffnete sich der von meiner Hütte wegführende Pfad zu einer weiten Lichtung, auf der verstreut Hütten lagen. Ich erblickte einige Dutzend Kinder, die sich an im Freien aufgestellten Waschbecken die Zähne putzten und ihre Gesichter wuschen. Ich war im »Cherokee Village« angelangt, einem Lager für Sieben- bis Zehnjährige, das zu den sogenannten »Villages« gehört, aus denen das »Camp Ockanickon« sich zusammensetzt. Den ganzen ersten Tag spielte ich mit den Jungen vom Cherokee Village. Sie hatten ein goldfarbenes Rehkitz mit weißen Flecken gefunden, das sie »Datino« nannten und mit Haferbrei und Milch und zarten Kohlblättern fütterten.
Ich habe nur wenige Bücher hierher mitgebracht, und ich habe bis jetzt keine Zeit gefunden, auch nur eins von ihnen zu lesen. Wie kann ich lesen, wenn der Wald so still ist, der See so blau und der Vogelgesang so rein? An manchen Tagen verbringe ich den ganzen Morgen, gemächlich unter den Bäumen entlangstreifend, in den Wäldern; ich lege mich mit verschränkten Armen auf den Teppich von weichem Moos und richte meinen Blick zum Himmel hoch. In solchen Augenblicken bin ich ein anderer Mensch. Ich könnte sagen, dass ich dann zu meinem »wahren Selbst« gefunden habe. Meine Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken sind anders als die, die ich in New York habe. Hier erscheint alles in geradezu übernatürlicher Weise in einem strahlenderen Licht. Gestern paddelte ich in einem Kanu mehr als eine Meile weit bis zum Nordende des Sees. Inmitten der Seerosen hielt ich mit dem Paddeln inne und machte mich erst dann wieder auf den Heimweg, als die Abenddämmerung den Himmel violett zu färben begann. Es wurde jetzt rasch dunkel. Hätte ich mich nur wenig länger dort oben aufgehalten, so hätte ich den Weg zurück zum Anlegeplatz von Pomona wohl nicht gefunden.
Sim-Früchte wie in Phuong Boi gibt es in diesem Wald nicht. Dafür aber finden sich hier Beeren, die ebenso purpurfarben und süß sind; sie heißen Heidelbeeren. Heute habe ich zusammen mit zwei acht Jahre alten Jungen einige davon gepflückt. Wir haben unsere Münder vollgestopft, bis sie sich blau färbten. Die ganze Zeit über hatten die Jungen sich etwas zu erzählen. Einer sagte, er habe in der vergangenen Nacht einen »Schwarzen Mann« gesehen, einen Teufel mit Hörnern, der seine Hände ins Zelt schob und nach den schlafenden Jungen griff. Er behauptete das im Brustton der Überzeugung. In Wirklichkeit aber muss es einer der Betreuer gewesen sein, der des Nachts bei ihnen nach dem Rechten schaute. Ich lächelte ein wenig und pflückte weiter Heidelbeeren, als der Junge ein paar Schritte zurücktrat und mich fragte: »Du glaubst mir nicht, oder?« – »Doch, ich glaube dir«, antwortete ich, »aber nicht ganz.«
»Warum nicht?«
»Weil das, was du da erzählst, schwer zu glauben ist. Man muss sich sehr anstrengen, um auch nur ein bisschen davon zu glauben.« Er sah bestürzt aus.
Am Abend kamen die beiden Jungen in meine Hütte, und beide behaupteten erneut, dass sie den »Schwarzen Mann« gesehen hätten. Sie sprachen voller Überzeugung, und es blieb mir nichts anderes übrig, als nachzugeben.
»Okay, ich glaube euch beiden.«
Zufrieden kehrten sie nach Cherokee Village zurück.
An solchen Tagen sehne ich mich nach Phuong Boi. Der Dai-Lao-Wald ist viel dichter und wilder. Selbst Tigern kann man dort begegnen! In vielen Nächten träume ich von Phuong Boi, doch gibt es in diesen Träumen immer etwas, was mich daran hindert, dort hinzukommen. Je mehr ich mich nach Phuong Boi sehne, umso trauriger fühle ich mich. Phuong Boi war unsere Heimat. Wie Bruder Nguyen Hung zu sagen pflegte: »Phuong Boi gehört nicht uns. Wir gehören zu Phuong Boi.« Unsere Wurzeln sind dort, tief in der Erde. Es heißt gewöhnlich, dass uns nur traurige Vorkommnisse in Erinnerung bleiben; das ist aber nicht wahr. Wir verbrachten die glücklichste Zeit unseres Lebens in Phuong Boi, und unsere Erinnerung macht es möglich, dass wir uns heute, ganz gleich, wo wir sind, diesem Ort so zuwenden, wie eine Sonnenblume sich zur Sonne hindreht.
Als wir zum ersten Mal nach Phuong Boi kamen, lebte Nguyen Hung noch in Dalat. In unserem Bemühen, den Menschen in Vietnam die Ideale des Buddhismus nahezubringen, hatten wir unendlich viele Enttäuschungen hinnehmen müssen. Hung war zehn Jahre jünger als ich, hatte aber schon ebenso viele Enttäuschungen erlebt. Was uns alle unglücklich machte, waren die politische Situation in unserem Land und der Zustand, in dem der Buddhismus sich befand. Wir versuchten, einen volksnahen Buddhismus ins Leben zu rufen, der den Bedürfnissen der Menschen Rechnung trug, aber wir hatten keinen Erfolg. Um die Idee eines möglichst viele Menschen ansprechenden, geeinten Buddhismus zu fördern, schrieb ich Zeitungsartikel, veröffentlichte Bücher und wirkte bei der Herausgabe von Zeitschriften mit. Dazu gehörte auch das Journal of the Buddhist General Association. Doch nach zwei Jahren wurde die Herausgabe des Journals eingestellt. Die Herausgeber sagten, fehlende Geldmittel seien schuld daran. In Wirklichkeit aber waren die in der Hierarchie oben stehenden Buddhisten mit dem Inhalt meiner Artikel nicht einverstanden. Auf einem Treffen erklärten sie: »Noch nie ist unsere Zeitschrift dazu benutzt worden, um die Vereinigung aller buddhistischen Gemeinschaften zu predigen!«
Wir fühlten uns verraten und verkauft. Die Gelegenheit, den Buddhismus in unserem Sinn richtungweisend zu beeinflussen, schien dahin zu sein. Die hierarchischen Strukturen waren zu konservativ. Was für Chancen gab es noch für uns junge Leute ohne Rang und ohne eigenes Zentrum, um unsere Träume zu verwirklichen? Ich wurde sehr krank, verließ die Stadt und zog mich in einen kleinen Tempel in der Gegend von Blao zurück. Unsere Freunde zerstreuten sich in alle Winde. Ich fühlte mich am Ende.
Aber auch in Blao konnte ich keinen Frieden finden. Der Tempel dort stand gleichfalls unter dem Einfluss der konservativen Kräfte in der buddhistischen Hierarchie. Von Zeit zu Zeit kam Schwester Dieu Am von Djiring zu Besuch und brachte Medikamente und ein paar Orangen mit. Ihr ist es zu verdanken, dass wir all unseren Mut zusammennahmen und Phuong Boi Wirklichkeit werden ließen. Jetzt ruht sie friedlich im Herzen der Erde.
Ich habe viel über die Anfänge von Phuong Boi nachgedacht. Schwester Dieu Am war die Erste, mit der ich über das, was mich bewegte, sprach. »Unser letzter Anker ist verloren gegangen«, sagte ich. »Vielleicht haben wir nicht intensiv genug praktiziert. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das in völliger Ruhe tun können.«
Sie antwortete, dass sie uns von Herzen gern »Plum Forest« zur Verfügung stellen würde und bereit sei, in den Thien-Minh-Tempel in Hue zurückzukehren, dass sie aber nicht befugt sei, eine solche Entscheidung zu treffen. Was für ein liebevolles und edles Herz sie doch hatte! Ich lächelte und sagte: »Es ist mir unmöglich, dich zu bitten, nach Hue zurückzugehen. Das wäre mir unangenehmer, als ertragen zu müssen, keinen Ort zur inneren Einkehr zu haben.« Schwester Dieu Am wohnte in Djiring in der Stille des Plum Forest. Aus dem Grund gaben wir später der Brücke am Eingang zu Phuong Boi den Namen »Plum Bridge«. Wie wunderschön war die Brücke einst! Heute liegt sie in Trümmern und ist verfallen.
Die vielen Rückschläge hatten unsere Zuversicht arg erschüttert. Es stand außer Frage, dass wir einen Ort brauchten, an dem wir unsere Wunden heilen, Kräfte gewinnen und neue Initiativen vorbereiten konnten. Pausenlos machten wir uns Gedanken über unsere Zukunft und fassten schließlich den Entschluss, ein eigenes Kloster zu gründen. Als geeignet scheinenden Platz wählten wir den entlegenen und ruhigen Dai-Lao-Wald, dessen Berge uns zum Kontemplieren viel Raum boten und in dem es Lichtungen und klare Bäche gab und Pfade, die zum Gehen einluden. Der Gedanke, ein solches Kloster zu errichten, übte auf uns die gleiche Anziehungskraft aus wie Wasser es bei einem Menschen tut, der die Wüste durchquert, oder ein Geschenk bei einem kleinen Kind. Wir malten uns einen Ort aus, wo wir einen Lebensstil pflegen konnten, wie er für die Menschen unserer Zeit nötig ist. Der Dai-Lao-Wald liegt etwa vier Meilen nördlich von Blao, wo die höchsten Berge zum Himmel ragen. Zu jener Zeit war der Wald im Besitz der einem Bergstamm angehörenden Montagnards. Wir konnten ihn ganz billig von ihnen erwerben. Zu beiden Seiten der durch den Wald führenden Straße rodeten wir bestimmte Flächen und machten sie so urbar; andere ließen wir als Urwald stehen.
Als wir das erste Mal auf der unbefestigten Straße in den tiefen und geheimnisvollen Dai-Lao-Wald hineinfuhren, wussten Schwester Dieu Am, Dieu und ich, dass wir einen Blick in die Zukunft taten. Der Name »Phuong Boi« sollte deutlich machen, dass wir uns auf die Wurzeln unserer kostbaren buddhistischen Kultur zurückbesinnen und sie wiederbeleben wollten. »Phuong« bedeutet »duftend«; »boi« ist die Art von Palmenblatt, auf der in alten Zeiten die Lehrreden des Buddha aufgezeichnet worden waren.
Der Teil des Waldes, an dem wir interessiert waren, gehörte verwaltungsrechtlich zu einem Dorf namens B’su Danglu. Nach einigen Wochen schafften Schwester Dieu Am, Dieu und ich es, das von uns erwünschte und sechzig Morgen umfassende Stück Land kartografisch zu umreißen. Wir boten 6500 Piaster (ungefähr 90 Dollar) dafür. Es war nicht so, dass wir die leichtgläubigen Montagnards hätten übervorteilen wollen. Das war der übliche Preis für Grundstücke hier, und tatsächlich legten wir noch zusätzliche 3500 Piaster (50 Dollar) obendrauf. Wir brachten das Geschäft mit zwei freundlichen Männern namens K’Briu und K’Broi zum Abschluss, von denen keiner lesen oder schreiben konnte. Aber der Ortsvorsteher von Blao namens K’Bres und sein Bezirksvorsteher namens K’Dinh konnten es.
An einem sonnigen Augusttag im Jahre 1957 gingen Tue und ich in das Büro des Vorstehers, um die Papiere zu unterzeichnen. Ich unterschrieb »Nhat Hanh«; es war das erste Mal, dass ich meine Unterschrift unter eine Urkunde setzte. Unten auf dem Vertrag waren die Fingerabdrücke von K’Briu, K’Broi und dem stellvertretenden Präfekten von B’su Danglu, die Unterschriften von K’Bres und K’Dinh und meine eigene. So wurde ich also zum Grundbesitzer, eine Tatsache, die die Kommunisten später gegen mich ins Feld führen sollten, um mich zu denunzieren.
18. Juli 1962
Medford, New Jersey
Seit Tagen regnet es schon. Das Dach meiner Hütte ist undicht, und die Bücher auf meinem Tisch werden allmählich feucht. Ich habe den Tisch schon ein paarmal umgestellt, und heute Morgen hoffe ich nun endlich ein trockenes Plätzchen gefunden zu haben.
Gestern Abend besuchten mich zwanzig Jungen vom »Ranger Village« in meiner Hütte, um von mir eine Einführung in den Buddhismus zu bekommen. Den größten Teil dieses Monats bin ich der »Gastredner« des Lagers gewesen. Ich habe zu insgesamt acht Gruppen gesprochen, auch zu den Jüngsten vom Cherokee Village. Die Rangers sind die Ältesten. Jeder Junge brachte einen Arm voll Holz für den Kamin mit. An kühlen Abenden macht ein warmes Feuer Pomona behaglich. Die Jungen und ich setzten uns ums Feuer. Ich trug die grauen Hosen und das graue Hemd eines Mönchsnovizen und fing an, den Jugendlichen zu erklären, dass dies eigentlich die Alltagskleidung von noch nicht voll ordinierten vietnamesischen Mönchen sei. »Ein voll ordinierter Mönch sollte die braune Robe tragen wie die, die da in der Ecke hängt«, sagte ich. »Ich aber mag es, die Kleider eines Novizen zu tragen. Ich habe so das Gefühl, jung zu sein.« Ich legte dann die braune Robe an und erklärte den Jungen, dass die Mönche in Vietnam braun gekleidet sind, um sich den Bauern gleichzustellen, deren Kleidung auch von brauner Farbe ist. Danach zog ich meine sanghati-Robe an und erklärte, dass diese gelbe Robe nur bei besonders feierlichen Anlässen getragen wird. Ich sprach ein wenig über den Südlichen (Theravada-) und den Nördlichen (Mahayana-)Buddhismus, über buddhistische Weisheit und über die Ähnlichkeiten zwischen Buddhismus und Christentum. Junge Leute sind aufgeschlossene Zuhörer und haben immer viel zu fragen. Ihre Wissbegier ist grenzenlos. Sie fragten: »Warum haben buddhistische Tempel geschwungene Dächer?« – »Bist du Vegetarier?« – »Dürfen buddhistische Mönche heiraten?« – »Welche Haltung nimmt der Buddhismus Jesus gegenüber ein?« Um unserem Zusammensein einen würdigen Abschluss zu geben, rezitierte ich Grenzenloses Leiden ausroden.
Nachdem sie gegangen waren, legte ich ein wenig mehr Holz ins Feuer und saß, in die Flammen schauend, still da. Draußen regnete es weiterhin in Strömen. Ich stellte mir vor, dass es auch in Saigon, Hue und Phuong Boi regnete. Bruder Thanh Tue hatte geschrieben, dass es in Phuong Boi schon seit Wochen regnet und dass der Sturm einen Teil des Daches vom Haus Montagnard fortgerissen hat. Ich weiß nicht, ob er die Absicht hat, es zu reparieren, oder ob er das ganze Haus dem Wind opfern will. Wir haben so viel Arbeit investiert, um dieses Haus hoch oben auf dem höchsten Berg zu errichten. Die steile Schräge des Daches gab ihm das Aussehen von zwei zum Gebet aneinandergelegten Händen. Wir verbrachten viele glückliche Stunden dort; wir studierten, machten Pläne, tranken Tee und hörten Musik, und gewöhnlich saßen wir nach japanischer Art auf den Fersen. Wenn uns aber die Füße und Beine müde wurden, wechselten wir zum kambodschanischen Stil und streckten unsere Beine zu einer Seite hin aus. Die Lotushaltung nahmen wir nur während der Sitzmeditation ein. Heute Abend stelle ich mir vor, wie ich in Phuong Boi mit Nguyen Hung, Tue, Thanh Tu und Tam Hue zusammensitze, und ich lächle still vor mich hin. Jeder von uns gehört zu Phuong Boi, wie Hung gesagt hat. Ich frage mich, ob Hung sich genauso sehr nach Phuong Boi sehnt, wie ich es tue.
Nachdem wir die sechzig Morgen Land gekauft hatten, war unser Geld restlos aufgebraucht. Wir hatten nicht einmal mehr so viel, um uns Medikamente kaufen zu können (mir ging es immer noch ziemlich schlecht). Also beschlossen Onkel Dai Ha und ich, zehn Morgen Wald urbar zu machen, um Tee anzubauen. Wir stellten drei Dutzend Montagnards an, die uns halfen, die Bäume zu roden, und einen Monat später, als die gefällten Bäume getrocknet waren, verbrannten wir sie. Bevor wir mit der eigentlichen Teepflanzung begannen, mussten wir auf die Regenzeit warten. Es war uns klar, dass es eine Weile dauern würde, bis der Teeanbau rentabel sein würde; also mussten wir uns Gedanken machen, auf welche andere Art und Weise wir zu Geld kommen konnten. Bruder Thanh Tue fuhr nach Saigon, wo er Tantiemen eintrieb, die verschiedene Verlagshäuser mir schuldeten, und Schwester Dieu Am schenkte uns einiges Geld, sodass wir weitermachen konnten.
Fünf Monate später gingen Schwester Dieu Am, Thanh Tue und ich zusammen mit Onkel Dai Ha in den Wald und stellten fest, dass die Teepflanzen prächtig gediehen waren. Onkel Dai Ha hatte unter den Montagnards Arbeiter ausgesucht und angestellt, die die Pflanzung vorgenommen hatten. Mit welcher Hingabe er sich der Verwirklichung des Dharma widmete! Der Wald war feucht und der Weg nicht gut markiert. Einige Male mussten wir stehen bleiben, um Blutegel von unseren Beinen zu entfernen. Onkel Dai Ha machte das alles gar nichts aus. Einmal, so erzählte er uns, hätten sich derart viele Blutegel an seinen Beinen festgesaugt, dass er nur mithilfe einer Bambusfaser, die er an den Beinen hin und her zog, die Egel abstreifen konnte. Thanh Tue und ich fühlten uns von ihnen nicht besonders belästigt. Sobald wir spürten, dass sich welche an uns festsetzten, machten wir eine kleine Pause und zogen sie ab, mit ein wenig Widerwillen. Schwester Dieu Am aber schrie jedes Mal auf, sobald sich einer an ihrem Bein festsaugte, und wir mussten ihr zu Hilfe kommen. Nach ein paar Monaten aber schaffte auch sie es, ihre Abscheu zu überwinden.
Während der Sommermonate konnten wir unbehelligt wandern. Doch sobald es im Wald wieder feucht wurde, waren auch die Blutegel wieder da. Onkel Dai Ha erklärte: »Sie sterben im Sommer nicht; sie trocknen einfach nur aus. Wenn der Regen kommt, erwachen sie wieder zum Leben.« Er erzählte uns, dass einer seiner Arbeiter einmal einen Zweig aufgehoben habe, um ihn als Zahnbürste zu benutzen. Aber plötzlich habe die »Zahnbürste« begonnen, sich zu winden. Es war ein Blutegel, der durch den Speichel des Mannes seine Lebenskraft wiedergewonnen hatte. Er warf ihn zu Boden und musste Wasser holen gehen, um sich den Mund auszuspülen. Die dort in den Bergen lebenden Menschen reiben sich die Beine mit einer Art Salbe ein, die den Egeln widerlich ist, oder sie tragen einen Kalkstein bei sich, wie er zusammen mit der Betelnuss gekaut wird. Wenn ein Blutegel mit ein wenig Kalkstein eingerieben wird, fällt er ab.
Während wir durch den Wald gingen, erzählten wir einander Geschichten, und es dauerte nicht lange, bis wir unsere Teeplantage auf dem Berg erreicht hatten. Der Berg Montagnard war der höchste im Wald. Wenn man von hier aus Ausschau hielt, war der Himmel vollkommen blau und die Wolken rein weiß. In der Ferne liegende, in Wolken eingehüllte Berge sahen aus wie Inseln, die aus einem Meer herausragten. An klaren Tagen konnten wir die sich in der Tiefe ausbreitende weite Landschaft überblicken. Zwei Jahre lang stieg ich jeden Tag auf die Höhen des Montagnard hinauf, und jedes Mal fand ich Phuong Boi schöner als zuvor. An manchen Morgen war der Nebel so dicht, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen konnte, aber selbst dann war es eine überwältigende Freude, dort oben zu stehen. Eines Morgens, als der Wald vom Vogelgesang widerhallte, verließen Hung und ich die Meditationshalle und stiegen den Berg hinauf. Als wir oben angekommen waren, sahen wir auf einmal zwei Hirsche, die inmitten der Teepflanzen tanzten. Im Morgenlicht glänzte ihr Fell wie mit weißen Sternen betupfte goldene Seide. Weil wir die Tiere nicht erschrecken wollten, blieben wir regungslos stehen und beobachteten ihr Spiel auf dem Teeberg. Dann sprangen sie davon und verschwanden im südlichen Teil des Waldes. Wir waren stumm vor Staunen.
Obwohl der Berg mit Tee bepflanzt war, sah es hier noch wild und unkultiviert aus. Wir gingen zwischen den Reihen von Teepflanzen hindurch, mussten dabei aber um viele stehen gebliebene Baumstümpfe herumgehen oder sie übersteigen. Onkel Dai Ha erklärte uns, dass sie innerhalb weniger Jahre verrotten würden, sodass es nicht nötig wäre, sie mit den Wurzeln auszugraben. Die Erde dort war weich und duftend. Wir gingen um den Berg herum und machten dann am Waldrand eine Pause. Dort wollte Onkel Dai Ha weitere fünfzehn Morgen urbar machen, um Häuser zu errichten und einen Garten anzulegen. Ein Jahr später, als Nguyen Hung zu uns zog, warf die Teeplantage bereits einen kleinen Ertrag ab, und Schwester Dieu Am schlug vor, weitere fünf Morgen urbar zu machen und noch mehr Tee anzupflanzen.
Zur gleichen Zeit begannen wir am Fuß des Montagnard mit dem Bau eines zweistöckigen Gemeinschaftshauses. Das obere Stockwerk sollte uns als Meditationshalle dienen, und für das Erdgeschoss planten wir eine Bibliothek, ein Arbeitszimmer, einen Schlafraum, eine Küche und ein Wohnzimmer.
Es gelang mir, ein weiteres Manuskript zu verkaufen, Neue Forschungsergebnisse über den Buddhismus, aber wir waren immer noch in finanziellen Nöten. Wir baten alle, die wir kannten, um Hilfe. Außer Schwester Dieu Am unterstützten uns Nhu Thong, Nhu Khoa und Onkel Dai Has Familie am meisten.
Während des Bauens war es für die Arbeiter außerordentlich schwierig, nach Phuong Boi zu gelangen und von dort wieder fortzukommen. Selbst mit Ketten um die Räder schaffte ein Laster es nicht, den verschlammten Berg hochzukommen, um benötigtes Bauholz oder Proviant abzuliefern. Onkel Dai Ha musste einen weiteren vierhundert Meter langen Weg durch den Wald brandroden lassen. Ich war der Geomant, der festlegte, nach welcher Seite die Gebäude ausgerichtet werden sollten, damit Wohlbefinden garantiert sei. Vielleicht sind meine mangelnden Kenntnisse in feng shui schuld daran, warum Phuong Boi heute nicht mehr existiert und wir selber in alle Winde zerstreut sind. Ich hätte die Aufgabe nicht übernehmen dürfen.
Jede Woche kam Schwester Dieu Am von Plum Forest herüber, um uns zu besuchen, und dank der harten Arbeit und dem Fußmarsch besserte sich ihr Gesundheitszustand. Selbst Nhu Khoa, ein kräftiger junger Mann, konnte mit ihr kaum Schritt halten. Weil wir rechtzeitig zum Regenzeit-Retreat in Phuong Boi einziehen wollten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Inzwischen war der Weg fertig geworden, und wir konnten Phuong Boi erreichen, indem wir eine Brücke überquerten und dem Pfad bis zum Fuß des Montagnard-Bergs folgten.
Wenn ich doch nur den Rest meines Lebens in diesem prachtvollen Wald zubringen könnte! Der Pfad duftete nach chieu-Blüten und vielen anderen Blumen. Ich brauchte nur an der Brücke zum Eingang von Phuong Boi anzukommen, und schon war ich heiter gestimmt. Ich hatte das Gefühl, angekommen zu sein. Der letzte Teil des Pfades stimmte mich noch freudiger. Hinter einer Kurve tauchten unerwartet der Montagnard und Phuong Boi auf. Der Zen-Meister Thây Thanh Tu liebte es, auf seinen Wanderstab gestützt und mit seinem weiten Strohhut auf dem Kopf, sich hier zu ergehen.
Unmittelbar vor Beginn des Regenzeit-Retreats begann es zu stürmen und zu regnen, und es war schwierig, alles ins Haus zu transportieren. Betten, Bücherregale, ein kleiner Herd und manches andere war an seinen Platz zu schaffen. Tue unterrichtete in Bao Loc und konnte uns nicht viel helfen. Hung und ich verbrachten lange Tage damit, die Meditationshalle auszugestalten. Es war uns wichtig, dass sie ein Gefühl von Schlichtheit und Harmonie vermittelte. In dieser Meditationshalle saßen wir nicht auf dem Boden, sondern erhöht auf bankförmigen Podesten. Den heitere Gelassenheit und Freude ausstrahlenden Buddha auf dem Schrein hatte Thây Giai Thich, mein älterer Bruder, bemalt.
An einem Nachmittag, als Hung und ich auf dem Balkon standen und zum Meditationswald hinunterschauten, sahen wir eine Wolke, die sich wie ein auseinandergerollter Ballen Seide vom Waldrand bis hin zum Fuß des Berges Montagnard erstreckte. Wir liefen den Berg hinunter, um der Wolke ganz nahe zu sein, aber sie verschwand. Also stiegen wir den Berg wieder hoch, und da war sie wieder! Mit seinen vielen Kiefern und anderen majestätischen Bäumen war der Meditationswald der schönste Teil des Waldes. Wir planten, eine Reihe von schmalen Pfaden und ein paar Plätze anzulegen, wo man in Meditation oder stiller Kontemplation sitzen konnte. Es gab viele verschiedene Blumen hier, die wir pflücken und mit denen wir den Buddha-Schrein schmücken konnten; am meisten mochten wir die chieu- und die trang-Blüten.
Nhu Ngoc und Nhu Thong hatten versprochen, zur feierlichen Einweihung von Saigon herüberzukommen. Unglücklicherweise regnete es an dem Tag in Strömen. Nhu Koa hatte Hung und Tue einen Jeep geliehen, mit dem zweitausend Bücher für unsere Bibliothek herangeschafft werden sollten. Aber immer wieder blieb der Jeep auf halbem Weg am Berghang stecken, und immer wieder rutschte er nach unten zurück. Es dauerte den ganzen Tag, bis der Wagen oben angekommen war und wir die Bücher ausladen konnten. Ganz zum Schluss, als Hung gerade ein hübsches Bücherregal, das Nhu Thong uns geschenkt hatte, ins Haus trug, begann es so heftig zu regnen, dass Hung und Thanh Tue wie Wasserratten aussahen. Ich räumte gerade Bücher ein, als ich sie kommen sah – bis auf die Haut durchnässt und am ganzen Leib schlotternd. Ich wickelte Hungs Füße in Decken ein und machte Feuer, damit Tues Kleidung trocken werden konnte; er aber wollte unbedingt in die Stadt zurückfahren.
Um sieben Uhr servierte Frau Tam Hue uns das Abendessen, die erste Mahlzeit an unserem neuen Küchentisch. Hung fror so sehr, dass er nicht mit dabei sein wollte. Schließlich setzte er sich aber doch an den Tisch, und ich bot ihm ein Schälchen Reis an. Ich sprach ihm gut zu: Wenigstens ein Häppchen solle er zu sich nehmen. Widerstrebend nahm er seine Essstäbchen in die Hand. Es dauerte aber nicht lange, da aß und plauderte er vergnügt. Noch dreimal durfte Frau Tam Hue sein Schälchen nachfüllen! In der Nacht fiel er in einen tiefen Schlaf, und von einer Erkältung war am nächsten Tag nicht das Geringste zu spüren.
Tue kam am nächsten Morgen nach Phuong Boi zurück und erzählte uns, dass er, nachdem er zum Bao-Loc-Tempel zurückgekehrt war, gleich trockene Kleider angelegt habe. Er habe sich dann eine Tasse heißen Tee eingeschenkt, sei aber eingeschlafen, während der Tee noch abkühlen sollte. Fest wie ein Murmeltier habe er die ganze Nacht durchgeschlafen.
Zum ersten Mal blieben Hung und ich die Nacht über in Phuong Boi. Die Türen waren noch nicht eingehängt, und der Sturm blies einen Holzbalken um. Das Krachen schreckte uns aus dem Schlaf. Wir hörten den Wind heulen, und uns war klar, dass ein Taifun im Anzug war. Da waren wir nun, mitten im Wald, weit weg von jeglicher Zivilisation! Unser einziger Wunsch war doch gewesen, Wurzeln zu schlagen, im Wald ein Haus zu bauen und uns auf sicheres Terrain zurückzuziehen!
Nach dem Krachen konnten wir keinen Schlaf mehr finden. Also machten wir uns ein Feuer und redeten miteinander, bis die ersten Vögel anfingen zu singen und die schreienden Gibbons den herannahenden Morgen ankündigten. Wir stiegen die Anhöhe hinauf und sahen, wie der Osten im Morgenlicht errötete. Nebel verhüllte die fernen Berge.
Phuong Boi war Wirklichkeit geworden! Es schenkte uns seine ungezähmten Hügel als riesige weiche Wiege mit Wildblumen und Waldgräsern als Kissen. Hier hatten wir zum ersten Mal eine Zuflucht gefunden vor der harten Unerbittlichkeit der Welt.
16. August 1962
Medford, New Jersey
Am nächsten Mittwoch werde ich von hier fortgehen und nach New York zurückkehren. Der Herbst ist da. Hier in Amerika nennen sie ihn »fall«, weil jetzt so viele Blätter von den Bäumen fallen. Die erste Jahreszeit, wenn junge Knospen aus den Zweigen hervorspringen, nennen sie »spring«. Riverside Park muss jetzt wunderbar aussehen. Princeton ist immer schön im Herbst. In Princeton führte mich mein Weg immer einen schmalen, von smaragdgrünem Gras gesäumten Pfad entlang. Es ist so kühl und frisch in dieser Jahreszeit. Beim leichtesten Lufthauch lösen sich Blätter von den Bäumen und streifen deine Schulter. Einige sind goldfarben, andere rot wie ein Lippenstift. Es gibt unvorstellbar feine Farbnuancen. Ein Blätterregen ist eine Freude fürs Auge. In meiner Heimat habe ich immer solche Bäume geliebt, deren Blätter sich im Herbst verfärben, wie den arjun-Baum. Der Dai-Lao-Wald ist immergrün. Nur sehr wenige Bäume verlieren dort ihre Blätter.
Princeton ist herrlich, aber es reicht nicht an die Schönheit von Phuong Boi heran. Niemals hüllt Nebel die Berge ein und vermittelt dir das Gefühl, am Meeresufer zu stehen. Weder weht der Duft von chieu-Blüten durch Princeton noch hallen die Schreie der Gibbons dort wider. Princeton ist nicht ungezähmt wie Phuong Boi.
Die Nächte, in denen der Mond sein Licht über die Wälder von Phuong Boi ergoss, werde ich nie vergessen. Nächte in einem Wald sind von ganz anderer Art als Nächte in der Stadt oder selbst auf einem Bauernhof. In der Nacht wird die absolute Autorität des heiligen Waldes offenbar. Undurchdringlich dicht ist der Vorhang der Dunkelheit. Wenn ich in Phuong Boi in meinem Arbeitszimmer saß, ertönten aus dem Wald immer viele unheimliche Schreie. Um acht Uhr abends war es bereits dunkle Nacht, und der Wald trat seine Herrschaft an. Das ganze Universum sank in eine tiefe Stille, die gleichzeitig vor Leben vibrierte. Fast konnte ich die majestätischen Schritte des Berggottes hören, wie er sich zwischen den hoch aufragenden Bäumen hindurchbewegte.
In Vollmondnächten konnte keiner von uns schlafen. Eines Nachts saß ich noch spät an meinem Schreibtisch und schrieb, als Thanh Tue sich aus dem Bett erhob und sich still ans Fenster stellte, um den mondbeschienenen Wald zu betrachten. Ich blies meine Kerze aus und stellte mich an seine Seite. Als Mond und Wald einander begegneten, kam eine unendlich wunderbare und geheimnisvolle Stimmung auf. Noch nie zuvor hatten wir Ähnliches erlebt. Die Stille war vollkommen, und dennoch konnten wir hören, wie Mond und Wald miteinander sprachen. Sie waren nicht länger zwei. Sie waren eins geworden. Würden wir den Mond entfernen, so würde der Wald aufhören zu existieren. Würden wir den Wald entfernen, so wäre kein Mond mehr da. Wenn Mond und Wald aufhörten zu existieren, würden wir nicht am Fenster stehen, durch das sich das helle Mondlicht ergoss. Wir waren verzaubert.