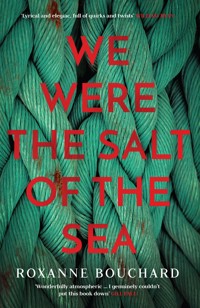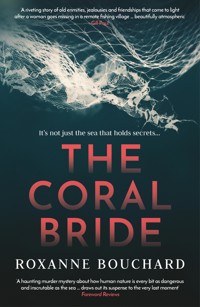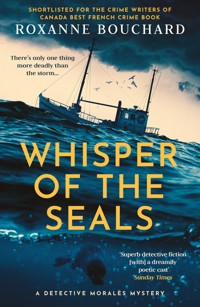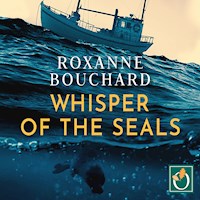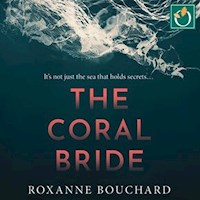Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atrium Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Bewohner des kanadischen Küstenörtchens Caplan führen ein ruhiges Leben im Rhythmus des Meeres. Doch als die junge Catherine Day auf der Suche nach ihrer leiblichen Mutter in den Ort kommt und kurz darauf deren Leiche in einem Fischernetz gefunden wird, beginnen alte Geheimnisse die Wasser der malerischen Küste zu trüben. Frisch aus der Großstadt nach Caplan gezogen, wird Sergent Joaquín Morales in die Untiefen des merkwürdigen Todesfalles geworfen. Statt sich dem Auspacken seiner Kisten widmen zu können, sieht er sich mit dem eigenwilligen Verhalten der Dorfbewohner konfrontiert – denn diese haben ihren ganz eigenen Umgang mit der Wahrheit: Verhöre driften in Plaudereien ab, und Beweise treiben mit den Gezeiten davon. Schon bald muss Sergent Morales erkennen, dass sich dieser Fall keine Regeln aufzwingen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roxanne Bouchard
Der dunkle Sog des Meeres
Roman
Aus dem Französischen von Frank Weigand
Für meine Eltern, Claude und Colette.
Ich liebe euch.
»Es gibt Leute, die kommen hierher und protzen rum. Sie prahlen, sie wollen uns auf Teufel komm raus beeindrucken. Sie plustern sich auf. Wir nennen sie: die Touristen.«
Bass, aus Bonaventure
1. Fischgründe
Die Alberto(1974)
Als O’Neil Poirier durch das Bullauge seiner Kajüte den Rumpf eines Segelboots erblickte, wusste er, dass der Tag wahrhaftig schlecht begann. Poirier kam von den Îles-de-la-Madeleine und hatte von dort seinen eigensinnigen Charakter und seine beiden Fischergehilfen mitgebracht. Sie waren zwei Tage zuvor in Mont-Louis angekommen und hatten sich zügig mit ausreichend Proviant für die Fahrt zur Île Anticosti eingedeckt, wo Kabeljau und Hering auf sie warteten. Weil sie bei Anbruch der Morgendämmerung ablegen wollten, hatten sie sich am Vorabend früh in die Kojen gelegt und nicht gehört, wie das Segelboot direkt neben ihnen festgemacht hatte. Bestimmt hatte das Surren des Generators die Schritte der benachbarten Mannschaft übertönt.
O’Neil Poirier befahl seinen Jungs, aufzustehen. Übel gelaunt ging der Fischer an Deck, um ein bisschen zu poltern, damit diese Sonntagssegler da drüben ein für alle Mal begriffen, dass sie nicht willkommen waren. Wenn ein Mann morgens um halb vier aufstand, um im eiskalten Wasser der Sankt-Lorenz-Strom-Mündung sein Tagwerk zu verrichten, hatte er keine Lust, erst noch ein Segelboot voller schlafender Touristen wegzuschieben, die nur ungern früh aufstanden und außerdem meckern würden, weil sie Angst hatten, die Fischer würden ihre Taue nicht wieder sorgfältig festzurren.
O’Neil ging nach draußen. Der Gipfel an Dreistigkeit war, dass der Besitzer des Seglers die Unverschämtheit besessen hatte, sein Stromkabel direkt an den Fischkutter anzuschließen, anstatt es bis zum Kai zu schleppen! O’Neil Poirier riss es grob heraus, beugte sich über den Einmaster und klopfte kräftig auf das Deck.
»Hey, du Wilder! Komm raus! Wir müssen reden!«
In diesem Moment hörte er von drinnen das Stöhnen einer Frau, einen langen herzzerreißenden Klagelaut, und Poirier spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten, denn solche Schreie hatte der Fischer noch nie gehört. O’Neil Poirier hatte auf dem offenen Meer vor Anticosti schon Windgeschwindigkeiten von 75 Knoten getrotzt und war kein Angsthase. Er packte sein großes Messer zum Kabeljau-Ausnehmen und sprang auf das Segelboot, als ein weiterer Schrei ertönte, noch atemloser als der erste. Er öffnete die Einstiegsluke und eilte im Handumdrehen die fünf Stufen hinab.
»Hey, jetzt reicht’s aber!«
Keine Antwort. Lediglich laute Atemzüge und das Geräusch unkoordinierter Bewegungen. Es war heiß, feucht. Im Halbdunkel und dem allgemeinen Durcheinander brauchte Poirier eine Weile, bis er eindeutig wahrnahm, was los war. Er näherte sich langsam, noch misstrauisch, der Koje, wo die Frau lag, und als er sah, was Sache war, handelte er, ohne zu zögern. Mit jenem wild entschlossenen Tatendrang, für den er bekannt war, stürzte er vorwärts, schnitt die Nabelschnur durch, wusch das Baby in lauwarmem Wasser und warf die Plazenta zu den Fischen.
Danach wischte er der jungen Mutter die Stirn, legte ihr das sorgfältig eingewickelte Neugeborene auf die Brust, hüllte die beiden in eine warme Decke und verließ lautlos den Einmaster.
An jenem Tag verschoben die Männer der Alberto äußerst vorsichtig das Segelboot der Frau, der in ihrer Not nichts anderes übrig geblieben war, als direkt neben ihnen festzumachen, vergewisserten sich zweimal, dass die Leinen solide waren, und schlossen das Elektrokabel am Kai wieder an. Leicht verspätet fuhren sie schließlich aufs offene Meer hinaus und blickten dabei noch lange zurück.
Positionsbestimmungen (2007)
Cyrille sagte, das Meer sei wie eine gesteppte Patchworkdecke. Mit Sonnenfäden aneinandergenähte Wellensplitter. Es verschlinge die Geschichten der Menschen und verdaue sie langsam in seinem kobaltblauen Bauch, bis nur noch verzerrte Spiegelbilder an die Oberfläche stiegen. Er sagte, die Ereignisse der letzten Wochen würden langsam im Halbdunkel der Erinnerung versinken.
***
Bevor das alles passierte, kam ich mir weiß und durchsichtig vor. Wie ein blank geputztes Glas. Aber leer. Sogar mein Arzt fand, dass ich bleich wirkte. Zu bleich.
»Sie sehen blass aus.«
»Das ist meine natürliche Hautfarbe.«
»Wie fühlen Sie sich?«
»Ich habe das Schlimmste hinter mir. Inzwischen zähle ich
die Stunden nicht mehr.«
»Die Stunden?«
»Ja. Bis vor zwei Monaten habe ich schon beim Aufwachen die Stunden gezählt, die ich hinter mich bringen musste, bevor ich mich wieder schlafen legen durfte. Inzwischen habe ich damit aufgehört. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen.«
»Das ist sogar ein sehr gutes Zeichen. Gehen Sie zu einem Psychologen?«
»Nein. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Ich habe Freunde. Ich will nicht dafür zahlen, mit jemandem zu plaudern.« Er nahm seine rechteckige Brille ab und legte sie auf den Schreibtisch. Er hatte mich einst geimpft und mich vor Röteln, Blinddarmentzündung und einer Unmenge von Schnupfen, Grippen und anderen taschentuchverzehrenden Erkältungskrankheiten gerettet. Er kannte mich schon so lange, dass er sich eine Meinung über mich erlauben durfte. »Warum habe ich das Gefühl, es geht Ihnen nicht gut, Catherine?«
»Es geht mir gut, Doktor … Es ist bloß … Es kommt mir vor, als hätte ich die Gebrauchsanweisung dafür verloren, wie man Dinge spannend findet. Wie man sich begeistert. Ich fühle mich einfach leer. Durchsichtig. Geht Ihnen das auch manchmal so, dass Sie spüren, wie sich die Erde ohne Sie dreht? Als wären Sie gerade aus einem Zug ausgestiegen, würden neben den Gleisen stehen und durch die schalldichte Glasscheibe zusehen, wie drinnen eine Party im Gange ist? Tja, ich stehe momentan im Nirgendwo. Weder auf der Party noch bei denen, die zuschauen. Ich fühle mich wie eine durchsichtige Glasscheibe, Doktor. Keine Gefühle. Nichts.«
»Wie alt sind Sie?«
»Dreiunddreißig, aber an manchen Tagen fühle ich mich viel, viel älter.«
»Sie müssen auf sich aufpassen, Catherine. Sie sind hübsch, kerngesund …«
»Manchmal zieht sich da, wo mein Herz ist, alles zusammen. Mir wird ganz schwindelig, und ich kippe um, mir wird schwarz vor Augen, und ich warte, bis der Tod seine Hand wegnimmt, damit ich wieder aufstehen kann.«
»Das sind Kreislaufprobleme. Haben Sie das öfter?«
»Nein, aber vielleicht passiert es ja noch öfter. Das ist anstrengend für mein Herz.«
»Wenn so etwas passiert, legen Sie sich auf den Boden und strecken Sie Ihre Beine an einer Wand hoch. Das hilft.«
»Und was hilft gegen den Rest?«
»Den Rest?«
»Ja, die Horrornachrichten im Fernsehen, den Tod meiner Mutter, die Pflanzen, die im Winter nicht blühen, das beschissene Wetter, die Komiker, die nicht komisch sind, die Werbung, die läuft, obwohl keiner sie sehen will, die schwachsinnige Politik, die Filme, in denen sinnlos rumgeballert wird, die unaufgeräumte Wohnung, das zerwühlte Bett und die aufgewärmten Essensreste, die in der Pfanne festkleben – was mache ich dagegen?«
Er seufzte. Er hatte es wahrscheinlich satt, Nervensägen wie mir das Leben zu retten, die nicht wussten, was sie damit anfangen sollten, und an die er seine Wunderkräfte lediglich verschwendete. Wieso sollte man einem Typen, der Grippe hatte, Antibiotika verschreiben, wenn er sich eine Woche später sowieso aufhängen würde? »Wie lange ist Ihre Mutter jetzt schon tot, Catherine?«
»Fünfzehn Monate …«
Ich hatte immer gedacht, wenn meine Eltern einmal tot wären, würde ich weggehen. Ich war jahrelang nur auf Seen rumgesegelt, hatte die Nase gestrichen voll vom ganzen Stadtleben in Montréal und träumte vom Meer. Ich wollte sehen, wie in der Gaspésie der Fluss zum Ozean wurde, wollte mich in der Baie-des-Chaleurs auf den Boden kauern und den Atlantik anbrüllen. Ich hatte allen Grund, wegzugehen.
Vor Kurzem hatte ich außerdem einen Brief erhalten, der in Key West abgeschickt worden war und mich zu einem Treffen in ein kleines Fischerdorf in der Gaspésie einlud. Ich wusste, wenn ich irgendwie mit meinen Problemen fertigwerden wollte, wäre das ein guter Anfang. Aber ich traute mich nicht und sah lieber zu, wie sich die Jahreszeiten in grauen Staubschichten auf den Regalen meiner spartanisch eingerichteten Wohnung ablagerten. Wieso sollte ich Wünsche haben? Wieso träumen? Wieso lieben? Ich wusste es nicht mehr. Es fiel mir schwer, mich von mir selbst zu befreien, und ich sah reglos zu, wie der Bürgersteig unter den Schritten der Passanten immer tiefere Risse bekam. Ich war wie ein Seemann an Land, auf dem Trockendock und ohne Segel. Mit Bleigewichten beschwert.
»Tun Sie etwas, um auf andere Gedanken zu kommen, Catherine.«
»Gedanken? Das sind Tatsachen, Doktor! Es gibt Leute, die haben Pläne, die haben Ziele im Leben … Und ich … Ich lebe, aber ich begreife nicht, warum ich darüber in Begeisterung ausbrechen sollte.«
»Sie sind Idealistin. Sie hätten gerne ein aufregendes Leben. Aber nur junge Leute stellen sich das Leben aufregend vor. In Wahrheit besteht das Leben nur aus Alltag. Wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir verzweifeln, oder wir lernen. Lernen Sie, Catherine.«
»Dass es langweilig ist?«
»Dass jeder Tag ein schöner Tag sein kann.«
»Aha.«
Hinter ihm tanzten Staubkörnchen im Sonnenlicht, das gedämpft durch die senkrechten Fensterläden drang. Im Laufe der Jahre hatte es die alten Latein-Diplome an der Wand in ihren Rahmen vergilben lassen.
»Der Sommer kommt … Warum verreisen Sie nicht?«
»Verreisen? Glauben Sie, Sextourismus in Marokko könnte ein bisschen Aufregung in mein Leben bringen?«
»Nein. Ich meine einfach einen Tapetenwechsel.«
»Was Sie Tapetenwechsel nennen, ist eine Täuschung, Doktor, eine vorübergehende Zerstreuung für Hobbyfotografen, die sich ihr Leben aus exotischen Bildern und Schnipseln zusammenbasteln.«
»Sie sind hart und selbstgefällig, Catherine. Ihre Ironie macht Sie ungerecht.«
»Sie haben recht, tut mir leid. Eigentlich fahre ich gern Auto. Dabei fühle ich mich frei. Aber das ist Benzinverschwendung und schadet ja leider der Umwelt. Außerdem drehe ich mich dabei im Kreis und lande immer wieder da, wo ich losgefahren bin.«
Er stand auf, in seinem weißen Kittel, um mich vor die Tür zu setzen.
»Sind Sie nicht früher mit Ihrem Vater segeln gegangen?«
»Ja, aber Sie wissen doch, was man sagt: Reisen ist nur eine Flucht vor sich selbst …«
»Dann fliehen Sie mal so richtig, Catherine, lassen Sie Ihre Probleme zu Hause und versuchen Sie, sich eine Zeit lang mit etwas anderem zu beschäftigen als mit sich selbst …«
Ich ging nach Hause. Ich las noch einmal den Brief aus Key West. Wo war das, Caplan? Ich sah auf der Landkarte nach. Dann regelte ich meine Angelegenheiten, packte und machte mich auf den Weg. Wie der Arzt es mir verordnet hatte. Ich sagte mir: Wir werden ja sehen, was dabei rauskommt.
Und bald sah ich es.
***
Heute rollt das Wasser seinen Wellenteppich gegen den Bug des Segelboots und lässt die gebrochenen Spiegelungen der ersten Sonnenstrahlen darauf schaukeln. Der Wind bläht die Segel, der Horizont ist in blendendes Rot getaucht, der Sonnenaufgang füllt das Meer mit Farben und verwandelt diese Geschichte in ein scharlachrotes Fresko. Der Himmel verfärbt sich blau und rosa, um den Einzug der Sonne gebührend zu feiern. Ein letztes Mal richte ich meine lichtüberfluteten Pupillen auf die zerklüftete Küste der Baie-des-Chaleurs. Sie ist bereits weit entfernt und verschwindet im hartnäckigen Dunst des Morgenrots.
Ich beuge mich über Bord. Im zerbrochenen Spiegel des Wassers bin ich ein zerschmettertes Kirchenfenster, ein durcheinandergeratenes Mosaik, ein funktionsgestörtes Gedächtnis ohne Zeitgefühl, ein Haufen ungeordneter Bilder, die ein verrückter Künstler willkürlich zusammengefügt hat. Ich öffne meine Hände, lasse die Spule meiner Erinnerungen in die Wellen fallen und sich ein letztes Mal darin entrollen.
Kutter und Köder
»Das Strandhotel von Caplan? Wissen Sie was? Das ist abgebrannt, Mademoiselle!« Er öffnete den Geschirrspüler zu früh, und eine gewaltige Dunstwolke waberte ihm entgegen. Schnell schloss er die Klappe wieder und wandte sich mir zu. Er reckte den Hals über die Theke und versuchte, einen Blick auf den Brief aus Key West zu erhaschen, den ich erneut geöffnet hatte, um die Angaben zu überprüfen, aber ich wich einen Schritt zurück.
»Wissen Sie was? Ein Riesenfeuer war das! Das ganze Dorf ist mitten in der Nacht zusammengekommen. Sogar aus Saint-Siméon und aus Bonaventure waren Schaulustige da! Natürlich hab ich bei der Gelegenheit das Bistro aufgemacht. Zwei Tage lang hat es ununterbrochen gebrannt! Die Flammen haben die Wände aufgefressen, überall sind Bettfedern rausgesprungen, die Feuerwehrleute wussten gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht! Mit der Asche hätte man den ganzen Strand bedecken können! Und wissen Sie was? Alles war hin! Das Hotel, die Bar und die Glücksspielautomaten. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht …?«
Ich lächelte. Wenn ich zehn Stunden Auto gefahren wäre, bloß um die Glücksspielautomaten im Strandhotel von Caplan zu sehen, wäre ich bestimmt enttäuscht gewesen, ja.
»Da, schauen Sie: Es stand da drüben, auf der anderen Straßenseite, bloß ein bisschen weiter westlich, aber da ist nichts mehr übrig. Ich würd sagen, das ist schon an die zwei Monate her. Jeder weiß das. Ich verstehe nicht, dass Sie davon nichts mitgekriegt haben, es war auf der Titelseite von L’écho de la Baie! Es gab sogar eine Sonderreportage mit Farbfotos! Vielleicht war der Brand eine Straftat, heißt es, und die Versicherungen wollen nicht zahlen. Wenn so was passiert, braucht man immer einen Sündenbock! Wissen Sie was? Schon komisch, dass jemand will, dass Sie da übernachten …«
Ich überprüfte das Datum. Der Brief war zwei Monate vorher in Key West abgeschickt worden. Ich steckte ihn wieder ein. Ich hatte noch nichts zu verbergen, aber auch nichts weiter zu sagen. Er räumte meine Pizzareste ab, warf sie in den Mülleimer und trat unzufrieden einen Schritt zur Seite.
»Wissen Sie was? Der beste Platz, um hier unterzukommen, ist bei Guylaine, gleich um die Ecke. Da werden Sie es viel gemütlicher haben als in dem abgebrannten Hotel!« Aus gebührendem Abstand öffnete er erneut den noch fauchenden Geschirrspüler. Er schnappte sich ein rot kariertes Tuch und begann wie ein Zirkusdompteur den Dampf wegzuwedeln. Dann zeigte er voller Lokalpatriotismus mit dem Kinn auf ein großes Haus, genau östlich von dem Café. Von oben auf den Felsen blickte es ruhig auf das Meer hinab. Eine zauberhafte Herberge, die ihre Gäste mit offenen Armen empfing.
»Das ist die schönste in der ganzen Gegend! Es ist ruhig da, Guylaine hat keine Kinder und auch keinen Ehemann. Und direkt daneben, ein Stück weiter, liegen der Fischerkai und das Hafencafé. Wenn Sie Fischer kennenlernen wollen, dann gehen Sie am besten da essen, am späten Vormittag, wenn die wiederkommen. Jetzt gerade macht Guylaine ihren Spaziergang, aber sie taucht bestimmt gleich hier auf, sie kommt immer bei mir vorbei …« Der Gedanke machte ihn anscheinend sentimental. Versonnen nahm er ein Glas, ließ es beinahe fallen, knallte es wie einen verhexten Gegenstand auf den Tresen, blickte noch einmal nachdenklich hinauf zur Herberge und wandte sich dann mit einem Seufzer wieder mir zu. »Wollen Sie solange einen Kaffee?«
Ich hatte nie besonders viel für Familienpensionen übriggehabt. Meist musste man dort plaudern, erzählen, wer man war, wo man herkam, wo man hinging, wie lange man bleiben wollte, und den Besitzern zuhören, wenn sie in allen Einzelheiten von der Sanierung des Dorfes erzählten. Aber gut. Anscheinend war es aussichtslos, ein Hotel in der Gegend zu finden, und fürs Campen war ich nicht gemacht, also blieb mir wohl nichts anderes übrig, als zu Guylaine zu gehen. Wohin sonst?
Er räumte mein Besteck und mein leeres Glas ab und stellte eine Tasse auf den Tresen, bevor er das Gespräch wieder aufnahm und fragend mit dem Zeigefinger auf meine Handtasche deutete.
»Falls Sie jemanden von hier suchen, kann ich Ihnen bestimmt helfen …«
Ich zögerte. Ich drehte mich auf meinem Stuhl zur Seite und blickte aus dem Fenster. Ich erinnere mich daran, weil das Meer meine gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nahm. Sein schwerer Geruch, die Kaimauer, die langsam in der Dunkelheit versank und die sich bald unter der undurchsichtigen Daunendecke der Nacht verbergen würde. Was gab es ohne Licht auf dieser Seite zu sehen?
»Wissen Sie was? Ich kenne eine ganze Menge Leute in der Gegend …«
Ich wusste noch nicht, wie ich über diese Frau sprechen sollte. Sie war für mich immer unaussprechlich gewesen, und jetzt sollte ich plötzlich von einem Tag auf den anderen ganz beiläufig ihren Namen sagen. Musste ich ihn mir erst siebenmal auf der Zunge zergehen lassen, meinen ganzen Mundraum damit benetzen wie mit einem seltenen Wein oder ihn mit den Backenzähnen zu einem weichen Brei zermahlen?
»Wie war der Name noch mal, den Sie suchen?«
Ich musste mich daran gewöhnen, zumindest eine Zeit lang so tun, als hätte ich ihn mir zu eigen gemacht. Ihn wenigstens in mein Vokabular aufnehmen, wenn er schon keinen Platz in meinem Stammbaum hatte. Und dann blickte ich aufs Meer und sprach ihn zum allerersten Mal aus. Ich atmete tief durch und sagte ihn laut und deutlich. »Marie Garant … Kennen Sie sie?«
Er wich einen Schritt zurück. Sein strahlendes Lächeln erlosch wie eine Kerzenflamme, die plötzlich ausgeblasen wurde. Aufmerksam und misstrauisch musterte er mich von oben bis unten.
»Ist das eine Freundin von Ihnen?«
»Nein. Ehrlich gesagt kenne ich sie nicht …«
Er nahm das Glas wieder in die Hand und begann es enthusiastisch abzurubbeln. »Puh! Sie haben mir kurz Angst eingejagt! Marie Garant ist nämlich keine Frau, die wir hier mögen. Wissen Sie was? An Ihrer Stelle, als Touristin, würde ich lieber nicht zu viel über sie reden, so machen Sie sich nämlich keine Freunde …«
»Wie bitte?«
»Aber Sie kommen nicht von hier, also können Sie das ja nicht wissen …«
»Nein. Kann ich nicht.«
»Sind Sie wegen ihr hier?«
»Ähm … Nein.« Das war fast gar nicht gelogen. »Ich mache Urlaub.«
»Also doch eine Touristin! Na dann, herzlich willkommen! Ich bin Renaud. Renaud Boissonneau, Rektor der Sekundarschule und Geschäftsmann für jede Art von Geschäften!«
»Freut mich …«
»Wissen Sie was? Wir werden uns um Sie kümmern! Hat Ihnen die Pizza geschmeckt? Der große Touristenrummel hat noch nicht begonnen, normalerweise ist es hier nämlich gerammelt voll! Puh! Immer komplett ausgebucht, die Leute finden das ziemlich originell hier. Haben Sie die Dekoration gesehen? Alles alt und voller Erinnerungen! Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir befinden uns hier in einem ehemaligen Pfarrhaus. Deshalb ist die Kirche gleich nebenan! Die Terrasse geht einmal rundherum. Wer beim Biertrinken nicht den Kirchturm sehen will, kann sich in Richtung Meer setzen oder in Richtung Fischerkai. Der Pfarrer wohnt da oben. Wer nach zwei, drei Gläschen bereit ist zu beichten, braucht bloß die Treppe hochzusteigen!« Er hatte erfolgreich den Geschirrspüler gezähmt und holte lärmend Geschirr hervor, das glücklicherweise unzerbrechlich war. »Ich mache hier sozusagen alles! Da, sehen Sie die Dekoration? Die habe ich aufgebaut! Ich hab alles genommen, was ich so im Keller hatte! Schauen Sie mal, wie originell: Kutschenräder, die von der Decke hängen (später hab ich noch die Öllampen dran befestigt), Stiefel, hölzerne Vogelhäuschen, Werkzeuge, Sägen, Kabel, Schiffstaue. In der Ecke hab ich alte Regenmäntel aufgehängt … Brauchen Sie einen Regenmantel? Na gut, heute war schönes Wetter … Aber in letzter Zeit hat es viel geregnet, finden Sie nicht?«
»Ist mir gar nicht aufgefallen …«
»Aha! Eine Städterin!« Als gäbe ihm die Tatsache, dass wir aus unterschiedlichen Welten kamen, das Recht zu Vertraulichkeiten, beugte er sich auf einmal zu mir und murmelte: »Und wissen Sie was? Ich mache die Dekoration, ich bediene an den Tischen, kümmere mich um das Geschirr, und wissen Sie, was ich bald auch noch werde? Küchenhilfe! Mit dreiundfünfzig Jahren! Es ist nie zu spät für neue Herausforderungen, Mademoiselle!« Er richtete sich auf und schloss krachend den Geschirrspüler. »Alles, was Sie hier sehen, kommt von mir zu Hause: der Globus, die alten Fotoapparate, die Seekarten, die antike Standuhr, der mittelalterliche Dolch, die Hufeisen … (Sagt man Hufeisen oder Hufeeisen? Wissen Sie was? Ich glaube, beides geht.) … die Flaschen, die Tontöpfe, die einzelnen Tassen, sogar die Kochbücher! Erzählen Sie mal: Wie sind Sie hierhergekommen? Durchs Tal oder über die Landzunge?«
»Ähm … Durch das Tal.«
»Das lob ich mir, Leute, die sich sinnlose Umwege ersparen!« Er schrubbte den Tresen, als versuchte er, seinen Lumpen bewusstlos zu schlagen.
»Sinnlose Umwege?«
»Die Landzunge! Percé, die Basstölpel, die Île Bonaventure … Der Umweg lohnt sich nicht, Mademoiselle! Wollen Sie da noch hin?«
»Ich weiß nicht. Ich habe noch gar nichts geplant.«
»Gerade heute habe ich nämlich Reiseführer reinbekommen! Ich habe sie noch nicht gelesen, aber … Ah! Wenn das nicht die hübsche Guylaine ist!« Sofort landete der Lumpen in der Spüle, wie ein peinliches schmutziges Ding.
Guylaine Leblanc war auf den ersten Blick um die fünfundsechzig Jahre alt. Ihr gepflegtes graues Haar, das sie zu einem lockeren Dutt hochgesteckt trug, verlieh ihr das gütige Aussehen einer Großmutter aus einem amerikanischen Film. Sie lachte zärtlich und zwinkerte dem dahinschmelzenden Renaud zu.
»Kennst du schon unsere neue Touristin, Guylaine? Wie heißen Sie noch mal?«
»Catherine.«
»Catherine und weiter?«
»Day. Catherine Day.«
»Catherine Day möchte bei dir unterkommen. Du hast doch bestimmt ein Zimmer für sie frei?«
Renaud küsste Guylaine auf beide Wangen, bevor sie mich auf die andere Seite der Nationalstraße zog, wo sie ihre Boutique, Le Point de Couture, eingerichtet hatte. Sie verkaufte dort selbst geschneiderte Kleidung und nahm auch Änderungen vor. Die Herberge befand sich auf der vom Straßenlärm abgeschirmten Rückseite. Eine geräumige Erdgeschosswohnung, im selben Stil dekoriert wie bei Renaud, mit einem erstaunlich gemütlichen Durcheinander aus alten Gegenständen, ausgestattet mit Ruhesesseln und einer großzügigen Veranda mit Blick auf den unmittelbar darunterliegenden Strand. Die drei Zimmer im ersten Stock waren für Touristen bestimmt, während Guylaine irgendwo am Ende der Treppe zum Dachboden schlief.
Sie bot mir ein Zimmer mit Meerblick an, ihr Lieblingszimmer, wie sie sagte, dekoriert mit Treibholz, ganz in Weiß und Blau gestrichen, mit einem Bett, über dem eine handgefertigte Patchworksteppdecke lag.
Es war ein sehr schönes Zimmer.
Mein erster Morgen in der Gaspésie begann unter einer reglosen gelben Sonne. Ich ging hinunter und gesellte mich beim Frühstück zu den anderen Gästen.
»… meine vier Kinder waren schon aus dem Haus, und mein zweiter Ehemann war gerade verstorben, da hat es mich ziemlich mitgenommen, als mir der Arzt mitteilte, dass man mir eine Brust amputieren musste. Ich hab mich gefragt, was bloß aus mir werden würde …«
Ich goss mir einen Kaffee ein. Ein junges Touristenpärchen saß turtelnd am Tisch, eine ältere Dame hatte sich an Guylaines Fersen geheftet und schnatterte dabei ohrenbetäubend laut vor sich hin.
»… da braucht man sich nichts vorzumachen: Sechsundsechzig Jahre alt, vom Leben ramponiert und nur noch eine Brust, welcher Mann würde mich da noch wollen? Dabei habe ich immer nur für meine Kinder gelebt …«
Unsere Wirtin verquirlte Pfannkuchenteig mit dem aufmerksamen und ungezwungenen Gesichtsausdruck, der den Leuten den Eindruck vermittelt, man hörte ihnen zu, und der diejenigen glücklich macht, die am liebsten mit Höchstgeschwindigkeit eine Vertraulichkeit nach der anderen von sich geben.
»… das hier ist meine allererste eigene Reise, ich bin nämlich noch nie verreist, ich hatte tatsächlich noch nie irgendwelche Pläne – ich kenne nicht mal meinen eigenen Geschmack, Madame! Haben Sie ein Lieblingsgericht? Tja, ich nicht! Sehen Sie, was ich meine …«
Ich leerte meine Tasse in einem Zug und zog in das Café am Hafen um.
Dort würde ich von nun an beinahe jeden Morgen frühstücken. Es war ein schöner Ort, der es sich am Rande des Kais in unmittelbarer Nähe der Seeleute bequem gemacht hatte und wo die Kellner und Kellnerinnen tatkräftig und dennoch ruhig herumspazierten. Das Stimmengewirr drehte sich im Kreis, entwich durch das Fenster und kam durch die Seitentür wieder herein. Man konnte sicher sein, nicht allzu viel davon mitzubekommen. Der ideale Ort also für eine kleine Pause von den Zwängen, der Pünktlichkeit, den genau durchgetakteten Abläufen des Alltags.
»Himmel, Arsch und Zwirn! Was hab ich dir gesagt? Schau, die Indianer kommen schon wieder bei Ebbe zurück!«
Ein großer, kräftiger Mann, der eine Kaffeetasse umklammerte, wartete auf sein Frühstück. Seine langen Haare waren im Nacken zusammengebunden, und um seinen Schädel hatte er ein rotes Halstuch geschlungen. Er trug Jeans, Arbeitsstiefel und einen grauen Pullover. Der Fischer und sein Gehilfe waren heute beinahe mit leeren Händen zurückgekommen. Ich nippte an meinem zweiten Kaffee, als ihr Boot anlegte. Der Hummer hatte ihnen die kalte Schulter gezeigt, und die beiden Männer wirkten niedergeschlagen. Die Kellnerin näherte sich, rote Haare, grüne Augen und das Lächeln einer jungen Frau. Sie stellte die Teller mit Rührei auf die mit Kinderzeichnungen geschmückten Tische. Die Männer schauten ihr dabei zu und bedankten sich. Sie ging wieder weg.
»Schau dir das doch an, Himmel, Arsch und Zwirn: Gleich sitzen die wieder fest! Da, das erste Boot kommt durch … Na … Klappts?«
Der strahlende Sonnenschein, der die Ebbe begleitete, lullte das Café mit seiner Wärme ein. Die Sonne funkelte im aufgewühlten Osten.
»Na, ganz schön knapp! Und das andere ist noch gar nicht wieder da!«
Ich mochte Männer, ihr Auftreten, ihre Männlichkeit. Manchmal tat es mir regelrecht weh, zu sehen, wie großzügig und zärtlich einige von ihnen ihre Frauen liebten.
»Himmel, Arsch und Zwirn, die haben es echt nicht eilig! Aber wir wissen ja: Ihr Boot wird von der Regierung bezahlt!«
»A-a-a-aber, arbeiten t-t-t-tun sie schon …«
»Wenn du meinst … Auf Urlaub hier?« Auf einmal hatte er sich zu mir umgedreht, ohne dass ich darauf gefasst gewesen wäre. Ich hatte ihn so lange beobachtet, dass ich wohl, ohne es zu bemerken, die Grenze zur Unverschämtheit überschritten hatte. Seine unglaublich blauen Augen trafen mich so unvermittelt, dass ich das Gleichgewicht verlor und mich am Tisch festhalten musste, um nicht umzukippen.
»Ja.«
»Nicht viel los hier, was?«
»Äh … Nein.«
»Es ist schon was los, aber nicht wie in der Stadt: Hier hat alles mit dem Meer zu tun! Im Sommer leben die Leute vom Tourismus … Dem schönen Wetter …«
Gebräunte Hände. Viereckig.
»Und im Winter?«
»Im Winter? Da leben sie von Hoffnung! Beim Fischen ist hier nicht die Hölle los. Siehst du: Hier gibts nur vier Boote. Meines, das von Cyrille und die zwei von den Indianern. Gerade fehlt eins. Die Indianer sind immer spät dran.«
»Woher kommen sie?«
»Aus dem Gesgapegiag-Reservat. Sie sind vom Volk der Mi’kmaq. Ihre Boote stellen sie hier ab, weil ihr Fischplatz nicht weit weg ist. Wenn die Regierung die Fahrrinne ausgraben würde, wäre hier viel mehr los! Aber nein, Himmel, Arsch und Zwirn! Die lassen das alles schleifen! Bau hier einen schönen Kai hin, und du wirst sehen, wie viele Fischer dann kommen, wie viele Freizeitsegler … Und das Café würde viel besser laufen!«
»Warum sind die Mi’kmaq spät dran?«
»Die sind so: Sie gehen spät ins Bett, stehen spät auf und verpassen die Flut! Bei Ebbe wieder hier reinzufahren, ist echt keine gute Idee. Aber was soll ich dir sagen? Die hatten es noch nie mit den Gezeiten! Die machen das immer so: Das Boot fährt in die Flussmündung ein, ein Mann stellt sich nach vorne, um den Steuermann in die Fahrrinne zu lotsen, aber das Wasser steht nicht hoch genug. Der Kapitän lässt den Motor an, um über die Sandbank rüberzukommen, aber er bleibt drin stecken. Schau: Was hab ich dir gesagt? Das zweite Boot kommt! Himmel, Arsch und Zwirn! Gleich stecken sie fest!«
»Wollen Sie ihnen nicht helfen?«
»Wenn du Lust auf nasse Füße hast, nur zu, Mademoiselle! Aber mir ist das zu kalt. Die kriegen das schon hin.«
»Die sind d-d-d-das gewöhnt.«
»Und sonst warten sie halt, bis die Flut wiederkommt! Oder sie ziehen es an Land. Schau mal … schau … Was hab ich dir gesagt? Die schaffen es immer irgendwie! Der Jérémie ist nicht mal ins Schwitzen gekommen!«
Aufrecht vorne am Bug des zweiten Boots, hielt ein Riese, aus dem harten Holz geschnitzt, aus dem man früher Masten baute, lässig ein zum Lasso geknotetes Tau in der linken Hand.
»Und du, wie heißt du?«
»Catherine Day.«
»Ich bin Vital Bujold. Mein Boot ist die Manic 5. Und er da ist Victor Ferlatte, mein Fischergehilfe.«
Beide Anfang sechzig. Mindestens. Vielleicht sogar älter.
»Machst du hier ’ne Zeit lang Urlaub, Catherine?«
»Ich weiß noch nicht.«
»Fährst du nach Percé?«
»Ich bin nicht sicher, ob ich Lust auf Touristenattraktionen habe, aber ich habe Angst, dass mir langweilig wird …«
Die Männer lachten, als hätte ich gerade mit hohen Absätzen eine Treppenstufe verfehlt.
»In der Gaspésie gibts nichts außer Langeweile!«
»Ist es wirklich so öde hier?«
»Nicht öde. Es ist anders. Die Gaspésie ist ein Landstrich, der stehen geblieben ist, wo nichts mehr los ist. Wenn du in Caplan bleiben willst, musst du lernen, dich so wenig wie möglich zu bewegen!«
Nachdem er sein Besteck auf den Teller gelegt hatte, schob er langsam das Spitzendeckchen zur Seite und stützte sich mit den Unterarmen auf den Tisch. Die Kellnerin kam vorbei, räumte alles ab, füllte die Tassen auf und ging wieder. Victor starrte gedankenverloren die Mi’kmaq an. Der Riese war auf den Kai gesprungen, hatte seine Taue befestigt und unterhielt sich lachend mit der Mannschaft des Nachbarboots. Auf einmal versickerte das Stimmengewirr des Cafés in den Spalten zwischen den Brettern, und ein seltsames Gefühl überkam mich.
»Komische Leute, diese Touristen! Fahren in den Urlaub und verbringen ihre Zeit damit, auf die Uhr zu schauen und mit der Kellnerin zu schimpfen, weil sie mehr als zehn Minuten braucht, um sie zu bedienen …«
»Und wenn es g-g-g-gießt, dann sind sie s-s-s-sauer auf uns, als w-w-w-wäre das unsere Schuld!«
»Hier kommen die Touristen nur vorbei. Sie rufen an, reservieren ein Zimmer, kommen am späten Nachmittag, besichtigen die Kirche, suchen am Strand nach Achaten, essen im Bistro zu Abend und gehen ins Bett. Am nächsten Tag frühstücken sie und fahren eilig weiter. Aber wozu diese Eile?«
Victor schüttelte den Kopf, als täten ihm alle Touristen der Welt leid.
»Himmel, Arsch und Zwirn! Kannst du das verstehen, Victor?«
Vital bohrte seine Augen wieder in meine, wie eine Eisenstange.
»Wenn du Abenteuer suchst, musst du nach Disneyland. Hier haben wir nichts Spannendes. Hier gibts nichts außer dem Meer. Unser Leben hier ist stehen geblieben. Nicht mal Wünsche haben wir mehr. Manchmal wünschen wir uns so sehr nichts, dass uns irgendwann die Zeit überholt. Die meisten Touristen ertragen das nicht und fahren schnell weiter.«
»W-w-w-wir nehmen es dir nicht übel, w-w-w-wenn du schnell wieder w-w-w-wegwillst.«
»Und wenn ich bleibe?«
»Hast du zu viel Zeit?«
»Weder zu viel noch zu wenig.«
»Na, dann bleib erst mal ein bisschen. Treib dich rum. Am Kai, am Strand. Du wirst sehen.«
Ich betrachtete verstohlen den großen Mi’kmaq. »Und was passiert dann?«
»Nichts! Das sag ich doch die ganze Zeit: Wenn du aufs Meer schaust, hast du gar nicht das Bedürfnis, dass was passiert!«
»D-d-d-du kannst Achate sammeln. A-a-a-am Strand gibts ’ne M-M-M-Menge davon.«
»Okay. Ich fang an. Mit dem Nichtstun.«
Die Männer standen auf.
»Wir gehen jetzt unseren Hummer verkaufen. Wir lassen dich mit den Indianern allein. Du kannst ruhig rübergehen und mit ihnen plaudern …«
Vielleicht wurde ich rot. Er beugte sich einen Augenblick zu mir hinüber.
»Der Jérémie da, der ist so stark, das kannst du dir nicht vorstellen. Himmel, Arsch und Zwirn! Die sind kräftig gebaut, die Indianer. Muss man ihnen lassen. Also dann … Tschüss, meine Hübsche!«
Sie gingen hinaus. Ich sah immer noch den großen Mi’kmaq an. Jérémie.
Es würde nichts passieren.
An diesem Tag spuckte der Himmel einen langweiligen eiskalten Nieselregen, der einen bis auf die Knochen durchnässte und erschauern ließ wie im Oktober. Ich wickelte mich auf einem Sessel in der Herberge in eine Decke und schlug ein Segelbuch auf, das irgendwo herumlag. Keine gute Idee. Die Schwermut hatte mich gepackt, und ich versank darin mit Haut und Haaren.
Als ich am späten Nachmittag an Renauds Theke auftauchte, hatte die Sonne meine trübe Laune zumindest teilweise weggewischt.
Er wienerte sein Werkzeug. Drei große neue Fleischermesser.
»Wollen Sie nach Percé fahren?«
»Nicht unbedingt. Ich habe mich bloß gefragt, was Sie darüber denken …«
»Ha! Sie haben wirklich kein Sitzfleisch!«
»Ich weiß: Ich bin im Urlaub und sollte lernen, gar nichts zu tun, aber das ist nicht so einfach …«
Liebevoll legte er seine Stichwaffen auf ein Holzbrett, das offensichtlich ebenfalls neu war. »Wissen Sie was? Sie brauchen unbedingt einen Reiseführer! Haben Sie schon den gedruckten Gaspésie-Führer gesehen?«
»Nein.«
»Ich habe gerade einen ganzen Stapel reinbekommen. Wenn Sie wegfahren wollen, muss ich Ihnen den unbedingt zeigen!« Er streckte den Arm aus und zog einen aus dem Verkaufsständer. Er schlug ihn auf und blätterte ihn vor mir durch. »Da. Schauen Sie sich das an: wunderschöne Farbfotos! Normalerweise folgen die Touristen der vorgegebenen Route. Aber man muss von Norden her anfangen! Schauen Sie mal, wie gut das gemacht ist. Man fängt an der Küste an: ›Besuchen Sie die Gärten von Métis, die Lachstreppe von Matane und das Haus der sechs Hochzeiten‹, und dann, dann kommt man in die Haute-Gaspésie. Wissen Sie was? Ich weiß gar nicht, ob die höher ist als der Rest, aber egal: ›Erleben Sie die faszinierenden Windanlagen von Cap-Chat, verpassen Sie nicht den Gaspésie-Nationalpark und das Leuchtturmmuseum von La Martre.‹ Danach kommt die Pointe, die Landzunge, ›ihre bunten Dörfer, der Forillon-Nationalpark, der Felsen von Percé, die Basstölpel und die bunten kleinen Läden auf der Île Bonaventure‹, und dann? Na? Na? Die Baie-des-Chaleurs, ›wo die ganze Familie sich ausruhen und im Meer baden kann‹! Und wissen Sie, was danach kommt? Danach fahren alle gleichzeitig durch das Tal wieder hoch, um so schnell wie möglich wieder in Montréal zu sein, bleiben in dem großen Feiertagsstau Anfang September hängen und kommen nach dreitausend Kilometern todmüde zu Hause an, um ihre Wäsche zu waschen und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit zu gehen!« Geräuschvoll klappte er den Reiseführer zu, rollte ihn zu einem Zylinder und reckte ihn drohend in die Höhe wie ein Missionar, der ein satanisches Pamphlet schüttelte. »Hört sich an wie ein Traumurlaub, oder? Ist es aber nicht! Natürlich können Sie da hinfahren, Mademoiselle Catherine. Sie können in Ihr Auto springen und als Touristin vom Südwesten bis in den Nordosten herumkutschieren, aber was haben Sie davon? Nichts! Anderswo sind die Dörfer arm, die Motels geschmacklos, die Restaurants langweilig, und das Meer ist kalt! Die Geschäfte verkaufen nur Ramsch! Souvenirkram, Nummernschilder mit der Aufschrift ›Ich liebe deine Frau!‹, Schnapsgläser in Felsenform, Tassen aus Percé, Kanada-Mützen und mit Muscheln verzierte Lampen! Nichts als gottverdammter Ramsch! Und wissen Sie was? Außerdem sind die Unterkünfte schlecht! Wenn Sie nach fünf Uhr ankommen, haut Sie der Typ vom Hotel übers Ohr. Er wird Ihnen einreden, dass seine Schwägerin zum Glück noch ein Zimmer frei hat, ein lächerliches Zimmerchen zu einem Wucherpreis, mit Blick auf einen Hinterhof! Wollen Sie das wirklich?«
»Ähm … Nein?«
»Nein!« Vehement warf er die touristische Anti-Bibel in den gähnenden Mülleimer. »Außerdem, wenn Sie in Richtung Landzunge fahren, dann sind Sie gezwungen, dem Reiseführer umgekehrt zu folgen, und so was ist ziemlich anstrengend, vor allem im Urlaub! Wenn eine Route schon vorgezeichnet ist, dann ist es doch viel einfacher, ihr zu folgen! Und Sie brauchen diese Tour doch gar nicht mehr zu machen, Mademoiselle Catherine: Sie sind schon am Ziel! Sie glauben, Sie langweilen sich, oder? Das liegt nur daran, dass Sie noch nicht den Rhythmus gefunden haben!«
»Aha …«
»Wissen Sie was, Mademoiselle Catherine? Die Touristen schleppen immer ihre eigenen Probleme mit, wenn sie verreisen! Wenn man wegfährt, muss man die zu Hause lassen!«
»Aha …«
»Natürlich können Sie bis zur Landzunge fahren. Bleiben Sie doch lieber bei uns. Bei Guylaine!«
Als er mit seinem Vortrag fertig war, holte er aus der Küche eine Tüte und zog vorsichtig eine neue Schürze heraus, die er stolz auseinanderfaltete und sich mit sorgfältigen Handgriffen umband. Auf der Brust prangte in gestickten Buchstaben sein neuer Titel »Küchenhilfe«. Er setzte sich eine lächerliche Haube auf und legte seine sauberen Messer auf das neue Brett.
»Renaud …?«
»Ja, Mademoiselle Catherine, womit kann ich einen wunderschönen Gast wie Sie glücklich machen?«
»Vital … Kennen Sie den Fischer Vital?«
»Na klar kenne ich den! Ha! Wissen Sie was? Ich wette, Sie sind verliebt! Ihr Herz ist zersprungen, als er Ihnen sein berühmtes ›Himmel, Arsch und Zwirn‹ vorgesungen hat. Und jetzt wollen Sie bestimmt Ihre Sandalen polieren und heiraten! Guylaine! Du musst ein Brautkleid schneidern! Unsere Touristin will heiraten!«
Guylaine war kaum eingetreten, da wurde sie schon vom Strudel erfasst. »Ach ja? Wen denn?«
»Vital!«
»Den Himmel-Arsch-und-Zwirn-Vital? Der ist schon verheiratet, Catherine …«
Ich wand mich wie ein Hummer im Kochtopf. »Aber nein! Ich bin Vital im Café begegnet, und er hat mir erzählt von …«
»Von Cyrille Bernard!«
»Cyrille Bernard? Wer ist das?«
»Cyrille ist Junggeselle …«
»Ich rufe noch heute Abend Vital an. Er soll Sie einander vorstellen! Gehen Sie morgen ins Café? Denn wissen Sie was, Mademoiselle Catherine? Wenn man trübsinnig ist, dann, weil das Herz noch nicht verankert ist! Und wir finden schon einen Märchenprinzen für Sie!«
»Renaud übertreibt ganz schön, Catherine, aber es stimmt. Cyrille wird Sie auf andere Gedanken bringen.«
»Wissen Sie was? Danach haben Sie bestimmt gar keine Lust mehr auf Percé und diesen ganzen Quatsch!«
***
Na gut. Ich gebe es besser gleich zu. Als die wunderbare, strahlende Liebesgeschichte, die mir die Märchen meiner Kindheit versprochen hatten, mir tatsächlich widerfahren war, hatte ich mich extrem ungeschickt angestellt.
Ich redete nicht darüber. Nie. Ich hatte kein Talent dafür, anderen ganz spontan meine allerintimsten Geheimnisse anzuvertrauen, und es fiel mir schwer, meinen Verrat zuzugeben. In einer Nacht hatte ich neun Jahre gemeinsames Leben eingeäschert. Durch einen Funken an der falschen Stelle war meine Beziehung in Flammen aufgegangen.
Ich schämte mich und hatte Angst, wieder am Strip-Poker der Liebe teilzunehmen. Keusch knöpfte ich den Kragen meiner Vergangenheit über dem Kloß in meinem Hals zu. Aus Furcht, Verwirrung oder purer Feigheit hatte ich mich für Enthaltsamkeit entschieden, für die ich auch noch großspurig die Werbetrommel rührte. Stolz schrie ich jedem beliebigen Typen ein »Ich bin eine freie Frau!« entgegen, obwohl ich meine einsamen Abende mit aufgewärmten Nudeln und romantischen Komödien voller plumper Schauspieler langsam satthatte. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht genau, was ich mit dieser uneingestandenen Einsamkeit anfangen sollte, und träumte insgeheim davon, ein bisschen was Verbotenes zu tun. Mit meinem erloschenen Herz bezweifelte ich, dass die Liebe mich erneut entflammen könnte, aber insgeheim hoffte ich es trotzdem.
Die lässige Kraft des hochgewachsenen Mi’kmaq hatte mich am Vorabend beeindruckt und ein bisschen aus der Fassung gebracht. Also war ich natürlich neugierig darauf, den anderen Fischer kennenzulernen. Kaum war ich an diesem Morgen erwacht, hockte ich mich bereits an mein Zimmerfenster, um den Kai zu überwachen. Das Boot des Mannes mit dem seltsamen Namen Cyrille Bernard war nicht mehr da. In Windeseile seifte ich mich ein, putzte mich heraus und schminkte mich. Ich suchte mein hübschestes, tief ausgeschnittenes Sommerkleid aus und schlüpfte in meine hochhackigen Pumps. Rückblickend wird mir klar, was für eine merkwürdige Idee das war, sich zu schminken und hohe Absätze anzuziehen, um einen Mann zu treffen, der vom Fischen zurückkam, doch es war mir schon immer schwergefallen, meine Weiblichkeit angemessen zu dosieren.
Ich saß also im Café, lange vor dem Zeitpunkt der Rückkehr der Fischer, die Füße eingezwängt, die Haare fest hinter den Ohren zusammengebunden und das Sommerkleid faltenlos gebügelt. Es wehte ein leichtes, warmes Lüftchen, wie ein Atemzug, der sanft die Röcke aller Frauen in der Gegend bauschte, und die Seeluft, die durch das Fenster drang, rötete meine Wangen.
Die Boote tauchten am späten Nachmittag auf. Ich hatte so viel Koffein in mich hineingeschüttet, dass meine Hände feucht und zitterig waren. Sie kamen näher, legten an. Ich schlug die Beine zu einer hübsch entspannten Pose übereinander. Und die Fischer sprangen auf den Kai.
Ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen war, Cyrille Bernard sei ein schöner, kühner, junger Mann. Ich weiß es wirklich nicht. Vital, Victor, Renaud, Guylaine: Sie alle hatten mich gewarnt, nichts von der Gaspésie zu erwarten, warum zum Teufel hatte ich mich also derartig verkleidet? Denn Cyrille war nicht besonders ansehnlich, musste man zugeben. Das Alter hatte sein Haar gelichtet, seine Ohren übermäßig lang gezogen und ihm ein paar anarchische Zahnlücken verpasst. Narben zogen sich in Streifen über sein Gesicht, und trotz seiner Freundlichkeit brauchte man eine Zeit lang, um sich an sein Äußeres zu gewöhnen.
Einen Sekundenbruchteil später dachte ich nur noch an Flucht. Ich ließ das Geld auf dem Tisch liegen, schnappte mir meine Handtasche und stürzte in Richtung Ausgang, doch die Fischer kamen so schnell herein, dass ich zurückgedrängt wurde. Und Vital erledigte den Rest. Als er mich erblickte, drehte er sich lässig zu Cyrille um und zeigte mit dem Finger auf mich, als wäre ich eine Nippesfigur für ein paar Groschen im Regal eines Billigsouvenirhändlers.
»Das ist sie!«
Der alte Fischer hob leicht den Kopf, wie ein Kapitän, der einen Matrosenanwärter musterte. Ich zwang mich zu einem schiefen Lächeln.
Wir kennen das Meer nicht.
Er begutachtete mich abschätzig von oben bis unten und umgekehrt, während ich mit meiner Handtasche, meinem auffälligen Kleid, meiner tief im Dekolleté versteckten Halskette und meinen hohen Absätzen am liebsten auf der Fußmatte im Boden versunken wäre.
»Das ist die junge Frau, die dich kennenlernen möchte.«
»Ich … Ich bin gerade mit dem Essen fertig … Ich wollte gerade gehen … Wir verschieben das, okay?«
»Himmel, Arsch und Zwirn, Cyrille, ich sag dir, du hast echt kein Glück bei den Frauen!«
Gelächter regnete auf mich nieder, während ich feige und voller Scham über mich selbst versuchte, mich zur Tür durchzukämpfen, die jedoch von besagtem Cyrille verstellt wurde, der sich natürlich keinen Millimeter rührte. Vital, Victor und der andere Fischer begaben sich zu den Tischen, doch Cyrille Bernard blieb stehen wie ein dickköpfiger Torwart. Ich muss zugeben, für einen Augenblick bekam ich Angst, fast Panik.
Wasser und Salz.
»Beruhig dich. Ich krieg nicht genug Luft, um dich einzuholen, falls du wegrennst!« Bei jedem seiner Atemzüge ertönte ein mühsames Pfeifen.
»Entschuldigen Sie mich … Ich … Ich habe zu tun …«
»Touristen haben nie zu tun. Wie heißt du?«
»Catherine.«
»Catherine und weiter?«
»Day. Catherine Day.«
»Dann schau mich mal an, Catherine Day …«
Ich hob den Kopf, und auf einmal durchbohrten mich seine blauen Augen.
Die unergründliche Tiefe, sein unberechenbares Wesen, die Brandung und die Gezeiten.
Er trat einen Schritt zurück.
Und doch …
»Wo kommst du her?«
»Aus Montréal.«
»Warum willst du mich sehen? Soll ich dich mit dem Boot mitnehmen? Ich hasse das, Touristen zum Fischen mitzunehmen …«
Wenn sich der Bug zum offenen Meer hin dreht, wenn die langen vergänglichen Wellen mich auf den Gipfel der Welt hieven und mich in ihrer rauschenden Wiege davontragen. Wenn der Wind in das Stagsegel fährt und das Großsegel bläht, zerstreuen sich meine Zweifel und lösen sich auf. Ich spanne das Tauwerk, schließe die Hände um das Steuerrad, und der Horizont gehört mir.
»Nein, nein, darum gehts nicht. Ich … Ich bin im Urlaub, ich habe nichts zu tun, und Renaud hat gesagt, Sie könnten …«
»Ich könnte was?«
»Ich weiß nicht … Mir vom Meer erzählen, damit ich auf andere Gedanken komme. Es mir erklären.«
Er begann spöttisch zu lachen, und das kränkte mich.
»Wenn du lernen willst, wie das Meer ist, dann musst du aufhören zu rennen, Kleine. Das ist das Erste, was ich dir sagen kann. Nimm dir einen Schaukelstuhl, setz dich auf eine Veranda, schau auf die Wellen und schaukle! Sonst nichts. Entspann dich, das wär schon mal ein guter Anfang.«
Dort bin ich glücklich: in der beängstigenden, stürmischen Erhabenheit des offenen Meeres.
Er trat zur Seite, und ich konnte entwischen, obwohl ich seltsamerweise gar keine Lust mehr dazu hatte. Ich stieg langsam zur Herberge hinauf. Ich zog meine Schuhe aus und ging barfuß an den veralgten Steinen entlang. Im niedrigen Wasser der Ebbe holten die Mi’kmaq fern am Horizont ihre Reusen ein.
***
Die ersten Touristen strömten langsam an den Strand, aber das Meer war noch zu kühl, als dass man gewagt hätte, fröhlich hineinzuspringen. Im Sand sitzend, ließ ich ziellos meine Gedanken schweifen.
Wenn die Ebbe kommt, verhakt sich ein Anker in meiner Kehle. Er zieht bei jeder Welle fester und erstickt mich. Wenn das Wasser schwindet, spüre ich einen Schmerz hier in der Brust, ein Echo, das die Worte verwischt, ein undeutliches Murmeln, einen Verlust.
Halb eins. In der Sonne trauten sich einige mutige Kinder ins kalte Wasser. Strandschönheiten schlotterten in ihren bunten Bikinis und schielten dabei zu den halb gebräunten Jungs, die sich gegenseitig eine Frisbeescheibe zuwarfen.
Rüde wirft das Meer mit seiner Brandung meine Bilder durcheinander. An meinen herabhängenden Armen baumeln die enthaupteten Hallelujas meiner Schiffbrüche. Gegen meinen Willen zieht es mich hinaus.
Ich stand ruckartig auf, so schnell, dass mir schwindelig wurde, und lief am Spülsaum entlang, um mich zu bewegen. Ich warf Kieselsteine ins Wasser und lächelte den vorübergehenden Kindern scheinheilig zu. Barfuß im Sand, sammelte ich so viele Steine, wie in meine Hände passten.
»Suchst du Achate, Kleine?«
Dieser Atem, der wie ein Blasebalg aus gegerbtem Leder pfiff, das konnte nur Cyrille sein. Ich blickte auf.
»Zeig mal.«
Ich öffnete die Hand. Ein halbes Dutzend rote, grüne, weiße Steine. »Ich habe schöne Steine gefunden, gestreift und marmoriert, aber keine Achate.«
»Ich hab nie verstanden, warum die Leute immer nach Achaten suchen. Ist wahrscheinlich ein Geduldsspiel.«
Ich schloss meine Finger wieder. »Anscheinend sind das Halbedelsteine.«
»Edel oder nicht, aber die hier haben ganz schön Glück, dass sie in deiner Hand liegen dürfen.«
Ich öffnete noch mal die Hand, um sie mir anzusehen.
»Da liegt übrigens ein großer Achat neben deinem Fuß …«
Ich hob ihn auf.