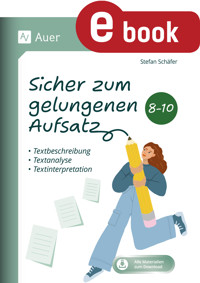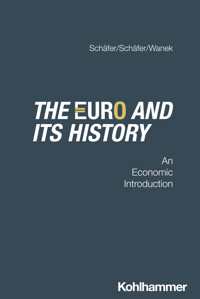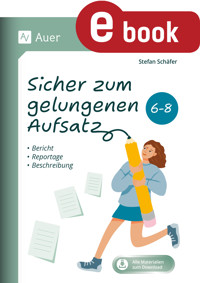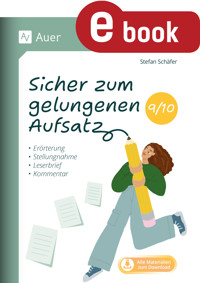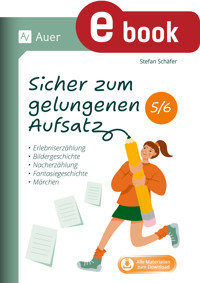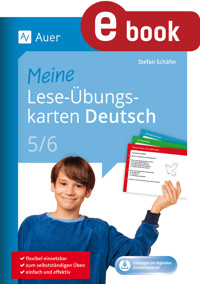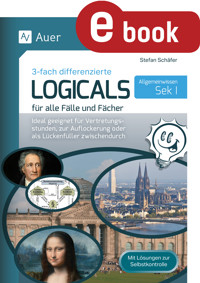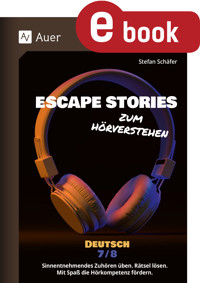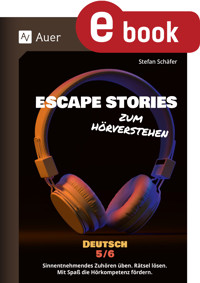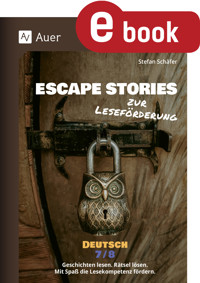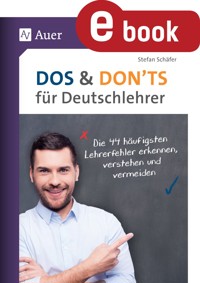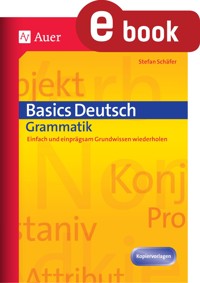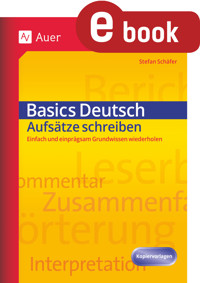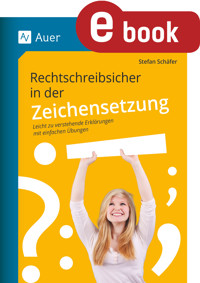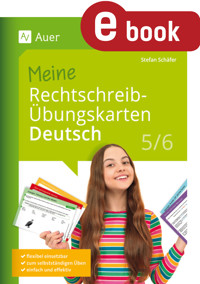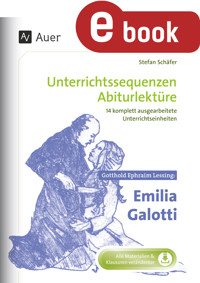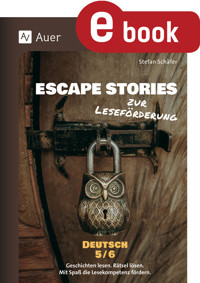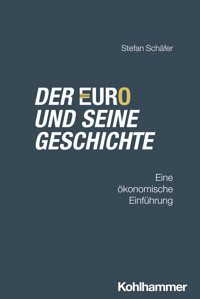
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mit ihrer gemeinsamen Währung haben die Europäer 1999 ein Experiment gewagt, das in der Geschichte des Geldes einmalig ist. Ihm waren zahlreiche währungspolitische Versuche vorangegangen, die seit den 1950er Jahren fortschreitende politische Integration monetär zu ergänzen. Die heutige Währungsunion stellt nicht das Ende dieser Entwicklung dar. Solange die Mitgliedsländer keine stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik betreiben, die europäischen Kapitalmärkte fragmentiert sind und wichtige EU-Mitglieder auf den Euro verzichten, bleibt das historische Projekt unvollendet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Schäfer
Der Euro und seine Geschichte
Eine ökonomische Einführung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-043362-5
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-043363-2
epub: ISBN 978-3-17-043364-9
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Cover
Vorwort
1 Einführung: Nationales Geld und internationaler Handel – ein einfaches Gedankenexperiment
1.1 Geld und seine Funktionen
1.2 Internationaler Handel und die Zahlungsbilanz
1.3 Devisenmarkt und Währungssystem
1.4 Die Gestaltung des internationalen Währungssystems
2 Vorgeschichte: Der lange Weg zum Euro (1945–1989)
2.1 Neustart nach dem Krieg: Bilateralismus, Europäische Zahlungsunion und Römische Verträge
2.1.1 Die Jahre des Bilateralismus
2.1.2 Die Europäische Zahlungsunion
2.1.3 Die Römischen Verträge
2.2 Westeuropas Währungen im Bretton-Woods-Zeitalter
2.2.1 Der Gold-Dollar-Standard im Überblick
2.2.2 Wie erreicht man fixe Wechselkurse?
2.2.3 Die EWG-Währungen im Bretton-Woods-System
2.2.4 Das Trilemma der Währungspolitik
2.2.5 Probleme ab Mitte 1960er-Jahre und Zusammenbruch
2.3 Die 1970er-Jahre: Werner-Plan und europäischer Wechselkursverbund
2.3.1 Der Werner-Plan: Eine EG-Währungsunion bis 1980?
2.3.2 Der Europäische Wechselkursverbund (EWV)
2.4 Das Europäische Währungssystem (EWS)
2.4.1 Ziele, Funktionsweise und Entwicklung im Zeitablauf
2.4.2 Wirtschaftshistorische Einordnung I: War das EWS ein Erfolg?
2.4.3 Wirtschaftshistorische Einordnung II: War das EWS ein D-Mark-Block mit der Bundesbank als Leitzentralbank?
2.4.4 Wirtschaftshistorische Einordnung III: War das EWS ein Wegbereiter der Währungsunion?
3 Vorbereitung: Delors-Report, Maastrichter Vertrag, Stabilitäts- und Wachstumspakt (1989–1998)
3.1 Der Delors-Report
3.2 Ökonomische Grundlagen der Diskussion in den 1990er-Jahren
3.2.1 Die Theorie der optimalen Währungsräume
3.2.2 Endogenität der Funktionsbedingungen einer Währungsunion?
3.2.3 Die politökonomische Betrachtung
3.2.4 Geldpolitik und Staatsverschuldung in einer Währungsunion
3.3 Der Maastrichter Vertrag
3.3.1 Die EZB als »europäische Bundesbank«?
3.3.2 Die Konvergenzkriterien
3.4 Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
3.5 Entscheidende Schritte auf dem Weg zur Währungsunion
3.6 Die EZB formuliert ihre Strategie
4 Honeymoon: Der Euro vor der Finanzkrise (1999–2007)
4.1 Die EZB bewährt sich – und passt ihre Strategie an
4.2 Griechenland, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Ungleichgewichte: Dunkle Wolken am Horizont?
5 Krisenjahre: Die Währungsunion am Rande des Zusammenbruchs (2008–2015)
5.1 Von der globalen Finanz- zur europäischen Staatsschuldenkrise
5.2 Dimensionen der Eurokrise
5.2.1 Die Eurokrise als Leistungsbilanzkrise
5.2.2 Die Eurokrise als Bankenkrise
5.2.3 Die Eurokrise als Staatsschuldenkrise
5.3 Die Diskussion über die institutionellen Ursachen der Krise
5.4 Die »Rettungspakete«, der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und das Krisenjahr 2015
5.5 Die Reform der Eurozonen-Architektur
5.5.1 Die Grundzüge der Diskussion im Überblick
5.5.2 Neuordnung der Fiskalregeln und makroökonomische Koordinierung
5.5.3 Die Reform der Finanzarchitektur
6 »The only game in town«: Die EZB als Mädchen für alles? (2015–2022)
6.1 Rückblick: Die Evolution der EZB-Geldpolitik seit Beginn der Finanzkrise
6.1.1 Die Reaktion der EZB auf die Probleme am Bankenmarkt
6.1.2 Die Reaktion der EZB auf die Staatsschuldenkrise
6.1.3 »Whatever it takes«
6.2 Quantitative Lockerung
6.2.1 Das »Programm zum Ankauf von Vermögenswerten«
6.2.2 Kritik an den Staatsanleihekäufen
6.3 Die geldpolitische Reaktion auf die Covid-Pandemie
7 Gegenwart und Zukunft
7.1 Die Inflation ist zurück
7.2 Die Revision der EZB-Strategie 2021
7.3 Steht die EZB unter fiskalischer Dominanz?
7.4 Das Programm »NextGenEU« und die Zukunft der Fiskalpolitik in der Währungsunion
7.5 Ein digitaler Euro?
7.6 Wann ist die Eurozone vollständig?
Literatur
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Vorwort
Seit seiner Einführung am 1.1.1999 ist der Euro das Geld, mit dem immer mehr Menschen in Europa bezahlen: Waren es anfangs knapp 300 Mio. in elf Staaten, so besteht die Währungsunion heute aus zwanzig Mitgliedsländern mit etwa 350 Mio. Einwohnern. Verantwortlich für den Euro zeichnet eine supranationale Institution, die Europäische Zentralbank (EZB). An sie haben die Teilnehmer der Währungsunion ihre Zuständigkeit für die Geld- und Währungspolitik abgetreten. Die Eurozonen-Länder sind seitdem »geldlos«, und der Euro sowie die EZB sind in gewissem Sinne »staatenlos«. Das hat es so noch nicht gegeben. Der Euro kann mit Fug und Recht als ein in der Geschichte des Geldes einmaliges Experiment bezeichnet werden.
Warum es zu einem solchen Experiment gekommen ist und wie es in den vergangenen Jahrzehnten verlaufen ist, will dieses Buch nachzeichnen. Von der unüberschaubaren Menge an Publikationen, die sich mit der europäischen Einheitswährung beschäftigen, unterscheidet es sich folgendermaßen:
Der Euro ist nicht vom Himmel gefallen, weder 1999 noch während der berühmten Konferenz von Maastricht im Jahr 1991. Seine lange Vorgeschichte, die strenggenommen mit dem Kriegsende 1945 beginnt, wird hier ausführlich beleuchtet. Diesen Aspekt vernachlässigt die Literatur zumeist.
Viele Beiträge zum Euro nehmen eine bestimmte Position ein. Im Gegensatz dazu ist es das zentrale Anliegen dieses Buches, die unterschiedlichen Sichtweisen gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Die Leser sollen das Für und Wider der entscheidenden Stationen nachvollziehen können, die die währungspolitische Integration Europas von den Anfängen in den 1940er-Jahren bis heute durchlaufen hat.
Anders als die meisten Veröffentlichungen zum Thema ist »Der Euro und seine Geschichte« explizit interdisziplinär ausgerichtet und richtet sich insbesondere auch an Laien. Das Buch ist ebenso für historisch, politologisch, juristisch oder kulturwissenschaftlich vorgebildete Leser geschrieben wie für an der geschichtlichen Entwicklung interessierte Ökonomen.
Die Darstellung erfolgt zwar aus ökonomischer Perspektive, kommt aber ohne die übliche wirtschaftswissenschaftliche Methodik aus. Die zentralen Zusammenhänge werden verbal und mit Hilfe anschaulicher Grafiken erklärt. Das Buch beginnt mit einem Einführungskapitel, das anhand eines Gedankenexperimentes in die grundlegenden Zusammenhänge der internationalen Makroökonomik einführt. Wer gleich in die (Vor-)Geschichte des Euro einsteigen möchte, kann dieses einführende Kapitel überspringen.
Um auch ein nicht deutschsprachiges Publikum zu erreichen, erscheint gleichzeitig eine Fassung in englischer Sprache. Ko-Autoren der internationalen Ausgabe sind Cory Wanek und Ann-Stephane Schäfer. Sie haben nicht nur die Übersetzung vorgenommen, sondern auch entscheidend zum Inhalt des Buches beigetragen.
Limburg, im Juli 2025Stefan Schäfer