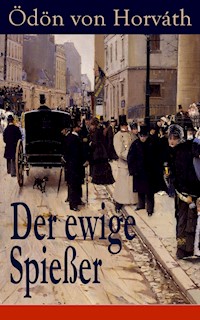Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
»Der ewige Spießer« ist der erste Roman von Ödön von Horváth und wurde 1930 verfasst. In klarer Sprache und losen Episoden zeichnet der Autor die sich kreuzenden Lebenswege mehrerer Figuren in einer kleinbürgerlichen Gesellschaft nach. Diese gibt sich nur nach außen edel, aber in ihrem Inneren ist sie rein auf Vorteil und Eigennutz bedacht: Die Handlung spielt während der Weltwirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg. Der arbeitslose Alfons Kobler zum Beispiel nutzt sein gutes Aussehen, um sich von älteren Damen aushalten zu lassen und in die gute Gesellschaft aufzusteigen. Die Näherin ohne Anstellung Anna Pollinger beschließt »praktisch« zu werden und sich prostituieren zu lassen. Der reiche Harry Priegler, Sohn eines Kriegsgewinnlers, soll ihr erster Kunde sein. Des Weiteren treten auf: verkommene Adlige, als Künstler gescheiterte Intellektuelle und andere, zeitlose Spießerfiguren. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ödön von Horvath
Der ewige Spießer
Erbaulicher Roman in drei Teilen
Ödön von Horvath
Der ewige Spießer
Erbaulicher Roman in drei Teilen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: De Gruyter, Berlin; New York, 1929 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-72-9
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Erster Teil -- Herr Kobler wird Paneuropäer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Zweiter Teil -- Fräulein Pollinger wird praktisch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Dritter Teil -- Herr Reithofer wird selbstlos
1
2
3
4
5
6
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
Die Erziehung des Herzens
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
»Der ewige Spießer« ist der erste Roman von Ödön von Horváth und wurde 1930 verfasst.
In klarer Sprache und losen Episoden zeichnet der Autor die sich kreuzenden Lebenswege mehrerer Figuren in einer kleinbürgerlichen Gesellschaft nach. Diese gibt sich nur nach außen edel, aber in ihrem Inneren ist sie rein auf Vorteil und Eigennutz bedacht:
Die Handlung spielt während der Weltwirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg. Der arbeitslose Alfons Kobler zum Beispiel nutzt sein gutes Aussehen, um sich von älteren Damen aushalten zu lassen und in die gute Gesellschaft aufzusteigen. Die Näherin ohne Anstellung Anna Pollinger beschließt »praktisch« zu werden und sich prostituieren zu lassen. Der reiche Harry Priegler, Sohn eines Kriegsgewinnlers, soll ihr erster Kunde sein.
Des Weiteren treten auf: verkommene Adlige, als Künstler gescheiterte Intellektuelle und andere, zeitlose Spießerfiguren.
»... aber was ich Ihnen vorwerfe, ist einfach dies: daß Sie sich vergeuden! Heutzutag muß man auch seine Sinnlichkeit produktiv gestalten! Ich verlange zwar keineswegs, daß Sie sich prostituieren, aber ich bitte Sie um Ihretwillen, praktischer zu werden!«
Für Ernst Weiß
Der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist, und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Wenn ich mich nicht irre, hat es sich allmählich herumgesprochen, daß wir ausgerechnet zwischen zwei Zeitaltern leben. Auch der alte Typ des Spießers ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden; wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Ich sage Zukunft, denn der neue Typ des Spießers ist erst im Werden, er hat sich noch nicht herauskristallisiert.
Es soll nun versucht werden, in Form eines Romans einige Beiträge zur Biologie dieses werdenden Spießers zu liefern. Der Verfasser wagt natürlich nicht zu hoffen, daß er durch diese Seiten ein gesetzmäßiges Weltgeschehen beeinflussen könnte, jedoch immerhin.
Erster Teil -- Herr Kobler wird Paneuropäer
Denn solang du dies nicht hast, Dieses »Stirb und werde!«, Bist du noch ein trüber Gast Auf der dunklen Erde.
1
Mitte September 1929 verdiente Herr Alfons Kobler aus der Schellingstraße sechshundert Reichsmark. Es gibt viele Leut, die sich soviel Geld gar nicht vorstellen können.
Auch Herr Kobler hatte noch niemals soviel Geld so ganz auf einmal verdient, aber diesmal war ihm das Glück hold. Es zwinkerte ihm zu, und Herr Kobler hatte plötzlich einen elastischeren Gang. An der Ecke der Schellingstraße kaufte er sich bei der guten alten Frau Stanzinger eine Schachtel Achtpfennigzigaretten, direkt aus Mazedonien. Er liebte nämlich dieselben sehr, weil sie so überaus mild und aromatisch waren.
»Jessas Mariandjosef!« schrie die brave Frau Stanzinger, die, seitdem ihr Fräulein Schwester gestorben war, einsam zwischen ihren Tabakwaren und Rauchutensilien saß und aussah, als würde sie jeden Tag um ein Stückchen kleiner werden -- »Seit wann rauchens denn welche zu acht, Herr Kobler? Wo habens denn das viele Geld her? Habens denn wen umgebracht, oder haben Sie sich gar mit der Frau Hofopernsänger wieder versöhnt?« »Nein«, sagte der Herr Kobler. »Ich hab bloß endlich den Karren verkauft.«
Dieser Karren war ein ausgeleierter Sechszylinder, ein Kabriolett mit Notsitz. Es hatte bereits vierundachtzigtausend Kilometer hinter sich, drei Dutzend Pannen und zwei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Greis.
Trotzdem fand Kobler einen Käufer. Das war ein Käsehändler aus Rosenheim, namens Portschinger, ein begeisterungsfähiger großer dicker Mensch. Der hatte bereits Mitte August dreihundert Reichsmark angezahlt und hatte ihm sein Ehrenwort gegeben, jenen Greis spätestens Mitte September abzuholen und dann auch die restlichen sechshundert Reichsmark sofort in bar mitzubringen. So sehr war er über diesen außerordentlich billigen Gelegenheitskauf Feuer und Flamme.
Und drum hielt er auch sein Ehrenwort. Pünktlich erschien er Mitte September in der Schellingstraße und meldete sich bei Kobler. In seiner Gesellschaft befand sich sein Freund Adam Mauerer, den er sich aus Rosenheim extra mitgebracht hatte, da er ihn als Sachverständigen achtete, weil dieser Adam bereits seit 1925 ein steuerfreies Leichtmotorrad besaß. Der Herr Portschinger hatte nämlich erst seit vorgestern einen Führerschein, und weil er überhaupt kein eingebildeter Mensch war, war er sich auch jetzt darüber klar, daß er noch lange nicht genügend hinter die Geheimnisse des Motors gekommen war.
Der Sachverständige besah sich das Kabriolett ganz genau und war dann auch schlechthin begeistert. »Das ist ein Notsitz!« rief er. »Ein wunderbarer Notsitz! Ein gepolsterter Notsitz! Der absolute Notsitz! Kaufs, du Rindvieh!« Das Rindvieh kaufte es auch sogleich, als wären die restlichen sechshundert Reichsmark Lappalien, und während der Kobler die Scheine auf ihre Echtheit prüfte, verabschiedete es sich von ihm: »Alsdann, Herr Kobler, wanns mal nach Rosenheim kommen, besuchens mich mal. Meine Frau wird sich freuen, Sie müssen ihr nachher auch die Geschicht von dem Prälatn erzählen, der wo mit die jungen Madin herumgstreunt is wie ein läufiges Nachtkastl. Meine Frau is nämlich noch liberaler als ich. Heil!«
Hierauf nahmen die beiden Rosenheimer Herren im Kabriolett Platz und fuhren beglückt nach Rosenheim zurück, das heißt: sie hatten dies vor.
»Der Karren hat an schönen Gang«, meinte der Sachverständige. Sie fuhren über den Bahnhofsplatz. »Es is scho schöner so im eignen Kabriolett als auf der stinkerten Bahn«, meinte der Herr Portschinger. Er strengte sich nicht mehr an, hochdeutsch zu sprechen, denn er war sehr befriedigt.
Sie fuhren über den Marienplatz.
»Schließen Sie doch den Auspuff!« brüllte sie ein Schutzmann an. »Is ja scho zu!« brüllte der Herr Portschinger, und der Sachverständige fügte noch hinzu: das Kabriolett hätte halt schon eine sehr schöne Aussprache, und nur kein Neid.
Nach fünf Kilometern hatten sie die erste Panne. Sie mußten das linke Vorderrad wechseln. »Das kommt beim besten Kabriolett vor«, meinte der Sachverständige. Nach einer weiteren Stunde fing der Ventilator an zu zwitschern wie eine Lerche, und knapp vor Rosenheim überschlug sich das Kabriolett infolge Achsenbruchs, nachdem kurz vorher sämtliche Bremsen versagt hatten. Die beiden Herren flogen in hohem Bogen heraus, blieben aber wie durch ein sogenanntes Wunder unverletzt, während das Kabriolett einen dampfenden Trümmerhaufen bildete.
»Es ist bloß gut, daß uns nix passiert is«, meinte der Sachverständige. Der Portschinger aber lief wütend zum nächsten Rechtsanwalt, jedoch der Rechtsanwalt zuckte nur mit den Schultern. »Der Kauf geht in Ordnung«, sagte er. »Sie hätten eben vor Abschluß genauere Informationen über die Leistungsfähigkeit des Kabrioletts einholen müssen. Beruhigen Sie sich, Herr Portschinger, Sie sind eben betrogen worden, da kann man nichts machen!«
2
Seinerzeit, als dieser Karren noch fabrikneu war, hatte ihn sich jene Hofopernsängerin gekauft, die wo die Frau Stanzinger in Verdacht hatte, daß sie den Herrn Kobler aushält. Aber das stimmte nicht in dieser Form. Zwar hatte sie den Kobler gleich auf den ersten Blick recht liebgewonnen; dies ist in der Firma »Gebrüder Bär« geschehen, also in eben jenem Laden, wo sie sich den fabrikneuen Karren gekauft hatte.
Der Kobler ging dann bei ihr ein und aus, von Anfang Oktober bis Ende August, aber dieses ganze Verhältnis war in pekuniärer Hinsicht direkt platonisch. Er aß, trank und badete bei ihr, aber niemals hätte er auch nur eine Mark von ihr angenommen. Sie hätte ihm so was auch niemals angeboten, denn sie war eine feine gebildete Dame, eine ehemalige Hofopernsängerin, die seit dem Umsturz nur mehr in Wohltätigkeitskonzerten sang. Sie konnte sich all diese Wohltäterei ungeniert leisten, denn sie nannte u. a. eine schöne Villa mit parkähnlichem Vorgarten ihr eigen, aber sie würdigte es nicht, zehn Zimmer allein bewohnen zu können, denn oft in der Nacht fürchtete sie sich vor ihrem verstorbenen Gatten, einem dänischen Honorarkonsul. Der hatte knapp vor dem Weltkrieg mit seinem vereiterten Blinddarm an die Himmelspforte geklopft und hatte ihr all sein Geld hinterlassen, und das ist sehr viel gewesen. Sie hatte ehrlich um ihn getrauert, und erst 1918, als beginnende Vierzigerin, hatte sie wieder mal Sehnsucht nach irgendeinem Mannsbild empfunden. Und 1927 blickte sie auf ein halbes Jahrhundert zurück.
Der Kobler hingegen befand sich 1929 erst im siebenundzwanzigsten Lenze und war weder auffallend gebildet noch besonders fein. Auch ist er immer schon ziemlich ungeduldig gewesen -- drum hielt er es auch bei »Gebrüder Bär« nur knapp den Winter über aus, obwohl der eine Bär immer wieder sagte: »Sie sind ein tüchtiger Verkäufer, lieber Kobler!« Er verstand ja auch was vom Autogeschäft, aber er hatte so seine Schrullen, die ihm auf die Dauer der andere Bär nicht verzeihen konnte. So unternahm er u. a. häufig ausgedehnte Probefahrten mit Damen, die er sich im geheimen extra dazu hinbestellt hatte. Diese Damen traten dann vor den beiden Bären ungemein selbstsicher auf, so ungefähr, als könnten sie sich aus purer Laune einen ganzen Autobus kaufen. Einmal jedoch erkannte der andere Bär in einer solchen Dame eine Prostituierte, und als dann gegen Abend der Herr Kobler zufrieden von seiner Probefahrt zurückfuhr, erwartete ihn dieser Bär bereits auf der Straße vor dem Laden, riß die Tür auf und roch in die Limousine hinein. »Sie machen da sonderbare Probefahrten, lieber Kobler«, sagte er maliziös. Und der liebe Kobler mußte sich dann wohl oder übel selbstständig machen. Zwar konnte er sich natürlich keinen Laden mieten und betrieb infolgedessen den Kraftfahrzeughandel in bescheidenen Grenzen, aber er war halt sein eigener Herr. Er hatte jedoch diese höhere soziale Stufe nur erklimmen können, weil er mit jener Hofopernsängerin befreundet war. Darüber ärgerte er sich manchmal sehr.
Recht lange währte ja diese Freundschaft nicht. Sie zerbrach Ende August aus zwei Gründen. Die Hofopernsängerin fing plötzlich an, widerlich rasch zu altern. Dies war der eine Grund. Aber der ausschlaggebende Grund war eine geschäftliche Differenz.
Nämlich die Hofopernsängerin ersuchte den Kobler, ihr kaputtes Kabriolett mit Notsitz möglichst günstig an den Mann zu bringen. Als nun Kobler von dem Herrn Portschinger die ersten dreihundert Reichsmark erhielt, lieferte er der Hofopernsängerin in einer ungezogenen Weise lediglich fünfzig Reichsmark ab, worüber die sich derart aufregte, daß sie ihn sogar anzeigen wollte. Sie unterließ dies aber aus Angst, ihr Name könnte in die Zeitungen geraten, denn dies hätte sie sich nicht leisten dürfen, da sie mit der Frau eines Ministerialrats aus dem Kultusministerium, die sich einbildete, singen zu können, befreundet war. Also schrieb sie ihrem Kobler lediglich, daß sie ihn für einen glatten Schurken halte, daß er eine Enttäuschung für sie bedeute und daß sie mit einem derartigen Subjekte als Menschen nichts mehr zu tun haben wolle. Und dann schrieb sie ihm einen zweiten Brief, in dem sie ihm auseinandersetzte, daß man eine Liebe nicht so einfach zerreißen könne wie ein Seidenpapier, denn als Weib bleibe doch immer ein kleines Etwas unauslöschlich in einem drinnen stecken. Der Kobler sagte sich: Ich bin doch ein guter Mensch, und telefonierte mit ihr. Sie trafen sich dann zum Abendessen draußen im Ausstellungsrestaurant. »Peter«, sagte die Hofopernsängerin. Sonst sagte sie die erste Viertelstunde über nichts. Kobler hieß zwar nicht Peter, sondern Alfons, aber »Peter klingt besser«, hatte die Hofopernsängerin immer schon konstatiert. Auch ihm selbst gefiel es besser, besonders wenn es die Hofopernsängerin aussprach, dann konnte man nämlich direkt meinen, man sei zumindest in Chikago. Für Amerika schwärmte er zwar nicht, aber er achtete es. »Das sind Kofmichs!« pflegte er zu sagen.
Die Musik spielte sehr zart im Ausstellungsrestaurant, und die Hofopernsängerin wurde wieder ganz weich. »Ich will dir alles verzeihen, Darling, behalt nur getrost mein ganzes Kabriolett«, so ungefähr lächelte sie ihm zu. Der Darling aber dachte: Jetzt fällt’s mir erst auf, wie alt daß die schon ist. Er brachte sie dann nach Hause, ging aber nicht mit hinauf. Die Hofopernsängerin warf sich auf das Sofa und stöhnte: »Ich möcht mein Kabriolett zurück!«, und plötzlich fühlte sie, daß ihr verstorbener Gatte hinter ihr steht. »Schau mich nicht so an!« brüllte sie. »Pardon! Du hast Krampfadern«, sagte der ehemalige Honorarkonsul und zog sich zurück in die Ewigkeit.
3
An der übernächsten Ecke der Schellingstraße wohnte Kobler möbliert im zweiten Stock links bei einer gewissen Frau Perzl, einer Wienerin, die zur Generation der Hofopernsängerin gehörte. Auch sie war Witwe, aber ansonsten konnte man sie schon in gar keiner Weise mit jener vergleichen. Nie kam es unter anderem vor, daß sie sich vor ihrem verstorbenen Gatten gefürchtet hätte, nur ab und zu träumte sie von Ringkämpfern. So hat sich mal solch ein Ringkämpfer vor ihr verbeugt, der hat dem Kobler sehr ähnlich gesehen, und hat gesagt: »Es ist gerade 1904. Bitte, halt mir den Daumen, Josephin! Ich will jetzt auf der Stelle Weltmeister werden, du Hur!«
Sie sympathisierte mit dem Kobler, denn sie liebte unter anderem sein angenehmes Organ so sehr, daß er ihr die Miete auch vierzehn Tage und länger schuldig bleiben konnte. Besonders seine Kragenpartie, wenn er ihr den Rücken zuwandte, erregte ihr Gefallen.
Oft klagte sie über Schmerzen. Der Arzt sagte, sie hätte einen Hexenschuß, und ein anderer Arzt sagte, sie hätte eine Wanderniere, und ein dritter Arzt sagte, sie müsse sich vor ihrer eigenen Verdauung hüten. Was ein vierter Arzt sagte, das sagte sie niemandem. Sie ging gern zu den Ärzten, zu den groben und zu den artigen.
Auch ihr Seliger ist ja Mediziner gewesen, ein Frauenarzt in Wien. Er stammte aus einer angesehenen, leicht verblödelten, christlich-sozialen Familie und hatte sich im Laufe der Vorkriegsjahre sechs Häuser zusammengeerbt. Eines stand in Prag. Sie hingegen hatte bloß den dritten Teil einer Windmühle bei Brescia in Oberitalien mit in die Ehe gebracht, aber das hatte er ihr nur ein einziges Mal vorgeworfen. Ihre Großmutter war eine gebürtige Mailänderin gewesen.
Der Doktor Perzl ist Anno Domini 1907 ein Opfer seines Berufes geworden. Er hatte sich mit der Leiche einer seiner Patientinnen infiziert. Wie er die nämlich auseinandergeschnitten hatte, um herauszubekommen, was ihr eigentlich gefehlt hätte, hatte er sich selbst einen tiefen Schnitt beigebracht, so unvorsichtig hat er mit dem Seziermesser herumhantiert, weil er halt wieder mal besoffen gewesen ist. Es hat allgemein geheißen, wenn er kein Quartalssäufer gewesen wär, so hätt er eine glänzende Zukunft gehabt.
Ferdinand Perzl, das einzige Kind, hatte die Kadettenschule absolvieren müssen, weil er als Gymnasiast nichts Vernünftiges hatte werden wollen. Er ist dann ein k. u. k. Oberleutnant geworden, und es ist ihm auch gelungen, den Weltkrieg in der Etappe zu verhuren. Aber nachdem Österreich-Ungarn alles verspielt und auch er selbst allmählich alles, was er erben sollte, die sechs Häuser und das Drittel der Windmühle, verloren hatte, ist er in sich gegangen und hat nicht mehr herumgehurt, sondern hat bloß zähneknirschend und mit der Faust in der Tasche zugeschaut, wie dies die Valutastarken taten. Er ist in ein Kontor gekommen und hatte seine liederliche Haltung während des großen Völkerringens in seinen Augen ausradiert, ist Antisemit geworden und hat die Kontoristin Frieda Klovac geheiratet, eine Blondine mit zwei linke Füß. Solch kleine Abnormitäten konnten ihn seit seiner Etappenzeit ganz wehmütig stimmen.
Über diese Heiraterei hatte sich jedoch seine Mutter sehr aufgeregt, denn sie hatte ja immer schon gehofft, daß der Nandl mal ein anständiges Mädl aus einem schwerreichen Hause heiraten würde. Eine Angestellte war in ihren Augen keine ganz einwandfreie Persönlichkeit, besonders als Schwiegertochter nicht. Sie titulierte sie also nie anders als »das Mensch«, »die Sau«, »das Mistvieh« und dergleichen.
Und je ärmer sie wurde, um so stärker betonte sie ihre gesellschaftliche Herkunft, mit anderen Worten: Je härter sie ihre materielle Niederlage empfand, um so bewußter wurde sie sich ihrer ideellen Überlegenheit. Diese ideelle Überlegenheit bestand vor allem aus Unwissenheit und aus der natürlichen Beschränktheit des mittleren Bürgertums. Wie alle ihresgleichen haßte sie nicht die uniformierten und zivilen Verbrecher, die sie durch Krieg, Inflation, Deflation und Stabilisierung begaunert hatten, sondern ausschließlich das Proletariat, weil sie ahnte, ohne sich darüber klarwerden zu wollen, daß dieser Klasse die Zukunft gehört. Sie wurde neidisch, leugnete es aber ab. Sie fühlte sich zutiefst gekränkt und in ihren heiligsten Gefühlen verletzt, wenn sie sah, daß sich ein Arbeiter ein Glas Bier leisten konnte. Sie wurde schon rabiat, wenn sie nur einen demokratischen Leitartikel las. Es war kaum mit ihr auszuhalten am 1. Mai.
Nur einmal hatte sie acht Jahre lang einen Hausfreund, einen Zeichenlehrer von der Oberrealschule im achten Bezirk. Der ist immer schon etwas nervös gewesen und hat immer schon so seltsame Aussprüche getan, wie: »Na, wer ist denn schon der Tizian? Ein Katzlmacher!« Endlich wurde er eines Tages korrekt verrückt, so wie sich’s gehört. Das begann mit einem übertriebenen Reinlichkeitsbedürfnis. Er rasierte sich den ganzen Körper, schnitt sich peinlich die Härchen aus den Nasenlöchern und zog sich täglich zehnmal um, obwohl er nur einen Anzug besaß. Später trug er dann auch beständig ein Staubtuch mit sich herum und staubte alles ab, die Kandelaber, das Pflaster, die Trambahn, den Sockel des Maria-Theresia-Denkmals -- und zum Schluß wollte er partout die Luft abstauben. Dann war’s aus.
4
Doch lassen wir nun diese historisch-soziologischen Skizzen und kehren wir zurück in die Gegenwart, und zwar in die Schellingstraße.
Knapp zehn Minuten bevor der Kobler nach Hause kam, läutete ein gewisser Graf Blanquez bei der Frau Perzl. Er sagte ihr, er wolle in Koblers Zimmer auf seinen Freund Kobler warten.
Dieser Graf Blanquez war eine elegante Erscheinung und eine verpatzte Persönlichkeit. Seine Ahnen waren Hugenotten, er selbst wurde im Bayerischen Wald geboren. Erzogen wurde er teils von Piaristen, teils von einem homosexuellen Stabsarzt in einem der verzweifelten Kriegsgefangenenlager Sibiriens. Mit seiner Familie vertrug er sich nicht, weil er vierzehn Geschwister hatte. Trotzdem schien er meist guter Laune zu sein, ein großer Junge, ein treuer Gefährte, jedoch leider ohne Hemmungen. Er liebte Musik, ging aber nie in die Oper, weil ihn jede Oper an die Hugenotten erinnerte, und wenn er an die Hugenotten dachte, wurde er melancholisch.
Die Perzl ließ ihn ziemlich unfreundlich hinein, denn er war ihr nicht gerade sympathisch, da sie ihn im Verdacht hatte, daß er sich nur für junge Mädchen interessiert. Wo hat der nur seine eleganten Krawatten her? überlegte sie mißtrauisch und beobachtete ihn durchs Schlüsselloch. Sie sah, wie er sich aufs Sofa setzte und in der Nase bohrte, das Herausgeholte aufmerksam betrachtete und es dann gelangweilt an die Tischkante schmierte. Dann starrte er Koblers Bett an und lächelte zynisch. Hierauf kramte er in Koblers Schubladen, durchflog dessen Korrespondenz und ärgerte sich, daß er nirgends Zigaretten fand, worauf er sich aus Koblers Schrank ein Taschentuch nahm und sich vor dem Spiegel seine Mitesser ausdrückte. Er war eben, wie bereits gesagt, leider hemmungslos.
Er kämmte sich gerade mit Koblers Kamm, als dieser die Perzl am Schlüsselloch überraschte. »Der Herr Graf sind da«, flüsterte sie. »Aber ich an Ihrer Stell würd ihm das schon verbieten. Denken Sie sich nur, kommt er da gestern nicht herauf mit einem Mensch, legt sich einfach in Ihr Bett damit, gebraucht Ihr Handtuch und ist wieder weg damit! Das geht doch entschieden zu weit, ich tät das dem Herrn Grafen mal sagen!«
»Das ist gar nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen«, meinte Kobler. »Der Graf ist nämlich leicht gekränkt, er könnt das leicht falsch auffassen, und ich muß mich mit ihm vertragen, weil ich oft geschäftlich mit ihm zusammenarbeiten muß. An dem Handtuch ist mir zwar heut schon etwas aufgefallen, wie ich mir das Gesicht abgewischt hab, aber eine Hand wäscht halt die andere.«
Die Perzl zog sich gekränkt in ihre Küche zurück und murmelte was Ungünstiges über die heutigen Kavaliere.
Als der Graf den Kobler erblickte, gurgelte er gerade mit dessen Mundwasser und ließ sich nicht stören. »Ah, Servus!« rief er ihm zu. »Verzeih, aber ich hab grad so einen miserablen Geschmack im Mund. Apropos: Ich weiß schon, du hast den Karren verkauft. Man gratuliert!«
»Danke«, sagte Kobler kleinlaut und wartete verärgert, daß man ihn anpumpt. Woher weiß denn das schon jeder Gauner, daß ich den Portschinger betrogen hab? fragte er sich verzweifelt.
Er überlegte: Pump mich nur an, aber dann schlag ich dir auf dein unappetitliches Maul!
Aber es kam ganz im Gegenteil. Der Graf legte mit einer chevaleresken Geste zehn Reichsmark auf den Tisch. »Mit vielem Dank zurück«, lächelte er verbindlich und gurgelte weiter, als wäre nichts Besonderes passiert. »Du hast es, scheint’s, vergessen«, bemerkte er dann noch so nebenbei, »daß du mir mal zehn Mark geliehen hast.« Was für ein Tag! dachte Kobler.
»Ich kann es dir heut leicht zurückzahlen«, fuhr der Graf fort, »weil ich heut nacht eine Erbschaft machen werd. Mein Großonkel, der um zehn Monate jünger ist als ich, liegt nämlich im Sterben. Er hat den Krebs. Der Ärmste leidet fürchterlich, Krebs ist bekanntlich unheilbar, wir wissen ja noch gar nicht, ob das ein Bazillus ist oder eine Wucherung. Er wird die Nacht nicht überleben, das steht fest. Wie er von seinem Leiden erlöst ist, fahr ich nach Zoppot. Nein, nicht durch Polen, oben rum.«
»Gehört Zoppot noch zu Deutschland?« erkundigte sich Kobler.
»Nein, Zoppot liegt im Freistaat Danzig, der direkt dem Völkerbund untergeordnet ist«, belehrte ihn der Graf. »Übrigens, wenn ich du wär, würd ich jetzt auch wegfahren, du kannst deine Sechshundert gar nicht besser anlegen. Wenn du mir folgst, fährst du einfach auf zehn Tag in ein Luxushotel, lernst dort eine reiche Frau kennen, und alles Weitere wird sich dann sehr leger abspielen, du hast ja ein gutes Auftreten. Du kannst für dein ganzes Leben die märchenhaftesten Verbindungen bekommen, garantiert! Du kennst doch den langen Kammerlocher, der wo früher bei den Ulanen war, den Kadettaspiranten, der wo in der Maxim-Bar die Zech geprellt hat? Der ist mit ganzen zweihundert Schilling nach Meran gefahren, hat sich dort in ein Luxushotel einlogiert, hat noch am gleichen Abend eine Ägypterin mit a paar Pyramiden zum Boston engagiert, hat mit ihr geflirtet und hat sie dann heiraten müssen, weil er sie kompromittiert hat. Jetzt gehört ihm halb Ägypten. Und was hat er gehabt? Nix hat er gehabt. Und was ist er gewesen? Pervers ist er gewesen! Lange Seidenstrümpf hat er sich angezogen und hat seine Haxen im Spiegel betrachtet. Ein Narziß!«
»Das muß ich mir noch durch den Kopf gehen lassen, wie ich am besten mein Geld ausgib«, meinte Kobler nachdenklich. »Ich bin kein Narziß«, fügte er hinzu. Die langen Haxen des Kammerlocher, das Luxushotel und die Pyramiden hatten ihn etwas verwirrt. Mechanisch bot er dem Grafen eine Achtpfennigzigarette an. »Das sind Mazedonier«, sagte der Graf. »Ich nehm mir gleich zwei.«
Sie rauchten. »Ich fahr bestimmt nach Zoppot«, wiederholte der Graf. Es schlug elf. »Es ist schon zwölf«, sagte der Graf, denn er war sehr verlogen.
Dann wurde er plötzlich nervös.