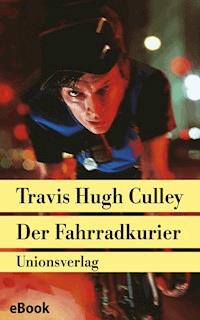
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Travis Hugh Culley ist pleite, sein Theaterprojekt war ein Flop, da stößt er auf eine Anzeige: »Fahrradkurier gesucht«. Es sollte der Beginn eines neuen Lebens werden. In seinem so authentischen wie rauschhaften Bericht lernt Culley, die Stadt neu zu sehen, zu hören, zu riechen und zu schmecken. Er scheint mit seinem Fahrrad zu verschmelzen, die physikalischen Gesetze aufzuheben und zu fliegen, der Zeit davonzurasen. Salziger Schweiß, Abgase, Kälte und extreme Erschöpfung hinterlassen ihre Spuren auf seinem Körper. Er erlebt die Magie der Balance auf zwei Rädern im Stillstand und das Glücksgefühl, den aggressiven Verkehr in einem irren Tanz zu durchdringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Travis Hugh Culley ist pleite, sein Theaterprojekt war ein Flop, da stößt er auf eine Anzeige: »Fahrradkurier gesucht«. Es sollte der Beginn eines neuen Lebens werden. In seinem so authentischen wie rauschhaften Bericht lernt Culley, die Stadt neu zu sehen, zu hören, zu riechen und zu schmecken.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Travis Hugh Culley wuchs in Miami auf. Nach Misserfolgen mit seinem eigenen Theater begann er Ende der Neunzigerjahre als Fahrradkurier in Chicago und in Philadelphia zu arbeiten. Die Erfahrungen, die er dabei sammelte, bildeten die Grundlage für sein erstes Buch Der Fahrradkurier.
Zur Webseite von Travis Hugh Culley.
Jürgen Bürger (*1954) studierte Volkswissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichte. Er ist als literarischer Übersetzer u. a. von Larry Beinhart, Thomas Adcock, Jerry Oster und Jerome Charyn tätig.
Zur Webseite von Jürgen Bürger.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Travis Hugh Culley
Der Fahrradkurier
Roman
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Bürger
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel The Immortal Class. Bike Messengers and the Cult of Human Power bei Villard Books, New York.
Originaltitel: The Immortal Class. Bike Messengers and the Cult of Human Power (2001)
© by Travis Hugh Culley 2001
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Gustav Pennsylero/Stone
Umschlaggestaltung:
ISBN 978-3-293-30742-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 06:16h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER FAHRRADKURIER
Einleitung1 — Tagesanbruch6:48 a. m.8:43 a. m.10:02 a. m.11:21 a. m.11:55 a. m.2 — Freiheit in der amerikanischen Stadt3 — Torso: Wie die Generation X zur Politik kommt4 — Der Lauf des Stieres5 — Das Aussetzungsprinzip6 — Die Physik des Schwebens7 — Jetzt/ChicagoDer Plan und das LandDer UntergrundDie Architektur der BewegungLärmDer Geist des Ortes8 — Zwischen Klippe und Ufer9 — Alley Cat: Von Krankheit und Erfolg10 — Hinterhalt8. September 199225. September 199811 — Requiem für den Arbeiter12 — Die Reste des öffentlichen RaumesDanksagungenMehr über dieses Buch
Über Travis Hugh Culley
Über Jürgen Bürger
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema USA
Zum Thema Sport
Zum Thema Großstadt
Für meinen Großvater Bernard Fox, Gründer des Fox Firestone Bike Shop, New Smyrna Beach, Florida, 1956.
Halte dein Werkzeug stets griffbereit.
Einleitung
Um 5 Uhr 22 nachmittags sind meine Lider schwer wie Kanaldeckel. An der Ecke Washington und Clark lehne ich mich gegen einen Verkaufsautomaten von USA Today und denke: Was bildest du dir eigentlich ein, so anmaßend zu sein?
Ich stehe im Zentrum des sich stoßweise bewegenden Stroms selbstzerstörerischer Massen inmitten eines Strudels stürmischer technologischer und ökonomischer Entwicklungen. Man nennt diese Zeit Rushhour, und ich schlürfe Flüssiges aus einem Styroporbecher. Das Wasser gabs gratis, der Becher jedoch kostete fünfundzwanzig Cent.
Ein alter Mann ohne Beine, ein Veteran zahlreicher Kriege, sitzt in seinem Rollstuhl an einer Straßenecke in der Nähe. Er ist umgeben von selbst gemachten Schildern, die seinen Fall darstellen, während er den Kopf gesenkt hat und schläft. Liebend gern wäre ich in seinem Körper. Liebend gern würde ich die Gegenwart der tausenden vorbeigehenden Menschen spüren, die gelegentlich ein paar Centstücke in seine kleine Schachtel werfen. Liebend gern würde ich eine grenzenlose Brüderschaft wie diese in der traumgleichen Landschaft seines ruhigen Atems spüren. Auf eine bedrückende Art muss es aufregend sein, dermaßen der Welt ausgeliefert zu sein, denke ich, während die Münzen auf seinem Schoß leise klimpern.
Der Becher steht auf dem Metallkasten neben mir. Er ist immer noch zur Hälfte gefüllt mit dem dicken Wasser, aus dem mein Körper die Feuchtigkeit herausfiltern muss. Das Wasser im Becher vibriert leicht. Ich sehe das Kräuseln auf seiner metallisch schimmernden Oberfläche, kann die Vibration selbst aber nicht spüren. Vielleicht verursachen die Züge dieses Beben. Oder die startenden Flugzeuge vom O’Hare. Es könnte auch der Leder-Express sein, diese marschierende Kolonne von Halbschuhen und hohen Absätzen, die um mich herum auf den Bürgersteig eindreschen. Es könnten die siebzehn Millionen Autos sein, die jedes Jahr in diesem Land hergestellt werden, oder auch die Summe der Aufschlagswucht, wenn sie auf unseren Straßen zusammenprallen. Jedenfalls stört irgendetwas, das ich nicht sehen kann, dieses Stillleben und nimmt unbemerkt Einfluss. Die Menschen trappeln weiter im Rhythmus der Vibration wie magnetische Hockeyspieler auf einem Spielfeld aus Blech. Sie wackeln leicht auf der Stelle und kreisen am Spielfeldrand. Auch sie gehorchen einem verborgenen Mechanismus, den ich von der Oberfläche aus nicht erkennen kann.
Wie bei dem Wasser im Becher kann ich zwar die Bewegung erkennen, aber ich kann die Vektoren nicht definieren, die diese Fußgängerwellen beeinflussen, die über die Kreuzung Washington Street und Clark rollen und etwas weiter weg über die LaSalle, Wells, Franklin und Wacker. Ich bin zu nah dran, unter der Last der Skyline nicht einmal in der Lage, mir eine Welt vorzustellen, die ohne die unbeholfenen Werke des Menschen auskommt. Ich hänge hier fest, bin erstaunt und fasziniert, liebe und hasse diese Stadt, liebe und hasse die Menschheit und meine ungeheure Winzigkeit darin. Und doch kann ich nicht Abstand halten. Nein, ich bin viel zu nah dran. Manchmal bin ich nur einen Hauch davon entfernt, mich ganz in ihr zu verlieren, aufgesogen zu werden.
Und wer bin ich? Ich bin ein Fahrradkurier: ein Lakai, ein Tagelöhner, eine Rotznase, für die dieser Ort hier ihr Zuhause ist. Ich bin Teil dieser Maschine, und gleichzeitig bin ich ihr Beobachter. Meistens stecke ich mittendrin, bin kaum ein eigenständiges Ich, aber dann habe ich diese Geistesblitze und sehe Bilder, die sich zu einem größeren Ganzen zusammenfügen, bei dem es nicht um mich, sondern um die Stadt geht. Auch sie ist befangen, stellt die gleiche Frage. Ich höre ihre Unsicherheit in meinem Herzen aufsteigen, sodass die Nerven in meinen Händen zittern und das Wasser sich scheinbar grundlos kräuselt. Diese Frage nimmt von mir Besitz, überwältigt mich. Was ist dieses Wirbeln um mich herum, das mich wie Radiowellen durchdringt, das unter mir als U-Bahnen vorbeizieht, das sich in Fahrstühlen an mich heranschleicht und über meinem Kopf fliegt? Das Gesamtbild zu erfassen erscheint unmöglich. Die Klippen, die um mich herum aufragen, sind so hoch, dass mir schwindlig wird, wenn ich nur an sie denke. Und doch glaubt jemand, irgendwo, er oder sie könne für »USA today«, das heutige Amerika, sprechen. Was wissen die denn? Wie können die behaupten, dies alles zu verstehen, wenn nicht einmal ich es kann, hier, im Herzen von Amerika?
Wer bin ich? Die Frage ist schwierig, denn ich bin mit einem Virus infiziert. Ich bin unendlich in Pixel aufgerastert, in eine Sequenz von Postleitzahlen und Etagennummern, Lieferterminen und Straßennamen. Wer ich bin, ist eine zweigleisige Geschichte, eine Stadt und ein Mann.
Ich heiße Travis. Ich bin jetzt fünfundzwanzig und bestimmt nicht in der Lage zu verallgemeinern. Ich kann nur hoffen, dass mein Standpunkt vielleicht nützlich ist, indem ich hier einfach stehe, ein Drifter, ein Träumer, ein Kurier sowohl außerhalb wie innerhalb dieses Gipfels des Fortschritts. Mir fehlen die akademischen Titel altehrwürdiger Universitäten, um mich eine Autorität auf dem Gebiet der Stadtentwicklung nennen zu dürfen, aber ich habe so viel: Ich habe eine Frage, und ich habe die Stadt, der ich sie stellen kann, ich habe den Abdruck, den diese Arbeit in die Schwärze hinter meinen Augen geprägt und mir wie ein Brandmal in die Haut gebrannt hat. Wenn schon nichts anderes, so habe ich zumindest einen der besten Plätze des Hauses für das Schauspiel und das Unrecht, das diesen Ort so aufregend macht.
In meiner Kuriertasche befinden sich vier in ein Seitenfach geknüllte Dollarscheine, eine Fahrradpumpe, ein Ersatzschlauch und ein Taschentuch mit Paisleymuster. In der Hand halte ich einen billigen Kugelschreiber mit dem Werbeaufdruck einer Marketingfirma, deren Dienste ich nie in Anspruch nehmen werde. Mein rechtes Schienbein juckt wegen der Socke, die ich über eine Schnittwunde hochgezogen habe. Meine Zehen sind immer noch glitschig von dem Blut, das mir in den Schuh gelaufen ist. Eine solche Wunde wird erst nach Monaten richtig verheilt sein. In einer Welt wie dieser wird alles infiziert.
Manchmal frage ich mich, ob meine Sichtweise der Dinge berechtigt ist, andererseits aber, wer tut das nicht? So viele von uns verbringen ihre Tage damit, auf Bildschirme und Börsenticker zu starren. Wir genießen es zuzusehen, wie die kleinen Lichter im Fahrstuhl vom Keller bis zur 83. Etage wandern. Die computergenerierten Zukünfte der Meteorologen und der Morgenzeitungen machen uns Sorgen, und gleichzeitig fragen wir uns, was eigentlich aus der Wirklichkeit geworden ist. Wir fragen uns, ob nicht vielleicht die Öffentlichkeit nur ein Team von Auswechselspielern ist, die hinter den Kommentatoren stehen wie bei Baseballspielen. Wir fragen uns, ob wir auch eine eigene Stimme haben oder ob wir Meinungsumfragen brauchen, die für uns sprechen. Es ist ein wichtiges Thema – der Wert des menschlichen Blickwinkels –, stößt es doch auf so viele bizarre Illusionen.
An diesem Punkt komme ich ins Spiel, dort, wo die täglichen Nachrichten auf taube Ohren treffen. Ich kann Ihnen nicht die täglichen Schlagzeilen bieten, die Berichte über Verbrechen und die Einzelheiten darüber, wer genau auf der Harrison Street erschossen wurde. Ich weiß weder, wo die Kugel eingedrungen ist, noch kenne ich das Motiv. Aber ich kann Ihnen etwas darüber erzählen, wie es ist, hier zu stehen und auf den Herzschlag der Welt zu lauschen, hier, wo ich vertraut bin mit den Schattenseiten der Gesellschaft und den höchsten Gipfeln des Kapitalismus. Genau um dieses Innenleben der Menschheit, betrachtet aus dem Herzen des Markts, geht es hier – eine Parallele: Menschenleben und Stadtleben in Nahaufnahme.
Außerhalb der anerkannten Blickwinkel von Sozialwissenschaftlern und weit entfernt von den Politikern mit ihren halblegalen Spendengeldern kann ich frei denken. Ich bin weder an vorgefertigtes Abstimmungsverhalten gebunden, noch habe ich Respekt vor der »Stimme der Autorität«. Ich stehe nicht im Dienst der Wissenschaft und werde auch nicht von ihr bezahlt. Hier stehe ich, kreise, radle durch die urbane Welt mit Lichtgeschwindigkeit oder manchmal auch nur mit der Geschwindigkeit der Erde, die sich unter mir dreht.
Sie sagen vielleicht, mein Blickwinkel sei nicht anerkannt, aber angesichts von Wolken, die sich in einem Meer stählerner Oberflächen spiegeln, hinsichtlich der Bedeutung von Verkehrszeichen und der Art und Weise, wie einem das Herz in die Hose rutscht beim Anblick einer anschwellenden Flut Abgase produzierender Lastwagen, wer will da schon behaupten, er sei etwas anderes als ein Amateur? Kann wirklich jemand autorisiert sein, das alles erfassen zu wollen? Ich denke nicht.
Ich kann nur hier stehen und meinen Gedanken freien Lauf lassen, darauf vertrauend, dass meine Worte widerspiegeln, was ich sehe. Mehr kann ich mir nicht erhoffen. Während ich um Respekt kämpfe, dem Geld nachjage, das ich nach Hause bringe, zwischen den Gelenken der Stadt arbeite – ein Stammesangehöriger, ein Eingeborener und doch zugleich ihr Kritiker –, bin ich, geübt im ordinären wie im erhabenen Wort, vielleicht in der Lage, das Bild der urbanen Welt, des Hier und Jetzt des Stadtlebens zu zeigen.
Durch einen stetigen, sieben Kopf starken Strom von Raubtieren kann ich mein Spiegelbild in einem Fenster sehen. Eine Andeutung meines roten Hemdes blitzt zurück durch das im Schatten liegende Glas. Die Straßen bewegen sich wie Stromschnellen, schäumen auf über lärmenden Kreuzungen.
Mein Becher Wasser hinterlässt in meinem Mund den Geschmack nach alter Rohrleitung. Schwarzer Dunst vorbeifahrender Lastwagen wirbelt im Kielwasser von Passanten auf. Mein Fahrrad lehnt an dem Zeitungsautomaten. Hier, auf der Straße, unter den Kurieren, ist es eine hervorragende und angesehene Maschine. Für den Rest der Welt, für die Massen, die mit mir durch diese Gräben trotten, scheint es ein Spielzeug zu sein, ein schlechter Ersatz für einen Ford Expedition oder einen Camry, diese großen und kleinen Panzer des Interstate Highway System – des größten staatlichen Bauvorhabens, das die Welt je gesehen hat.
Was diese Menschen nicht wissen, ist, dass das Fahrrad mehr ist als nur ein Sport und mehr als nur ein Job. Das Fahrrad ist eine Revolution, ein Angriff auf ziviles Gebiet, fest entschlossen, von Grund auf Verantwortung zu übernehmen für die Gestalt unserer Städte. Es ist eine Meuterei, die ewige Einbahnstraße herauszufordern. Das Fahrrad ist eine Philosophie, eine Lebensart, und ich benutze es wie einen Hammer, um die Welt zu verändern und unsere vom Krieg zerrissenen Städte zu erlösen.
Mit dieser einfachen Geschichte aus dem Blickwinkel der Menschen, die in ihr vorkommen, fordere ich Sie auf, zu bedenken, dass wir vor dem Hintergrund der Überproduktion an Massenmedien vielleicht ein paar Aspekte dieses »USA today«, dieses heutigen Amerikas, vergessen haben könnten. Vielleicht haben wir die Kultur der Muskelkraft übersehen, die öffentliche Räume zurückverlangt und sie den Durchschnittsmenschen zurückgibt.
Wo bin ich? Ich stehe an der Ecke Washington und Clark, direkt vor Chicagos Daley Plaza, und ich bin nicht allein.
1
Tagesanbruch
6:48 a. m.
Mensch und Maschine verschmelzen zu einer Einheit, wenn ich auf ein Fahrrad wie dieses steige. Indem ich mein ganzes Gewicht dem rechten Pedal eines einfachen Flaschenzugsystems anvertraue, überwinde ich den Widerstand von zwei schmalen Reifen, die durch einen Aluminiumrahmen und eine Stahlkette miteinander verbunden sind. Eine kleine Scheibe auf der Achse des Hinterrads, das langsam der Kraft meines Gewichts nachgibt, hält die Kette straff. Wenn ich mich nach vorne beuge, zieht mein Körpergewicht das Ritzel um die Hinterachse und bewegt sie einen Zoll. Die Räder, gehalten von einer Matrix aus Metallspeichen, die wiederum an einer Nabe befestigt sind, werden von dem Ritzel auf einem Kugellager gedreht. Achtzehn Zoll Radgummi kriechen vorwärts.
Mein Gewicht verlagert sich von einem Pedal zum anderen und kehrt dabei die seitliche Neigung des Rahmens immer wieder um. Wie bei einer gezupften Gitarrensaite verringert sich die Amplitude des Rades nach und nach. Die Seitwärtsbewegung wird durch Geschwindigkeit ersetzt. Zehn Meter. Ein Block. Einen Kilometer. Dieser Prozess wiederholt sich endlos. Zug und Druck meiner Beine ziehen die Kette um eine Scheibe, das so genannte Kettenblatt, welches mit einem System von Kurbelarmen und Pedalen verbunden ist. Die einzelnen Teile funktionieren wie ein Organismus, absorbieren den Asphalt und den kalten Wind, während sie die Rotation der Räder stetig kraftvoller werden lassen und so Triebkraft aufbauen. Mein Rumpf, gehalten von Armen, die eine Lenkstange umklammern, und Zehen, die mit Pedalen verbunden sind, zieht den Sattel kraftvoll von Seite zu Seite. Das Fahrrad und ich schießen von Norden kommend in den Loop, das Herz der City, während im Osten der Lake Michigan wogt und in Chicago ein neuer Tag beginnt.
Als ich von der Michigan Avenue Bridge zur Madison Street hinunterrase, verschmelzen die dunklen Konturen der vom Bauhaus beeinflussten Architektur mit den kalten Steinfassaden ihrer Nachbarn im neogotischen Stil. Im Freilauf rolle ich weiter und biege in einer weit gefahrenen Rechtskurve nach Westen auf eine leere dreispurige Straße quer durch den Loop ab. Diese erste Zustellung des Tages verscheucht meine morgendliche Trägheit, pumpt Wärme durch meine Adern und treibt mir den ersten Schweiß auf die Stirn. Die Luft ist sauber, mein Kopf ist klar. Ich suche nach einer Abbiegemöglichkeit links auf die Wells Street.
An diesem Morgen mache ich meine Zustellungen im gelben Schein der Straßenlaternen, noch bevor die Computer hochfahren, die Banken aufmachen und die Börsenticker anspringen. Die Fahrstühle sind noch leer, und die Ampeln regeln einen nicht vorhandenen Verkehr an Kreuzungen, die schon bald verstopft sein werden. Die meisten Auslieferungen führen mich zu um diese Uhrzeit noch geschlossenen Büros, wo ich die Umschläge unter dunklen Glastüren durchschiebe. Ich bewege mich so schnell und effizient wie möglich, vergeude keine Energie. Ein Arbeitstag als Fahrradkurier ist wie eine harte Droge: Du weißt nie, wie dick es kommt, bis du deinen Rausch überstanden hast.
Während ich ungehindert durch die Schatten des Morgens gleite, scheint die Welt in perfektem Frieden. Die ganze Stadt ist ruhig und entspannt. Selbst Gebäude bekommen ihren Schönheitsschlaf. Ich verlasse durch die Drehtür das Morton Salt Building und laufe hüpfend die kalten Stufen zum Grinch hinunter, meinem gelben Tourenrad von Cannondale, das ans Brückengeländer oberhalb des Flussufers gekettet ist. Während sich im Morgengrauen der Himmel verfärbt, schiebt sich hinter meiner linken Schulter ein steter Menschenstrom durch die Drehtüren. Sie haben die Augen noch nicht ganz auf und wirken ruhig; sie lächeln leise vor sich hin wie Babys, die noch warm und kuschelig im Bettchen liegen.
Ich genieße diese stille Zeit, wenn der Rhythmus der Stadt noch langsam ist. Ich kann mich in diese frühmorgendliche Bescheidenheit einfühlen, und ich empfinde diese nachdenkliche Ehrfurcht, die ich auch in der frommen Haltung der gehenden Menschen erkenne. Dieser Respekt wird bröckeln, sobald die Farben des Himmels zu Blau umschlagen und die Stadt erwacht. Schon bald werden dieselben ruhigen Gesichter um eine freie Minute, eine Telefonnummer, die positive Reaktion eines Vorgesetzten oder Kunden kämpfen. Anständige Menschen, die einer ehrlichen Arbeit nachgehen, werden zu Brüllduellen getrieben, zu gegenseitigen Beleidigungen gezwungen und werden kurz davor stehen, einfach alles hinzuschmeißen und zu kündigen.
Ich begleite sie auf jedem Schritt dieses Wegs. Ich habe die geröteten Gesichter und die misstrauischen Blicke gesehen, wenn sich in überfüllten und dennoch stillen Fahrstühlen Schultern berühren. Ich habe das maskenhafte Lächeln gesehen, das sie bei anstrengenden Konferenzen über Bilanzsalden vor sich hertragen. Und doch kenne ich keine einzige dieser rastlosen Seelen. Nur mit sehr wenigen von ihnen wechsle ich je ein Wort; irgendwie gehören sie einer anderen Spezies an. Ihre Maschinerie und ihre Mythologie bewegen sich ausschließlich in eine Richtung. Dicht gedrängt stehen sie in engen Räumen, schauen zu den Messingleisten der Fahrstühle auf und erheben sich, als wären sie Geister, die zu einem goldenen Leben nach dem Tode auffahren. Sind sie auf eine bestimmte Etage aus? Auf einen Titel hinter ihrem Namen? Eine bestimmte Zahlenfolge auf ihrer Gehaltsabrechnung? Vielleicht wollen sie nur ein wenig Sicherheit? Ich weiß es nicht. Aber sie gehen einen bestimmten Weg, und sie werden alles tun, um auf diesem Weg zu bleiben.
Ich sehe sie jeden Tag, anständige Menschen, die sich anbrüllen, aneinander vorbeihasten und über andere hinwegschreiten. Ich sehe sie, wenn sie am schlimmsten sind: im öffentlichen Raum, auf der Straße, wo niemand hinsieht und sich kein Mensch kümmert.
Ich habe keine Zeit, mich in diesem Jammertal fangen zu lassen. Genau wie meine Augen es müde geworden sind, an einem einzigen Tag über eine Million Menschen zu schweifen, so ist mein Herz es überdrüssig, sich für sie zu interessieren. Meine Beziehung zu diesen Stadtmenschen hat sich darauf reduziert, mit ihnen das Schweigen in den Fahrstühlen zu ertragen oder die Rituale des Abholens oder Zustellens von Sendungen durchzuspielen und mich durch einen Verkehr zu kämpfen, in dem »Bitte« und »Danke« im zermürbenden Sturmangriff wütend hupender Autos und unnötiger Schmähungen untergehen. Ich habe festgestellt, dass diese anständigen Menschen so sehr in ihren privaten Kämpfen gefangen sind, dass sie zu einer Unterhaltung oder einem freundlichen Wort oft gar nicht mehr in der Lage sind. Sie konzentrieren sich, tragen die Last ihrer selbst gemachten Welten und versuchen, sichereren Boden unter die Füße zu bekommen.
Während diese Massen über die von ihnen getroffenen Entscheidungen und die übernommenen Verpflichtungen stöhnen, treibe ich über ihnen. Ich bin frei von ihren Vorstellungen von Gut und Böse, Reich und Arm, Richtig und Falsch. Als arbeitender Mensch mit einem eher ungewöhnlichen Beruf zähle ich in ihren Augen vielleicht nicht viel, dafür aber bin ich frei von ihren Werturteilen. Bisweilen hält man mich für einen Außenseiter, einen Schmarotzer und Junkie, doch gleichzeitig werde ich beneidet um die Atmosphäre, die Energie, die Vision Amerikas, die ich noch habe, während sie sich in ihrer werktäglichen Tretmühle abplacken.
Ich liebe meine Arbeit und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich bewundere die anmaßende Geschichte dieser alten Gebäude, dieser Monumente der freien Marktwirtschaft, und auch die Prachtstraßen, an denen sie errichtet wurden. Sie erzählen Heldengeschichten der Vorfahren dieser Stadt, deuten Verhaltensregeln an, die nur für manche gelten und nicht für alle. Straßennamen ehren die Eliten wie eine tief verwurzelte Propaganda. Chicago bleibt eine umstrittene Stadt, in der große Politik auf lokalem Niveau ausgespielt wird, wo Gesetzgeber ihr Handwerk von Unterweltbossen lernen, wo Tugend und Leiden das Elend der Armen sind. Ich höre immer noch aus ihrer langen Geschichte die Aufschreie sozialer Unruhen durch diese ruhigen Straßen hallen, die solch historische Augenblicke widerspiegeln wie beispielsweise die 68er-Krawalle, die drückende Last des Schwarzen Freitags und den Schock nach dem Großbrand von 1871.
Auf den öffentlichen Plätzen findet immer irgendeine hitzige Diskussion statt. Demonstranten marschieren auf den Straßen und stimmen ihre Sprechchöre vor Regierungsgebäuden an. Passanten tragen Plakate mit politischen Slogans. Sie wollen weder Geld, noch kandidieren sie für irgendein Amt; sie glauben einfach nur an etwas, und das teilen sie mit. Ich halte mich gern in dieser Arena auf, irgendwo in der Nähe des dicksten Getümmels. Ausgerüstet mit einem Funkgerät, zwei Rädern und einem Team zuverlässiger Kuriere, die sich ihre Brötchen verdienen wollen, gelingt mir dies jeden Morgen aufs Neue.
Wir wecken die Stadt zusammen mit Lastwagen und der ruhigen Flut der sich aus Pendlerzügen ergießenden Fußgänger. Wenn die Zeitungsbündel geöffnet und in Verkaufsstände an den Bordsteinkanten gepackt werden, lesen wir auf der ersten Seite der Tribune von der jüngsten Gräueltat. Wir fahren auf vertrauten Pfaden um die Füße und Handflächen der Stadt, sehen auf ihrem vernarbten Rücken die Spuren des Missbrauchs der vergangenen Nacht. Wir rufen ihre Wahrzeichen aus, wie wir es müssen, und fügen über Funk die Spitznamen hinzu, die wir erfunden haben.
»Neununddreißig an Zentrale.«
»Neununddreißig kommen.«
»Bin jetzt mit einem Sack Lumpen raus aus der Lockbox.«
»Fahr die Peat runter, und melde dich wieder, wenn du die Foote erreicht hast, Neununddreißig.«
»Okay, Chef.«
»Und wo steckt mein Punk?«
»Dreiunddreißig an Zentrale?«
»He, Punk, lass den Kaffee stehen, und melde dich, wenn du in der Litter Box bist. Der Katz hat eine Oil Can mit deinem Namen drauf.«
»Aber ich trinke gar keinen Kaffee – es ist ein mocaccino.«
»Du bist unterwegs zum Kat, du Ratte, und, Punk, gib Gummi.«
Dieses Geplänkel gehört zu den erfreulichen Seiten des Jobs. Jede Kurierfirma entwickelt ihre eigene Straßensprache. So reden wir alle – tagsüber, nach der Arbeit, zu Hause –, wodurch sich selbst der unerfahrene Kurier zugehörig fühlt. Er ist Teil einer größeren Gruppe. Auch wenn wir vielleicht recht schroff miteinander umgehen, begegnen wir uns normalerweise mit großem Respekt.
Jenseits von Alter, Geschlecht, Hautfarbe und all diesem Uneinigkeit schaffenden soziopolitischen Bockmist wird die Kurierbranche von Leuten getragen, die weitgehend auf einer Wellenlänge liegen. Viele von uns sind Künstler und Musiker im Alter zwischen zwanzig und dreißig. Die meisten von uns waren lange genug pleite, um Überlebenskünstler zu werden, und haben genügend großartigen Träumen nachgehangen, um einen Bogen um die Zwänge eines Angestelltenlebens mit festem Gehalt zu schlagen. Ich bin in diese Stadt gekommen, um beim Theater Karriere zu machen. Als Kurier halte ich mich über Wasser. Bewegung gegen Bares und Geld für Meilen – das sind die Mantras vieler sich abstrampelnder Genies. Wir arbeiten für materielle Dinge, und wir posaunen unsere Armut hinaus für die Freiheiten, die sie uns gibt. Beinahe jede Woche begegne ich einem anderen ehrgeizigen Biker, der Handzettel für seine nächste große Show, seine nächste Ausstellung oder seinen nächsten Club-Gig dabeihat.
Abgesehen von diesen oberflächlichen Ähnlichkeiten besteht eine tiefes, stillschweigendes Einverständnis zwischen Kurieren. Wenn einer am Boden liegt, übernehmen andere seine Last. Wenn einer verletzt ist, sind andere da, um zu helfen. An manchen Tagen kann die Arbeitslast so groß sein, dass Biker dehydrieren, in Panik geraten, am Ende orientierungslos und beinahe unansprechbar sind oder Funkmitteilungen durcheinander bringen. Wir müssen aufeinander aufpassen, uns umeinander kümmern. Biker werden verletzt, und wenns dazu kommt, haben wir oft genug nur uns selbst.
Heute quatschen wir über Funk über das Geschlecht von Tauben, beobachten, wie die Welt langsam an uns vorüberzieht, und warten, dass wir über den Äther neue Abholaufträge erhalten.
8:43 a. m.
In meiner Anfangszeit, als mich dieser rechteckige Horizont noch faszinierte und zugleich entmutigte, erschien mir diese Arbeit wie eine sadistische Strafe. Ich war unbeholfen, höchst unfallgefährdet und völlig ineffizient. Die Stadt war für mich einfach nur riesig und komplex. Ich wusste nicht, ob ich hier draußen länger als eine Woche durchhalten würde. Aber ich machte weiter. Ich machte weiter, weil ich musste, und brachte jeden einzelnen Tag mit einer makabren Resignation hinter mich. Bald lernte ich meine ersten Lektionen über die Stadt in Form von Tricks und Abkürzungen. Mit ihrer Hilfe konnte ich mich leichter zurechtfinden und meine Manöver planen. Mit der Zeit wurden diese Lektionen vertieft. Schließlich nahmen sie die Gestalt philosophischer Erkenntnisse an, die mir halfen, mich auf die Arbeit einzustellen. Es ist schon wahr: Die Sichtweise, die man von den Dingen hat, bestimmt, wie man mit ihnen lebt.
Die erste große Lektion erhielt ich bereits nach einer Woche im Job. Ich war völlig ausgepowert nach den Meilen auf dem Rad. Psychisch war ich erschöpft durch die Anstrengung, jeden einzelnen Augenblick hellwach sein zu müssen, die gigantische Reizflut zu bündeln, die Straßen kennen zu lernen, die täglichen Pendeltouren und natürlich das Gequatsche. Dann wurde ich eines Morgens in die Zentrale gerufen, wo ich verschiedene Lieferungen abholen sollte, die am Abend zuvor nicht mehr zugestellt worden waren.
Ich bog zu Service First ein. Die Gasse war mit illegal abgestellten Autos von Fahrern zugeparkt, die sich um übergroße Sendungen und Fuhren in die Vororte kümmerten. Das Büro war ein umgebautes Gartenapartment, dessen ständig offener Hintereingang in eine Küche ohne Schränke und Spüle führte. Das Mobiliar bestand aus ein paar Tischen und Stühlen, auf denen Belege und Quittungen herumlagen. In einer Ecke stand ein alter Kühlschrank, darauf Wasserflaschen und halb leere Bierdosen. Karrenschmiereflecken und Ersatzteile von Fahrrädern hatten schon vor langer Zeit den letzten Rest von Wohnlichkeit beseitigt. Aus Schlafzimmern waren Büros geworden, Kleiderschränke wurden zu Aktenschränken umfunktioniert, und die weißen Wände waren durch die nachmittäglichen Kettenraucher-Sitzungen des gestressten Personals hellbraun verfärbt.
Als ich ankam, sprachen die Leute vom Funk durch eine Plexiglasscheibe zu mir, die in die Rigipswand der beengten Funkzentrale eingesetzt war. Chris Coster alias Zero reichte mir mehrere große Umschläge. Ich hatte mich gerade gesetzt, um sie in meine Schultertasche zu packen, als Pat, Nummer vierunddreißig, mit dem Rad in der Hand durch den Hintereingang hereintorkelte.
Pats Dreadlocks sahen aus wie kurze Zweige, die in alle Richtungen abstanden. Er war muskulös und durchtrainiert; Tätowierungen schimmerten unter seiner schwarzen Haut. Er war eine Mischung aus Voodoopriester und Wicker-Park-Punk. »Scheiße, meine Fresse«, spuckte er aus. Schwitzend und erregt kramte er in seiner Plastikkiste nach einem T-Shirt, das noch nicht zu sehr stank, und nach einem neuen Helm. In abgehackten Sätzen berichtete er durch das Schiebefenster, dass er gerade in irgendeine Scheiße mit einem Taxifahrer geraten war.
Anscheinend hatte Pat von der linken Fahrspur nach rechts abbiegen wollen, als ein Taxi beschleunigte und ihm den Weg versperrte. Pat trat in die Pedale und signalisierte dem Taxi, dass er sich davor setzen wollte, um auf die Grand Avenue abzubiegen. Als er glaubte, auf der sicheren Seite zu sein, beschleunigte das Taxi wieder und holte Pat um ein Haar von seinem Rad. Im letzten Augenblick riss Pat den Lenker herum und brachte sein Bike unter Kontrolle. Inzwischen hatte das Taxi ihn überholt und fuhr ein Stück vor ihm. Pat trat in die Pedale. (Ich weiß, wie er fährt. Der Typ ist flink wie ein Berglöwe.) Er zerrte sein Bügelschloss aus der Tasche, zog auf der Fahrerseite von hinten auf und zerschlug nur Zentimeter vom Kopf des Fahrers entfernt die Seitenscheibe. Der Typ latschte voll auf die Bremse, und Pat war auf und davon. Mit einem andersfarbigen Helm und Shirt war er jetzt bereit, sich ohne Angst vor einer möglichen Racheaktion erneut in den Frühmorgenverkehr zu stürzen.
Ich war sprachlos. Ich sah keinen Sinn darin, mit Gewalt auf einen anderen Menschen zu reagieren. Was brachte es Pat, wenn er die Scheibe selbst des widerlichsten Autofahrers einschlug? Wie sollte sich dadurch das Verhalten des betreffenden Fahrers ändern, selbst wenn er falsch oder unverschämt oder nötigend gehandelt hatte? Abgesehen davon war ich baff, dass er Chris und Dave Goldberg von der Sache erzählte. Immerhin arbeitete er für diese Typen. Vielleicht ist es absolut okay, dachte ich. Mein Gott, vielleicht ist es sogar normal!
»Mit dir ist aber alles klar?«, wollte Zero von Pat wissen. Er interessierte sich ausschließlich für die Fakten.
»Alles bestens – bin nur noch ein bisschen von der Rolle«, erwiderte Pat lässig.
»Kein Scheiß!«
Goldberg kam ans Fenster und fragte, ob der Taxifahrer den Firmennamen gesehen hätte.
»Nee, ich glaube, der war mit anderen Sachen beschäftigt.«
»Erste Sahne, Mann!« Chris lachte prustend.
»Mach ’n paar Minuten Pause. Komm erst mal wieder runter.«
»Nee, Mann. Bin jetzt wieder voll da. Ich melde mich in zehn Minuten aus der Can.«
»10-4. Gib Gummi, Mädchen«, rief Chris noch, als Pat schon aus der Hintertür war.
Nachdem Pat fort war, unterhielten sich die beiden Typen vom Funk weiter.
»Du solltest ihn nicht noch anstacheln«, meinte Goldberg.
»Hör zu«, verteidigte sich Chris, »wenns um den Biker auf der Straße geht, interessiert mich Richtig oder Falsch nicht. Ich brauche lebendige und selbstbewusste Biker.«
»Den Spruch kenne ich.«
»10-4, Dave. Ich will einfach nur keinen Stress, sollte mal jemand verletzt werden. Von der Scheiße hatte ich schon mehr als genug.«
An diesem Punkt endete das Gespräch, womit die Sache für mich ungeklärt blieb. Es ging mir den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Wenn ich später Pat über Funk hörte, schwang in seiner Stimme eine unterschwellige Wut mit, als wollte er sagen: »Ihr könnt mir für diese Scheiße gar nicht genug zahlen.« Er fühlte sich angeschissen. Nummer vierunddreißig fühlte sich mies behandelt, wo er meiner Meinung nach eigentlich hätte gefeuert werden müssen.
Andererseits hatte ich mich noch nie in seiner Lage befunden. Bislang war ich noch nicht auf die Probe gestellt worden, und ich hatte auch noch nicht am eigenen Leib erfahren, wie viel ich von mir selbst investieren musste, um auf diesen verstopften Straßen zu überleben. Ich hatte diese extreme Welt noch nicht mit all ihren Facetten erlebt. Mit der Zeit sollte ich lernen, dass Chris’ Verteidigung gerechtfertigt war. Als Biker stand ich allein gegen den Verkehr, die Menschen, die Elemente, die unhandlichen Umschläge und Päckchen und die Polizei, die Biker schon wegen der kleinsten Verstöße einlochte. Die Firma hat überhaupt nichts zu tun mit meinem Überleben oder Erfolg.
Der Fahrradkurier ist so was wie ein einsamer Reiter; der Himmel allein weiß, was er vor diesem Job gemacht hat, und bisweilen setzt er sich absolut extremen Situationen aus. Jeden Tag bezwingt er eine Flut von Hindernissen und vollbringt wahre Wunder, um bei etwas zu gewinnen, das im Grunde bloß ein kleines Spiel gegen die Zeit ist. Kurierfirmen werden einem Biker den Rücken stärken, der jedes Hindernis überwinden kann, der wie Pat fast so was wie ein Zauberer ist. Ein Biker wie er ist kaum zu ersetzen.
Falls die Firma versucht, einen Kurier zu bestrafen, können zwei Dinge passieren. Ein unerfahrener Biker wird versuchen, besser zu werden. Das bedeutet, er wird entweder schneller fahren oder aber versuchen, Fehler zu vertuschen – wobei er nicht selten seine innere Ruhe verliert, seinen Stil auf der Straße. Früher oder später wird er dann Scheiße bauen und sich verletzen. Wenn sich der Biker jedoch nicht disziplinieren lässt, wenn er genug Selbstvertrauen besitzt, dann wird er einfach zu einer anderen Firma gehen, um dort zu zaubern.
Einfach ausgedrückt basiert die Beziehung zwischen dem Biker und seiner Firma auf einem beiderseitigen Vorteil. Es gibt keinen Arsch, in den es zu kriechen gilt, und keinen Vertrag, der zu unterschreiben ist. Letzten Endes läuft alles auf die brutal einfache Prämisse hinaus: Ungeachtet der Distanz, der Wetterlage, der Tageszeit oder der Begleitumstände – wenn die Sendung pünktlich ausgeliefert wird, bleibt die Übereinkunft zwischen Kurier und Firma bestehen. Dies zu erreichen kann allerdings tödlich sein. Am Ende ist nämlich der Biker immer auf sich allein gestellt, er steht, wo es keine Schatten gibt, wo kein Mensch ihm hilft und wo er sich hinter nichts und niemandem verstecken kann. Auf der Straße muss der Fahrradkurier ganz allein und persönlich die volle Verantwortung übernehmen. Das ist die erste Lektion.
10:02 a. m.
Ich sitze da und verfolge den rauschenden Strom der Autos und Busse. Der Himmel kräuselt sich in den aufsteigenden Abgasen. Ich spüre das Verstreichen der Sekunden, während meine Gedanken alles protokollieren. Wann immer ich für einen Augenblick Luft schnappen kann, meditiere ich über die Welt, die Straße, den Tag, den psychischen Stress der Moderne und der Urbanität. Ich vergewissere mich, dass mein Stift an der richtigen Stelle steckt und dass ich immer einen Ersatz habe. Ich strecke die Beine, um die Knie locker zu halten. Ich denke über die anderen Biker nach, deren Stimmen ich über Funk höre, und darüber, was mir die nächsten zehn Sekunden bringen werden. Ich denke darüber nach, wie ich meinen Job schneller und mit weniger Kraftaufwand erledigen kann. Ich mache Prognosen.
In zwanzig Minuten werden sich die Straßen leeren. Taxifahrer werden auf der Suche nach Fuhren kreisen oder in langen Schlangen vor Hotels warten, sie werden Fahrertüren einen Spaltbreit öffnen, sich hinauslehnen und auf die Straße spucken. In Büros werden zunehmend Privatgespräche geführt und Verabredungen zum Mittagessen getroffen. Ich werde einige täglich anfallende Aufträge erledigen, wofür ich ungefähr eine Stunde brauche.
Die Stadt, die mir früher so chaotisch und wild vorkam, erscheint jetzt wie ein perfekt choreografierter Gesellschaftstanz. Ich habe gelernt, eine bestimmte Ordnung und Struktur in der Stadt zu erkennen, eine spezielle Geometrie, ein Reich der Notwendigkeit hinter jedem ungeplanten Sprung und Schlingern. Der Loop hat seine eigenen Naturgesetze, mit denen der Biker klarkommen muss. Es gibt viele schöne Axiome wie: Cops nördlich des Flusses sind viel zu korrupt, um beinhart das Gesetz durchzusetzen, und Fahrräder sind im Verkehr unsichtbar – überhole stets links. Diese Lektionen lernt man mit zunehmender Erfahrung und durch einen Schuss gesunden Menschenverstand, aber nicht alle dieser Gesetze gehen so leicht in Fleisch und Blut über.
Eine der schwierigsten Lektionen, die ich lernen musste, lautet, dass die Stadt auf die emotionale, die philosophische – die subjektive Empfänglichkeit des Kuriers reagiert. Wie in einem Traum oder einer Halluzination spiegelt die Stadt den Kurier, und je nachdem, wie gut er mit sich selbst klarkommt, legt sie fest, wie lange er im Job durchhält.
Pat, Nummer vierunddreißig, ist ein Beispiel. Wenn man mit Wut im Bauch arbeitet, machen einen schon die geringsten Hindernisse fix und fertig. Aggressive Autofahrer und schlendernde Fußgänger werden zur persönlichen Nemesis. Am Ende hat Pat den Job geschmissen, nachdem er mit einem anderen Taxifahrer in die Haare geriet. Jeder von uns weiß, dass Taxis ein wunderbarer Vorwand sind, um aus der Haut zu fahren, aber Pat hat dieses Klischee einfach ein paar Drehungen überzogen.
Wenn man jedoch dieses Gesetz des Widerspiegelns versteht, kann man bestimmte Traumen vermeiden, bevor sie passieren. Das beste Beispiel dafür fand ich in Matt, Nummer 6145, dem schlaksigen buddhistischen Kurier von Cannonball Courier. Er hat vor ein paar Jahren das Radfahren aufgegeben, weil er, wie er sich ausdrückte, die Zeichen der Zeit erkannte. Er war zu lange dort draußen gewesen, und ich glaube, er fühlte sich langsam von der Stadt verfolgt, als würde er von einer Art Geist beobachtet. Er stieg vom Rad, um nicht verletzt zu werden. »Ich habs erlebt.« Er lächelte traurig. »Ich wollte nicht enden wie mein Bruder.«
Matts Bruder Max war ebenfalls Fahrradkurier gewesen, einer der besten. Nachdem er neun Jahre als Biker Nummer 221 bei Advanced Messenger Service gearbeitet hatte, brauchte er einen Tempowechsel. Er versuchte, seine letzten paar Monate abzureißen, bevor er in einen vorhersehbareren Beruf wechselte. Eines Nachmittags scherte er auf die Gegenfahrbahn aus, um an einem Lieferwagen vorbeizukommen, der an einer Kreuzung halten musste. Eigentlich ein Standardmanöver bei dichtem Verkehr. Doch als Max gerade hinter dem Lieferwagen ausscherte, trat ein Typ von einem Parkservice in einem roten Sportwagen aufs Gas, schoss über genau diese Kreuzung und tauchte völlig unerwartet in seinem Weg auf. Max wurde vom Fahrrad gerissen und durch die Luft geschleudert. Als er wieder zu Bewusstsein kam, lag er stark blutend auf einer Bahre. Nach der folgenden Operation hatte er fünf Nägel und eine Metallplatte im rechten Knie. Man sagte Max, er würde nie wieder Fahrrad fahren können, da das rekonstruierte Gelenk und der Knochen der Belastung nicht mehr gewachsen seien. Statt zu kündigen, nahm er drei Jahre unbezahlten Genesungsurlaub.
Der große Unterschied zwischen Matt und Max ist, dass der eine mehr Wert auf seine Intuition legte als auf seinen Lebensunterhalt. Matt erkannte, dass er Schwierigkeiten förmlich herausforderte. Bevor er in diese Schwierigkeiten geriet, kündigte er und machte sich den Kopf wieder frei.
Manchmal ist es verdammt schwer, hier draußen eine positive Einstellung zu behalten. Die Arbeitslast kann absolut erdrückend sein. Unvorhersehbare Probleme können sich ergeben mit ernsten Verletzungen, extremer Erschöpfung oder tiefer Frustration als Folge. Wenn allerdings ein Biker trotz falscher Adressen, unhöflicher Empfänger, platter Reifen, leerer Akkus im Funkgerät, wild gewordener Cops, hitzköpfiger Sicherheitsdienstleute und verletzter Freunde eine gute Einstellung behalten kann, dann kann er für seine Firma unersetzlich werden.
Im Hochsommer 98 fehlte es Service First an Bikern. Wir waren zu fünft und erledigten die Arbeit von mindestens neun Leuten. Aber als sich herumsprach, dass wir Leute einstellten, tauchten wie immer erfahrene Biker auf, die mit ihren Firmen unzufrieden waren.
Eines Morgens sagte man uns, dass irgendwann an diesem Tag ein Neuer anfangen würde. Diese Nachricht kam als große Erleichterung, da wir bereits seit Wochen überarbeitet und völlig ausgepowert waren. Wir blieben an diesem Tag bei unserem fiebrigen Tempo und warteten auf Hilfe, um das Arbeitspensum etwas besser zu verteilen. Am Nachmittag deckte uns die Zentrale immer noch wie Maschinengewehrsalven mit neuen Aufträgen ein. Ich hatte längst aufgehört mitzuzählen, wie viele Umschläge ich in meine Tasche geschoben hatte, und hatte keinen Schimmer, wohin sie zugestellt werden sollten. Die Typen im Büro hatten ebenfalls den Überblick verloren. Das zwang uns, ganz pragmatisch Umschläge mit Kollegen zu tauschen, ohne die Zentrale mit den Details zu belästigen. Wir waren alle frustriert und wollten dieses demoralisierende Chaos einfach nur noch halbwegs in den Griff bekommen. Dann kam was über Funk rein, was ich noch nie zuvor gehört hatte.
»Thuribidabidop?«
»10-9?«
»Thirdybopdaclean, daCock 10-4? 10-4?«
»Nummer fünfunddreißig? Bist du mit dem Hancock fertig?«
»Yubeyu gotcha!«
»Verstanden, 10-4, verschone mich mit dem R2-D2-Kauderwelsch, und hol ein Looking Glass bei DDB ab.«
»Tebelepde-gotcha, gotcha-boo.«
»Ich fasse das als 10-4 auf, Fünfunddreißig. Melde dich, sobald die Sache läuft.«
»T-four! Bgout! Whahoooo!«
Nummer achtunddreißig, Otis, meldete sich über Funk: »Was zum Teufel war das denn?« Die Zentrale stellte uns allen den neuen Typen vor, Todd, Nummer fünfunddreißig, der im Verlauf der nächsten paar Wochen meine Theorie über das bestätigte, was mit einer positiven Einstellung passieren kann.
Er sah aus wie ein Fleisch gewordenes Mitglied der Jetson-Familie, war ein stattlicher Mann mit trickfilmhaft gutem Aussehen und rannte wie die Karikatur eines Büroangestellten herum. Ich erinnere mich gut an seine bis zu den Knien hochgekrempelte Anzughose und an die schmale Krawatte. Wenn er nicht seinen Helm trug, fuhr er mit einem Hut à la Frank Sinatra und einer Arbeitsschutzbrille. Er ernährte sich von Snickers und Coke und schwor auf diese Kombination, als wäre Zucker ein Synonym für Leben (und vielleicht war da sogar was dran). Nummer fünfunddreißig umgab ein irrsinniges Tempo und eine konstante Ironie. Wie der Joker in der alten Batman-Serie schaffte er es, über absolut alles und jedes zu gackern. Wenn er den Funk benutzte, dann redete er in Zungen, was bedeutete, dass er sich nie identifizieren musste, weil außer ihm kein Mensch so quatschte. Er spielte in Springbrunnen, er heulte bei Tagesanbruch den Mond an, und er stürzte sich auf jede Arbeit. Todd war eifrig und kontaktfreudig, aber ein Anfänger war er nicht. Bei anderen Firmen hatte er als Kurier schon das Schlimmste mitgemacht, den Schneematsch und überfrierenden Regen, aufplatzende Haut und permanente Dunkelheit, aber er hatte eine Lebenseinstellung entwickelt, die den Job für ihn zu einem einzigen großen Spaß machte. Sein Irrsinn verwandelte noch den höllischsten Tag in etwas, worüber man lachen konnte.
»Ich will eine Welt wie diese!«, brüllte Todd über Funk. Irgendwann fand er einen Job bei einer großen Werbeagentur und bastelt nun utopische Visionen für alberne Produkte wie Drano und Tic-Tac. These bestätigt: Das Gesetz des Widerspiegelns der Stadt lässt den Kurier auf genau den Albtraum oder das Geschenk des Himmels treffen, mit dem er auch zur Arbeit kommt. In Todds Fall war dies eine zweidimensionale Manie in der überdrehten Geschwindigkeit eines Trickfilms.
11:21 a. m.
Mit dieser Überlegung walze ich aus dem Leo Burnett Building auf die Randolph hinaus und sehe an einem inzwischen sagenhaften Tag hunderte winziger weißer Partikel durch die Luft segeln. Die leichte Brise weht Seifenschaum von einem Gerüst, das an der Dachkante der Daley Plaza befestigt ist. Es sieht aus wie Schnee, der aus einem perfekten blauen Spätsommerhimmel rieselt. Die Flocken verschwinden im geschäftigen Treiben auf der Clark Street darunter.
In solchen kleinen Dingen finde ich, wonach ich suche: Augenblicke unglaublicher Schönheit, Geschichten des menschlichen Kampfes, große Ideen und religiöse Ekstase. Viele Jobs bieten wunderbare und herausfordernde Erfahrungen, aber nichts kommt auch nur annähernd an dies heran.
Jenseits von all dem Stress, der Erschöpfung und der häufig bizarren Ausdrucksformen der Menschlichkeit, denen ich täglich begegne, schätze ich diese Arbeit wegen dem, was sie mir gezeigt hat und was sie aus mir gemacht hat. Doch diese tiefe Zufriedenheit stellte sich nicht sofort ein. Sie kam erst, als ich begriff, dass ich als Fahrradkurier erfolgreich sein konnte.
Erfolg hängt für einen Biker ganz wesentlich von zwei Faktoren ab: wie gut man einen Rhythmus halten und wie gut man sich beherrschen kann. Die erste Herausforderung besteht darin, den Rhythmus der Stadt zu finden. Das dauert seine Zeit und erfordert Einfühlungsvermögen sowie ein wenig Seele. Die nächste Herausforderung – sich zu beherrschen – verlangt innere Stärke. Wenn man aber erst einmal so weit ist und den Rhythmus der Stadt hören und ihr in die Augen sehen kann, Ordnung im Chaos entdeckt, dann verschwinden schlagartig alle Hindernisse, die einen Amateur verwirren können. Das richtige Timing, wann man essen und trinken muss, wann sich dehnen, wann Hals über Kopf die Michigan Avenue hinunterrasen – das alles wird klar. Verstopfte Straßen erscheinen leer. Kreuzungen und rote Ampeln lassen sich mühelos bewältigen. Die Handgriffe, um das Fahrrad abzuschließen, werden bis zur Perfektion choreografiert und können in drei Sekunden oder noch weniger vollführt werden.
Ich entdeckte dieses Geheimnis nach Monaten harter Arbeit. Ich wurde von meiner Route abberufen, um »einen Hinshaw aus dem Krankenhaus zu ziehen«. Krankenhäuser sind berüchtigt wegen ihrer Unübersichtlichkeit, da sie nicht selten hunderte von Zimmern pro Etage haben. Der Auftrag war eben erst reingekommen, und die Sendung musste bis um zehn Uhr morgens abgeholt sein. Ich warf einen Blick auf die Uhr: 9 Uhr 43 – das bedeutete Ärger. »Tu so, als hättest du nichts anderes zu tun, Neununddreißig, hols ab, stells zu, und gib mir die Empfangsbestätigung durch.« Die Zentrale wusste, dass ich immer noch an einer Knieverletzung laborierte und nach den anstrengenden letzten Wochen ziemlich ausgebrannt war. Ein Teil von mir wollte sagen: »Nee, Mann, mach deinen Scheiß selbst.« Aber ich wusste, dass man mich nur dann von einer Route abziehen würde, wenn ein Job bereits einen Flächenbrand auf dem Schreibtisch auslöste. Für mich als Fahrradfahrer war es ein wichtiger Schritt zu verkünden, dass ich das Unmögliche möglich machen konnte. Ich konnte Wunder vollbringen. Egal, was mir in die Quere kam, ich konnte diese Sache deichseln – ohne dabei meine normale Route zu unterbrechen.
»10-4, Chef. Ich bin dran.«
Ich jagte die Columbus hinunter, kämpfte mich durch das Krankenhaus und sackte den Umschlag ein. Ich schoss aus 680 North Lake Shore Drive und nahm die Erie Richtung Westen. Die Erie brachte mich zur St. Clair, und die St. Clair führte mich zur Grand, von wo ich die Lower Michigan erreichen konnte. Die Lower Michigan führte zum Lower Wacker, der Warp-Zone, wo ein blauer Taurus genau in meinem Tempo unterwegs war. Ich bekam den Radkasten über dem Hinterrad auf der Beifahrerseite zu fassen (im toten Winkel). Normalerweise kriegt es keiner mit, wenn ich so was mache, doch dieses Mal sah ich, wie sich die Fahrerin, eine junge schwarze Frau, nervös über das Lenkrad beugte. Sie hatte gesehen, wie ich mich bei ihr einklinkte. Zuerst trat sie einfach nur aufs Gas, um mich abzuschütteln, aber ihr Wagen hatte nicht genug Beschleunigung. Ich beobachtete sie im Rückspiegel und sah, dass sie Angst hatte und wild entschlossen war, mich loszuwerden. Ich rechnete damit, dass sie auf die Bremse latschte oder ausscherte, aber im richtigen Moment stellten wir im Spiegel Blickkontakt her. Ich nickte ihr ruhig zu und artikulierte mit Lippensprache: »Ist schon okay. Alles okay.« Meine Tachonadel bewegte sich auf siebzig Kilometer pro Stunde zu, und über die linke Schulter sah ich die Ausfahrt näher kommen.
Sorgfältig auf mein Timing achtend, ließ ich den Wagen los und rollte in seinem Fahrtwind weiter. Auf dem Gesicht der Fahrerin war jetzt ein überraschtes Lächeln aufgetaucht. Ich tippte die Hinterradbremse gerade genug an, um ohne wegzurutschen die Kurve nehmen zu können und nicht vom Gegenverkehr erwischt zu werden, und schoss die unterirdische Ausfahrtsrampe hinauf, fuhr um die Straßenecke und schloss das Rad ab. Als ich nach Ablieferung der Sendung aus 221 North Wells herauskam, warf ich wieder einen Blick auf die Uhr. Um 9 Uhr 53 gab ich die Zustellungsbestätigung per Funk an die Zentrale durch. Ich erwartete keinen Applaus von der Zentrale. So läuft das hier draußen nicht. Die Arbeit applaudiert sich selbst; die Arbeit war pünktlich erledigt worden, und ich war immer noch unterwegs. Man nennt es »seinen Job erledigen«, aber das Gefühl dabei erinnert mehr an fliegen – mit dem Unterschied, dass in dieser Welt fliegen irgendwie schon völlig normal ist.
Um 9 Uhr 59 erreichte ich das NBC Building an der City Front Plaza (wir nennen dieses Gebäude »Peacock«), um eine Zehn-Uhr-Abholung zu machen, und lief schnell hinein, um den schwarzen Regenwolken zu entkommen, die sich über der Stadt zusammengezogen hatten. Die Spiegel im Fahrstuhl bestätigten meine Ruhe. Ruhig zu sein bedeutete, dass ich mir keine Gedanken darüber machen musste, wie ich irgendwo hinkam. Ich musste nicht denken. Ich konnte meinem Körper vertrauen; er wusste genau, wie er etwas erreichen konnte, woran mein Verstand nicht mal zu denken wagte.
Bis zum Abend hatte ich einundsechzig Sendungen ausgeliefert, empfindliche Knie oder nicht. Manche der anderen Biker hatten gerade mal vierzig geschafft. Ich stand im Regen und erinnerte mich an die Dinge, die ich erlebt hatte.
Zwei Taxen hatten versucht, mich von der LaSalle abzudrängen. Für die Steigung der Fairbanks hatte ich mich an einen Abschleppwagen gehängt. Bis Mittag hatte ich bereits zweiunddreißig Sendungen zugestellt. Eine Frau war von einem schwarzen Mazda angefahren worden, der auf einer regennassen Kreuzung ins Schleudern gekommen war. Als ich vorbeirollte, lag die junge Frau noch auf dem Boden. Überall und ständig war ich gerutscht; meine Reifen schienen überhaupt keine Haftung zu haben. Ich hatte eine sehr wichtige Sendung bei einem Richter abgeliefert; er hatte die Tür hinter mir geschlossen, bevor er mir den Lieferschein abzeichnete. Ich hatte eine Abkürzung über die Abwärtsrampe des Apparel-Center-Parkplatzes genommen, als plötzlich ein BMW vor mir aufgetaucht war. Ich musste voll in die Eisen steigen, war wie ein mit einer Zwille abgeschossener Stein durch die Luft geflogen und knapp einen Meter vor dem Wagen gelandet (Gott sei Dank gibts Helme). In 200 Madison hätte ich mich um ein Haar mit einem Sicherheitsdienstmann geprügelt, blieb aber cool. Ich war einem Typen über die Zehen gefahren, als er versuchte, durch den dichten Verkehr auf der State Street zu flitzen. Ich blieb bei meinem Tempo. Wann immer es eng wurde, sagte ich mir: Mach Bestandsaufnahme und fahr weiter. Immer im Rhythmus bleiben.
Schon bald hatte ich das Gefühl zu schweben, gelassen auf die Stadt hinunterzuschauen und mir selbst meinen Weg durch all die unübersichtlichen Winkel und kniffligen Gebäude zu zeigen. Sogar bei sintflutartigem Regen und schlüpfrigen Bremsen erschienen aus dieser gottgleichen Warte all meine Bewegungen mühelos und geschmeidig. Ich genoss das sich ständig verlagernde, kreisende Gewicht meines Körpers, das Fahrrad und die Straße als einen einzigen Organismus. Ich war in der Zone. Noch während ich mir ein Ziel vorstellte, war ich wie durch einen Zauber bereits dort angekommen. Ich wirkte ausgeruht, und doch lag hinter mir wie ein ferner Nachhall alles, was ich gerade erst erlebt und bewältigt hatte.
Als ich an diesem Tag nach der Arbeit vor dem Spiegel stand, sah ich, dass mein braun gebranntes Gesicht mit Dreckspritzern übersät war. Meine Haare waren verfilzt. Mein Körper war feucht, heiß und kalt. Meine Beine waren geschwärzt, und die rissige Haut meiner Finger gesättigt von Dreck. Mein leuchtend rotes Hemd war jetzt eher dunkelrot. Als ich meine schwarzen, fingerlosen Handschuhe abstreifte, sah ich saubere weiße Handflächen. Ohne die Rüstung der Radfahrermontur war mein bleicher Körper namenlos. Das Alter Ego des Fahrradkuriers hatte ihn aufgezehrt. Ich war nicht mehr menschlich, ich war ein Fahrradkurier im Körper eines Menschen. Ich kam mir vor wie ein Metronom: Hatte ich meinen Rhythmus erst einmal gefunden, gab es kaum einen Grund, wieder anzuhalten.
Unter der Dusche stehend beobachtete ich, wie schwarze Partikel in einem Strudel abliefen und durch die Abflussrohre zurück in die Stadt gesaugt wurden. Aber es war kein normaler Dreck, den ich da abwusch. Es war Schweiß und verbrannter Treibstoff. Ich roch wie ein Auspufftopf. Meine Oberschenkel waren dermaßen verkrampft, dass es schmerzhaft war zu sitzen. Beim Säubern meiner Ohren förderte ich schwarzes Ohrenschmalz zu Tage. Während sich meine Muskeln in willkürlichen Schüben verkrampften, lehnte ich mich in einem bequemen Sessel zurück. Meine Augen schienen wie versengt, aus ihren Höhlen gebrannt. Aber hinter ihnen stürzte sich mein Geist immer noch vorwärts. Selbst der Ruhezustand schien Energie zu erfordern. Wie ein Besessener, der sich seinen Weg aus der Welt der Toten heraufbahnte, sagte ich dann völlig unerwartet:
»Das Leben ist ein Haufen Scheiße, aber die Arbeit ist voll cool.«
Ich versuchte zu lachen, aber mir tat das ganze Gesicht weh, ausgelaugt vom rauen Wind. Die Gedanken wirbelten und tanzten und zeterten weiter durch meinen Kopf, bis ich am nächsten Morgen aufwachte, um erneut die Rüstung anzulegen.
11:55 a. m.
Es fällt mir schwer, die Arbeit des Fahrradkuriers als einen herrlichen Tagesjob zu beschreiben, eine nur entfernt an Arbeit erinnernde Freizeitbeschäftigung für strahlende Sonnentage in einer großen Stadt. Sicher, es gibt Augenblicke, die kommen einem vor wie ein Fest der menschlichen Kraft und der individuellen Freiheit. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht und eine kühle Brise weht, inmitten der Ströme von Joggern und Touristen, die wegen Musikfestivals die Parks bevölkern, überall nur blauer Himmel, dann bin ich der Erste, der anhält und dankbar ist für diese Seite meiner Arbeit. Ich genieße diese Szenen, auf die ich zufällig stoße auf meinem Weg durch die Gold Coast mit einer dringenden Sendung für jemanden in einer Wolkenkratzereigentumswohnung im Park. Es gibt Tage, die enden an einem sagenhaften Nachmittag mit dem Geplänkel von Freunden über Funk, bei dem mit beabsichtigter Coolness Dinge gesagt werden wie:
»Neununddreißig an Zentrale. Ich bin jetzt fertig und hier oben im Himmel, hab ein kaltes Sam Adams in der Hand und hoffe, dass es auch so bleibt.«
»10-4. Du hattest einen harten Tag, Nummer neununddreißig. Leg die Beine hoch, und schau dir die Mädels an. Sehe ich dich morgen früh?«
»Fettes 10-4, Chef. Die Beine sind oben. Neununddreißig Ende.«





























