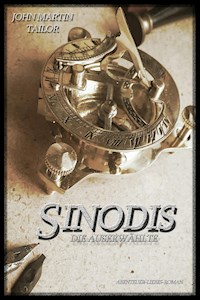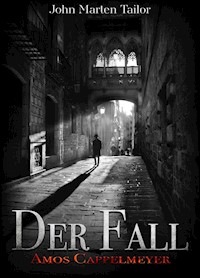
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Amos Cappelmeyer ist ein unbedeutender Schriftsteller aus der Thüringischen Provinz, doch als er ein unglaublich lukratives Angebot erhält, binnen kürzester Zeit einen Roman zu schreiben, ahnt er nicht, auf welch perfides Spiel er sich einlässt. Er könnte alles verlieren, deshalb reist Amos nach Wien, um dort die nötige Inspiration zu finden. Mit Hilfe der attraktiven Ex-Agentin Audrette Miller, die ihn in das Sinnliche und Übersinnli-che einweiht, begibt er sich an diversen Schauplätzen auf die Suche nach einem Serienmörder, welcher seit Jahrzehnten sein Unwesen treibt. Darüber hinaus trifft er auf sein ganz persönliches Phantom. Amos muss schmerzhaft erfahren, dass nicht jeder nur sein Bestes will und vieles nicht so ist, wie es scheint.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Fall - Amos Cappelmeyer
John Marten Tailor
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Nachwort
Texte: © Copyright by John Marten Tailor
Alle Rechte vorbehalten. All rights resereved.
https://john-marten-tailor.com
Umschlaggestaltung: www.thaleaklein.de/premade-neu-vercovert
Bildquellen: www.depositphotos.com und www.pexels.com
Verlag:https://john-marten-tailor.com/Impressum
Druck:epubli - ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Personen und Handlungen in diesem Buch sind frei erfunden. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Persönlichkeiten sind nicht beabsichtigt und unterliegen dem Zufall.
Für meinen alten Kumpel Bernd, er würde gewiss wissen, wer gemeint ist.
Prolog
Ich bin, wer ich bin ...
Die Leute mochten mich schlicht als Mann mittleren Alters bezeichnen, mein Name: Amos Cappelmeyer. Ja, ganz recht, im Englischen wie im ostdeutschen Dialekt Ämos.
In meinem Geburtsjahr wurde Che Guevara erschossen, Martin Luther King schwang feurige Reden gegen den Vietnamkrieg und ein Dr. Manfred Eigen aus Göttingen erhielt den Nobelpreis für Chemie. Dies alles ereignete sich im Jahr des Herrn 1967. Ich stamme aus einem Örtchen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, von dem garantiert 99,9% der Menschheit niemals je gehört haben. Egal, für mich bleibt es der reizvollste Ort auf Erden.
Ich bin, wie ich bin.
Leider schlug die Damenwelt einen weiten Bogen um meine Person, da die Natur mich nicht eben gesegnet hatte, und ich, ehrlich gesagt, keine besonderen Anstrengungen unternahm, dem entgegenzuwirken. Von durchschnittlicher Statur, etwas unter ein Meter achtzig groß, hatte ich mir zumindest das volle dunkle Haar meiner Jugend bewahrt, welches von mir in Eigenleistung hin und wieder gestutzt wurde, wie der Rasen vorm Küchenfenster. Ich war weder trainiert, noch definiert - wie es auf neudeutsch heißt -, der Waschbrettbauch verbarg sich geschickt. Es bestand kein Anreiz, mit der Zeit zu gehen, bei uns auf dem Land war die Welt in Ordnung. Zu meiner modernsten Errungenschaft zählte ein preiswertes Smartphone, weil ich mir einredete als aufsteigender Stern am Schriftstellerhimmel das Internet zu benötigen.
Insgeheim sehnte sich mein Herz nach ein bisschen Zuneigung, von der großen Liebe wagte ich nicht zu träumen. Einsam suchte ich die Erfüllung als Schreiberling, mit zugegeben - mäßigem Erfolg. Hier und da einen Artikel in hiesigen Lokalblättern zu veröffentlichen, ein kleiner Lichtblick. Meine Sternstunde blieb die Kolumne »Der Totenkult in Mitteldeutschland von der Frühzeit bis zur Gegenwart am Beispiel der Gemeinde Kleinschmalkalden«, doch ich hatte mir in den Kopf gesetzt, einen echten Roman zu verfassen. Etwas, mit mehr Volumen, das man in der Hand halten konnte, wie die Bücher meiner Vorbilder aus Jugendtagen. Doch selbst nie in den Genuss der EOS, der erweiterten Oberschule, gekommen, geriet meine Karriere bereits vor ihrem Beginn ins Stocken. Knauserig, wie es meine Natur vorgab, schaffte ich ein paar Cent aus der Arbeit im Postdienst auf die hohe Kante. Von den Ersparnissen versuchte ich, meinen Traum zu erfüllen, - dabei verschlug es mich ins Ausland.
Ich nahm meinen kompletten Jahresurlaub, um nach München zu reisen, wohin ich eingeladen worden war. Ja, das Warten hatte sich ausgezahlt. Nach dem Gespräch mit der Verlagsleitung wurde ich übermütig. Mit kaum mehr als meinem Postbank-Sparbuch mit 1.500 Euro, Wäsche für ein paar Tage und ein Laptop im Gepäck, entschied ich spontan, nicht direkt nach Hause zu fahren, sondern am Münchener Hauptbahnhof den nächsten x-beliebigen Zug zu besteigen. Den kündigte die Abfahrtstafel für 12 Uhr 25 auf Gleis 9 an.
Zufällig war dessen Ziel Wien.
Der Tapetenwechsel sollte meiner aufgeputschten Kreativität Vorschub leisten, daher mietete ich mich von unterwegs mit Hilfe des Smartphones für sieben Tage in einem bescheidenen Hotel in der österreichischen Hauptstadt ein. Versprach mir raschen Reichtum. Wie konnte Mann nur so blauäugig sein, sich mit einem Verlag auf ein verwegenes Angebot einzulassen: 700.000 Euro, wenn ich es fertigbrachte, einen spannenden Roman abzuliefern, Thema frei, Minimum 300 Seiten - in sieben Tagen! Einfacher als ein Lottogewinn. Der Pferdefuß: Gelang es mir nicht, verlor ich mein Haus in bester Alleinlage, doch diese Option zog ich maximal mit einem Achtel Hirnkapazität in betracht.
So nahm das Schicksal seinen Lauf.
In grenzenloser Überheblichkeit unterschrieb ich mit einem goldenen Federhalter die Vereinbarung, vor den Konsequenzen die Augen verschlossen. Man hatte mich bei der Ehre gepackt. Mich, einen drittklassigen Schriftsteller vom Lande. Nur Gevatter Tod war längst fester Bestandteil des Plans ...
Ich bin, was ich bin.
KapitelEins
Ein einziger Tag
Sommer 1978
Man schrieb die dritte Ferienwoche, ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch, geschaffen dafür, diesen im Freien zu verleben. Zwei Knaben, annähernd gleichen Alters, nicht nur körperlich unterschiedlich wie Tag und Nacht, fristeten ihn in einer Art ungesunder Zwangsgemeinschaft an einem kleinen See auf dem großelterlichen Grundstück. Libellen schwirrten, Bienen summten voller Lebensfreude, es duftete nach gemähtem Gras und Mücken umkreisten ihre Blutopfer, während die Kinder, nur in ihren Badehosen, Steinchen über die Wasseroberfläche hüpfen ließen.
»Ist das öde! Ich weiß nicht, was ich hier eigentlich soll«, maulte der Dunkelblonde, dessen Erscheinung und besonders sein Gesichtsausdruck ihn beim ersten Blick von der Kategorie „netter Nachbarsjunge“ ausklammerte.
Dasselbe, wie letztes Jahr und das Jahr davor. »Es sind Ferien«, stellte sein Spielgefährte dann lakonisch fest, weil er keinesfalls belehrend wirken wollte. Noch beim Sprechen katapultierte er mit voller Kraft einen weiteren flachen Stein auf den See hinaus, der diesmal sofort versank. Pech.
»Scheiße, das funzt nich`. Mir reicht`s! Ich bin kein Baby mehr. Wessen behämmerte Idee war das?«
»Fluch nicht, Bruno«, mahnte der schmächtige Zehnjährige mit dünner Stimme und biss sich sofort auf die Lippe.
»Wer sagt das?«, geiferte Bruno streitlustig, wobei er extrem einer alten englischen Hunderasse ähnelte. Er litt unter enormen Stimmungsschwankungen, was sein jüngerer Vetter schmerzhaft hatte lernen müssen, als er dabei einen Milchzahn verlor. Dies ereignete sich in einem anderen, längst vergangenen Sommer. Trotzdem, jedes Wort, jeder Widerspruch könnte der Zünder für den nächsten Wutausbruch sein - und vergangen ist nicht gleich vergessen.
»Weißt du doch.« Nachdem er die Augen verdreht hatte, schleuderte Amos wieder einen flachen Stein weit hinaus, der vorbildlich dreimal hintereinander aufditschte, und freute sich insgeheim, dass er etwas besser beherrschte. Etwas, für das man weder riesengroß noch stark sein musste. Ihm lagen eher die Kopfsachen. Mathe zum Beispiel, oder Aufsätze schreiben. Locker hätte er jetzt eine Abhandlung über die Flora im Thüringer Wald zwischen Kleinschmalkalden und Tambach-Dietharz zu Papier bringen können. Einfach so. Doch Holzkopf Bruno funkelte ihn finster an, dabei zerquetschte er einen hässlichen schwarzen Käfer zwischen zwei Fingern. Schmatz.
Gar nicht gut. Amos griff nach einer Pusteblume in Reichweite und begann nervös daran herumzuzupfen.
Ein fieses Grinsen legte sich für den Hauch eines Momentes um Brunos Mundwinkel.
»Was der Alte sagt, juckt mich nicht. Der hat mir überhaupt nix zu befehlen.«
Amos zuckte zusammen. Er verabscheute es, wenn jemand respektlos von seinem verehrten Großpapa sprach. Der Großvater liebte schließlich all seine Enkel gleichermaßen. Aber der Sermon fand kein Ende:
»Bei dir sieht die Sache anders aus, du Werchel. Meine Eltern sind nicht so dämlich, sich beim Kraxeln den Hals zu brechen.« Da hatte der Cousin ein Tabu-Thema angeschnitten, bei dem selbst der beherrschte Amos aus der Haut fuhr.
»Halt sofort den Mund! Du sollst nicht so reden!«
»Ach!« Bruno sprang mit unerwarteter Behändigkeit auf. Seine kurzen Finger gruben sich in den dunklen Haarschopf des Kleineren, dass dieser aufschrie, und zerrten ihn auf die Knie.
»Au! Au! Bist du blemblem? Lass mich los!«
Bruno war in seinem Element, als er sadistisch forderte:
»Sag bitte.«
»Du sollst loslassen.« Obwohl Amos sich geschworen hatte, nie wieder klein beizugeben, zwängte er das eine Wort über die Lippen: »– Bitte.«
Bruno ließ derart abrupt los, dass Amos auf seinen Hintern landete.
»Du Lutscher! Du erbärmlicher, kleiner ...«, an dieser Stelle gingen Bruno die Vokabeln aus. In der Abteilung Gehirn war er etwas zu kurz gekommen.
»Hör auf!« Wieder auf den Beinen stürmte Amos wie eine Furie auf den Hünen zu, rammte ihm eine Faust in den Wamst. Sicher hatte der Schlag nicht ernstlich weh getan, dafür war Bruno nun echt stinkig. Mist.
Amos tat das einzig Vernünftige, er ergriff die Flucht - unter den höhnischsten Beschimpfungen.
»Lauf zu Opi, du kleiner Schmarotzer! Heul doch!«
Amos schlug einen Haken und stürzte sich von dem knapp fünf Meter langen Steg in den Teich. Er empfand das Wasser kälter, wie an einem Sommertag zu vermuten, aber als er die Augen öffnete, konnte er prima sehen.
Bruno plumpste ins Wasser. Schneller wie erwartet.
Amos Vorsprung schrumpfte weiter, dann kam ihm die zündende Idee.
Kurz tauchte er auf, um seine Lungen zu füllen. Der Teich mass an dieser Stelle eine Tiefe von über zweieinhalb Metern. Vorne am Steg gammelte ein altes Kinderfahrrad auf dem Grund herum, das einst Klein-Bruno gehörte und inzwischen von Gräsern überwuchert wurde. Die Schwimmkünste des Cousins waren nicht herausragend.
Ein Punkt für die Kleinen.
Amos witterte seine Chance, tauchte zielgerichtet unter. Bald hielt er in den Händen, was er haben wollte, genau in dem Moment, als Bruno über ihm herum paddelte und brutal versuchte, ihn zu ertränken. Amos wusste, was es zu tun galt.
Er war im Besitz der Fahrradkette, die benutze er wie ein Strick, probierte, Bruno damit zu fesseln, und zwängte ihn weiter unter den Steg. Im Wasser war alles leichter, lernt man in der Schule oder aus Erfahrung. Der Große strampelte überrascht, am Ende seiner Atemluft. Bläschen entwichen seiner Nase, die Beine zappelten, die Kette rutschte erneut ab.
Das darf doch nicht wahr sein! Wieder ein Plan, der nicht funktioniert. Bruno würde ihn windelweich prügeln. Nein, mehr noch. Mit einem Zahn als Obolus würde er sich jedenfalls nicht zu frieden geben. Plötzlich verfing sich Brunos linker Fuß im Fahrradrahmen, panisch wedelte er mit den Armen, die Augen aufgerissen. So überrascht.
Er kam nicht frei, ihm fehlte es an Kraft.
Jetzt oblag es Amos, zu entscheiden, und zwar sprichwörtlich über Leben und Tod. Nie beabsichtigte er, seinem Cousin ernsthaft zu schaden, deshalb dauerte es nur Sekunden, bis er begann, an ihm herumzuzerren, um ihn frei zu bekommen. Brunos Augen blieben geschlossen.
Amos tauchte kurz auf, stieß einen Hilferuf aus, ging danach sogleich wieder auf Tauchstation. Er bog und zerrte an dem speckigen Fuß, dann war es geglückt. Der schmächtige Junge brachte Bruno an die Wasseroberfläche, schrie erneut um Hilfe, wie es seine Lungen hergaben. Irgendwie gelang es ihm gar, den Körper an das flache, grasige Ufer zu ziehen.
Auf einmal war der Großvater da, in seiner typischen Kluft bestehend aus Holzschuhen und einem Arbeitskittel. Amos Herz ging auf.
Geschafft. Alles wird in Ordnung kommen.
»Mach platz, Werchel!«
Werchel bedeutete so viel wie kleines, unbeholfenes Kind und war fester Bestandteil des großelterlichen Vokabulars. Der ältere Mann beugte sich hinunter und tätschelte dem Bewusstlosen die Wangen.
»Bruno? Hörst du mich? Bruno? – Wie lange war er im Wasser, Ämos?«
Amos zuckte die Schultern unter dem stechenden Blick des Erwachsenen.
»Nicht lange. Weiß nicht«, stotterte er unbeholfen, wünschte sich sehnlichst, Worte zu hören wie: Es wird alles wieder gut, doch stattdessen startete Großvater Wiederbelebungsmaßnahmen. Wie gebannt starrte der Knabe auf den Brustkorb seines Vetters sowie die grauen Hände seines Vormunds, die in einem gleichmäßigen Rhythmus zu pumpen begannen.
Täuschte das, oder sah Bruno viel weniger bedrohlich aus?
Die sich überschlagende Stimme des Großvaters riss Amos aus seinen Gedanken.
»Und eins, und zwei, und drei!« Unverhofft hustete Bruno, würgte, bis Wasser aus Mund und Nase trat. »Junge, mein lieber Junge! Du bist da. Alles in Ordnung?« Krächzend kam ein »Ja«, das Amos in diesem Moment alles bedeutete.
»Was ist denn nur geschehen? Ämos?«
»Uns war so warm, deshalb sind wir schwimmen gegangen. Auf einmal waren da ganz merkwürdige Wasserwesen, die haben Bruno festgehalten ...!«
»Ach, Ämos, du mit deiner blühenden Fantasie. Reiß dich zusammen. Dein Cousin wäre fast ertrunken!« Und im gleichen Atemzug: »Wir bringen dich erstmal rein. Wie wäre das, Junge?«
»Mmh.«
»Fass mit an, Ämos. Wir schaffen ihn in die Küche. Da kann er sich aufwärmen.«
Beim Abendessen waren sie vollzählig am Tisch versammelt. Die Großeltern auf der einen, die Kinder auf der anderen Seite. Der blasse Amos hielt den Blick gesenkt, erwartete jeden Augenblick die fällige Standpauke, doch die blieb aus. Bruno verhielt sich merkwürdig, hatte nicht mehr gesprochen seit dem Erlebnis im Teich.
Großvater blätterte missmutig in den Thüringer Nachrichten, räusperte sich. Er bekam jedes Mal schlechte Laune, wenn er über das Übel im Lande las. Deshalb hatte Amos gelernt, Zeitungen als eher abträglich für den Familienfrieden einzustufen. So kam es sporadisch vor, dass ein Exemplar, welches er am Morgen aus dem Briefkasten holen sollte, verschwand. Das Resultat erwies sich jedoch als kontraproduktiv, denn Großvaters Laune blieb den kompletten Tag über getrübt.
»Das darf nicht wahr sein«, raunte Luitpold, ohne die Lippen zu bewegen.
»Wie bitte? Du sprichst in Rätseln. Lass uns teilhaben, Lui«, forderte Oma Hilde, entfaltete ihre Serviette und drapierte sie auf ihrem Schoß, wie es sich für eine Dame geziemte. Sie hatte nicht aufgegeben, den Kindern Tischmanieren beibringen zu wollen, doch das hatte weder bei ihrem Gatten funktioniert, noch bei den eigenen Kindern und die Aussichten für die jüngste Generation Cappelmeyer standen lausig.
»Noh, im Harz oben ist eine Frau abgängig - bei diesen schwerreichen Hotelheinis. Weißt schon, die wo ständig die Annoncen in der Zeitung sind. `Nen Sohn hat`s wohl, kaum älter als wie unsere Beiden hier und plötzlich ist sie wie vom Erdboden verschluckt? Wer glaubt denn sowas? Hier, sogar mit Foto.« Er klopfte auf das Bild, als ob die anderen am Tisch es dann besser sehen könnten. »Kann fast jede sein, wenn ihr mich fragt. Aber es ist eine Belohnung ausgelobt, stellt euch vor. 500 Mark! – Glaube ja nicht, dass sie gefunden wird. Aber wer fragt einen alten Mann.«
»Ja, ja, die Welt ist verdorben«, nickte Hilde traurig, klatschte in die Hände und knipste in Nullkommanichts ihr bestes Sonntagslächeln an. »Aber jetzt esst bitte auf, Jungs und dann ist Schlafenszeit für euch. Morgen ist ein neuer Tag.«
500 Mark, das war unvorstellbar viel Geld, nicht nur für einen Knaben wie Amos.
KapitelZwei
Unklar
Gegenwart
… das Unfassbare geschah gleich in der ersten Nacht. Baufahrzeuge frästen alten Asphalt von der Straße direkt unter meinem Fenster. Eine Arbeit, über deren Sinn oder Unsinn ich nicht zu urteilen vermochte.
Auf jeden Fall stank es unerträglich nach verbranntem Teer.
Ein Höllenlärm, den kompletten Spätnachmittag lang, seit ich nach viereinhalb Stunden Zugfahrt die Zimmertür aufgesperrt hatte. Zudem war es stickig und warm in dem Kabuff, welches mir als Sparzimmer verkauft worden war. Wie sollte ich da schlafen, geschweige denn schreiben können? Ich, der Schriftsteller, inmitten seiner kreativen Phase, der nichts als absolute Stille und Ruhe gewohnt war? Für den ein Buntspecht bei der Arbeit an Lärmbelästigung grenzte?
Das Schreiben konnte ich mir heute abschminken, hoffte auf morgen.
Um nicht länger in der Enge des stillosen Zimmers sinnlos umher zu tigern, klappte ich den Laptop zu, streifte mir mein abgewetztes Lieblingsjackett mit den Armflicken über die Schultern, setzte meinen Stetson auf und begab mich in die Lobby. Der hochnäsige Concierge versicherte mir, nicht über die Straßenbaumaßnahmen informiert worden zu sein. Ich kaufte ihm das nicht ab und beschloss, um die Häuser zu ziehen. Immerhin war dies die Landeshauptstadt, da sollte doch was gehen.
Weit kam ich nicht, denn ich hatte nie Bauarbeitern hautnah bei der Arbeit zugesehen. Eine eigentümliche Faszination ergriff mich. Die rotierenden Scheiben der Fräse fraßen sich hungrig durch maroden welligen Teer. An der Seite mitlaufend beobachtete ich die drehenden Fräsmonster. Meine Neugier blieb nicht unbemerkt.
»Was glotzt`n Du so dämlich, du Tunte? Noch nie ehrliche Männer bei der Arbeit gesehen?«
»Äh, offen gesagt, nicht.« Kurzum schilderte ich dem Straßenarbeiter, dass ich einer der bekanntesten Schriftsteller unserer Epoche sei und gewöhnlich mit meiner Zeit knausern müsse. Er zog zweifelnd eine balkenförmige Augenbraue hoch.
»Ach, echt? Wie ist dein Name, Hallawachl?«
Ich räusperte mich, rang um Selbstbewusstsein: »Amos Cappelmeyer.«
»Kappelmeier? Ja, von dem habe ich gehört. Das ist doch der, der ...«
Zu meiner Verwunderung schien mein Gesprächspartner diesen Namen zu kennen, woher auch immer, und zitierte aus Büchern, von denen ich nichts wusste. Seine unrasierte Visage lud zum Reinschlagen ein, während er auf gebildet tat und seine Augen leuchteten gar wie kleine Funken, als er sein literarisches Wissen kundtun durfte, ohne von den harten Knochen aus der Asphalt-Branche verspottet zu werden.
Sollte ich mich zu erkennen geben, zugeben, dass ich in Wahrheit eine Null war? Kam nicht in Frage, denn ich würde den fürchterlichen Kerl der Firma »Leffler International Bau« niemals wieder sehen und machte mir einen Jux daraus, vorzugeben, jemand zu sein. Nach einer Weile fühlte ich mich wie sein Bruder, wir qualmten sogar eine Kippe zusammen. Doch die Kaltfräsmaschine produzierte auf einmal merkwürdige Geräusche und ruinierte den Moment. Gunar, so hieß der Typ, beschattete mit einer Hand seine Augen und fluchte, den Glimmstängel zwischen den Lippen:
»Scheiße! Nicht schon wieder.«
»Was meinst du damit, Gunar? Passiert das öfters?«
»Frag nicht so dämlich.« Als Mann weniger Worte demonstrierte ein fester Griff in meinen Nacken seine Entschlossenheit. Er schleifte mich zur Asphaltfräse.
»So, du Dummschwätzer, jetzt bist du dicht genug dran am Geschehen und kannst sehen, wie die Maschine ihre Arbeit ereldigt.« Das rotierende Fräswerk, welches direkt vor meiner Nasenspitze lärmend Fräsgut durch die Gegend spuckte, jagte mir gehörig Ballerkacken ein. Mein Alter Ego brüllte wie am Spieß, was zum Glück im Lärm der Fräse unterging. Oder?
»Spuck es aus, wer bist du, du Spinner?«
»Ich, ich bin ...« Vor Aufregung pinkelte ich mir in die Hosen. Es wurde wärmer um meine Genitalien. Gut, dass ich den Großteil an Flüssigkeit bereits ausgeschwitzt hatte. Er ließ von mir ab. So schnell mich meine Füße trugen, rannte ich davon. Die Ledersohlen klackerten höllisch laut, doch das fiese Lachen dröhnte noch aus einhundert Metern Entfernung in meinen Gehörgängen. Wieder Mal hatte ich versagt, sah aus wie ein Heckenpenner. Mit dem Jackett verdeckte ich die einurinierte Stelle, stank jedoch zehn Meter gegen den Wind. Selbst die Hotelbediensteten krümmten sich vor Lachen, bildete ich mir ein. Zitternd schloss ich mein Zimmer auf, welches linker Hand in einem schlauchartigen Flur lag, dessen Boden von geschmackloser rotgepunkteter Auslegeware geschmückt war, die den Geruch von Verwesung ausdünstete. Noch im Vorraum entledigte ich mich meiner Kleider. Schleunigst die Taschen entleeren. Eine rasche Dusche könnte helfen, nur wie üblich fehlte in der Flasche die Seife. Entnervt rief ich bei der Rezeption an, um dort meinem Unmut Luft zu machen.
Wenig später klopfte es.
»Wer da?« Keine Antwort. »Herrgottszeiten.« Ich riss die Tür auf, vor mir stand eine bildschöne rothaarige Frau mit einer Flasche knallgelber Flüssigseife und einem Grinsen von Ohr zu Ohr.
»Zimmerservice! - Die Saf. Soll ich dich einsafen, Schnuckiputz?«
»Bitte was? Unterstehen Sie sich! Nun geben Sie schon her!« Ich entriss ihr die Flasche und knallte der zwielichtigen Person die Tür vor der Nase zu. Nachdenklich, aber rollig trat ich unter die Dusche. Schließlich war ich nur ein Mann aus Fleisch und Blut. Meine Lanze stand kerzengerade, dürstete danach, ein Weib zu beglücken.
»Was meint ihr, ist das gut so?«, erkundigte sich die kleine Rothaarige angeekelt, als sie sich kunstvoll drapierte. So nah am Boden stiegen Ausdünstungen in ihr zartes Näschen, die nichts erfreuliches Vermuten ließen. Mittlerweile bereute sie, sich auf dieses Kammerspiel eingelassen zu haben. Der Bodenbelag kratzte, wie ein Strohballen auf nackter Haut und binnen Sekunden war ihr, als ob ihr ganzer Körper von unzähligen mikroskopisch kleinen Parasiten befallen worden sei. Eine Dusche würde danach nicht ausreichen. Sie hatte sich definitiv unter Wert verkauft. »Machen die hier auch mal sauber?« Die Frage galt ihren beiden männlichen Begleitern, die das Equipment aus Filmrequisiten in einem Alu-Koffer verstauten.
»Halt die Klappe und rühr dich nicht«, bekam sie zur Antwort.
»Okey-dokey. Tote Frau kann ich am besten.«
»Sonst wären wir nicht hier, Süße.« Noch ein paar letzte Handgriffe, dann war alles perfekt arrangiert.
»Die Show kann beginnen. Und keine Bewegung, Beata. Rückzug, Franky. Wir sind raus.« Die beiden Männer eilten den verwaisten Korridor entlang und entschwanden über den Notausgang.
Dreißig Minuten später duftete der Anzug angenehm nach Zitrone und hing zum Abtropfen in der Wanne. Mit einem Handtuch um den Bauch gewickelt öffnete ich die Tür einen Spalt, schielte hinaus. Womöglich stand sie ja noch da? Ich hegte die unsinnige Hoffnung, dass sie auf mich gewartet hatte.
Verdammt! Und ob sie noch da war.
Mir verging mit einem Schlag alles.
Ausgerechnet jene Frau, die mir vor wenigen Augenblicken ein zwielichtiges Angebot unterbreitet hatte, lag tot vor meiner Tür. Was für ein Desaster, das bedeutete Ärger mit der Polizei.
Leere Augen starrten an die Decke. Durchtrennte Kehle. Eine Wunde zog sich gut fünfzehn Zentimeter von einem Ohr zum anderen. Kein appetitlicher Anblick. Winzige Einkerbungen an den Wundrändern hatte ich längst bemerkt und analysiert. Als eifriger Krimifan hatte ich keine Folge meiner Lieblings-TV-Serie verpasst und wusste bestens Bescheid. Grundsätzlich kamen nicht viele Messertypen in Betracht. Davon abgesehen, hatte ich trotz meines Alters nie zuvor einen toten Menschen gesehen.
Ein Würgereiz reaktivierte die stibitzten Chips aus der Lobby. Vor Schreck schnellte die Tür ins Schloss zurück. Aufbrandendes Geschrei im Flur bereitete mir gehöriges Fracksausen. Kurz darauf klopfte es energisch, doch meine Stimme versagte den Dienst. Das Hämmern ließ Wände erzittern, akustisch untermalt von den Worten:
»Polizei! Öffnen Sie sofort die Tür!« Warum sollte ich? Meine Weste war rein, daher stellte ich mich taub. »Wir wissen, dass Sie da sind. Aufmachen!«
Eine Minute später durchbrachen sie die Tür, pressten mich nackt gegen die Wand.
»Hey, Moment mal!« Handschellen klickten unsanft meine Handgelenke hinter meinem Rücken zusammen. Die Staatsgewalt dachte nicht im Traum daran, einen Mörder zu bekleiden. Was sollte ich auch anziehen? Den Anzug hatte ich gerade frisch gewaschen, er hing tropfend in der Duschwanne, somit sprachen alle Indizien gegen mich. Schweiß benetzte meine Stirn. Die Polizei sah nur, was sie sehen wollte. Einer der Beamten schüttelte den Kopf, als ob er fürchterlich enttäuscht von mir sei. Dabei kannten wir uns überhaupt nicht.
»Ab mit dem Wicht!«
Sie führten mich durch das Treppenhaus, ich betone, unbekleidet. Auch die Lobby sollte auf ihre Kosten kommen. Hinter vorgehaltener Hand amüsierte man sich über meinen zu klein geratenen Penis. Die Uniformierten drückten mich gedemütigt auf den Rücksitz aus Kunstleder. Es quietschte. Sogar vorschriftsmäßig angeschnallt wurde ich von den pflichtbewussten Beamten, die jedoch nicht umhinkonnten, eine weitere herablassende Bemerkung über mein kleines Geschlechtsteil fallen zu lassen. Was für Hohlbirnen, nur Augen für das Offensichtliche. Mir wurde übel bei dem Gedanken, dass bedeutsame Spuren außer Acht gelassen werden könnten. Aber was sollte ich tun, hatte ich doch nur wenig Zeit meinen Roman zu vollenden. In diesem Moment verfluchte ich meinen Leichtsinn, im Handumdrehen Geld generieren zu wollen. Dass ich als Mörder hätte eingebuchtet werden können, kam mir nicht in den Sinn.
Am Polizeirevier angekommen, einem unscheinbaren Gebäude ohne jeglichen Charme, fiel eine Handvoll Reporter wie die Geier über meine Person her, schossen jede Menge Fotos. Auch Fragen, wie ich die Frau umgebracht habe, waren dabei. Wie konnten sie es wagen, mich in der Öffentlichkeit dermaßen bloß zu stellen! Und wie, zum Henker, konnte das mit der Frau so rasch bekannt werden?
Ich schwieg verbissen. Hatte ich keine Rechte?
Mit dem nackten Gesäß auf dem kalten Blechstuhl sitzend, wartete ich auf die anstehende Befragung. Doch zu meiner Verwunderung erschien niemand. Dauernd ging die Tür auf und verschiedene Personen spazierten an mir vorbei mit scheelen Blicken. Ich war die Attraktion auf dem Revier und machte dicht.
Abermals sezierte ich das Erlebte gedanklich, überlegte, was ich übersehen hatte.
Hunger und Durst quälten mich, pissen musste ich obendrein. Nach einer gefühlten Ewigkeit, schätzungsweise sechs bis acht Stunden, betrat ein Polizeibeamter den Raum, der einen Stock verschluckt haben musste. Ein Polizeioberkommissar seines Zeichens, der verkündete:
»Herr Cappelmeyer, Sie dürfen gehen. In ein paar Minuten bringt ein Kollege Ihr Gewand.« Keine Entschuldigung, nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Wiederum dauerte es zwei Stunden, bis jemand für mich Zeit fand. Die Beamten knallten meine Sachen auf den Tisch, Reisetasche, Notebooktasche, den Stetson. Wohl denn, nichts geht über einen ordentlichen Hut. Sobald ich ihn trug, fühlte ich mich wie ein Geheimagent längst vergangener Zeiten.
Gedanken an die arme Frau plagten mich. Sie war die Einzige, die mir überhaupt je ein unmoralisches Angebot unterbreitet hatte. Schuldete ich ihr deshalb etwas? Während ich mich anzog, betrat ein anderer Polizist den Raum, ein weiterer unsympathischer Bursche. Er erwies sich als höflich und schien bemüht um meine Person.
»Herr Cappelmeyer, ich fahre Sie zurück zu Ihrem Quartier.«
Das war das Letzte, was ich wollte.
»Nein! Kommt nicht in Frage. Warten Sie kurz.« Mein Smartphone besaß nur minimale Energie, die Datenübertragung war auf Schneckentempo gedrosselt, aber für eine Hotelsuche musste es genügen. »Bingo!« Das abgelegene 2-Sterne-Haus in der Nähe versprach Ruhe und sollte für meine Bedürfnisse ausreichen. »Zur Schwalbe«. Allein der Name ließ die Herberge verdächtig erscheinen. Große Auswahl blieb um diese Zeit allerdings nicht. »Da will ich hin.«
»Wie Sie meinen.« Der Beamte chauffierte mich.
Ich rechnete mit dem Desaströsesten, da meine Visage gewiss in sämtlichen Nachrichtensendungen durch den Dreck gezogen worden war. Offenbar gab es hier keinen Fernseher oder er war kaputt. An der Rezeption buchte ich mit hochrotem Kopf ein Einzelzimmer für sechs Übernachtungen mit Frühstück auf Kosten der Polizeibehörde. Der Beamte unterschrieb die Rechnung und verabschiedete sich formvollendet. Sollte ich jetzt Erleichterung verspüren? Mir war nach allem, etwa einen Heben bis der Arzt kommt, oder doch eher Sex? Der Portier räusperte sich und überreichte mir den Schlüssel.
»Nummer Sechs, bitteschön. Das Zimmer ist nach hintern gelegen, eines unserer größten. Die Stiege ist da vorne.« Treppe, kein Fahrstuhl. Na ja, hatte ja nur leichtes Gepäck. Also machte ich mich auf in die dritte Etage zu Zimmer sechs, wieder auf der linken Seite, zog die elektronische Karte durch den Scanner. Die Tür sprang weit auf. Überraschenderweise eröffnete sich vor mir eine Wohnlandschaft von wenigstens zwanzig Quadratmetern mit einem separaten Schlafraum. Bestimmt hatten die unsichtbaren Finger der Polizei mitgewirkt, was mir nur recht war und der Ärger teilweise besänftigt. Ich war ein genügsamer Mensch. Erziehung prägt uns ein Leben lang.
In mir staute sich die Müdigkeit, aber meiner Geldbörse stand ein anstrengender Job bevor. Nach dem Frischmachen suchte ich den hauseigenen Schankraum auf, dort quetschte ich mich auf einen von sechs freien Barhockern. Es gab wenig Publikumsverkehr. Der Barkeeper platzierte prompt eine eiskalte Flasche Wodka, Soda und ein Glas auf den Tresen. Der Alkohol plätscherte kaskadenartig über das Eis im Becher, das bei dem Kontakt knisterte und knackte. Der erste Schluck umschmeichelte den Gaumen. Einkehrende Ruhe beförderte meine Gedanken zu der toten Frau, die mit durchtrennter Kehle ihre Leben ausgehaucht hatte. Die zackigen Abrisse an den oberen Hautschichten, Hand-, und Fußgelenken, die Fesselungsspuren aufwiesen, waren ein Indiz für Gewalt, aber ohne Obduktionsbericht nur schwer zu beurteilen. Ein unlösbares Puzzle, hatte es den Anschein, aber nicht für Amos Cappelmeyer!
Den zweiten Wodka kippte ich in einem Zuge hinunter. Vom Keeper bekam ich ungefragt Salzstangen dazu. Meine Überlegungen suchten verzweifelt Antworten. Der Täter musste sich von hinten genähert haben. Die Zacken boten zwei Optionen: erstens, ein Kampfmesser, zweitens ein Brotmesser.
Also denk nach, Cappelmeyer, denk nach. Wer zum Henker würde eine so schöne Frau töten? Auf ihrer Arbeit! Weshalb wurde sie zum Opfer?
Der Gedanke, warum sie ausgerechnet vor meinem Zimmer lag, ließ mir keine Ruhe, eines jedoch schien von vornherein klar zu sein, der Täter war männlich!
Die maskuline Bedienung hinter dem Tresen zeichnete sich durch eine ausgeprägte Beobachtungsgabe aus, er schenkte unaufgefordert nach. Die brennende Flüssigkeit rann die Kehle hinunter. Ein Genuss. Meine Blicke durchbohrten den attraktiven, jungen Mann, ohne ihn tatsächlich zu sehen. Er fühlte sich unbehaglich, doch ich beschwichtigte mit der Erklärung, dass ich Lösungen suche ...
Zur späten Sunde setzte sich eine elegante, großgewachsene Frau um die vierzig einen Hocker weiter zu meiner Rechten. Sie trug ihr kastanienbraunes Haare offen, war auffällig geschminkt und genoss meine ungeteilte Aufmerksamkeit, so viel stand fest. Genüsslich kippte ich meinen 3-Fachdestillierten. Ihre Blicke musterten mich auf ihren Anspruch hin. Gezupfte Augenbrauen verrieten einiges über einen Menschen und bekundeten Interesse. Außer meiner Wenigkeit war weit und breit kein anderer Mann in Sicht, nur der Jüngling hinter der Bar, was für ein Segen. Ihre langen Beine zappelten nervös umher. Höflich, nach Cappelmeyer-Art, bot ich ihr einen Drink an. Sie wandt sich mir lächelnd zu, rückte einen Stuhl auf. Der Barkeeper stellte ein zweites Glas für die Lady ab. Gentlemanlike füllte ich ihr Trinkgefäß zur Hälfte, doch sie schien eine Harte zu sein.
»Halbe Sachen machen wir nicht.« Sie drückte den Flaschenkopf runter, bis das Gefäß randvoll war. »Prosit.«
Wir ließen die Gläser klirren.
Ein Abend zum Entspannen.
»Du kannst mich Kitty nennen«, bot sie an. Freimütig erzählte sie von ihrem geschiedenen Mann. Der Ex lebte irgendwo im Ausland. Kinder im Alter von fünf und sechzehn Jahren erfüllten ihr Leben nur zum Teil.
»Es muss doch noch mehr geben!«
Ich nickte taktvoll. Die beiden Stammhalter waren beim Vater für die Ferien oder ein langes Wochenende, was auch immer. »Sturmfrei«, nannte sie ihren Zustand. »Eigentlich mache ich mir nichts aus Alkohol.«
»Ich auch nicht«, bekräftigte ich den besonderen Anlass. Der heutige Abend war der ihre. Ihre Hände suchten die Meinen. Ich setzte den nächsten Wodka an die Lippen, – der Wievielte war es? - da passierte es: Sie küsste mich. - Mich alten Sack! Meine Gefühlswelt bestand aus heillosem Chaos. Was verdammt stimmte mit mir nicht? Noch nie in meinem Leben wurde ich so zärtlich geküsst! Ich war siebenundvierzig ...
Ihre Lust auf meine Zunge war erbarmungslos.
Die angebrochene Flasche und die bezaubernde Frau im Schlepptau, was brauchte ein Mann mehr. Undefinierbare Gefühle in der unteren Körperregion breiteten sich aus. Vor der Tür stehend übernahm die schöne Fremde den Zimmerschlüssel, weil ich nicht wusste, in welche der beiden Öffnungen die Karte eingeführt wurde. Die Tür sprang auf, sie betrat staunend meine Wohnlandschaft.
»Sapperlot, so ein Zimmer hätte ich auch gern!« Ihre Kleider verstreute sie auf dem Weg ins Schlafzimmer. Ich dachte, das gibt es nur im Fernsehen. Zuerst die Pumps, dann die Bluse. Die Unbekannte hatte eine echt geile Kiste. Meine Glocken der Glückseligkeit schlugen Alarm. Ich Hengst hatte noch nie eine Stute wie diese. Nur Sekunden später fand ich sie erotisch auf dem Bett drapiert vor. Wiehern hätte ich bei diesem Anblick können. Passend dazu gingen mit meinen Hormonen die Pferde durch.
Unbeholfen streifte ich mir die Sachen ab, um dann entblättert vor ihr zu stehen, mit einem Ständer, der nach Erlösung schrie. Ich krabbelte auf das Bett, konnte den Segen noch nicht fassen. Ihre Brüste hatten gelitten durch das Stillen der Kinder, doch für mich war sie die betörendste Frau in diesem Universum. Unsere Lippen erfreuten sich aneinander, unwillkürlich lebten wir unsere Leidenschaft in vollen Zügen. Sie hatte Kondome dabei. Das Latexteil fand seinen Weg auf meinen Prachtjungen, ich selber wäre dazu nicht in der Lage gewesen.
Wir hatten uns gefunden, nach langer Zeit der Einsamkeit. Immer wieder holten wir uns ab, Liebe zu empfangen, bis wir schweißgebadet nebeneinanderlagen. Küsse des Dankes für die schönen Momente stimmten mich glücklich. In dieser Nacht weilte ich auf einem andern Stern, tief erfüllt schlief ich ein.
Die REM-Schlafphase führte mich zurück zur Asphaltfräsmaschine, die hatte unter dem Licht der Straßenlaterne ein Kreuz in die verbliebenen Teerschichten gefräst. Ich versuchte, schärfer zu sehen. Eine eindeutig weibliche Person war dort eingebettet, vernagelt mit Bügelklammern, unfähig, sich zu bewegen. Ein Mann, dieser Gunar, lachte mich fies an, gab den Wink, die monströse Maschine in Bewegung zu setzten.
»Stopp!« Ich kämpfte mit mir, nicht ins Schreien zu verfallen. Die rotierende Fräswalze bewegte sich träge vorwärts, hatte aber bereits die roten Pumps zerfetzt. Die kleinen Knöchelchen der Füße flogen wie scharfe Nägel umher, bohrten sich dabei in umstehende Verkehrsschilder.
Phalanges, Metatarsalia, Talus.
Ich konnte das Grauen nicht fassen. Kalter Schweiß brach mir aus.
Loses Fleisch wurde förmlich zu Brei verarbeitet. Sie kreischte unter Höllenqualen. Noch.
Tränen der Hilflosigkeit bahnten sich ihren Weg durch meine geschlossenen Lider. Mittlerweile hatten sich die Frässcheiben zu den Knien hochgearbeitet. Die Frau war zäh. Ihre Lider flatterten, doch die Augen wurden leer. Die Aussichtslosigkeit der Situation hatte sich in ihr Hirn gemeißelt.Wie konnte ich helfen? Ich musste doch etwas tun!
Atemnot nahm mich in Besitz. Ich vermochte nicht länger hinzusehen, aber gleichzeitig war ich unfähig, den Blick abzuwenden. Sie fixierte meine Augen, um Erlösung flehend und nun erkannte ich sie: Meine erste sexuelle Erfahrung, die Liebe für einen Abend, doch ich stand der Situation völlig machtlos gegenüber.
Das Becken war zerfetzt ... dann überfuhr die Maschine den leblosen Rest der einst stolzen Frau. Dabei zog die Fräse einen breiten, schmierigen Blutstreifen über den dunklen Asphalt.
Ich schrie wie am Spieß und wachte schweißgebadet gegen vier Uhr morgens auf. Allein. Es brauchte eine geraume Weile, bis ich mich sortiert hatte. Langsam begriff ich, es war nur ein böser Traum gewesen, der mich in diesen Zustand versetzt hatte.
Ich schälte mich aus dem nassen Laken, ließ mich einen Meter weiter am Tisch nieder und goss einen Wodka pur in Zimmertemperatur ein. Im Normalfall würde ich niemals einen Drink ohne Eis zu mir nehmen, aber außergewöhnliche Situationen erforderten Abstriche. Meine Geschmacksknospen empfanden den Alkohol als beruhigend.
»Gott sei Dank«, murmelte ich vor mich hin. »Nur ein Traum.« Der anstrengende Sex, - kein Traum - , verlangte Tribut, ergo legte ich mich wieder aufs Ohr. Der Schlaf riss mich erneut tief hinunter.
Gerädert vom nächtlichen Trauma stand ich um elf Uhr auf. Eine Dusche versprach Entspannung. Ein mittelprächtiger Schriftsteller hatte häufig dämonische Träume und es war mir verhasst, sogar sehr.
Das Gesicht war gerade frisch rasiert, da pochte es an der Tür.
»Moment!«
Wie sollte es anders sein, die Polizei, die immer paarweise anrückte. Entzückend.
»Herr ... Kappelmeier?«
»Das bin ich.«
»Hauptkommissar Vogt. Wäre nett, wenn wir uns kurz unterhalten könnten«, sagte der Kräftigere des Pärchens.
»Bitte kommen Sie herein.« Ich wies auf die Wohnlandschaft und bemerkte, dass der Zweite die Nase rümpfte. Müssten die mir nicht eigentlich aus der Hand fressen?
»Herr Cappelmeyer, bitte nehmen Sie platz.«
Das verhieß selten Gutes. Mein Gehirn spielte mir Streiche, vor meinem inneren Auge malte ich mir das Schlimmste aus, doch es sollte noch ärger kommen. Zu allem Übel hatte ich bisher keine Silbe, kein einziges Wort für den Roman geschrieben. Unerfreulicher noch, ich hatte nicht den geringsten Schimmer, worüber ich schreiben sollte, dabei hing meine Zukunft davon ab. Ich begann zu verzweifeln.
»Herr Cappelmeyer, haben Sie mir zugehört? Nein? Na fein. Sie wurden gesehen, wie Sie gestern Nacht mit einer Dame die hauseigene Bar verlassen haben ...«
»Das ist richtig.«
»Kannten Sie die Frau gut?«
»Kann ich nicht behaupten.« Faktisch wusste ich rein gar nichts über sie, nur dass sie die zärtlichste Frau war, die mir je begegnet war, doch mit dieser Information würden die Polizeibeamten herzlich wenig anfangen können.
»Dachte ich mir. – Waren Sie beide den ganzen Abend zusammen?«
Ich nickte heftig.
»Bis zum Einschlafen. Als ich aufwachte, war sie allerdings fort.«
»So so. Wissen Sie, Herr Cappelmeyer, in der Nacht ...«
Der Jammerlaut, der nun folgte, übertraf alles, was je meiner Kehle entsprungen war. In dem Moment, wo der Beamte von der Caterpillar erzählte, war es um meinen Geist geschehen. Nie zuvor fühlte ich mich leerer. Sie war eine Frau, die mich mit ihrer bezaubernden Art absolut eingefangen hatte, auf der Suche nach einem Mann, so simpel war das. Die Polizei hatte Mühe, noch ein vernünftiges Wort aus mir heraus zubekommen und trat unzufrieden den Rückzug an.
»Halten Sie sich bereit. Möglich, dass wir mit weiteren Fragen auf Sie zurückkommen müssen.«
»Klar, ich bin hier.«
»Sollte Ihnen noch etwas einfallen ist hier meine Karte.« Ich nahm die billige, weiße Visitenkarte entgegen und ließ sie auf das Tischchen fallen, weil ich sie eh nicht brauchen würde. Dann setzte ich den Wodka an, trank bis zur Neige. Sogleich bestellte ich eine weitere Flasche und befasste mich mit der Frage, wer in der Lage war, auf diese abartige Weise zu morden? Ich begriff den Sinn dieser Tat nicht. Mein Zerwürfnis mit der Welt hatte einen entscheidenden Wendepunkt erreicht. Im Hier und Jetzt zählte nur die Betäubung.
Irgendwann fiel ich volltrunken um. Im Geiste erschien mir die schöne Unbekannte, verabschiedete sich mit zarten Worten:
»Amos Cappelmeyer, vergiss mich nicht, bitte!« Dann Stille, nichts als Stille, die mir Frieden brachte.
Verkatert wachte ich am frühen Nachmittag, auf der Bettkante sitzend auf, was sehr eigenartig war, und fuhr zusammen. Mit verklebtem Mund und aufgedunsener Zunge entschlüpfte es mir:
»Du meine Güte, haben Sie mich ärschreckt! Aber verdammt, was suchen Sie in meinem Zimmer?«
»Wir haben noch einige Fragen an Sie. Dazu müssten Sie mich allerdings aufs Revier begleiten«, entgegnete der höfliche Polizist neutral.
»Kommt nicht in Frage. Bin doch nicht wahnsinnig.« Ich hatte eine reine Weste, war nur noch zu alkoholisiert, um überhaupt etwas zu sagen, geschweige zu schreiben.
»Sie weigern sich also?« Mühsam zwang ich meine Stimmbänder, mir zu gehorchen, und formulierte folgenden Ausspruch:
»Ich will nicht unhöflich sein, doch ich gehe nirgends hin. Ich habe mir gestern die Kante gegeben, nachdem die Bolizei mir unterbreitet hatte, wer die Tote war. Ein chinesisches Sprichwort besagt: »Das Leben meistert man lächelnd oder überhaupt nicht«, und jetzt verzieh dich aus meinem Zimmer, du Lutscher!«
Seine Höflichkeit fand ein jähes Ende. Ich hätte gewarnt sein müssen.
Seine Faust prallte ungebremst in meine Visage, Blut spritzte. Ich sank zu Boden. Bevor ich Gelegenheit bekam, die Auslegeware voll zu bluten, zerrte der Befehlsempfänger mich auf die Bettkante. Mir dröhnte der Schädel. Auch das Anbrüllen meiner Person von Angesicht zu Angesicht brachte keine Lösung. Ich durfte nur seinen üblen Atem riechen. Irgendwas mit Zwiebeln und Knoblauch, was für ein Gestank. Mir wurde noch elender. Überheblichkeit, verbunden mit einer Portion Frechheit, sollte den Tag rasch enden lassen, indem ich mit der Hand vor meinem Riechorgan herumwedelte.
Meine Liebste war bereits gestorben, warum nicht ihr folgen! Mein ausgestreckter Mittelfinger rief bei dem Kiberer das Rote im Auge hervor. Sein Gesicht verzog sich zu einer aggressiven Fratze. Eingeschüchtert war ich keinesfalls, bis erneut eine Faust Kontakt zu meinem linken Auge aufnahm. Mein Ich verabschiedete sich in die Dunkelheit ... Knock-out in der zweiten Runde, dabei sackte ich zu Boden. Der Polizist hatte ein neues Hobby gefunden, nämlich meine Fresse zu polieren. Mittlerweile war ihm der Teppich egal. Später verließ er den Raum, mit einem Gruß von Alfred.
Hä? Hatte ich richtig gehört? Wer zum Geier war dieser ominöse Alfred?
Konnte nicht einmal etwas halbwegs glatt laufen in meinem Leben?
Dann versank ich im Land der Finsternis.
Wie lange war ich weg gewesen?
Ich erwachte und ein Geräusch ertönte, das ich nicht zuordnen konnte. Krampfhaft versuchte ich, mich zu konzentrieren. Was war das nur? Gnädigerweise legten meine Gehirnzellen schließlich die Lösung parat:
Das Zimmertelefon schrillte bis zum Erbrechen. Unter brutalen Schmerzen, mit letzter Kraft hievte ich mich so weit hoch, dass ich nach dem Hörer langen konnte:
»Wer stört?«
»Herr Cappelmeyer? Frau Seeling, vom Verlagshaus Kniebrecht in München«, flötete eine weibliche Stimme. »Wir wollten uns erkundigen, wie Sie vorankommen mit Ihrem Werk. Es bleibt schließlich nicht mehr viel Zeit übrig. Können Sie uns eventuell schon etwas dazu berichten?« Ganz mieses Timing, schrie ich innerlich gequält, antwortete jedoch gewohnt optimistisch, direkt raus:
»Frau Seller, Schätzchen, pass mal gut auf: Mein Abgabetermin ist in fünf Tagen, wenn ich nicht irre? Also, warum nerven Sie derweil nicht einen anderen Autor, Sie Nymphe? Und rufen Sie bloß nicht wieder an!«
»Ich darf ja wohl sehr bitten! - Weder heiße ich Seller noch bin ich Ihr Schätzchen, Sie schmieriger alter Sack! Was bilden Sie sich ein?«
Jetzt hatte sie sich bestimmt ins Höschen gemacht, ihre überdrehte, schrille Stimme verriet sie. Aber, ob es mir nun gefiel, oder nicht, war es ein Weckruf, endlich mit meiner Arbeit loszulegen. Nur worüber schreiben? Noch immer hatte ich kein Thema gefunden. Ideen waren bei mir auf der Flucht, oder sollte ich sagen, es hing ein Fluch über mir.
Wie auch immer, ich brauchte eine Dusche. Im Spiegel erkannte ich mich selbst nicht mehr. Das Wasser hämmerte auf meine mit Blutergüssen übersäte Haut. Am übelsten war mein linkes Auge zugerichtet. Damit konnte ich kaum etwas sehen, nur durch einen schmalen Schlitz und auch nur verschwommen.
Der Schweißgeruch war abgewaschen, das Blut der vergangenen Stunden den Abfluss hinuntergespült. Nur zwei jämmerliche Sätze frische Wäsche füllten meine Reisetasche? Ich streifte mir die Sachen über, ein quietschbuntes Hawaiihemd und eine Kaufhallen-Niethose, der Hut durfte auf keinen Fall fehlen. Jetzt sah ich endgültig wie ein verwegener Gangster aus, fehlte nur noch ein adäquates Schießeisen im Hosenbund. Heute lastete die alte Jacke unendlich schwer auf meinen Schultern, was ich mir durch die Prügelmale erklärte.
Ich verließ das Zimmer, mein Bedarf an Dresche war gedeckt. Den Hut tief ins Gesicht gezogen, suchte ich die Flucht aus dem Hotel. Doch kurz vor dem Ausgang wurde ich aufgehalten.
»Herr Cappelmeyer, nicht so hurtig! Hier ist eine Nachricht für Sie.« Im Eingang überreichte der Concierge mir einen schmierigen Zettel, der unbedarft in die Innentasche der Jacke wanderte.
»Danke«, murmelte ich zwischen geschlossenen Lippen.
Die Sonne brachte alles an Licht hervor, sodass ich für einen Moment nur wenig von meiner Welt zu sehen in der Lage war. Vergeblich probierte ich, die Hutkrempe noch tiefer zu ziehen. Ich hatte einen Plan: Einfach geradeauslaufend, suchte ich die nächstbeste Konditorei, ein Konzept, das in jeder Stadt früher oder später zum Erfolg führte. Mich dürstete nach einer gepflegten Tasse Bohnenkaffee. Die Menschen, die mir entgegenkamen, rümpften die Nase und schlugen weite Bögen um mich. Mir war eh nicht nach Reden, besonders nicht, nach den letzten Stunden.
KapitelDrei
Erbarmen
Den ohne Wurzeln wird der Wind davontragen. (Unbekannt)
Die Frau im Café trug Trauer und haderte mit sich selbst, dabei starrte sie in ihren Latte Macchiato mit Sojamilch. Sie saß zurückgezogen in der hintersten Ecke bei den Toiletten, was nicht bedeutete, dass sie nicht mitbekam, was um sie herum vorging.
Beobachten gehörte zu ihrer Natur.
Da war diese junge Kellnerin, die Zoff mit ihrem Macker hatte, einem äußerst unangenehmen Typ, der aus seinen Eifersüchteleien keinen Hehl machte. Sie fragte sich, wie verkommen die Welt war. Als Vorgesetzte hätte sie den Störenfried längst nach draußen befördert.
Sie rührte noch einmal in ihrem allenfalls lauwarmen Getränk. Wie hatte sie hier landen können?
Eine rhetorische Frage, auf die sie die Antwort nur zu gut kannte. Sie war nach Wien gereist, um Abschied von ihrer großen Schwester zu nehmen. Die Geschwister hatten sich nicht sonderlich nahe gestanden, nicht wie es Schwestern sollten. Zwar telefonierten sie regelmäßig, aber die Distanz war einfach zu groß. Die Frauen lebten in verschiedenen Zeitzonen. Aber sie erschien als Letzte in der Anruferliste der Verstorbenen, der Grund, warum sie jetzt in Österreich war und nicht zu Hause oder wenigstens in einer pulsierenden Metropole wie Berlin oder Hamburg. Sie musste Hellen die letzte Ehre erweisen.
Aktuell betrat ein Mann das Café und bewegte sich zielstrebig auf die WCs zu. Mit dem hatte es Gott, oder wer auch immer dafür die Verantwortung trug, nicht gut gemeint. Er fühlte sich unwohl in seiner Haut und war bemühte, nicht aufzufallen, was völlig unmöglich war, denn allein seine Erscheinung mutete wie aus einer anderen Zeit an. Das Auffälligste am ihm war ein altertümlicher Hut, ein Stetson, wie sie als Amerikanerin wusste, den er tief ins Gesicht gezogen trug und auch nicht abzusetzen gedachte, als er am Nachbartisch platz nahm, ohne Notiz von ihr zu nehmen. Zum Glück. Sie wollte nicht reden.
Ein merkwürdiger Kauz. Irgendetwas stimmte mit seinem Gesicht nicht. Deshalb wahrscheinlich der Hut. Er blickte auf, um die Bestellung bei der genervten Bedienung aufzugeben, und sie sah Blutergüsse und Schwellungen. Wie ein Preisboxer wirkte der Mann nicht, auch die besten Jahre lagen schon hinter ihm. Aber als er sprach, fiel ihr die angenehme Stimme auf, auch wenn er leicht gereizt klang.
»Was darf`s sein?« Die grellrot gefärbte Servierkraft trug ihre Nase ziemlich weit oben, als sie mich das fragte.
»Eine Tasse Kaffee und ein Stück Apfelkuchen mit Sahne, bitte.«
»Also, ein Schümli und ein Apfelschlangerl mit Obers. Na, Sie könn`s noch vertragen«, und ging von dannen, die blöde Kuh. Sie entsprach so gar nicht meinem Typus Frau. Obwohl, ich war selbst kein Frauenschwarm. Bei diesem Gedanken legte sich ein leichtes Grinsen über mein lädiertes Gesicht. Die Kellnerin, die daheim einen Namen wie Chantalle, Mandy oder Jaqueline tragen würde, hieß Solveig und stellte den Pott Kaffee und meinen geliebten Apfelkuchen mit Sahne auf den Tisch, ohne mich eines Blickes zu würdigen.
»Bitt`schö. Haben`s auch Geld dabei?«
Es stand ergo noch böser um mich, wie befürchtet. Ich war gewappnet: Triumphierend wedelte mein letzter Hunderter Barvermögen unter ihrer Nase und meine Schlagfertigkeit holte zum Finale aus.
»Ach, und Schätzchen, keine Sorge, dich könnte ich auch bezahlen!« Die Gesichtsfarbe ihrer Haarpracht angepasst, knallte sie mir das Wechselgeld von 91,55€ auf den Tisch und verschwand schnaubend. Schlürfend genoss ich den dampfenden Kaffee, verfeinerte ihn mit Sahne vom Teller. Der Kuchen war ausgezeichnet.
»Wo ist der Dämlack?« Ein Schrank von einem Mann stürmte das Café, fegte die Stühle in seinem Weg an die Seite, wie Streichhölzer. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen, die Sicht auf ihn versperrte meine Hutkrempe. Eine weibliche Reibeisenstimme vom Nachbartisch stellte unmissverständlich klar, sollte er Hand an mich legen, würde Mr. Gipskopf sich tot auf dem Boden liegend wiederfinden.
»War`n Missverständnis«, murmelte der Koloss handzahm und trat den Rückzug an. Was wurde hier gespielt?
»Vielen Dank, aber das hätte ich locker allein geschafft«, behauptete ich, dann voller Wehmut: »Für mich hat sich noch nie jemand eingesetzt!«
»Doch, ich soeben. Das würde ich auch wieder tun, seien Sie gewiss!«, erwiderte die Dame vom Nebentisch mit einem leichten Akzent, während sie in ihrem Latte Macchiato herumrührte und den Löffel abschleckte. »Es sei denn, Sie erweisen sich als Arschloch.«
Nun wollte ich sehen, wer da eine starke Etikette vertrat. Als ich den Kopf hob, dachte ich zu träumen; eine zierliche Frau, wie ein Engel, mit langen kastanienbraunen Haaren, die sie zu einem strengen Dutt trug, in konservativen Schwarz gekleidet. So ein Persönchen hatte den Neandertaler in seine Schranken verwiesen? Ein schiefes Lachen huschte über mein geschundenes Gesicht. Kopfschütteln. Doch das Schießeisen, das sich hart in meine Eier schob, rückte mein Weltbild wieder zurecht. Natürlich hatte ich keine Angst, sie hatte die gleichen Augen wie meine schöne Unbekannte. Kitty? Ein alter Sack saß einer traumhaften Frau gegenüber, die mit ihrem Schießeisen genau auf seine Kronjuwelen zielte. Meine Aufmerksamkeit war ihr zu 100 Prozent gewiss, so viel stand fest.
Sie berichtete mir vom Verlust ihrer geliebten Schwester, dabei kullerten der harten Lady Tränen der Trauer über das makellose Gesicht. Im Roman käme jetzt mein Einsatz, doch ich trug nur selten Taschentücher mit mir herum. Sollte ich ihr erzählen, dass ich möglicherweise ihre Schwester gepimpert hatte? Ich hörte lieber weiter geduldig zu. Zu meiner Beruhigung wanderte ihre Knarre in die geräumige Marken-Handtasche. Meine Eier hätten ihr auf der Stelle huldigen können. Sie setzte sich um, links neben mich, lehnte sich an meine Schulter. Sie erzählte mir, ihre Schwester habe sie in der fraglichen Nacht noch angerufen und berichtet, dass sie endlich den Mann gefunden habe, der sie so mochte, wie sie war.
»Was habe ich mich gefreut für meine Schwester! Sie müssen wissen, seit ihrer Scheidung überkam sie nach und nach die Einsamkeit. In der Nacht klang sie glücklich, wie ewig nicht mehr. Sie hat zwei Kinder ... Ach, entschuldigen Sie bitte, ich heule Ihnen die Ohren voll und habe mich noch nicht vorgestellt, wie unhöflich von mir. Mein Name ist Audrette Miller.«
»Audrette? Was für ein hübscher Name. Ausgefallen. Ich bin Amos Cappelmeyer aus Thüringen, aus der verträumten Gemeinde Floh-Seligental.«
»Hocherfreut, Herr Cappelmeyer aus Floh-was?«
»Floh-Seligental. Keine Sorge, das kennt kaum jemand. Sind Sie eine echte Amerikanerin? Ich meine nur, Sie sprechen hervorragend Deutsch.« Ihr Schmunzeln ließ mir das Herz aufgehen.
»In der Tat besitze ich die amerikanische Staatsbürgerschaft. Liegt daran, dass ich im Alter von elf Jahren mit meinem Vater in die Staaten gegangen bin. Meine Schwester blieb bei unserer Mutter.«
»Interessant. Dürfte ich nach dem Namen Ihrer werten Schwester fragen?«
»Meine Schwester hieß Hellen, Hellen van Dijk. Wieso?«
Der Tränenfluss war nicht mehr zu bremsen, wie ein alter Köter heulte ich das Lokal zusammen. Schließlich hatte sie doch noch einen echten Namen bekommen.
Das Schießeisen bohrte sich zum zweiten Mal unerbittlich in meine Eier. Jetzt war ich geliefert.
»Was soll der Bullshit?« Ihr Blick wurde eiskalt, hasserfüllt.
»Oh nein, das ist ein Missverständnis! Hören Sie ...« Es gab nur den einen Ausweg, nämlich ihr alles anzuvertrauen. Ich begann mit den Ereignissen im Verlag. Dass ich ein drittklassiger Autor war, einen packenden Roman innerhalb von sieben Tagen abzuliefern hätte und dafür eine stattliche Summe einstreichen konnte. Im Falle meines Scheiterns, verlöre ich mein Haus im Grünen. Sie legte nachdenklich den Zeigefinger an ihre Nasenspitze.
»Was ist das für ein Quatsch? Warum dein Haus? Verstehe ich nicht.«
»Was weiß ich. War mir egal, habe nur die verdammten Euros gesehen.«
»Na schön. Aber soll das ein Zufall sein? Von einem solchen Vertrag habe ich noch nie gehört. Ist was Besonderes an deinem Haus, Cappelmeyer?«
»Nein, ganz und gar nicht. Es ist alt. Ich habe ein nettes Grundstück, die Luft ist sauber, mehr nicht.«
»Klingt aufregend«, grinste Audrette. »Schön blöd, in einer Woche einen kompletten Roman schreiben zu wollen.«
»Finde ich nicht. Na ja, also ...«, stotterte ich betreten. »Der schon wieder.« Der Hüne kreuzte erneut auf, mit hochrotem Schädel, hatte sich wohl am Kiosk um die Ecke Mut angetrunken.
»Der nervt.« Audrette spannt den Hahn ihrer Knarre. Sie war es leid, von dem hirntoten Mammut unhöflich von der Seite angequatscht zu werden, und richtete den Lauf auf seinen rasierten Schädel.
»Sehen Sie nicht, dass hier zwei kultivierte Erwachsene ernsthafte Gespräche führen?« Mit gewichtiger Stimme forderte sie den Neandertaler auf, lieber seine Alte anständig zu vögeln, dann würde die auch keine alten Säcke derart herablassend behandeln.
Bravo. Meine Meinung. - Bis auf den Teil mit den alten Säcken ...
Der Koloss brüllte zur Abwechslung sein Mädchen an. Es endete mit einer schallenden Ohrfeige, welche die Bedauernswerte gegen die nächste Wand beförderte. Da platze meiner neuen Bekanntschaft der Kragen.
»Das darf doch nicht wahr sein!« Sie platzierte ihre Waffe neben der Kaffeetasse, winkte Mr. Schrankwand zu sich, der aufs Wort gehorchte und antrabte, nur um von Audrette einen ordentlichen Tritt in die Kronjuwelen verpasst zu bekommen. Alleine das Zusehen schmerzte. Der zweite Tritt mit den Highheels quer durch die Hackfresse bescherte ihm ein breites Joker-Grinsen, dann sackte er zu Boden, wie ein gefällter Baum. Audrettes Gesicht spiegelte keinerlei Emotionen. Sie zupfte an ihrem Kleid rum und setzte sich wieder neben mich, als wäre es das Normalste der Welt.
»Also, wo waren wir eben stehengeblieben?« Trocken antwortete ich:
»Kleines, du hattest deine Knarre in meine Eier gebohrt, wolltest den Verdacht ausschließen, dass ich der Mörder deiner geliebten Schwester bin.«
»Richtig.« Der Hahn rastete zwar ein, was als Erfolg gewertet werden mochte, doch sie fixierte mich weiter mit ihren Blicken. Kein Wimpernzucken, nichts ... Das rief mir folgendes chinesische Sprichwort ins Bewusstsein: »Frauen tragen die Hälfte des Himmels.« Bei Audrette konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Plötzlich lächelte sie wie ein Honigkuchenpferd:
»Du stehst auf chinesische Sprichwörter?«
Ich nickte. Im Stillen keimte die Frage auf, ob diese Person mein Gegenstück sein sollte? Der Kaffee war längst erkaltet, meine Augen klebten an der Amerikanerin. Schwermütig meinte sie:
»Ein Weg entsteht erst, wenn man ihn geht.« In dieser Sekunde stand für mich fest, sie war mein YIN. Audrette, so zierlich und zerbrechlich sie wirkte, war in Wahrheit ein Vulkan. Sie wünschte sich von mir, sie zu der Beerdigung ihrer Schwester zu begleiten.
»Ist doch eine Frage der Ehre!«
»Die Leiche ist freigegeben und wird Morgen zur Mittagszeit beigesetzt. Allerdings gibt es ein kleines Problem. Ich habe versäumt, für heute Nacht ein Zimmer zu buchen. So was Blödes.« Ich zuckte die Achseln.
»Also, ich sehe da kein Problem. In meiner Unterkunft sind gewiss noch Zimmer frei. Wenn du keinen Wert auf Luxus legst, meine ich.«
»Du hast nicht zufällig ein Doppelzimmer? Ich dachte bloß, das würde Zeit und Geld sparen. - Bilde dir nichts darauf ein. Ich bin praktisch veranlagt.«
»Das bin ich auch.« Ungläubig deutete ich in Richtung meiner Unterkunft. »Sind nur ein paar Gehminuten.«
»Na dann, worauf wartest du noch?« Wir plauderten angeregt über das eine Thema, das uns verband, Hellen, auch als wir längst vor dem Hotel standen. Es war eine meiner unlogischsten Entscheidungen. Einerseits liebte ich ihre Schwester Hellen, – ein merkwürdiges Wort in Bezug auf eine Frau, die ich nur einige Stunden kannte, – doch andererseits fühlte ich mich von Beginn an zu Audrette hingezogen. Dennoch blieb da dieses Unbehagen in meiner Magengegend. Alldieweil hätte ich eine Person an meiner Seite, die in der Lage wäre, mich zu beschützen. Mich beschlich dumpf das Gefühl, dass dieser Faktor nicht ganz unerheblich sein würde.
»Wollen wir reingehen?« Ich ergriff ihre Hand und stolzierte mit ihr an meiner Seite ins Foyer. Kurz meldete ich meine Eroberung an. Der Rezeptionist trug Frau Miller vorschriftsmäßig in den Computer ein.
»Gerne, der Herr. Ich setzte den zweiten Gast auf die Rechnung.«
»So soll es sein.« War das etwa Ungläubigkeit in seiner Mine? Ich nahm den Zweitschlüssel in Empfang, tippte mir an den Hut, dann erklommen wir die abgewetzten Stufen zur dritten Etage.
»Kein Aufzug?«, kam die unweigerliche Frage. Doch schon waren wir im passenden Flur. »Ist das nicht dein Zimmer da vorne links, die Nummer 6?«
»In der Tat.« Die Zimmertür stand einen Spalt weit offen. Ich könnte Stein und Bein schwören, das ich die Türe fest zugezogen hatte, und zuckte die Schultern. Kein Licht. »Da ist doch was faul!« Audrette hielt mich am Arm zurück, den Zeigefinger an die Lippen gelegt, dann kramte sie ihre Bleispritze aus den Tiefen der Tasche hervor und stöckelte selbstsicher voran. Zuerst knipste sie das Licht an.
»Damn, ich hab`s gewusst.« Eine Verwüstung meiner Wohnlandschaft konnte nicht übersehen werden, doch für Audrette legte sich im Chaos ein Muster dar, welches sie mit dem Smartphone fototechnisch dokumentierte.
»Oh nein! Nicht der Computer!«, entfuhr es mir beim Anblick der auf dem Boden entleerten Notebooktasche, dabei glich der tragbare Computer einem gefalteten Buch.
»Das ist zu nichts mehr zu gebrauchen«, diagnostizierte meine Begleiterin. Ja, das zu erkennen bedurfte keines Genies. Wie sollte ich jetzt auf die Schnelle ein Buch schreiben? Mit der Hand, auf die alte Art? Lachhaft. Panik keimte in mir auf, alles Blut sackte in meine Füße.
»Hey, Amos! Alles klar? Du bist plötzlich so bleich geworden. Du hast doch deine Daten gesichert?« Nicken. Keine Lüge. Nichts multipliziert mit nichts ist dann wohl - nichts. Aber das brauchte sie nicht zu wissen. »Na dann.«
Audrette kickte die Pumps in den Raum, entkleidete sich bis auf die Haut, um dann in Windeseile die gesamte Wohnlandschaft aufzuräumen. Sie war mit einem traumhaften Apfelarsch gesegnet und Titten, klein und knackig. Zum Anbeißen, nur der Urwald ihrer Scham brannte mir einen Schauder auf die Netzhaut. Kaum fertig mit Aufräumen, ließ sie sich mit der Hotelleitung verbinden, der sie ein Ultimatum auferlegte.
»Entweder ist in einer Stunde ein neues modernes Notebook auf den Namen Amos Cappelmeyer auf diesem Zimmer, oder ...« Nur Minuten später klopfte es, wer hätte das gedacht? Unsere vielsagenden Blicke waren schon jetzt die eines eingespielten Teams. Die Waffe verborgen hinter dem Rücken, blieb sie ansonsten, wie Gott sie geschaffen hatte. Aus ihrer Position hatte sie den Tisch im Rücken und die Tür im Blick.
»Mach auf«, befahl sie. Ich weiß, sie wollte das Überraschungsmoment auf ihrer Seite wissen. Dem Hoteldirektor klappte, wie zu erwarten, die Kinnlade hinunter, als er die Frau im Evakostüm erblickte. So lag die gesamte Aufmerksamkeit bei ihr, ich war nur schmückendes Beiwerk. Das Handy in der einen Hand und die neun Millimeter in der anderen, trat sie so nah an den Hotelier heran, dass der hätte eigentlich erblinden müssen. Selbst ich konnte von der rassigen Lady noch etwas lernen, obwohl ich von dieser speziellen Methode absehen würde, nach meiner peinlichen Erfahrung.
»So meine Lieber, schau dir die Fotos an. Na? Das gefaltete Notebook kannst du mitnehmen und entsorgen. Ich gebe dir exakt eine Stunde Zeit, um den Schaden zu beheben. Ansonsten findest du dein Hotel in der Presse wieder.« Sein frisch rasiertes Gesicht begann zu glühen.
»Was? Nein, nein, ich meine ...« Dann schmetterte sie ihm die Tür vor der Nase zu. Er hatte gar keine Chance.
»Eine Stunde!!« Mich lächelte sie an: »Fortan ticken die Uhren anders in deinem Leben. Das ewige Herunterputzen findet mit diesem Tage ein Ende!« Mich packte die Ehrfurcht und ihre resolute Art machte mich an. Jedoch fuchtelte sie mit der Waffe vor meiner Nase rum, was ich überhaupt nicht leiden mochte.
»Könntest du vielleicht ... Was ist das überhaupt für eine Verbindung zwischen dir und dem Schießprügel?« Sie legte ihr Werkzeug auf dem Tisch ab, aber sollte ich auf eine Antwort gehofft haben, war ich schief gewickelt.
»Wir haben eine Stunde. Willst du bloß quatschen?« Sie sprühte vor Elan. Mein Blick traf unweigerlich auf ihren Urwald, damit schrumpfte mein Verlangen nach ihrem Schoß auf ein Minimum. Doch ihre Lippen suchten die meinen. Mich traf ein Blitzschlag der Sinnlichkeit, von nur einem Kuss. Sie warf einen diskreten Blick auf das Oberhaupt in der Hose, der einen Versuch unternahm, sich durch den Stoff zu bohren.
»Bin gleich zurück. Nicht weglaufen.« Sie verschwand im Bad. Keine Viertelstunde später stolzierte eine majestätische Gazelle heraus. Audrette zelebrierte ihren Auftritt. Heiliger Strohsack! Sie war vollends rasiert. Ein Traum von einer Frau, nur einen Zentimeter vor meiner Nase, die den Duft einer Blumenwiese versprühte. Ein fester Handgriff in meine Hoden unterstrich ihren Anspruch.
»Uns bleiben fünfundvierzig Minuten. Die Uhr tickt.« Ich küsste sie zärtlich, verzog aber schmerzvoll das Gesicht. Momentan keine gute Idee. Meine Finger tänzelten über ihren Rücken, wir verloren uns in der Glückseligkeit. Der Blick nach unten musste von ihr kommentiert werden:
»Nicht schlecht, mein Lieber.«
»Nicht schlecht? Du wirst noch dein blaues Wunder erleben.« Ich trieb die Lady vor mir her, bis der finale Stoß meiner Lenden den kläglichen Rest ihres Verlangens aus ihr herausgepresst hatte. Ihr erster Orgasmus seit Langem, wie sie mir später gestand. Ich vermochte kaum Vergleiche zu ziehen, aber es war mindestens genauso grandios wie mit ihrer Schwester.
»Wer hat dich überhaupt so zugerichtet? Sieht übel aus«, kam die Sprache letztlich auf mein entstelltes Gesicht.
»Ach das, sieht schlimmer aus, als es ist. Das war ein Dämlack von Polizist. In meinem Hotel - einem anderen - gab es einen Mord. Danach noch der Vorfall mit Hellen, da ist er ausgerastet.«
»Stop! Was, redest du da? Ein Polizist? Mord? Seltsam. Davon hätte man doch in den Nachrichten hören müssen. Also, ich habe nichts mitbekommen. - Diese Österreicher sind ein eigenwilliges Völkchen.« Da konnte ich nur zustimmen. »Ich werde gleich mal im Netz nachlesen, was da passiert sein könnte. Sowas gibt`s doch gar nicht.«
Sie griff nach ihrem Smartphone und tippte die entsprechenden Suchbegriffe ein. Ohne Ergebnis. »Sag ich doch, da ist was oberfaul. Warte, ich probiere noch was anderes.« Sie ließ sich die Schlagzeilen der letzte Tage anzeigen und schüttelte den Kopf. »Fehlanzeige. Alles dreht sich um dieses Zugunglück bei Wels mit mehreren Toten und zig Verletzten. Wie sowas geschehen kann? Die Zahl der Toten hat sich auf fünf erhöht. Traurig.«
Es klopfte. Sie las die Uhr vom Display ab. »Auf die Minute. Hätte ich nicht erwartet.« Audrette nahm ihre Knarre auf, positionierte sich vor der Tür. Ihr Nicken gab mir zu verstehen, dass ich die Tür mit einem Ruck öffnen sollte. Der Hoteldirektor starrte Frau Miller auf die Hupen.
»Ich darf sehr bitten!« Ob das wohl noch ein Nachspiel habe. »Aber wenigstens pünktlich.« Sie öffnete den Notebookkarton auf seinem Arm, überprüfte den Inhalt auf Vollständigkeit. »Warum nicht gleich?« Als Entschädigung für das Anstarren, verlangte sie freie Essenswahl für die Dauer unseres Aufenthalts.
»Was Sie wünschen, gnädige Frau.«
»Danke und auf Wiedersehen.« In diesem Fall knallte ich dem Lackaffen die Tür vor der Nase zu. Audrette stellte mit einem Anflug von Stolz den Karton auf dem Tisch ab. »Das hast du prima hinbekommen«, lobte ich.
»Habe ich dann nicht auch eine Belohnung verdient?«
»Hast du.«