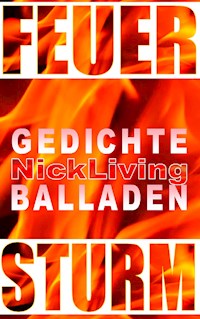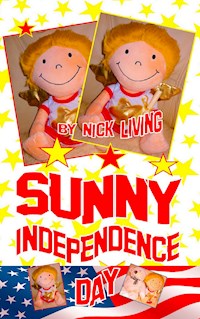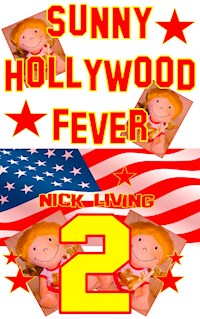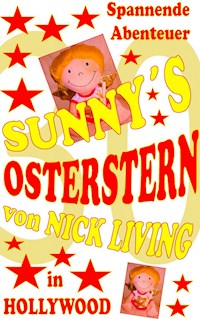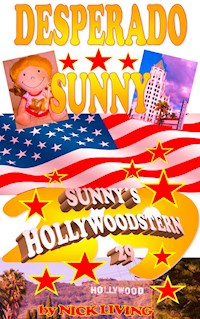Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ist wieder Geisterstunde bei Nick - und - was hat es mit dem Fluch vom Weinberg auf sich? Die Antwort darauf, und all die anderen unvorstellbaren und unglaublichen Begebenheiten, die einerseits berichtet wurden und andererseits geschilderte Geschichten sind, warten auf die Leser. Unfassbares für alle Altersgruppen, denn im zweiten Teil des Werkes werden lustige, wie auch spannende und gruselige Kindergeschichten erzählt. Am Schluss wartet noch eine schier unfassbare Geschichte aus der Stadt der Engel. Tja, Wahrheit oder nicht, es scheint wohl egal zu sein, denn es ist alles möglich, wenn man es nur zulässt. In jedem Fall aber sind alle Geschichten so unglaublich wie das Leben selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Geschichten und Berichte
Eiszapfen
Geldbörse
Gelbe Rosen
Verfahren
Die Bar
Einbruch
Der alte Helm
Der Fluch vom Weinberg
Ein Mordfall
Die Begegnung
Spritztour
Im Schwimmbad
Das Loch
Banküberfall
Späte Buße
Stadt der Engel
Discofahrt
Der Weihnachtsengel
Die Kette
Seemannsgarn
Der Traum
Wunschbuch
Letzter Arbeitstag
Jungbrunnen
Die Albträume des Steve Miller
Die Brücke
Schmetterlinge
Die Soße
Flug 2033
Friedas Speicherstick
Der Hauch des Lebens
Fantasien
Bommelmütze
Letzter Fall
Sandras Liebe
Die Hexe
Kredithai
Der Stein
Apotheke
Elfe
Kronleuchter
Knoten
Tattoo
Steppenbrand
Basecap
Flug ins Jenseits
Brunnen des Lebens
Erbschaft
Pullover
Gelber Eimer
Sunny´s Abenteuer
Nur ein Stückchen Stoff?
Der seltsame Pfarrer
Die weiße Frau von Hollywood
Die Erfindung
Der Krater vom Kirkwood Drive
Der König von San Diego
Der Geist von Wao Chung
Die verrückte Leuchtreklame
Das Atelier
Großvater
Eier mit Schinken
Die Hymne von Hollywood
Tempel
Der fremde Junge
Der Geist vom Theater
Der fliegende Bus
Heilquelle
Runen
Lift des Todes
Der verrückte Film
Der traurige Hollywoodstern
Die seltsame Tür
Kraft des Mondes
Der verwurzelte Hollywoodstern
Die Chronik von Hollywood
Der 4. Juli
Schmetterling
Praktikum
Lederjacke der Träume
Nordlicht
Das achte Weltwunder
Geist aus der Vergangenheit
Der weiße Fluss
Superklasse
Flugreise
Weihnachtsstiefel
Die alte Kiste
Wetterballon
Moped
Universal-City
Der Weihnachtsteddybär
Die Stadt der Engel
Los Angeles - Stadt der Engel
Geschichten und Berichte
Eiszapfen
Dieser Winter ist voller Leichen! So titelte eine namhafte Tageszeitung in Chicago und viele Leute, die jeden Tag aus dem Hause mussten, hatten große Angst. Dennoch musste es weitergehen und so versuchte man, das Unausweichliche, diese ständige Bedrohung zu verdrängen. Und dann geschah es wieder – erneut wurden zwei tote Menschen gefunden. Sie lagen einfach auf dem Bürgersteig und niemand wusste, was ihnen zugestoßen sein konnte, denn von einem Täter fehlte immer jede Spur.
Jerry Byrne hatte all die vielen Horrornachrichten verfolgt und wusste nun selbst nicht mehr, ob er das Haus noch einmal verlassen sollte oder besser nicht. Er wusste, dass es nicht möglich wäre, ohne den Job zu verlieren, einfach für eine unbestimmte Zeit daheimzubleiben und die Katastrophe auszusitzen. Deswegen nahm er sich vor, genau aufzupassen und sich ständig umzuschauen, während er durch die Straßen lief. Natürlich wusste er genau, dass es nicht möglich war, alles um sich herum unter Kontrolle zu haben. Aber ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit konnte keineswegs schaden. So verließ er das Haus und fühlte sich wirklich nicht wohl in seiner Haut. Sein Weg führte durch belebte Straßen und es sah wahrlich nicht so aus, dass ein verrückter Mörder hier herumlungern würde, um gleich loszuschlagen.
Plötzlich allerdings schrie jemand laut auf! Jerry fuhr herum und erschrak! Nicht weit von ihm entfernt lag ein junger Mann. Er bewegte sich nicht mehr und Jerry wusste sofort, was das bedeutete. Als er sich dem Fremden näherte, entdeckte er eine blutende Wunde an seinem Kopf. Vermutlich war der Mann von einem anderen erschlagen worden. Die schnell eintreffende Polizei wunderte sich schon gar nicht mehr, hatte sie doch längst mit dem nächsten Opfer gerechnet. Einer der Beamten meinte, dass es schon ein schwerer Gegenstand gewesen sein musste, mit welchem der Täter zugeschlagen hatte. Als die Leiche abgeholt wurde, lief auch Jerry weiter. Doch es war ganz seltsam, zwar hatte er einen solch furchtbaren Fall noch nie miterlebt, aber irgendetwas erschien ihm sonderbar. Er konnte es sich nicht erklären, aber er spürte es genau und eine innere Stimme meinte, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging.
Es hatte wieder zu schneien begonnen, da blieb er stehen und zog sein Mobiltelefon aus der Tasche. Er konnte einfach nicht ins Büro gehen und rief dort an, um sich einen Tag freizunehmen. Das ging recht einfach, denn er hatte unzählige Überstunden, und sein Chef hatte ihm schon vor Wochen das Abbummeln dieser Stunden angeboten. Nachdenklich setzte er sich auf eine Bank und schaute sich um. In diesem Winter hatte es wirklich stark geschneit und einen Blizzard hatte es auch schon gegeben. Die zahllosen Schneehaufen türmten sich an den Straßenrändern und die Leute hatten Mühe, sie zu umgehen. Auch die Autos fuhren vorsichtig und rutschten mehr als sie fuhren. Jerry stöhnte und konnte sich nicht erklären, was da in ihm opponierte, was ihn zu diesem Entschluss, heute nicht zur Arbeit zu gehen, bewog.
Sein Blick streifte die umstehenden Gebäude und die Dächer einiger niedriger Häuser. Dicke Eiszapfen hingen dort herb und schienen eine starke Bedrohung für die Menschen auf dem Bürgersteig zu sein. Aber halt… was war das… einige der Zapfen schienen sich zu bewegen. Jerry stutzte, rieb sich die Augen und schaute wieder hin. Kein Zweifel, die Eiszapfen bewegten sich, ganz langsam nur aber er konnte es sehen, ganz behutsam, beinahe in Zeitlupe bewegten sie sich hin und her. Diese sonderbare Bewegung glich beinahe dem Pendeln einer Uhr, aber wieso funktionierte das, w es doch gar nicht windig war? Plötzlich tat einer der Zapfen einen Satz und sauste hinunter. Unten spielte ein Kind im Schnee – der Zapfen fiel und fiel und das Kind sprang lachend durch die Schneehaufen. Gleich würde es von dem spitzen Zapfen getroffen, da sprang es in ein Haus und verschwand. Der Zapfen aber fiel nicht einfach so ins Leere. Er machte auf einmal eine scharfe Kurve und hätte das Kind die Haustür nicht hinter sich geschlossen, wäre er ebenfalls in das Haus gestürzt. Krachend zerschellte er an der Tür und Jerry sprang entsetzt auf, um zum Ort des Geschehens zu eilen. Offenbar hatte das alles kein Mensch bemerkt, jedenfalls nahm niemand Notiz von dem Geschehen. Jerry starrte zum Dach hinauf und bemerkte die sich bewegenden Zapfen. Sie schienen die Straße zu beobachten, aber wie war so etwas nur möglich? Es war doch nur Eis, gefrorenes Wasser sonst nichts, oder? Jerry wusste, dass er schnellstens handeln musste. Er rief die Polizei und versuchte die Leute davon zu überzeugen, einen anderen Weg zu nehmen, nicht unter diesem Dach entlang. Die Menschen schauten zwar ziemlich verdutzt, taten aber, wie ihnen geheißen wurde, und die Zapfen schienen gar nicht erbaut von Jerrys Handeln. Sie schienen sich untereinander zu verständigen, bewegten sich schneller als eben noch, und dann rissen drei von ihnen von der Dachkante ab. Wie Geschosse jagten sie zu Boden und Jerry wusste genau, was sie vorhatten. Sie wollten ihn treffen, wollten sich offenbar an ihm rächen, weil er sie entlarvt hatte. Unterdessen traf die Polizei ein und sperrte die Straße ab. Jerry schaffte es gerade noch rechtzeitig, sich in ein Haus zu retten, als auch schon die drei Zapfen hinter ihm an der Hausmauer zerschellten. Die Beamten, die all das mitverfolgt hatten, trauten ihren Augen nicht. Schnell sprangen sie in ihre Fahrzeuge und warnten die Menschen über Lautsprecher. Panisch rannten die Leute um ihr Leben, retteten sich in die Häuser und schon nach wenigen Minuten war die Straße menschenleer. Die Eiszapfen hatten das alles mitverfolgt und schienen wohl nicht so recht zu wissen, was sie nun tun sollten. Ein eintreffendes Panzerfahrzeug begann schließlich damit, die Zapfen vom Dach zu schießen. Dabei entstand zwar auch an den Dächern ein erheblicher Sachschaden, aber eine andere Möglichkeit gab es im Moment nicht, und die Zapfen konnten restlos beseitigt werden. Das wurde in den meisten Straßen getan und es herrschte über den gesamten Zeitraum Ausnahmezustand in der Stadt. Nach einer Woche war die schwere Arbeit geschafft und kein einziger Eiszapfen hing mehr an irgendeinem Dach. Auch hatte man die Dächer, die für eine solch starke Eiszapfenbildung infrage kamen, mit einer ganz bestimmten Chemikalie behandelt, die es verhinderte, dass sich neue Zapfen bildeten.
Als man die Zapfen, welche man von den Dächern geholt hatte, untersuchte, konnte man zunächst nichts Besorgniserregendes finden. Doch unterm Mikroskop zeigte sich Unglaubliches: Sämtliche Zapfen schienen mit einer Zellschicht überzogen zu sein. Es handelte sich hierbei um eine organische Schicht, die wohl irgendwie zum Leben erweckt worden war, wie auch immer das geschah. So konnten sich die Zapfen aus eigener Kraft bewegen, wie sie allerdings anstellten, über eine solch bösartige Intelligenz zu verfügen, blieb ein Rätsel. Über Jerrys heldenhaften Einsatz wurde noch tagelang in den Medien gesprochen und es schien, als wenn die Gefahr mit der Beseitigung der Eiszapfen für immer beseitigt worden sei. Es geschah nichts mehr, der Ausnahmezustand wurde aufgehoben und die Menschen liefen durch die Straßen als sei es nie anders gewesen. Schon bald zog der Alltag in die Stadt zurück und die mysteriösen Vorkommnisse mit den Zapfen verblassten.
Eines Abends tobte ein heftiger Blizzard über der Stadt und hohe Schneeberge hatten sich auf den Straßen und Bürgersteigen aufgehäuft. Auch die Dächer waren voller Schnee, doch die Chemikalie verhinderte zuverlässig, dass sich Eiszapfen bilden konnten. Jerry war in Gedanken, als er von der Arbeit nach Hause zurückkehrte. Es war sehr anstrengend, durch den hohen Schnee zu stapfen und der Winterdienst hatte einfach viel zu viel zu tun, um alle Straßen zu beräumen. Plötzlich schien sich einer der hohen Schneehaufen zu bewegen. War es ein Hund, der sich darunter verborgen hatte, eine Katze vielleicht? Offenbar war es nichts dergleichen. Als Jerry vorüberlief, stob der Haufen auseinander, fuhr hoch in die Luft, um gleich darauf wieder zum Erdboden zurück zu sausen. Jerry sah die Schneelawine auf sich zukommen und schaffte es gerade noch rechtzeitig, sich in sein Haus zu retten. Als er durch die Scheibe der Haustür nach draußen blickte, traf ihn beinahe der Schlag. Denn der Schneehaufen hatte sich bedrohlich vor die Tür des Hauses gesetzt und versperrte nun den Weg. Doch da war noch etwas, dass Jerry einfach nicht glauben konnte: In den Schnee war irgendetwas Merkwürdiges geschrieben, das in feuerroten großen Lettern leuchtete, als hätte es der Teufel in den Schnee geritzt. Jerry wusste genau, was das zu bedeuten hatte, und entzifferte entsetzt das grausige Wort, welches ihn selbst zu meinen schien:
RACHE!!!
Geldbörse
Norman lebte allein in einem winzigen Haus in den Hollywood Hills. Er hatte keinen Job und verdingte sich in Hollywood als Gelegenheitsarbeiter in der Hoffnung, eines Tages als Schauspieler entdeckt zu werden. Leider ließ dieser Erfolg auf sich warten und das Geld wurde knapper und knapper. So fuhr er an den Wochenenden zu seinen Eltern, die in San Jose lebten, und verlebte doch einige Tage, wo es ihm an nichts mangelte. Immer wieder hatten ihm die Eltern gesagt, nicht allein zu bleiben, vielleicht doch wieder nach San Jose zurückzukommen. Hier gab es Arbeit und Geld und außerdem war das Leben zu zweit besser, angenehmer und auch sicherer. Immerhin war dann stets jemand vor Ort, wenn es dem anderen so schlecht ging, dass er keine Hilfe mehr holen konnte. Norman aber schlug all die guten Hinweise in den Wind. Er war noch jung und mit seinen gerademal zwanzig Jahren wollte er sich nicht binden. Er hatte sogar Albträume, als biederer Familienvater am Abend mit Frau und Kind vorm Fernseher mit einer Flasche Bier in der Hand… nein, so sollte es wirklich niemals enden. Und so hoffte er einfach weiter auf den Traumjob, der doch nie kam.
An einem schönen Sommerwochenende allerdings schien alles anders. Diesmal sollte er nicht zu den Eltern kommen, weil sie ihn aufsuchen wollten. Sie wollten sehen, ob er sich wirklich wohlfühlte in seinem kleinen Häuschen und seine Mutter erwog heimlich, ein bisschen sauber zu machen und vielleicht die Wäsche zu waschen. Außerdem wollte sie ihm den Kühlschrank mal wieder richtig auffüllen, denn sie wusste genau, dass er das bitternötig hatte. Das Wochenende war wirklich sehr erholsam und die Eltern waren vollauf zufrieden, weil ihr Sohn eine saubere Wohnung hatte und sich auch sonst große Mühe gab, ein anständiges Leben zu führen.
Als sie sich am Sonntagabend wieder verabschiedeten, war die Jane, Normans Mutter sehr traurig. Aus irgendeinem Grund schien etwas auf ihrer Seele zu liegen und ihre Augen wurden feucht wie der Morgentau auf den Wiesen. Sie konnte sich einfach nicht von ihrem Sohne trennen und sie konnte sich das alles gar nicht erklären. Als sich der Wagen in Bewegung setzte, öffnete sie noch einmal die Scheibe und winkte Norman lange zu. Doch als er in der Dunkelheit verschwand, wurde sie noch trauriger. Ihre Schwermut schien beinahe grenzenlos und sie konnte es sich selbst nicht erklären, was es war. Sie sprach mit Bill, ihrem Ehemann und der versuchte, sie zu beruhigen. Allerdings wunderte auch er sich über die vermeintliche Unruhe seiner Frau. Schließlich konnte er nicht mehr weiterfahren, bog in eine kleine Schneise am Straßenrand und hielt den Wagen an. Die beiden Eheleute sprachen lange miteinander und liefen sogar ein kleines Stückchen durch den angrenzenden Wald. Als sie zum Wagen zurückkehrten, bemerkte Jane, dass irgendetwas auf der Rückbank lag. Als sie nachschaute, stutzte sie – es war Normans Geldbörse. Wie kam die nur hierher, Norman hatte doch gar nicht im Wagen gesessen. Wie konnte das nur sein? Nervös holte sie ihr Mobiltelefon aus der Tasche und rief bei ihrem Sohn an. Aber sie hatte keinen Erfolg. Obwohl sie wusste, dass Norman oft lange wach blieb, ging er doch nicht an sein Handy. Das fand sie sehr sonderbar und das ungewisse Gefühl schien sie beinahe auffressen zu wollen. Die Luft wurde ihr knapp und schließlich rief sie laut: „Komm, lass uns noch einmal zurückfahren! Da stimmt was nicht, ich spüre es genau!“ Bill rollte mit den Augen, konnte er sich doch nicht vorstellen, dass sein erwachsener Sohn nicht Manns genug sein sollte, seine Geldbörse vielleicht in den nächsten Tagen selbst abzuholen. Immerhin war ja nichts drin, was er hätte dringend gebrauchen können, leider auch kein Geld. Jane allerdings bestand auf der Rückfahrt und so kehrten sie kurzerhand um.
Als sie bei Normans Haus eintrafen, war alles dunkel und nichts deutete darauf hin, dass irgendetwas nicht stimmen sollte. Dennoch war Jane voller Angst und Panik und stürmte wenig später ins Haus. Und da sah sie das Unglück: Ihr Sohn lag bewusstlos am Boden und die Zimmer waren verwüstet. Bill rief schnellstens die Polizei, während sich Jane um ihren Sohn kümmerte. Der kam rasch wieder zu sich und es war ihm glücklicherweise auch nicht viel passiert. Schon nach wenigen Minuten ging es ihm wieder besser und die rasch eintreffende Polizei konnte wenig später auch die beiden Diebe fassen. Jane weinte und versprach, bis zum nächsten Tag zu bleiben. Und dann sagte sie mit bebender Stimme: „Hätte ich nicht deine Geldbörse auf der Rückbank des Wagens entdeckt, wären wir weiter gefahren… nicht auszudenken, was dann geschehen wäre!“ Norman, der schon wieder lächelte, stutzte ein wenig. „Meine Geldbörse? Wieso?“, stieß er erstaunt hervor und dann zog er seine Geldbörse aus der Hosentasche hervor, wo er sie stets aufbewahrte. Die Mutter war starr vor Schreck und Bill schüttelte ungläubig mit seinem Kopf. Wie war das nur möglich? Als er kurz darauf zum Wagen lief, um nachzusehen, konnte er es selbst nicht glauben – Normans Geldbörse, die eben noch auf dem Rücksitz lag, war nicht mehr da. Nachdenklich lief er ins Haus zurück, war jedoch froh, dass alles so gekommen war. Auf diese schier unfassbare Weise konnten sie ihrem geliebten Sohn zu Hilfe kommen, als er sie so dringend brauchte. Für Norman jedoch war dieser Vorfall ein Wink des Schicksals. Er sah ein, dass es wohl nichts brachte, auf diesem verlorenen Posten auf das große Glück zu warten, welches in Form einer Superrolle einer Filmgesellschaft daherkam. Er verkaufte schnellstens sein Haus und zog nach San Jose zu seinen Eltern, wo er schließlich Arbeit, eine kleine Wohnung und sein Glück in Form einer eigenen Familie fand.
Gelbe Rosen
Es war der dritte und letzte Verhandlungstag. Der arbeitslose Gauner Eddi Johns war angeklagt, den Banker James Miller aus Habgier ermordet zu haben. Auf einem Friedhof sollte er den Banker abgefangen haben, als dieser gerade dabei war, seinem Vater einen Strauß seiner geliebten gelben Rosen aufs Grab zu legen. Eddi wollte Geld von ihm. Doch als dieser ihm keines geben konnte, schoss er auf ihn. Der Banker starb noch auf dem Grab seines Vaters. Auch der starb vor wenigen Wochen unter merkwürdigen Umständen. Der Mord wurde von einem angetrunkenen Obdachlosen beobachtet, der sein Nachtlager in unmittelbarer Nähe des Grabes aufgeschlagen hatte. Eddi leugnete jedoch bis zur letzten Minute. Schließlich wurde er frei gesprochen. Denn obwohl man dem Obdachlosen glaubte, konnte die Waffe, mit welcher er umgebracht wurde, nirgends gefunden werden. Damit schien der Fall abgeschlossen. Eddi verließ als freier Mann das Gerichtsgebäude. Millers Mutter aber blieb verstört und allein gelassen zurück. Ihre Trauer war unbeschreiblich. Sie konnte den Verlust des einzigen Sohnes einfach nicht verkraften. Ihr ging es von Tag zu Tag immer schlechter. Ein klein wenig Trost fand sie bei ihren geliebten gelben Rosen. Überall im Garten hatte sie diese wunderschönen Blumen angepflanzt. Sehr oft sprach sie mit ihnen. Und gerade jetzt, wo sie in so kurzer Zeit hintereinander den Mann und den Sohn verlor, weinte sie sich bei ihren Rosen aus. Beinahe jeden Tag ging sie auf den Friedhof, um am Familiengrab, in welchem nun auch ihr geliebter Sohn lag, zu trauern. Jedes Mal nahm sie einen Strauß ihrer gelben Rosen mit. Sie konnte nicht mehr allein zu Hause sein. Zu schwer wog der Verlust. An einem Sonntag ging sie wieder einmal völlig verzweifelt zum Grab. Sie hatte zwei große Sträuße gelber Rosen bei sich. Als sie vor dem Grab stand, brach sie weinend zusammen. Dabei fielen ihr die Sträuße aus der Hand. Sie landeten auf der Wiese neben dem Grabstein. Als sie die Blumen wieder aufheben wollte, bemerkte sie etwas Glänzendes, welches sich unter den Blumen im dichten Gras verbarg. Als sie das Gras etwas beiseite drückte, erstarrte sie vor Schreck… im Gras lag ein Revolver! Sie holte den Friedhofsverwalter und der alarmierte die Polizei. Da sich der Fundort in unmittelbarer Nähe des Grabes befand, hatten die Ermittler einen ganz bestimmten Verdacht. Vermutlich war das die Waffe, mit der Eddi den Banker erschossen hatte. Der Revolver wurde auf Fingerabdrücke untersucht. Und wirklich – auf der Waffe fanden die Ermittler seine Fingerspuren. Eddi gestand alles. Doch beim Verhör gab es plötzlich Unklarheiten. Eddi beteuerte, die Waffe in einen Fluss geworfen zu haben. Er beschrieb sogar, an welcher Stelle er den Revolver ins Wasser warf. Die Ermittler untersuchten das gesamte Gelände, welches Eddi beschrieb. Doch einen Revolver fanden sie nicht. Dafür aber einen wunderschönen Strauß gelber Rosen. Irgendjemand hatte sie in den Papierkorb, der am Flussufer neben einer weißen Holzbank stand, geworfen. Einer der Ermittler nahm den Strauß aus dem Korb. Dabei fiel eine kleine weiße Tüte heraus. Darauf war der Schriftzug „Arsen“ zu lesen. Sofort wurde der Rosenstrauß zur Gerichtsmedizin gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Tüte ebenfalls Eddi gehört hatte. Denn neben den Fingerspuren, welche auf der Tüte gesichert werden konnten, fanden die Ermittler auch einen kleinen Notizzettel, auf dem der Name und die Adresse von Millers Vater standen. Es war eindeutig Eddis Handschrift! Nun konnte auch der rätselhafte Tod von James Millers Vater aufgeklärt werden. Als die Ermittler Eddi mit dem Rosenstrauß, in welchem sie die Arsentüte fanden, konfrontierten, bestritt dieser, jemals einen Rosenstrauß in seinen Händen gehalten zu haben. Er litt seit seiner Kindheit an einer seltenen Rosenallergie.
Verfahren
In den Sommermonaten war ich beinahe täglich mit meinem Fahrrad unterwegs. Da ich noch nicht sehr lange in diesem kleinen Dorf lebte, erkundete ich auf diese Weise die herrliche Umgebung. Auch an den Pfingsttagen des letzten Jahres war es so. Ich zog meine Fahrradkleidung über und fuhr los. Irgendwann landete ich in einem riesigen Waldstück. Es hätte ein wirklich herrlicher Ausflug werden können, wenn da nicht dicke Regenwolken ihre Last ausgerechnet über mir los werden mussten. Zu allem Unglück hatte ich mich auch noch verfahren! An einer einsamen Gabelung blieb ich stehen und schaute mich ratlos um. Doch ich wusste beim besten Willen nicht, in welche Richtung ich weiter fahren musste. Nirgends fand ich ein Schild und der dichte Wald verhinderte die Sicht. Ich wusste einfach nicht mehr, wo ich mich befand. So wendete ich und fuhr in die Richtung, aus welcher ich glaubte, gekommen zu sein. Doch der Weg endete im Dickicht des Waldes. Plötzlich sah ich einen jungen Mann in einem Jogginganzug. Er stand mitten auf dem Weg und winkte mir zu. Als ich näher kam, rannte er los. Ich verstand nicht, was das zu bedeuten hatte. Brauchte er Hilfe oder wollte er mir den Weg aus dem Wald zeigen? Lange überlegte ich nicht. Ich schnappte mein Rad und fuhr dem Mann hinterher. Hinter einer Biegung aber war er verschwunden. Wieder blieb ich stehen und wartete. Dann plötzlich erschien er wieder. Er stand einfach vor mir auf dem Weg und winkte unaufhörlich in meine Richtung. Und wieder rannte er los. Ich folgte ihm, doch es war so wie eben… Nach einigen Kurven verlor ich ihn aus den Augen. Ich konnte ihn nirgends mehr entdecken. Irgendwann stand ich vor einem kleinen Haus. Es war teilweise von Bäumen verdeckt, sodass man leicht an ihm vorübergehen konnte, ohne es zu bemerken. Ich stieg vom Rad, um mich zu orientieren. Aber der junge Mann zeigte sich nicht mehr. Da ich auch nicht wusste, wo ich mich befand, wollte ich in dem Haus nach dem Weg fragen. Vielleicht konnte mir dort jemand helfen. Ich ging auf die schmale Holztür zu und klopfte vorsichtig an. Dabei sprang die Tür einen Spalt weit auf. Vermutlich hatten die Bewohner vergessen, sie abzuschließen. „Hallo, ist jemand da!“, rief ich laut. Zunächst kam keine Antwort. Doch als ich noch einmal rief, vernahm ich deutlich ein seltsames Stöhnen und Wimmern. Obwohl mir nicht so ganz wohl war, trat ich ein. Noch einmal rief ich, ob jemand zu Hause sei. Und erneut vernahm ich das rätselhafte Wimmern. Langsam ging ich durch den schmalen Korridor. Hinter der nächsten Tür fand ich dann doch jemanden vor – ein Mann lag auf dem Boden und wand sich vor Schmerzen. Neben ihm lag ein Jagdgewehr. Vermutlich hatte sich ein Schuss gelöst. Als ich mich zu ihm herunter beugte, um ihm zu helfen, erstarrte ich… es war der junge Mann, den ich soeben im Wald gesehen hatte. Später stellte sich heraus, dass der junge Mann als Förster in dem großen Waldstück tätig war. An diesem Tage wollte er zur Jagd. Doch kurz zuvor erlitt er einen Kreislaufkollaps. Dabei fiel er auf das Gewehr. Es löste sich ein Schuss und verletzte ihn schwer. Wäre ich nicht rechtzeitig im Haus erschienen, wäre der Mann vermutlich gestorben. Hatte mich vielleicht der Geist des jungen Mannes zu seinem Hause geführt? Waren etwa seine große Not und seine Angst daran beteiligt, dass seine Seele mich zum Haus führte. Ich wusste es nicht und war froh, ihm noch rechtzeitig geholfen zu haben. Als der Mann endlich mit einem Notarztwagen abgeholt werden konnte, wollte auch ich wieder weiter fahren. Dabei fiel mir ein, dass ich ja den Weg nicht kannte. Ich hatte in dem Trubel einfach vergessen, nach dem Weg ins Dorf zu fragen. Da keiner mehr im Hause war und ich mein Handy nicht bei mir hatte, wollte ich das Telefon im Haus nutzen, um zu Hause anzurufen. Doch das funktionierte nicht. Ich konnte es nicht fassen! So viel Pech konnte man doch gar nicht haben. Genervt legte ich den Hörer auf die Gabel und schaute kurz aus dem Fenster. Doch was war das… ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Draußen auf dem Weg stand der junge Mann und lächelte zum Fenster hinüber. Dabei winkte er mir zu und rannte schließlich los…
Die Bar
Manchmal, wenn ich allein zu Hause sitze, erinnere ich mich an die alten Zeiten. Dann krame ich mir die alten Fotos aus dem Schrank und verbeiße mir so manche Träne. Ja, es war schon eine ereignisreiche Zeit, damals, vor 30 Jahren. Auf einem Foto entdeckte ich eines Tages auch unsere kleine alte Bar. Dort hatte ich damals meinen Ehemann Jim kennengelernt. Die Musik, der Blues… „What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong… ich höre es noch, als wären all die vielen Jahre nicht vergangen. Ich sah mich mit Jim an einem der wackeligen Holztische sitzen und Rotwein trinken. Ach, wir konnten uns damals kaum etwas leisten. Aber in die kleine Bar gingen wir dennoch immer, wenn wir Zeit hatten. Damals lebten wir noch in einem heruntergekommenen Zimmer mitten in Boston. Wenn wir miteinander tanzten, dann war es so, als kannten wir uns schon eine Ewigkeit. Und dann heirateten wir. Irgendwann zogen wir weg aus der Gegend. Dann kamen die Kinder… die Karriere… das Haus… die Scheidung. Tränen liefen mir übers Gesicht. In die alte Bar sind wir seither nie mehr gegangen. Ich klappte das Fotoalbum zu und beschloss, nach Boston zu fahren. Noch einmal wollte ich nach der Bar suchen… vielleicht gab es sie ja noch. Mir war nach Erinnerungen und die Neugierde ließ mir einfach keine Ruhe. Ich zog eine Jacke über, stieg ins Auto und fuhr nach Boston. Natürlich konnte ich mich nicht mehr genau erinnern, wo sich die Bar befand. Aber ich erinnerte mich noch, dass sie wohl zwischen zwei zierlichen runden Gebäuden stand, die aussahen wie Türmchen. Und tatsächlich, nachdem ich mich mehrmals verfahren hatte, entdeckte ich die winzige Seitenstraße mit den beiden Türmchen. Sogar die Bar gab es noch. Doch die Fenster waren vernagelt und das Schild überm Eingang, welches mir damals viel größer erschien, hing nur noch an einer alten Stromleitung und pendelte im Wind hin und her. Die Schrift darauf war nicht mehr zu erkennen. Ich erinnerte mich, dass wir damals heimlich, um nicht den Eintrittspreis zahlen zu müssen, durch einen Nebeneingang, den ausschließlich das Personal nutze, hinein gingen. Ich suchte nach diesem Nebeneingang. Und ich fand ihn. Er stand offen. Vorsichtig trat ich ein. Unter meinen Schuhen knirschten Glasscherben der zerbrochenen Fensterscheiben. Die schmale Treppe, die zum Tanzsaal hinauf führte, war total verdreckt. Überall lagen zerfetzte Zeitungen und Unrat herum. Es roch muffig und alt. Sogar die Pendeltür zum Saal gab es noch. Ich stieß sie auf und stand augenblicklich in meiner eigenen Vergangenheit. Durch die Spalten der Bretter, die vor die Fenster genagelt wurden, fiel etwas Sonnenlicht auf das zerschundene Parkett. Das Licht verfing sich im Staub des leeren Raumes und verzauberte ihn regelrecht. In der Mitte des Saales stand vergessen ein kaputter Stuhl herum. Ich setzte mich, und was dann geschah, erscheint mir noch heute wie ein Wunder. Als ich mit meinen Fingern an der Unterseite des Stuhles entlang tastete, stieß ich auf etwas Weiches, das unterm Sitzpolster klemmte… es schien Papier zu sein. Ich zog es hervor und betrachtete es. Es war eine alte Zeitungsseite aus dem Jahre 1976. Unter einem langen Text konnte ich ein Foto sehen. Es war schon recht vergilbt. Aber ich konnte genau erkennen, was… oder besser gesagt wer darauf abgebildet war… Jim und ich… wie wir auf dem Parkett tanzend unsere Runden drehten. Ich konnte es nicht fassen… wir beide… damals vor über dreißig Jahren… unbegreiflich. Mir schien es beinahe so, als sollte ich diese Zeitung finden. Denn plötzlich knackte es draußen vor der Pendeltür. Ich erschrak und schaute ängstlich zur Tür. Was, wenn irgendwelche Gauner hereinkämen? Oder vielleicht Obdachlose, die das verfallene Haus für sich okkupiert hatten? Doch es kam ganz anders… als das Knacken und Knirschen verstummte, stieß jemand die Pendeltür auf. Durch das staubige Sonnenlicht konnte ich zunächst nicht sehen, wer da gekommen war. Langsam erhob ich mich von meinem Stuhl. Und jetzt konnte ich sehen, wer dort stand… Jim! Er schaute mich an und wir sprachen kein Wort. Wie konnte das nur möglich sein? Woher wusste er, dass ich ausgerechnet heute hier sein würde? Ich konnte mir all das nicht erklären. Doch es war real… Jim stand wirklich vor mir! In diesem Augenblick spürte ich einen heftigen Stich im Herzen. Mir schossen die Tränen in die Augen… ich konnte meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Jim lächelte mich an und sprach noch immer kein einziges Wort. Und auch ich konnte nichts sagen… mir hatte es reglerecht die Sprache verschlagen. Das konnte einfach kein Zufall sein! Wir liefen aufeinander zu und umarmten uns. Wir konnten uns nicht mehr loslassen und in diesem Moment war es so, als gäbe es nichts, dass uns noch trennen konnte. Was für ein faszinierender märchenhafter Augenblick. Wir küssten uns und tanzten so wie damals unsere Runden – quer durch den Saal. Und wie im Märchen ertönte der alte Blues, zu dem wir schon damals getanzt hatten: „What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Wir konnten unser Glück nicht fassen. Stundenlang tanzten wir zu einer Musik, die eigentlich gar nicht da zu sein schien. Als es draußen langsam dunkler wurde, hielten wir uns noch immer in den Armen. Wir wussten in diesem magischen Augenblick genau – es musste ein Zeichen sein, dass wir uns genau zu diesem Zeitpunkt in dieser kleinen verfallenen Bar mitten in dieser riesigen Stadt wiederfanden. Es war fantastisch und unwirklich zugleich. Es war unfassbar! Als wir gemeinsam die Bar verließen, schien es uns, als wollte sie sich von uns verabschieden. Ein seltsam trauriges Gefühl schwebte in der Luft. Wir bedankten uns beim Verlassen des alten Gebäudes für diese wundervolle Schicksalsfügung. Und irgendwie schien es, als wünschte uns die alte Bar alles erdenkliche Glück dieser Welt. Jim und ich lebten seitdem wieder zusammen. Und es begann eine intensive und liebevolle Zeit, die wir dankbar entgegennahmen. Ein Jahr später, es war unser Hochzeitstag, wollte Jim wieder zur alten Bar zu fahren. Vielleicht konnten wir dort wie früher tanzen und dem alten Blues lauschen. Dazu nahm Jim einen kleinen CD-Player mit. Er hatte sich vor Jahren die CD mit unserem Lied gekauft. Wir fuhren nach Boston, doch das Gebäude, unsere kleine Bar zwischen den Türmchen gab es nicht mehr. Sie war weggerissen worden. An der Stelle, an welcher sie stand, befand sich nur noch ein Trümmerhaufen. Das Merkwürdigste aber war, dass wir neben dem Schutthaufen einen alten Stuhl fanden. Ich betrachtete ihn mir genau und fand die alte Zeitungsseite mit unserem Foto unter dem Sitzpolster. Ich zog sie heraus und steckte sie ein. Dann erkundigten wir uns in einem Antiquitätenladen ganz in der Nähe, wann das Gebäude weggerissen wurde. Die freundliche Inhaberin schaute uns irritiert an… offensichtlich wunderte sie sich über diese Frage. Schließlich meinte sie kühl: „Die Bar gibt es schon seit dreißig Jahren nicht mehr. Sie ist damals bis auf die Grundmauern abgebrannt. Seitdem liegt der Schutthaufen hier herum und keiner kümmert sich mehr darum…“. Wir konnten es nicht glauben. Doch plötzlich erklang Musik aus der Ferne… ein Blues, welcher uns beiden sehr bekannt vorkam und uns die Tränen in die Augen trieb: „What A Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Und wir tanzten in dem kleinen Laden dazu, als sei die Zeit niemals vergangen…
Einbruch
Bis heute kann ich mir nicht erklären, was in dieser furchtbaren Gewitternacht wirklich geschehen war. Aber ich kann mich noch immer an jedes einzelne gruselige Detail erinnern. Seit kurzer Zeit besaßen wir ein kleines Haus auf dem Lande. Wir hatten es uns im letzten Jahr gekauft. Ray, mein Ehemann, arbeitete in der Stadt als Rechtsanwalt. Und es gab Tage, an welchen er nicht nach Hause kam. Er musste sich mit Klienten treffen und sehr viel recherchieren. Da wir uns noch im Aufbau unserer jungen Familie befanden, musste er jedes Mandat annehmen. Wir brauchten einfach das Geld! Ich war im vierten Monat schwanger und saß oft allein zu Hause. Doch ich genoss den herrlichen Ausblick auf den Wald gleich hinter dem Haus. An jenem verhängnisvollen Sommerabend saß ich noch lange auf der Terrasse unseres Hauses. Seit geraumer Zeit las ich in einer alten Bibel, welche ich von meiner Großmutter zum letzten Weihnachtsfest geschenkt bekam. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein. Jedenfalls wurde ich von lautem Donnergrollen eines nahenden Gewitters geweckt. Irgendwie musste die Bibel herunter gefallen sein. Ich hatte sie jedenfalls nicht mehr in der Hand und dachte wegen des Gewitters auch nicht daran, sie zu suchen. Todmüde ging ich ins Haus und vergaß vermutlich, hinter mir die Terrassentür zu schließen. Das Telefon klingelte und Ray war dran. Er meinte nur, dass er auch an diesem Abend nicht nach Hause kommen könnte. So blieb ich also wieder einmal mutterseelenallein zu Haus. Unterdessen war das Gewitter sehr nahe und die grellen Blitze erzeugten sekundenlang merkwürdige Schatten im Zimmer. Plötzlich fiel das Licht aus und mein Telefongespräch mit Ray wurde unterbrochen. Nun war ich also auch noch von der Außenwelt abgeschnitten. Nachdem ich mir noch etwas zu trinken aus der Küche geholt hatte, ging ich nach oben ins Schlafzimmer. Trotz des Gewitters musste ich schnell eingeschlafen sein… jedenfalls wurde ich von einem lauten Knall regelrecht aus dem Bett geworfen. Es hörte sich an, als sei eine Tür vom Wind zugeworfen worden. Oder war es etwas ganz anderes… ein Schuss vielleicht? Ich fuhr hoch und knipste an meiner Nachttischlampe herum. Doch der Strom war noch immer nicht da. Neben meinem Bett hatte ich eine kleine Taschenlampe für Notfälle postiert. Und jetzt war ein Notfall! In mir kroch die Angst hoch – die Angst um mich und um mein ungeborenes Kind. Ich nahm die Taschenlampe und ging hinunter ins untere Stockwerk, wo sich das Wohnzimmer und die Wirtschaftsräume befanden. Aber da war nichts. Lediglich der Wind bewegte die offen stehende Terrassentür auf und zu und erzeugte dabei diese merkwürdigen Geräusche. Erleichtert wollte ich wieder nach oben, um mich ins Bett legen. Da knallte es erneut – diesmal jedoch schien es ganz nah und sehr laut zu sein. Plötzlich überschlugen sich die Ereignisse. Ich stand noch auf der Treppe, da bemerkte ich, wie ein Schatten von der Terrassentür zur Küche huschte. Und schlagartig wurde mir klar… ein Einbrecher musste im Haus sein! Wie angewurzelt verharrte ich auf der Treppe und schaltete die Taschenlampe ab. Ich wagte nicht einmal Luft zu holen. Doch irgendwann musste ich weiter gehen. Der Einbrecher durfte mich nicht zu fassen bekommen. Ich wagte nicht, mir vorzustellen, was er tun würde, wenn er mich entdeckte. Besorgt strich ich mit der Hand über meinen Bauch. Ich dachte in diesem Moment nur an eines… an mein Kind! Glücklicherweise war es eine Stahltreppe, auf der ich stand, so konnte sie wenigstens nicht knarren. Aber mein Pech schien in dieser Nacht nicht mehr enden zu wollen. Ich stieß mit der Lampe an das Metallgeländer…
Das dabei verursachte Geräusch war laut genug, um den Einbrecher auf mich aufmerksam werden zu lassen. Blitzschnell kam er aus der Küche gerannt und stand bewegungslos vor der Treppe. Zu allem Unglück kam auch noch der Strom wieder und das Licht im Haus schaltete sich ein. Nun konnte ich nur noch beten. Der Einbrecher hatte einen schwarzen Strumpf über sein Gesicht gezogen und einen Revolver in der Hand. Damit fuchtelte er wild in der Luft herum. So schnell es mir möglich war, rannte ich die Treppe nach oben, geradewegs ins Schlafzimmer hinein. Ein Schuss fiel… traf mich aber nicht. Hinter mir schloss ich ab und wartete. Ich durfte mich keinesfalls zu sehr aufregen, doch die Angst lähmte meinen gesamten Körper. Was, wenn der Einbrecher die Tür aufbrach? Was, wenn ich mein Kind durch den Schock verlor? Nein, so weit durfte es niemals kommen! Irgendeine Gerechtigkeit musste es doch geben. Wieder fiel ein Schuss… ihm folgte ein lauter Schrei. Dann wurde es schlagartig ruhig. Was war geschehen? Hätte der Einbrecher nicht längst hier oben sein müssen. Bange Minuten vergingen, in denen ich nicht wagte, die Tür wieder aufzuschließen, um nach dem Rechten zu schauen. Die Stille im Haus war unerträglich. Ich zitterte am ganzen Leibe. Mein Blick fiel zum Wecker auf dem Nachttisch… er zeigte „Viertel Zwei“. Plötzlich vernahm ich erneut ein Geräusch… es hörte sich an, als würden Schlüssel klappern. Das musste Ray sein! Oh mein Gott… endlich! Ich musste ihn unbedingt warnen. Hastig schloss ich die Tür auf und rannte zur Treppe. Es war tatsächlich Ray. Sprachlos und wie vom Schlag gerührt stand er in der Diele. Und auch ich blieb entsetzt stehen. Vor der Treppe lag der Einbrecher und rührte sich nicht mehr. Allerdings wimmerte und stöhnte er leise vor sich hin. Vermutlich war er gestolpert und mit dem Kopf auf das Treppengeländer gefallen. Dabei wurde er wohl bewusstlos. Ray erfasste sofort die Gunst der Stunde. In Windeseile holte er einen Strick aus der Küche und fesselte damit den Einbrecher. Unterdessen rief ich die Polizei. Die Beamten kamen schnell und der Einbrecher konnte festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen lange gesuchten Mörder handelte. Er hatte bereits eine Frau in einem benachbarten Ort überfallen und getötet. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Offensichtlich war ich noch einmal mit meinem Leben davon gekommen. Glücklich fiel ich Ray in die Arme. Vorsichtig streichelte er meinen Bauch… Und plötzlich sah ich auch meine alte Bibel. Sie lag neben der Treppe. Genau dort, wo wir den Einbrecher fanden. Nachdenklich schaute ich auf das Foto meiner Großmutter, welches an der Wand neben der Treppe hing. Darauf schien sie so seltsam zu lächeln und mir zu zuzwinkern. Bei der Rekonstruktion des Falles wurde herausgefunden, dass der Einbrecher über die Bibel gestolpert war. Ich war mir jedoch sicher, am Nachmittag auf der Terrasse in der Bibel gelesen zu haben. Und zwar ziemlich genau auch eine Textstelle in einem der Zehn Gebote:
„Du sollst nicht töten“
Der alte Helm
Ken hatte eine Schwäche für Motorräder. Er fühlte er sich schon wie ein Biker. Mit einer Harley durch die Gegend düsen… davon träumte er. Doch leider reichte sein Geld, welches er sich bei seiner Arbeit als Gelegenheitsarbeiter in einer kleinen Baufirma zusammensparte, nur für ein kleines klappriges Moped. Aber er achtete es sehr und freute sich, überhaupt ein Zweirad zu besitzen. Denn er hatte sonst keinen, der ihm irgendetwas geben konnte. Mit seinen Eltern lag er seit Jahren im Streit. Sie wollten nichts mit einem Arbeitslosen zu tun haben und enterbten ihn. Als er schließlich auch noch seine Wohnung verlor und als Obdachloser auf der Straße leben musste, blieb ihm nur noch das alte Moped. Aber seine großen Träume, irgendwann vielleicht doch noch mit einer Harley durchs Land zu fahren, verlor er nie. Auf einem Müllplatz neben der Brücke, unter welcher er nächtigte, fand er eines Tages einen alten rostigen Stahlhelm. Er strich ihn mit schwarzer Farbe an und probierte ihn auf. Er passte sehr gut zu seinem zerschlissenen Lederoutfit und stand ihm wirklich ausgezeichnet. So ausgestattet fuhr er, immer wenn er sich wieder etwas Geld erarbeitet hatte, mit seinem Moped durch die Straßen. An einem verregneten Morgen wollte er schon sehr zeitig los, um der Erste zu sein, wenn die Arbeit verteilt wurde. Er brauchte dringend Geld und konnte es sich an diesem Tage nicht leisten, zu spät zu kommen. Der Regen wurde immer stärker und leichter Nebel breitete sich über der Landstraße, welche in die Stadt führte, aus. Ken fuhr nicht sehr schnell, konnte jedoch kaum etwas erkennen. In einer Kurve verlor er plötzlich die Gewalt über sein Gefährt. Das Moped kam ins Schleudern und rutschte zur Seite. Kopfüber fiel er die Böschung hinunter, stieß mit dem Kopf an einen Stein und landete geradewegs in einem Kornfeld. Sein Moped krachte führerlos gegen einen Pfeiler und blieb dort liegen. Glücklicherweise hatte er den Stahlhelm auf dem Kopf. Dieser schützte ihn vor Kopfverletzungen, die er sich zwangsläufig bei seinem Sturz zugezogen hätte. Eine ganze Weile lag er so da und starrte in den Regen hinein. Dann erhob er sich und nahm den Helm vom Kopf. Doch was war das… im Inneren des Helms entdeckte er eine Nummer. Zunächst konnte er sich keinen Reim darauf machen. Doch über der Nummer entdeckte er ein winziges Zeichen, ein Symbol. Es kam ihm irgendwie bekannt vor… irgendwo musste er es schon einmal gesehen haben. Nur wo? Da er keinerlei Idee hatte, was es mit der Nummer und dem rätselhaften Symbol auf sich haben könnte, setzte er den Helm wieder auf und suchte sein Moped. Zwar war es sehr verbeult, aber es fuhr noch. So konnte er doch noch zur Arbeitsvermittlung fahren und bekam einen Tagesjob in einer Metallfirma zugeteilt, in welcher er schon sehr gejobbt hatte. Schon als er durch das Firmentor fuhr, wurde ihm einiges klar… Am Tor und auf dem Gebäudetrakt des Betriebes entdeckte er genau das gleiche Symbol, welches auch in seinem Helm eingeritzt war. Er konnte sich jedoch noch immer keine schlüssige Erklärung auf all das geben. Wieso war in seinem Helm ausgerechnet dieses Symbol eingeritzt? Am Nachmittag holte er sich seinen Lohn im Büro ab. Als er auf seinen Abrechnungszettel schaute, entdeckte er die Bankverbindung der Firma. Die Kontonummer glich der rätselhaften Nummer in seinem Helm bis auf die letzten beiden Ziffern. Wie ein Blitz schoss es Ken plötzlich durch den Sinn… die eingeritzte Nummer gehörte hundertprozentig zu dem Symbol der Firma! Vielleicht war es eine Kontonummer? Auf dem schnellsten Wege fuhr er zurück zu seinem geheimen Lager unter der Brücke. Wieder und wieder schaute er auf die Nummer in seinem Helm. Und immer wieder betrachtete er nachdenklich das Symbol. Plötzlich kam ihm eine verwegene Idee… Er wollte zur Bank fahren und dort erfragen, was es damit auf sich hatte. Dazu notierte er sich die Nummer auf einen Zettel. Schließlich fehlten nur noch ein sauberes Hemd und eine passende Krawatte… beides fand er in einem Koffer, den er noch besaß. Er stieg auf sein Moped und fuhr los. Tatsächlich hatte die Bank noch geöffnet. Am Schalter gab er vor, seine Bankkarte verlegt zu haben. Aber die Kontonummer könnte er noch sagen… mit unsicherer Stimme las er die Zahlen von seinem Zettel ab. Die Schalterangestellte schaute Ken zunächst sehr misstrauisch an. Dann fragte sie mit gesenkter Stimme, so, als sollte es niemand hören: „Sind Sie zufällig Ken Meyers? Und wenn JA… haben Sie Ihren Personalausweis dabei?“ Ken wusste nicht, was er sagen sollte, so überrascht war er. Woher wusste die Angestellte seinen Namen? Da er sich aber keiner Schuld bewusst war, nickte er mit dem Kopf. „Ja, das bin ich… wieso?“, fragte er leise und legte seinen Ausweis auf den Tresen. Wortlos nahm die Angestellte den Ausweis an sich und verschwand in den hinteren Teil des Raumes. Aus einem großen Stahlschrank entnahm sie eine dicke Akte. Mit ihr kehrte sie zurück. „Schauen Sie…“, sagte sie dann, während sie Ken den Ausweis zurückgab, „Ein Herr Joseph Meyers ist vor Kurzem verstorben. Vor seinem Tode hatte er noch ein Testament hinterlegt, welches auch beim Notar einzusehen ist. Darin wurden Sie als Alleinerbe benannt. Das Konto, welches Sie uns nun genannt haben, ist jetzt Ihres…“. Vorsichtig schob sie Ken einen Kontoauszug über den Tisch. Der glaubte zunächst, an einer Sehstörung zu leiden… aber es gab keinen Zweifel… auf dem Auszug war ein Guthaben von 2,5 Millionen Dollar zu verbucht. Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Joseph Meyers tatsächlich um Kens Großvater handelte. Ihm gehörten mehrere Firmen. Unter anderem auch die, wo Ken als Gelegenheitsarbeiter ab und zu gejobbt hatte. Die Unterlagen bewiesen, dass Ken alles erben sollte. Warum seine Eltern nie von ihm erzählt hatten, konnte er sich letztlich nur so erklären, dass der Großvater als Soldat im Krieg gekämpft hatte. Darauf waren Kens Eltern nicht sehr stolz. Ja, sie schämten sich sogar dafür. Sie vernichteten alles, was an ihn erinnerte und sagten sich von ihm los. Daraufhin wurden sie von ihm enterbt. Auch den alten Stahlhelm des Großvaters warfen sie nach seinem Tod, von dem Ken nichts wusste, auf den Müll… Ken hatte ihn schließlich kurz darauf zufällig dort gefunden…
Der Fluch vom Weinberg
Shiva liebte die schier endlosen wunderschönen Weinberge. Diese Weite und die Ursprünglichkeit dieses herrlichen Landes hatte sie tief in ihr Herz geschlossen. Nie wollte sie fort von hier. Und nie konnte sie sich auch nur im Entferntesten vorstellen, für einen Mann all das aufzugeben. Ewig wollte sie hier bleiben, allein. Der kleine Weinbetrieb, den damals schon ihr Vater bewirtschaftete, schien ein Stück von ihr selbst zu sein. Sie opferte sich für ihn auf und der Wein gedieh wie sonst keiner. Nach der Lese wurde in jedem Jahr ein köstlicher Wein auf den Markt gebracht. Doch es gab einen Wermutstropfen, der die Stimmung in jenem verhängnisvollen Jahr trübte. Es war die Reblaus, die urplötzlich große Mengen der Weinstöcke vernichtete. Und es kam so, wie sie es niemals dachte – es konnten nicht mehr so viele Flaschen wie in den vorherigen Jahren auf den Markt gebracht werden. Das bedeutete, dass nicht mehr alle Kunden zufriedengestellt werden konnten. Sie sprangen ab. Und viel zu schnell sprach sich das Debakel herum. Beinahe 70 Prozent aller Kunden kündigten ihre Verträge. Shiva konnte das einerseits zwar verstehen, doch anderseits hatte sie geglaubt, die alten Freunde hielten noch zu ihrer Familie. Leider blieben auch sie dem Weingut fern. Und so dachte Shiva bereits über den immer näher rückenden Konkurs nach. Eines Tages dann das nicht mehr abwendbare Desaster – das Weingut war bankrott! Und als ob das noch nicht das Schlimmste sei, hatte sich wegen der Neuinvestitionen ein kapitaler Schuldenberg angehäuft. Shiva wusste keinen Ausweg mehr. Der Konkursverwalter sprach nicht mehr nur von Entlassungen und vom Verkauf des Weingutes. Nein, er wollte nun auch an das Elternhaus, welches sich so friedlich und harmonisch an die Weinberge schmiegte. Das konnte Shiva unmöglich zulassen. Aber was sollte sie nur tun? Abend für Abend saß sie mit ihrem treuesten und besten Freund, dem verständnisvollen Arbeiter Jo im Weinkeller beim Heurigen. Sie mochte ihn wirklich sehr und er hatte nicht nur Augen für Shiva übrig. Doch er schwieg und ließ sich nichts anmerken. Nur sein Herz, das sprang ihm bald vor Trauer aus der Brust, als er seine geliebte Shiva so leiden sehen musste. Irgendwie hofften ja beide, dass ihnen vielleicht beim köstlichen Wein etwas einfiel. Doch die Flaschen leerten sich und die Köpfe waren es auch. Keine Idee… keine Hoffnung… keine Aussicht. Es war sehr kühl hier unten und so brachte Jo zu jedem Treffen einen Kerzenleuchter mit nach unten, damit es ihnen etwas wärmer und gemütlicher zumute war. Als Jo die Kerzen entzündete, wärmten sich die beiden ihre kalten Hände an den kleinen Flämmchen. Doch am Abend vor der Zwangsversteigerung geschah etwas Seltsames. Wieder saßen sie zusammen beim Wein und sannen nach einem Ausweg. Das Personal war bereits entlassen und die letzten Fässer würden am folgenden Tag unter den Hammer kommen. Da hieß es nur… trinken, was das Zeug hielt. Die Kerzen verbreiteten ein angenehm warmes Licht und Shiva konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Jo traute sich etwas näher an Shiva heran und drückte sie ganz fest an sein Herz. Plötzlich fuhr ein kaum wahrnehmbarer Luftzug durch den Keller. Die Kerzen flackerten ein wenig. Jo, dem das aufgefallen war, rüttelte die noch immer weinende Shiva ganz sachte. „Schau mal… woher kommt denn der Wind? Alle Türen sind dicht und Fenster gibt’s hier keine.“. Shiva schaute zuerst zu Jo und dann auf die Kerzen. Da… wieder bewegte ein unmerklicher Luftzug die Flamme der Kerzen. Shiva wischte sich die Tränen aus ihrem Gesicht. „Tatsächlich“, sagte sie dann leise, „Wie kann das nur sein? Da muss doch irgendwo eine Öffnung sein… oder?“ Jo nickte verlegen. Die beiden erhoben sich und gingen die lange Reihe der Weinfässer entlang. Doch nirgendwo gab es auch nur einen einzigen Hinweis auf eine Öffnung oder einen Spalt in der Mauer oder in der Decke. Am Ende des endlos lang gezogenen Kellers wollten sie wieder umkehren. Da bemerkte Jo, dass sich eine der Steinfliesen unter ihren Füßen bewegte. Mehrmals trat Jo auf sie und rüttelte mit seinem Fuß an ihr. Die Fliese schien nicht fest auf dem Boden zu liegen. Er bückte sich und konnte tatsächlich die Fliese vom Fußboden nehmen. Shiva fand das mehr als merkwürdig. Zusammen rüttelten sie an den umliegenden Fliesen. Es handelte sich wahrhaftig nicht um die einzige Fliese, die locker war. Gemeinsam hoben sie die lockeren Fliesen vom Boden. Sie gaben schließlich die Sicht auf eine Steintür, die in den Boden eingelassen war, frei. Sie war rund und an deren Rand befand sich eine Einkerbung. Vermutlich konnte man die Tür dort öffnen. Doch so sehr sie sich auch mühten, sie bekamen die Tür nicht auf. Sie schien fest mit dem Boden verwurzelt zu sein. Ratlos setzten sich die beiden an den Rand der Tür. Aus einer Werkzeugkiste, die in einer Ecke herumstand, holte Jo ein Stemmeisen. Doch auch damit ließ sich die Tür nicht bewegen. Shiva schaute auf die zahlreichen Weinfässer. Sollte all die viele jahrzehntelange Arbeit, die Arbeit ihres Vaters, ja ihrer gesamten Familie umsonst gewesen sein? Gedankenlos las sie einen der Sprüche, die auf dem Fass vor ihr eingebrannt waren, und hatte dabei schon wieder Tränen in den Augen. Doch welch Wunder… ein seltsames Vibrieren ließ den Keller erzittern. Die beiden glaubten schon an ein Erdbeben. Aber es war kein Beben… es war die Steintür, die sich rumpelnd und ganz langsam zur Seite bewegte. Shiva und Jo konnten es nicht fassen. Sollte tatsächlich der Spruch bewirkt haben, dass sich die Tür öffnete? Fassungslos starrten die beiden auf das rätselhafte Geschehen. Als die Tür vollständig zur Seite geschwenkt war, gab sie den Blick in einen pechschwarzen Tunnel frei. Was verbarg sich dort? Was befand sich hinter dieser Tür? Nie hatte ihr der Vater oder die Mutter etwas von dem Tunnel berichtet. Sollten sie jetzt dort hineingehen? Jo fasste sich als Erster… „Komm Shiva, wir gehen rein! Was haben schon zu verlieren? Der Weinberg ist doch sowieso verloren…“ Shiva musste ihm zustimmen und war mit seinem Vorschlag einverstanden. Sie standen auf und kletterten in den Tunnel hinein. Nachdem sie in dem schwarzen Höllenschlund verschwunden waren, schloss sich die Tür über ihnen wieder. Erschrocken sahen sie mit an, wie sich das Tor zur Freiheit verschloss. Wie sollten sie hier je wieder herauskommen? Sie wussten es nicht, schienen in dem schwarzen Loch gefangen zu sein. Doch plötzlich vibrierte es erneut… der schwarze Schlund verwandelte sich in einen hellen Kellerraum. Wie war das nur möglich? Wo kam das Licht so plötzlich her? Überall an den felsigen Wänden hingen Bilder und inmitten des Raumes stand ein Tisch mit einem riesigen goldenen Kerzenleuchter. Die langen goldfarbenen Kerzen verbreiteten dieses wohlig warme Licht. Die beiden trauten ihren Augen nicht. Wer lebte hier unten? Als hätte jemand diese Frage gehört verfärbte sich plötzlich die Felswand und ein alter Mann in einem schwarzen Umhang stand vor ihnen. Shiva starrte wie gebannt auf diesen Zauber… sie konnte es nicht glauben, was sie da sah… Vor ihr stand ihr verstorbener Vater! Auch Jo musste sich an den schroffen Felswänden festhalten. War so etwas überhaupt möglich? All das grenzte an Magie, an Zauberei. Oder hatten sie nur zu viel Wein getrunken? War das schon das Delirium? Nein! Denn auf einmal sprach der Mann zu ihnen: „Shiva, wie schön, dass Du gekommen bist. Meine geliebte Tochter. Nun weiß ich, dass Du endlich jemanden gefunden hast, der Dich liebt. Möge ewiges Glück Euch beiden zuteilwerden. Der Zauber ist damit ausgelöscht. Und es wird wieder Wein geben… Wein in unseren Weinbergen!“ Der Mann verschwand und Shiva stand noch immer weinend vor der fahl schimmernden Felswand. Von welchem Fluch hatte da ihr Vater gesprochen? Und warum machte sich ihr eigener Vater über ihr Unglück lustig? Fassungslos hielt sie sich ihre Hände vors Gesicht. Jo kam näher und streichelte Shiva über ihre langen schwarzen Haare. Dann meinte er nur: „So sei es. Lass uns zurück gehen.“. Und als ob auch dieser Satz gehört wurde, schob sich die Felsentür beiseite und die beiden kletterten aus dem Loch in den Weinkeller zurück. Die Tür verschloss sich und selbst die Einkerbung, sowie ihre Umrisse verschwanden vor ihren Augen. Nichts deutete mehr darauf hin, dass hier jemals eine Tür gewesen sei. Noch immer unter dem Einfluss des soeben Erlebten stehend schauten sich die beiden lange in die Augen. Hatten sie das alles vielleicht doch nur geträumt? Da vernahmen sie laute Stimmen. Es hörte sich an wie Geschrei… Jubelgeschrei… das musste von draußen kommen. Die Tür zum Weinkeller wurde aufgerissen und zwei Weinbauern, die Shiva bis zuletzt die Treue hielten, stürmten herein. „Hallo Shiva! Du glaubst ja gar nicht, was draußen geschehen ist.“
Shiva schaute die beiden misstrauisch an. Was sollte das? Wollten sie nun auch noch die beiden Mitarbeiter verkohlen? „Komm mit raus und überzeuge Dich selbst. Und Du auch Jo… kommt mit raus!“ Die vier liefen aus dem Weinkeller, und standen plötzlich inmitten herrlicher Weinstöcke. Alle überreif und voller gesunder Trauben. Auch die Nacht war vorüber und die Sonne schien vom Himmel als sei nichts geschehen. Kein Zweifel… das musste ein Wunder sein. Dicke Tränen rannen Shiva über die rosigen Wangen. Aber es waren Tränen der Freude und der Dankbarkeit. Der Weinberg und das gesamte Weingut schienen gerettet. Der Insolvenzverwalter musste einsehen, dass er hier nichts mehr zu tun hatte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von dem Wunder im Weinberg. Auch die Hausbank gab Shiva wieder Kredit. Schnellstens stellte sie das gesamte ehemalige Personal wieder ein und das Weingut schrieb fortan nur noch schwarze Zahlen. Jo aber, der sich schon vor vielen Jahren heimlich in Shiva verliebt hatte, heiratete sie endlich. Die beiden wurden ein glückliches Paar und bekamen drei Söhne. Und noch heute sitzen die beiden abends zusammen im Weinkeller und sprechen über die wundersamen Erlebnisse, die ihnen widerfuhren. Der Fluch, von dem der Vater sprach, war ein altes Zitat aus einem keltischen Kalender. Darin wurde dem Weinberg vorausgesagt, dass dieser mit der ersten Tochter, die keinen Mann, der sie ehrlich liebte, nach Hause bringt, verderben solle. Als Shiva zusammen mit Jo in den Tunnel vordrang, ihr dort ihr eigener Vater erschien, wurde dieser Fluch für immer beseitigt. Denn es war Liebe in allen Herzen. Und die Heirat besiegelte letztlich nur noch das Ende des Fluches. Er hatte fortan keine Macht mehr über das Gut. Und noch heute wacht der Geist des Vaters über dem Weinberg. Manchmal glaubt Shiva seine Stimme zu hören, die leise sagt: „Nun weiß ich, dass Du endlich jemanden gefunden hast, der Dich liebt. Möge ewiges Glück Euch beiden zuteilwerden…“
Ein Mordfall
Ich arbeitete damals im Police Departement „West“ in Boston. Es gab unzählige Fälle, die ich bearbeiten musste – einige waren kurios, andere wieder einfach und klar. Beinahe achtzig Prozent der Mordfälle konnten wir aufklären… eine gute Bilanz. Doch meinen letzten Mordfall werde ich wohl nie vergessen. Es begann an einem schönen Sommerabend und veränderte mein restliches Leben. Ich saß auf meiner kleinen Terrasse und Tracy, meine Frau hatte mir einen Tee hinausgebracht. Schon seit Tagen litt ich unter starken Kopfschmerzen und ich wusste nicht genau, ob ich zum Arzt gehen sollte oder nicht. Als ich so saß und meinen Tee schlürfte, stand plötzlich eine junge Frau auf der Terrasse. Ich war sehr überrascht, weil Tracy immer bescheid gab, wenn Gäste kamen. Doch von der jungen Frau sagte sie nichts. Na, jedenfalls war ich sehr verdutzt und fragte die Frau, was sie hier will. Sie starrte mich mit weit aufgerissenen Augen an und antwortete nicht. Ich gebe zu, dass mir das sehr komisch vorkam. Und Tracy kam auch nicht. Immer wieder redete ich auf die Frau ein, doch sie stand nur schweigend da. Mir fiel auf, dass sie Blutspuren im Gesicht trug. Mit einer nervösen ungeschickten Handbewegung fegte ich schließlich das Teeglas vom Tisch. Umständlich bückte ich mich, um die Scherben aufzuheben. Als ich wieder hochkam, war die Frau verschwunden. Allerdings stand Tracy in der Tür und freute sich absolut nicht über meine Schusseligkeit. Sie schimpfte laut und nannte mich einen Trottel. Ich fragte sie, wo die junge Frau sei und was sie eigentlich wollte. Doch Tracy reagierte gar nicht, meinte nur, dass ich nicht ablenken möge. Von einer jungen Frau jedenfalls wollte sie nichts wissen. Irgendwie verdrängte ich den Vorfall – vielleicht war die Frau ja auch durch den Garten gekommen. Wer weiß… manchmal vergaß einer von uns, das Gartentor zu schließen. Am nächsten Morgen wurde ich zu einem Mordfall in einen der Vororte gerufen. Und was ich dort sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Im Keller des Mietshauses lag eine aufgedunsene Leiche… sie war dort vergraben worden. Wegen Bauarbeiten wurde sie schließlich entdeckt. Als ich ihr Gesicht sah, erschrak ich fürchterlich – es war die junge Frau, die auf meiner Terrasse stand. Ich konnte mir das Ganze nicht erklären. Wieso kam diese Frau, die eigentlich tot war, auf meine Terrasse? Wie war das nur möglich? Oder hatte ich mir das alles nur eingebildet? Aber sie stand doch vor mir – ich wusste es genau! Die nachfolgenden Ermittlungen waren ebenso seltsam wie diese Erscheinung. Wochenlang kam unsere Ermittlergruppe nicht weiter in diesem Fall. Es gab weder Indizien noch Hinweise auf irgendeinen Täter. Wir tappten regelrecht im Dunkeln. Als ich die kleine Wohnung der Ermordeten noch einmal genauer und ohne die Kollegen unter die Lupe nahm, ging ich noch einmal von Zimmer zu Zimmer. Immer wieder versuchte ich mir vorzustellen, was sich hier abgespielt haben könnte. Da knackte es plötzlich im Badezimmer. Kurz verharrte ich und wartete ab. Doch es passierte nichts. Vorsichtig schlich ich ins Bad. Neben der Badewanne lag ein Fön. Ich wusste genau, dass der bei den Ermittlungen noch nicht da war. Ich zog mir Gummihandschuhe an und betrachtete ihn von allen Seiten. Er trug diverse Blutspuren und war am Luftaustritt leicht angesengt. War die Tote vielleicht in der Badewanne umgebracht worden? Hatte der Täter den Fön ins Badewasser geworfen? Noch einmal wurde die Wohnung durchsucht. Und man fand neue Erkenntnisse… die junge Frau wurde allerdings nicht vom elektrischen Strom getötet. Sie wurde mit dem Fön in der Badewanne erschlagen. Die Blutspuren am Fön und die spezielle Wunde am Kopf der Toten bewiesen das eindeutig. Erst danach warf der Täter den Fön ins Wasser und erhoffte sich dadurch, dass die Blutspuren abgewaschen wurden. Doch das passierte offensichtlich nicht. Die plötzliche kleine Stichflamme, die beim Eintritt ins Badewasser entstand, versengte den Fön ein wenig an dessen Luftaustritt. Danach wurde die Leiche schließlich vom Täter irgendwie in den Keller verbracht. Doch wer konnte der Täter sein? Ihr Freund war es nicht – das wussten wir bereits. Doch mit wem hatte sich noch getroffen? Hatte sie noch andere Freunde, von denen wir nichts wussten? Arbeitete sie vielleicht im Rotlichtmilieu? Wir kamen mal wieder nicht weiter. Am folgenden Wochenende fuhr ich mit Tracy zu einem kleinen See. Es war ein heißer Tag und wir wollten baden gehen. Doch der rätselhafte Fall ging mir nicht aus dem Kopf. Nichts, aber gar nichts wies auf einen Täter hin. Aber es musste einen geben. Bis zum Abend lagen wir in der Sonne und genossen den herrlichen Tag. Das Wasser des einsam liegenden Sees war angenehm kühl. Als sich die Dunkelheit bereits über die nahen Berggipfel ausbreitete, ging ich ein letztes Mal ins Wasser. Tracy packte in der Zwischenzeit die Badesachen zusammen. Ich schwamm noch einmal ein Stück hinaus auf den See. Doch plötzlich begegnete ich einem jungen Mann. Er schwamm dicht neben mir her und schaute mich dabei immerfort an. Mir war der Mann zunächst gar nicht aufgefallen. Tracy und ich waren doch ganz allein am Seeufer, dachte ich. Lange schwamm der Mann neben mir her. Mir wurde das Ganze zu dumm und ich kehrte um. Der Mann allerdings tat es mir gleich – auch er wendete und schwamm wieder neben mir her. Ich rief laut: „Na, Sie bekommen wohl auch nicht genug. Ist schon ein schöner See.“. Der junge Mann jedoch starrte zu mir herüber und schwieg. Als ich am Ufer ankam, tauchte ich noch einmal, um auch den Kopf abzukühlen. Doch als ich wieder auftauchte, war der Fremde verschwunden. Das konnte doch nicht sein. Ich fragte Tracy nach dem jungen Mann. Doch die meinte nur, dass sie genug damit zu tun hätte, die Sachen zusammenzupacken. Verächtlich nannte sie mich einen Faulpelz. Ich trocknete mich ab und kontrollierte währenddessen die Umgebung mit scharfem Blick. Einen jungen Mann entdeckte ich jedoch nirgends. Wir waren ganz allein am Strand. Schließlich fuhren wir wieder nach