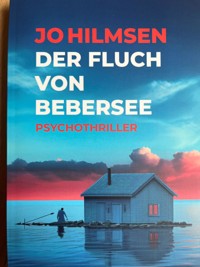
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was redet dieser Mensch da, denke ich. Meine Christina lebt. Meine Geliebte, von der ich hoffe, dass sie es schaffen wird, mich hier rauszuholen. Denn im Grunde ist sie die Einzige, die versichern kann, dass ich niemanden getötet habe. Auch nicht aus Versehen. Und erst recht nicht im Wahn. Sie ist die Einzige, die die ganze Geschichte kennt, von Anfang an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jo Hilmsen
Der Fluch von Bebersee
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Fluch von Bebersee
Kapitel 2
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Impressum neobooks
Der Fluch von Bebersee
Brandenburg an der Havel Maßregelvollzug, 23. August 2019
Das Einzige, was ich im Moment tun kann, ist leise zu wimmern. Es gibt keine Lösung, sich so hinzulegen, dass der Schmerz in irgendeiner Weise nachlässt, ich einen Moment Entspannung finde. Es gibt nichts, was Linderung verspricht, keine Möglichkeit, dieser Höllenqual zu entkommen. Morphium hätte vielleicht geholfen, aber Morphium bekomme ich hier nicht.
Der Schmerz überdeckt alles. Er überdeckt meine Situation, er überdeckt den Gedanken an dieses Haus am See, er überdeckt die Geschichte von Christina Buschmann in Bebersee geboren 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August und er überdeckt sogar meine Gedanken an die lebende Christina Buschmann, meine Geliebte, von der ich hofft, dass sie es schaffen wird, mich hier rauszuholen. Denn im Grunde ist sie die Einzige, die versichern kann, dass ich niemanden getötet habe. Auch nicht ausversehen. Und erst recht nicht im Wahn. Sie ist die Einzige, die die Wahrheit kennt. Sie ist die Einzige, die die ganze Geschichte kennt – von Anfang an. Und nun dieser Schmerz, der alles überlagert, als käme nun zu meiner fast aussichtslosen Situation auch noch eine körperliche, eine möglicherweise existentielle körperliche Misslage hinzu.
Angst überkam mich. Angst, die mir Schweißströme in den Hals laufen ließen. Und dann die Wirbelsäule hinab. Es war eine Angst, als müsste ich auf der Stelle sterben, meinen letzten Atemzug tun, hier in der Forensik, hier quasi hinter Gittern beziehungsweise Mauern.
Ich könnte um Hilfe rufen, an der geschlossenen Glastür der Station rütteln. Ich könnte mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, bis er blutete – wie ich es schon einmal getan hatte – ich könnte, ich könnte… Aber das würde nichts bringen, nichts. Der Schmerz in meiner Lendenwirbelsäule tobt und breitet sich in meinem ganzen Körper aus. Ich bin schweißgebadet.
Es gibt hier einen Arzt, Doktor Rüffert. Er ist zwar Psychiater, aber sicher hatte er während seines Medizinstudiums gelernt, was es möglicherweise mit diesem Höllenschmerz auf sich hat, der irgendwo von der Lendenwirbelsäule herrührte und vielleicht kann er mir tatsächlich helfen. Unmenschen sind sie hier allesamt keine.
Aber bevor ich nach Doktor Rüffert rief – das war durchaus möglich, die psychiatrische Forensik hierzulande ist bei Weitem nicht so dramatisch, wie man es sich vorstellt – muss ich erst einmal versuchen, mich zu beruhigen. Ich versuche in den Schmerz zu atmen, ähnlich wie bei einer Entbindung und zwang meine Gedanken fernab von hier. Fernab von diesem Etablissement, fernab von dem, was möglicherweise auf mich zukommt, aber vor allem, fernab von meiner, derzeit so arg gebeutelten körperlichen Hülle. Tief einatmen durch die Nase, langsam durch den Mund ausatmen.
Nach dem zehnten langgedehnten Ein- und Ausatmen, wie ich es einmal bei meiner Physiotherapeutin Yvonne mit Yoga-Ausbildung gelernt hatte, beginne ich mich tatsächlich ein wenig zu beruhigen. Und das erste Bild, was vor mir auftaucht, war das Haus in Seenähe. Es ist im Nachhinein leicht feststellbar, dass meine derzeitige Misere mit diesem Haus begann. Und dennoch frage ich mich, ob der Grundstein dafür nicht schon sehr viel früher gelegt worden war.
Doch zurück zum Haus.
Kapitel 2
Berlin, 7. Mai 2018
Ich hatte mir gerade meine zweite Tasse Kaffee eingeschenkt, als mein iPhone klingelte. Vor mir lag ausgebreitet die aktuelle Ausgabe des Berliner Tagesspiegel. Daneben standen auf dem Tisch ein Schälchen Erdbeerkonfitüre, Pére Michel Weichkäse, ein hartgekochtes Ei und in einem geflochtenen Körbchen lagen zwei Croissants. Am Telefon war Christina, meine derzeitige Lebensgefährtin. Ihre Stimme flatterte vor Aufregung.
„Trutz“, flüsterte sie. „Ich habe es gefunden.“ Ich sah, während ich das Telefon an mein Ohr presste, aus dem Fenster. Meine kleine Maisonette Wohnung lag im Herzen des Berliner Prenzlauer Berges, in der Bötzowstraße, unweit des Volksparks Friedrichshain. Allerdings konnte ich den nicht sehen, die Fenster gingen alle in den Hof. Dafür entschädigte ein schöner Blick auf die Kugel des Fernsehturms. Und, was ein noch viel größerer Vorteil war – der Hof war ausgesprochen ruhig. Vis-á-vis landete ein Taubenpaar auf der Dachrinne. Ich nahm einen Schluck heißen Kaffee, bevor ich antwortete.
„Was hast du gefunden?“ Ich erahnte, wie Christina die Augen verdrehte. Sie arbeitete gerade als freiberufliche Projektleiterin für den Berliner Senat. Und da gab es häufig Gründe, die Augen zu verdrehen.
„Das Haus, du Dummkopf. Unser Haus!“
„Ach was. Wo?“
„Es war ein Geheimtipp“, plapperte nun Christina aufgelöst los. Ich hörte aufmerksam zu, dabei wanderte meine Zunge abwechselnd vom rechten in den linken Mundwinkel und strich ab und an über die oberen Vorderzähne. Ein Tic, wenn ich hochkonzentriert war, den Christina manchmal zur Weißglut trieb. Trutz, pflegte sie dann zu schimpfen, du hast deine Zunge schon wieder nicht unter Kontrolle.
„Tatjana hat ihn mir gegeben. Du weißt doch, dass die beiden ebenfalls seit geraumer Zeit nach einer neuen Bleibe suchen. Aber dieses Haus wäre für sie zu klein, wegen der Kinder, meinte sie und deshalb hat sie mir den Tipp gegeben. Und du kennst Tatjana. Sie hat ein ausgesprochenes Gespür und was noch wichtiger ist: Geschmack. Was sagst du?“
Was soll ich schon sagen, dachte ich. Das war sicherlich fair von Tatjana und Arne. Über Geschmack ließ sich bekanntlich streiten, auch über Tatjanas. Deshalb brummte ich nur ein unverbindliches:
„Soso.“
Christinas Enttäuschung war selbst durchs Telefon fast körperlich zu spüren, also bemühte ich mich rasch zu beschwichtigen.
„Wo steht es denn, unser Traumhaus?“ Das war gerade noch rechtzeitig. Christina ließ ihren Atem langsam entweichen und sagte dann triumphierend:
„In Bebersee, in der Schorfheide, keine Autostunde von Berlin entfernt.“
„Das klingt gut.“
„Das klingt gut?“, echote Christina. „Das ist traumhaft, ein Glückstreffer, glaub mir. Und der Preis ist der absolute Hammer. Ich habe sämtliche Unterlagen hier. Soll ich zu dir kommen oder kommst du zu mir?“
„Einen Moment, Christina. Ich bin leider nicht auf so einen Glückstag vorbereitet. Ich hole schnell meinen Terminkalender, okay.“ Ich legte das iPhone neben das Schälchen Erdbeerkonfitüre und schlurfte zu meinem Schreibtisch. Ein kurzer Blick in den Kalender reichte.
„Ab Acht hätte ich Zeit. Wenn du willst, komme ich zu dir. Was denkst du?“ Dabei wusste ich, dass es Christina am liebsten gewesen wäre, wäre ich sofort zu ihr aufgebrochen. In manchen Dingen war sie ein bisschen ungeduldig, aber das war wohl unserem Altersunterschied geschuldet – ihrem Heißsporn oder meiner Trägheit – je nachdem von welcher Position aus man es betrachtete. Immerhin war Christina fast zehn Jahre jünger als ich. Allerdings sollte ich nicht unerwähnt lassen, dass es genau diese Gegensätze, die unsere nun seit sechs Jahren währende Beziehung, im Grunde sehr harmonisch machte. Sie trieb an, ich bremste manchmal aus. Und das kam uns bisweilen beiden zu gute. Christina schien einen Moment lang zu überlegen.
„Okay. Und bring bitte einen guten Wein mit. Schließlich haben wir etwas zu feiern.“
Nachdem ich dies versprochen und aufgelegt hatte, starrte ich kurz gedankenverloren aus dem Fenster. Die beiden Tauben saßen noch immer auf der Dachrinne mir gegenüber und durchforsteten mit ihren Schnäbeln das Gefieder des anderen.
„Bebersee“, murmelte ich, dann ging ich zu meinem Schreibtisch und startete den Laptop. Ich kannte zwar die Schorfheide ganz gut – Honeckers ehemaliges Jagdrevier, Goebbels Sommervilla in Bogensee – aber nicht den Ort Bebersee. Als der Laptop hochgefahren war, tippte ich den Ort bei Google Earth ein. Die virtuelle Kamera flog aus den unendlichen Weiten des Universums nach Brandenburg. Ringsherum Wald, soviel stand fest. Eine kleine Straße endete im Ort, das war gut. Kiefernwälder, ein See. Nicht schlecht. Ein Pilzparadies, dessen war ich mir sicher. Ich liebte es, im Herbst Steinpilze und Maronen zu suchen. Andere Pilzsorten kannte ich nicht.
Templin lag nur einen Steinwurf entfernt. Von meiner Wohnung bis nach Bebersee benötigte man mit dem Auto auf der B 109 ca. 1 Stunde, auf der A11 oder A10 1 Stunde 17 Minuten, vorausgesetzt, man blieb von Staus verschont. Christina hatte diesbezüglich ein wenig geflunkert, aber das war nicht der Rede wert.
Hier also wollten wir unseren Traum verwirklichen: Ein Haus am See oder wenigstens ein Haus in Seenähe. Hier also wollten wir eine räumliche Nähe schaffen, von der wir beide bislang nicht wirklich überzeugt waren. Möglicherweise sogar eine dauerhafte. Ein Rückzugsort auf dem Land, getrieben von dem immer unerträglicher werdenden Leben im aufstrebenden Berlin, mit seinen Millionen Touristenscharen und den, sich ins astronomische steigernde Mieten.
Obgleich ich dieses Leben mochte. Die quirlige Unverbindlichkeit, die jeden Tag zu einem Abenteuer machte, die sich stets wandelnde und neu erfindende Stadt und die alles zu beherrschen scheinende Kultur mit seinen zahllosen Events. Aber langsam obsiegte auch in mir die Überzeugung, dass es durchaus Alternativen gab. Und eine Ausweichmöglichkeit kam da gerade recht. Eines Tages würden wir möglicherweise ganz umsiedeln. Wer weiß?Kapitel 3
Templin, 7. Juni 2018
Der Haus- und Grundstückskauf war komplizierter als der Abschluss eines Handyvertrages. Der Templiner Notar namens Karl-Gustav Stockhausen warf mit Begriffen wie Nebenabreden, Gemarkung und ähnlichen Dingen um sich, als sollte dies den Respekt vor dem über zweihundert Jahre alten Gebäude noch etwas steigern. Das Katasteramt war bemüht worden, die Denkmalpflege und schließlich setzten Christina und ich unsere Unterschriften unter den Kaufvertrag. Wir waren gleichberechtigte Käufer mit einem Anteil von je fünfzig Prozent. Die Schlüssel landeten auf dem Tisch, und Christina griff zu.
„Jetzt haben wir ein gemeinsames Kind“, witzelte ich beim Hinausgehen, und Christina knuffte mir als Antwort ihren Ellenbogen in die Seite. „Vielleicht wird es nicht das einzige bleiben.“
Ich stutzte kurz, denn ich dachte eigentlich, dass dieses Thema kein Thema mehr war.
„He, ich bin jetzt Vierundvierzig. Ich glaube nicht, dass ich mich noch reproduzieren möchte.“
„Und ich bin jetzt Fünfunddreißig. Und meine biologische Uhr beginnt langsam zu ticken“, konterte Christina.
„Wie jetzt?“
„Ach, Trutz…“ Christina mimte einen mitleidigen Blick. „Lass uns ein anderes Mal darüber sprechen. Jetzt wollen wir unser Haus einweihen, okay.“
„Aber… Na gut. Okay.“
Wir fuhren direkt von Templin zu unserem neu erworbenen Haus in Bebersee, Dorfstraße 4. Christina legte lässig ihre Beine auf der Innenverkleidung über dem Handschuhfach des Wagens und ließ das Beifahrerfenster herunter.
„Ich glaube, ich bin glücklich“, sagte sie, legte den Schlüsselbund beiseite, den sie die ganze Zeit wie einen besonderen Schatz in ihrer Hand betrachtet hatte und fingerte nach einer Zigarette. „Wir haben ein Haus. Ein Haus am See. Ein Denkmal an einem See, umgeben von Kiefernwäldern. Wie romantisch.“ Ich lächelte.
„Vergiss nicht, dass ein zweihundert Jahre altes Lehmhaus neben der Romantik auch verdammt viel Arbeit mit sich bringt und zunächst erst einmal wenig Komfort bietet. Es gibt viel zu tun.“
„Paah. Du das Haus, ich den Garten.“
„So ist das aber vertraglich nicht vereinbart worden.“
Christina machte ein unbeirrt verzücktes Gesicht.
„Erinnerst du dich an den Garten.“
„Ja.“, antwortete ich, da wir dieses Haus und den Garten ungefähr hundertmal besichtigt hatten, bevor wir die Verträge unterzeichneten.
„Was für Möglichkeiten“, schwärmte sie, „ich werde einen Kräutergarten anlegen. Wir werden unter dem Apfelbaum eine Bank aufstellen und in der Abendsonne den See betrachten. Vielleicht können wir auch Kartoffeln anbauen und uns von unserer eigenen Ernte ernähren. Vielleicht schaffen wir uns ein paar Hühner an. Was meinst du?“
Natürlich, dachte ich, jeder Großstädter träumte diese Tagträume und spätestens nach dem Bruch der ersten Wasserleitung, floh man zurück ins behagliche Kasernendasein mit den anderen Idealisten und redete lieber darüber, als sich die Hände bei Ausschachtungen blutig zu schuften. Und wenn die ersten Hühner von Marder, Habicht oder Fuchs geholt worden waren, war es auch mit der Tierromantik Essig. Dennoch war auch ich seltsam berührt. Ja, geradezu euphorisch.
Es war ein schöner Sommertag. Der Himmel über Brandenburg war überwiegend blau, unterbrochen nur von dicken weißen Wattewolken. Das Thermometer zeigte behagliche fünfundzwanzig Grad Celsius an. Am Straßenrand, kurz hinter Großdölln, grasten friedlich ein paar Rehe, unbeeindruckt vom Straßenverkehr. Wildunfälle waren in dieser Gegend die häufigste Unfallursache. Ein Schild zählte 97 in diesem Jahr. Ich drosselte eingeschüchtert das Tempo meines Mercedes A 220 d und blickte skeptisch auf das äsende Schalenwild. Der Gedanke an einen Crash mit einem Reh oder schlimmer, mit einem Wildschwein ließ mir die Schulter straffen und das Lenkrad ein wenig fester umklammern. Aber zum Glück hatte das Schorfheider Wild gerade anderes im Sinn.
Weder Wild, noch irgendein Mensch befanden sich auf der Straße als wir den Ortseingang von Bebersee erreichten. Ein friedliches Bild. Gegenüber der ehemaligen Bushaltestelle war ein großes Schild aufgebaut, der die Wander- und Radwege der Umgebung markierte. Ein Stapel abgeholzter Kiefernstämme wartete auf seinen Abtransport. Wir bogen im Schritttempo in die Schotterstraße ein, die zu unserem neuen Zuhause führte und blieben schließlich vor der Dorfstraße 4 stehen. Ich schaltete den Motor aus. Obwohl Christina die ganze Fahrt über gestrahlt hatte, zog sie jetzt einen kleinen Schmollmund. Wahrscheinlich, dachte ich, hat sie eine kleine Abordnung des Dorfes erwartet, um uns als Neuankömmlinge zu begrüßen oder wenigstens einen Blumenstrauß vorm Gartentor von den Nachbarn und war nun enttäuscht. Schließlich hatten wir bei den hundert Besichtigungen und den Vorverhandlungen mehrfach Worte mit den Nachbarn gewechselt und sie eigentlich als nett empfunden.
„Die Märker sind nun einmal so“, versuchte ich zu trösten. „Wir sind hier schon etwas nördlich. Die Leute brauchen einfach ein bisschen, um warm zu werden. Du wirst schon sehen.“
Mir fiel ein Gedicht von Paul Risch ein – ein Heimatdichter: Wie der Märker entstand. Darin ging es darum, dass der Heiland Christ mit Sankt Peter zur Spree und Havel gekommen war und Sankt Peter seine beiden Schuhe verloren hatte. Den einen im Moor, den anderen in schwarzgrauer Heide. Der heilige Petrus bat den Heiland einen Menschen zu erschaffen, der dieses schöne Land bewirtschaften sollte. Und der Heiland stieß einen Kienapfel mit einem Fuß und befahl, sei ein Mensch. Und der Kienapfel wurde zu einem hässlichen Grobian, der die Augen rollte und den Heiland mit den Worten: Wat stöttste mi? beiseiteschob. Aber rezitieren konnte ich nur die letzten Zeilen:
Will er in dem Sumpf und Sand gedeih´n
Dann muss er trutzig und rauhaarig sein!“
„Hier gibt es fast keine Brandenburger mehr“, konstatierte Christina nüchtern.
Das stimmte. Vor fast jedem Grundstück standen ein oder mehrere Wagen mit Berliner Kennzeichen.
„Ach, was soll´s.“ Christina bemühte nun tapfer ein Lächeln. Ich stülpte verlegen die Lippen und begann meine Zunge die üblichen Wege wandern zu lassen. Christina war enttäuscht, soviel stand fest. Doch dann schob sie die Enttäuschung damit beiseite, in dem sie ihren Kopf in den Nacken warf und verkündete:
„Komm, Schatz. Jetzt musst du mich über die Schwelle tragen.“ Ich zog kurz die Augenbrauen bei dem Wort Schatz hoch, widersprach aber nicht, sondern schleppte Christina durch das Gartentor, den Vorgarten, durch den Hauseingang, der nach geöltem Holz roch, über die zwei Stufen zum Eingang und schließlich ins Haus. Mein Atem war mit jedem Schritt schwerer geworden und mein Gesicht begann ein bisschen zu lodern.
Ohne mir auch nur den Hauch von körperlicher Erholung zu gönnen, begann Christina mich zu küssen und ein paar Minuten später liebten wir uns auf der Matratze, die wir bereits bei unserem letzten Besuch mitgebracht hatten.
Als es dämmerte, saßen wir beide zufrieden auf einer der beiden Stufen vor unserem Haus, jeder mit einem Glas Rioja in der Hand, lauschten den Geräuschen der Nacht und betrachteten vergnügt wie ausgelassene Kinder den phantastischen Sternenhimmel, der sich über die dunklen Wälder der Schorfheide und dem See wie aus einem Märchen über uns spannte. Es wurde kühler, und ich holte Decken für uns. Das Haus, der Augenblick, die Welt war in Ordnung. Christina summte vergnügt irgendein albernes Lied, und ich warf ab und an einen verstohlenen Blick auf das Haus und überlegte, womit ich beim Umbau beginnen müsste. Das Dach – ein klassisches Walmdach war weitgehend in Ordnung, außer dass vielleicht die Regenrinnen gereinigt werden mussten. Auch die elektrischen Leitungen waren auf dem neuesten Stand. Im Haus gab es einen Kamin und einen Kachelofen, mit dem man die untere Etage beheizen konnte. Das warme Wasser wurde von einem 100 Liter Boiler im Keller aufbereitet. Sorgen bereitete mir ein Balken im Fachwerk, der Gutachter riet zur dringenden Auswechslung. Eine moderne Heizung musste her und die Wände benötigten einen neuen Farbanstrich. Der obere Stock musste komplett saniert, später die Scheune ausgebaut werden. Eins nach dem anderen, dachte ich und bekam plötzlich große Lust, gleich morgen damit anzufangen.
Ein Rehbock bellte, ein Käuzchen rief. Wolken von Insekten schwärmten in der Dämmerung, in erster Linie Mücken.
Punkt zweiundzwanzig Uhr löschte sich die Straßenbeleuchtung des Ortes von selbst. Das ist vernünftig, dachte ich. Wir unterhielten uns flüsternd, so als wollten wir diesen Moment nicht durch unnötigen Lärm stören. Christina schwärmte von der frischen Landluft, entzückte sich immer wieder aufs Neue über das großzügige Grundstück und verlor sich in Details, mit was und wo sie den Garten zu gestalten gedachte. Ich hörte zu und kommentierte eher einsilbig, genoss aber ähnlich wie Christina die Landluft und die Atmosphäre. Ein wahrer Sternenschuppenregen verschönerte den Nachthimmel, und wir beide staunten mit offenen Mündern über dieses Himmelsspektakel.
Bei den Nachbarn waren längst die Lichter gelöscht, als wir uns schließlich entschlossen, schlafen zu gehen.
Kapitel 4
Bebersee, 8. Juni 2018
Auch der nächste Morgen bescherte uns Sonnenschein. Der Himmel war wolkenlos. In der Luft lag der herrliche Geruch nach getrocknetem Holz.
Ich beschloss, vor dem Frühstück eine Runde zu joggen. Christina hatte sich bei meinem Vorschlag, gemeinsam zu joggen, kurz gereckt und sich dann auf die andere Seite gekugelt. Ihr Gesicht war fast vollständig von ihrem dunkelbraunen Haar bedeckt. Ich strich ihr das Haar aus dem Gesicht und gab ihr einen Kuss auf die Wange, den Christina mit einem Lächeln und dem schmatzenden Geräusch eines nuckelnden Kleinstkindes beantwortete. Dann schlüpfte ich in eine kurze Hose, streifte mir ein T-Shirt über und zog mir meine Joggingschuhe an. Die Nachbarn rechts von uns saßen bereits im Garten und frühstückten. Ich winkte, wünschte einen guten Morgen und die Nachbarn grüßten und winkten zurück.
Na, also, dachte ich, das wird schon. Dann lief ich los. Mein Weg führte mich westlich aus dem Ort heraus, bis hin zum See. Ich umrundete ihn einmal und lenkte dann meine gleichmäßigen Laufschritte in den Wald. Es hatte seit einigen Wochen nicht mehr geregnet und der Boden war hart wie Beton. Dafür roch es wunderbar. Ich lief nie länger als dreißig Minuten und da ich eine Weile nicht mehr laufen war, kam ich ordentlich außer Atem. Und es tat gut.
Als ich zurückkam, hatte Christina bereits den Tisch in den Garten geschleppt und war gerade dabei, Kaffee zu kochen. Der Wasserkocher brodelte und Christina goss das kochende Wasser in eine Kanne, deren Boden ein paar Zentimeter mit Kaffeepulver bedeckt war. Kaffeeduft durchströmte die kleine Küche.
„Guten Morgen“, begrüßte ich Christina und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. Christina strich mir einen Schweißtropfen zärtlich von der Schläfe und sah mir in die Augen.
„Ich liebe dich.“
„Ich liebe dich auch“, antwortete ich. Dann ging ich ins Bad und begann mich unter der Dusche wunderbar zu fühlen.
Ja, dieses Haus ist ein echter Glücksgriff, dachte ich, seifte mich ein, wusch mir das Haar und begab mich schließlich in den Garten, wo Christina mit dem gedeckten Frühstückstisch auf mich wartete.
Wir frühstückten unter einem der Apfelbäume. Eine Wespe säbelte kleine Stückchen aus dem Eberswalder Leberkäse und machte sich humorlos damit davon. Auf einem der frischen Stücken Melone hatte sich eine Honigbiene niedergelassen, ließ aber davon ab.
Nach dem Frühstück entschied Christina ein wenig auf unserem Grundstück umher zu spazieren (wegen der Planung der Pflanzungen) und ich brachte Geschirr, Tisch und Stühle zurück ins Haus. Es war Samstag. Morgen Abend mussten wir zurück nach Berlin. Ich hatte am Montagmorgen einen wichtigen Termin mit meinem Verleger. Es galt, die nächsten Lesungen zu organisieren und meine Lesereise zu planen. Christina musste die Woche ebenfalls arbeiten, dann hatten wir beide zwei Wochen frei, um in aller Ruhe das Haus und das Grundstück, vollkommen in unseren Besitz zu nehmen, bevor ich mich auf meine Tour begab.
Ich nahm mir Zeit beim Zurückräumen des Tisches, der Stühle und des Geschirrs. Hier draußen tickten die Uhren anders, das war schon nach ein paar Stunden klar und ich ließ entspannt Wasser in die Spüle, um das Geschirr zu reinigen.
Ein kalter, spitzer Schrei riss mich aus meinen Gedanken. Christina! Ich stürzte aus dem Haus und rannte in den Garten. Mein erster Gedanke galt einem Raubtier. Waren in Brandenburg nicht seit ein paar Jahren wieder Wölfe hierher gewandert? Und sollte sich ausgerechnet so eine Bestie gerade hier und jetzt über Christina hermachen. Mein zweiter Gedanke galt der Bestie Mensch. Ein entflohener Sträfling, der sich am Bebersee in einem scheinbar unbewohnten Grundstück versteckt hielt und sich sicher wähnte, bis Christina aufgekreuzt war und nun mit einer Axt vor ihr stand. Hatte sich nicht auch dieser Kindermörder – dieser Schmöckel – monatelang in den Brandenburger Wäldern versteckt?
Erst mein dritter Gedanke widmete sich, während ich panisch in Richtung Christinas Schrei lief, den authentischen Gefahren, die einem hier eventuell drohten: ein falscher Schritt über eine verborgene Wurzel oder einem Maulwurfshügel, Wespen,- Hornissen,- Bienenstiche. Wildschweine oder Brombeergestrüpp, was sich um die Beine gewickelt hatte.
Es war nichts von alledem.
Ich fand Christina ganz am Ende unseres Grundstückes vor einer Art Hügel kauern, das halbe Gesicht hinter ihren Händen verborgen. Sie war kreidebleich.
Ich versuchte mich als erstes erst einmal selbst zu beruhigen. Kein Wolf, kein Schwerverbrecher, kein Hornissenangriff, nicht einmal Brombeergestrüpp. Stattdessen ein Hügel – grasbedeckt.
„Mein Gott, Christina…, ich dachte…“, sagte ich erleichtert.
„Hier steht mein Name“, stöhnte Christina.
„Wie, auf dem Gras?“
„Christina Buschmann. Das ist mein Name“, sagte sie fast tonlos und zeigte auf einen Grabstein auf dem Grashügel.
„Trutz, was hat das zu bedeuten?" Ich glotzte kuhäugig auf den Stein, dann bekam ich doch eine kleine Gänsehaut. Zum Glück hatte ich mich genauso schnell wieder unter Kontrolle. Um sie zu beruhigen, strich ich Christina sanft über den Rücken.
„Christina, sieh nur. Das Datum.“
In den Stein gemeißelt, standen die Worte Christina Buschmann geb. Sens, darunter der Name und die Daten: geb.: 24.08.1799 gest.: 24.08.1825. Sonst nichts.
Für Christina hingegen hatten die fast zwei Jahrhunderte Zeitunterschied, die zwischen ihrem Leben und dem Tod dieser Frau mit dem gleichen Namen, nicht die Bedeutung, die ich mir erhofft hatte. Sie schien fassungslos, obwohl ich sie niemals als dramatisch veranlagt erlebt hatte. Im Gegenteil. Christina war im Grunde eine nüchterne, sehr strukturierte Frau. Eine Frau, die eine Situation, wie auch immer sie geartet war, erst einmal gründlich analysierte, bevor sie sich zu irgendwelchen Handlungen oder emotionalen Ausbrüchen hinreißen ließ. So war es in der Vergangenheit gewesen und so war es auch bei diesem Hauskauf abgelaufen. Sicher, sie hatte ihr Herz an dieses Haus verschenkt, vom ersten Augenblick an, aber dennoch hatte sie das nicht ihrem Verstand untergeordnet. Im Moment allerdings schien diese schier unumstößliche Gesetzmäßigkeit vollkommen außer Kraft gesetzt zu sein. Was mich eher wunderte, war, dass wir diesen Grabstein nicht ein einziges Mal bei unseren dutzenden Rundgängen gesehen hatten.
„Eine Leiche auf dem Grundstück, das ist nicht gut. Das ist entschieden nicht gut“, flüsterte Christina mit ihrem kalkfarbenen Gesicht. Ich rieb mir die Augen.
„Christina, das hat überhaupt nichts zu bedeuten“, sagte ich und gab meiner Stimme einen festen Klang. „Außer dass eine Frau deines Namens hier vor fast zweihundert Jahren beerdigt worden war. Wahrscheinlich hat sie sich umgebracht, denn sonst wäre sie ja auf dem nahen Friedhof beerdigt worden.“ Ich zeigte ein wenig unbeholfen in Richtung des nahen Dorffriedhofes mitten im Wald. „Das ist vielleicht sogar eine ganz romantische Geschichte. Möglicherweise hat ihr Mann sie so sehr geliebt, dass er sie trotz aller Umstände unbedingt in seiner Nähe wissen wollte. Sieh es doch einfach mal so.“ Wie um dies noch einmal zu bekräftigen, trat ich einen Schritt vor und schloss Christina in die Arme.
„Eine Leiche auf unserem Grundstück, das ist entschieden nicht gut“, wiederholte Christina. Dann riss sie sich, ohne mich eines Blickes zu würdigen, von mir los und rannte ins Haus. Ich sah Christina nach und betrachtete dann das Grab von Christina Buschmann geb.: Sens, geboren 1799, gestorben 1825. Und starrte auf das Datum. Der vierundzwanzigste August. Zweimal. Geburt und Tod. Jeweils an einem vierundzwanzigsten August.
Eigentlich war es gar kein richtiges Grab. Es war ein Grabstein. Ob hier wirklich eine Leiche lag, hätte man nur zweifelsfrei klären können, wenn man diesen kleinen Hügel umgegraben hätte. Vielleicht fand man dann nichts anderes als Erde und die üblichen Regenwürmer zum Beispiel. Allerdings verwarf ich diesen Gedanken sogleich. Ich war ja schließlich weder Archäologe noch Pathologe. Und wenn dann in der Tat Menschenknochen zum Vorschein kamen, was sollte ich damit anfangen, außer einer oberflächlichen anatomischen Betrachtung? Schädel, Thorax, Oberschenkel,- Unterschenkelknochen. Zu mehr würde es vermutlich nicht reichen.
Diese Frau – Christina Buschmann – hatte hier offensichtlich eine Weile gelebt. Aller Wahrscheinlichkeit war sie hier gestorben. Den Gedanken, dass es sich um eine mögliche Selbstmörderin handelte, verwarf ich nicht grundsätzlich. Warum hatte sich Christina Buschmann 1825 das Leben genommen? Ich rechnete kurz. Christina Buschmann war am 24. August gerademal sechsundzwanzig Jahre alt geworden. Was war am 24. August 1825 in Bebersee passiert? Hatte sie ihren sechsundzwanzigsten Geburtstag noch gefeiert und sich dann umgebracht? Oder saß sie den ganzen Tag allein im Garten und wartete, auf wen oder was auch immer und setzte dann ihrem Leben ein Ende, weil das, worauf sie gewartet hatte, nicht geschah?
Ich konnte nicht genau sagen warum, aber ich blieb weiter vor dem Grabstein und starrte auf den Namen.
„Christina Buschmann“, flüsterte ich nach einer Weile, „wer um Himmelwillen warst du?“
Und plötzlich geschah etwas, was mich erstarren und mir einen eiskalten Schauer den Rücken hinunterlaufen ließ. Ich hörte ein leises Wispern.
Verdutzt sah ich mich um, aber da war niemand. Jedenfalls kein Mensch. Ein Rotschwänzchen machte auf sich aufmerksam und Mücken summten. Da war es wieder! Ein Wispern. So als ob mir jemand leise etwas zuraunte. Aber die Stimme war wie in Watte gepackt.
Ich schloss die Augen und kratzte mich an der Stirn. Was war das?
Ich meinte eine Stimme zu hören und fragte mich einen Moment, ob ich jetzt und hier auf unserem frisch erworbenen Grundstück mit dem Haus am See dabei war, den Verstand zu verlieren. Und da war es wieder.
Ich, hörte ich jetzt deutlicher. … brauche Hilfe.
Beinahe wäre ich vor Schrecken nach hinten gekippt und fand gerade noch mein Gleichgewicht. Die Härchen meiner Unterarme hoben sich als wären sie Blumen, die sich der Sonne entgegenstreckten. Eine Gänsehaut breitete sich über meinem gesamten Körper aus.
„Was zum Teufel geht hier vor“, entfuhr es mir.
Ich brauche Hilfe, wisperte es abermals. Deine Hilfe. Am liebsten wäre ich schreiend davongerannt. Hier gab es definitiv nichts außer mir und diesem Grab von Christina Buschmann geb.: Sens, geboren 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August.
Aber etwas hielt mich fest und ich fühlte mich außerstande, mich auch nur einen Schritt fortzubewegen.
Das Wispern ging in einen Singsang über, undeutlich. Es war nicht klar, was da gesungen wurde und vor allem wer da sang. In meinen Ohren klang es wie ein Kinderlied:
Heile, heile Gänschen, tut bald nicht mehr weh.
Heile, heile Gänschen, tut bald nicht mehr weh.
Heile, heile Mäusespeck, in hundert Jahren ist alles weg.
In dem Fall waren es wohl eher zweihundert Jahre. Eine Amsel machte Radau, obwohl es eigentlich keinen Grund für Radau gab. Und genauso wie der Spuk gekommen war, war er wieder vorbei. Plötzlich herrschte Stille. Absolute Stille. Kein Laut. Nichts, kein Amselradau, nicht einmal Mückengesumme. Es war fast noch unheimlicher als der vorherige Singsang und das Gewisper. Die Welt hatte für einen Augenblick den Ton abgestellt.
Ich rieb mir das zweite Mal die Augen und wartete angespannt. Worauf, das konnte ich nicht sagen. Und dann war alles wieder normal. Die Welt fuhr ihre Geräusche hoch. Die Amsel machte ihren Radau wegen was auch immer, ein Hund bellte, und ich ertappte eine Mücke dabei, die gerade verzückt ihren kleinen Stechrüssel in meinen Ringfinger bohrte. Ich schlug zu, aber die Mücke entkam.
Ich bin Schriftsteller, dachte ich, und meine Hauptbeschäftigung ist, zu recherchieren. Also werde ich recherchieren.
„Ich werde herausfinden, wer du warst, Christina Buschmann geboren 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August“, flüsterte ich zu dem Grabstein vor mir. „Ich schwöre dir, ich werde es herausfinden.“
Dann ging ich zu Christina, um sie zu beruhigen. Gleich morgen würde ich mit der Recherche beginnen. Von der unheimlichen Begegnung mit dem Gewisper und dem Singsang erzählte ich ihr natürlich nichts.
Kapitel 5
Brandenburg an der Havel Maßregelvollzug, 19. August 2019
Der Schmerz, der meinen Körper martert, hat noch einen Zahn zugelegt, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten hätte. Aber es ist so. Ich versuche die Embryonalstellung, aber auch die hilft nichts. Mit allergrößter Anstrengung stelle ich mich auf die Füße und tue ein paar Schritte. Mein gesamter Körper ist noch immer schweißgebadet. Das glühende Eisen auf meinem Rücken, versenkt sich unvermindert. Mein Zimmer liegt im Dunkeln, diese Apokalypse hatte mich im Schlaf erwischt oder wahrscheinlich bei einem dieser lebhaften Träume, die mir jede Nacht zusetzen, in denen ich um mein Leben renne und wahrscheinlich herumgestrampelt habe. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist.
Wie ein Neunzigjähriger tippele ich unter Aufbietung all meiner Kräfte zum Lichtschalter und drücke ihn. Blick auf meine Armbanduhr. Es ist drei Uhr. Neben meinem Bett steht der kleine Nachtschrank auf dem ein Medikamentenschälchen wartet, gefüllt mit Risperdal und Seroquel 300. Ich weigere mich, seit ich hierhergebracht worden bin, dieses Zeugs zu schlucken. Geduldig stellt man mir jeden Morgen, mittags und am Abend so ein Schälchen hin und wartet. Es ist mir egal. Zwangsmedikation ist selbst in der Forensik tabu. Ich weiß nicht, wie es in anderen Forensiken zugeht, hier ist es tabu. Wenn jemand völlig durchdreht oder das Personal angreift, wird derjenige fixiert oder kommt schlimmstenfalls in das Iso-Zimmer – bekleidet mit einem Klinikslip. Das ist die Höchststrafe.
„Hilfe“, wimmere ich. Und dann lauter: „Hilfe!“
Einen kurzen Moment flackert dieser kurze Augenblick auf, als ich vor dem Grabstein von Christina Buschmann geb. Sens geb. 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24.August stand und als ihre vermeintliche Stimme mir zu wisperte: Ich brauche Hilfe. Deine Hilfe. Und wie ich mich in meine Recherchen gestürzt habe. Besessen, fast paranoid, um Christina – meiner Christina – eine Geschichte zu liefern, die sie beruhigen würde, die sie mit dem Haus und dem Grundstück mit einem Grabstein versöhnen könnte. Aber das war nur kurz. Die Realität war zu brachial, um ihr gedanklich zu entkommen.
„Hilfe!“, schreie ich endlich. „Ich brauche Hilfe!“ Bis zur verschlossenen Glastür der Station werde ich es nicht mehr schaffen und um diese Zeit nach Doktor Rüffert zu rufen, ist aussichtslos.
Nach einer schieren Ewigkeit, öffnet sich meine Zimmerzellentür. Pfleger Neudeck brummt, was los sei und reißt dann erschrocken die Augen auf.
„Ich brauche einen Arzt“, stöhne ich mit letzter Kraft, dann wird mir schwarz vor Augen.
Als ich wieder zu mir komme, steht Doktor Rüffert vor mir und räuspert sich. Ich liege auf der Krankenliege seines Behandlungszimmers und spüre nichts mehr. Der Schmerz ist davongeflogen.
„Ich habe Ihnen ein Schmerzmittel gespritzt, ich hoffe, das war in Ihrem Sinn, Herr Fiedler!“
Zweifellos ist dies eine Anspielung darauf, dass ich mich weigere, Risperdal oder Seroquel zu schlucken. Aber ich bin zu schwach und zu dankbar um, wie ich es sonst bei diesem Thema tat, verbal wild um mich zu schlagen. Stattdessen blinzele ich mir eine Träne aus dem Auge.
„Ja, vielen Dank!“ Einen kurzen Moment fühle ich mich in der Tat wie neugeboren.
„Gegen ein Glas Rotwein hätte ich jetzt nichts einzuwenden, Herr Doktor.“
„Sie wissen, dass es hier keinen Alkohol gibt.“
„Natürlich. Danke nochmal Doc!“ Ich wische mir mit einer raschen Handbewegung die noch immer schweißnasse Stirn trocken. „Haben Sie eine Ahnung was das war? Ich meine, dieser unsägliche Schmerz. Ich habe so etwas noch nie erlebt.“
Doktor Rüffert runzelt die Stirn und schiebt sich seine Brille auf die Nase. Dann einen Stuhl an meine Liege und sagt:
„Legen Sie sich mal bitte auf die Seite.“ Ich tue, was er befiehlt. Er tastet hier und tastet dort ein wenig herum. Zwischendurch lässt er immer wieder ein brummiges Hm verlauten.
„Und?“
„Nun, bestenfalls haben Sie sich Ihren Ischiasnerv eingeklemmt. Ein sogenannter Hexenschuss. Aber so wie Sie gejammert haben, tippe ich eher auf einen Bandscheibenvorfall. In Ihrem Alter ist das gar nicht so ungewöhnlich. Um das herauszufinden, habe ich hier leider nicht die Möglichkeiten. Ich denke, ein MRT wird da Gewissheit bringen, danach werden wir weitersehen. Ich muss Sie in eine Klinik überführen lassen.“
„In Handschellen vermutlich.“
„Das wird in Ihrem Fall nicht nötig sein. Aber selbstverständlich in Begleitung.“ Doktor Rüffert sieht mich an.
„Versuchen Sie aufzustehen. Wenn Sie wieder laufen können, gehen Sie zurück in Ihr Zimmer. Ich werde Ihnen ein Attest ausstellen, dass Sie Ruhe brauchen. Und dann werde ich das Nötige veranlassen. Einverstanden?“
„Einverstanden.“
Ich versuche aufzustehen und merke, dass dies problemlos gelingt. Mein Rücken wirkt verspannt, aber das ist auch alles. Ein bisschen wie ganzkörpergepolstert, fühle ich mich. Keine Spur von Schmerz. Ich nicke dankbar und mache mich daran, die Tür von Doktor Rüfferts Zimmer zu öffnen.
„Herr Fiedler?“ Ich drehe mich um.
„Was ist mit den anderen Medikamenten. Sind Sie jetzt bereit für eine Behandlung?“
Ich überlege kurz und antworte mit einer Gegenfrage.
„Glauben Sie eigentlich, dass ich unschuldig bin, Herr Doktor?“
Doktor Rüffert schiebt seine Augenbrauen in die Höhe, ohne zu blinzeln.
Jedes Gespräch über Schuld oder Unschuld ist hier im Grunde obsolet. An diesem Ort wird nicht gerichtet, hier wird verwaltet. Verwaltet und begutachtet, aber das dauert seine Zeit. Manchmal Jahre.
„Sie wissen, dass es mir nicht zusteht, darüber zu urteilen.“
„Ja, Doktor. Ich meinte auch nur Ihre ganz persönliche Meinung.“
„Wie lange sind Sie jetzt hier, Herr Fiedler?“
„Vier Monate.“
„Und wie oft haben Sie mir diese Frage schon gestellt?“
„Einmal im Monat?“, antworte ich achselzuckend.
„Jede Woche. Wenn Sie sich einer Behandlung unterziehen, können wir vielleicht etwas für Sie tun. Sie wissen, dass Sie unter einer Schizophrenie leiden. Und ich kann Ihnen helfen.“
Ich schüttele den Kopf und verlasse das Behandlungszimmer. Eine Spritze gegen die Schmerzen, ja. Seroquel oder Risperdal – niemals.
Inzwischen haben alle Insassen im Gemeinschaftsraum Platz genommen. Frühstückszeit.
Obwohl ich eigentlich keinen Hunger verspüre, hole ich mir ein Tablett, stelle eine Schale Müsli darauf und greife nach einem Joghurt. Zuletzt gieße ich mir eine Tasse Kaffee ein. Dann gehe ich zu meinem Platz. Derzeit befinden sich 20 Personen auf dieser Station. 8 Frauen, 12 Männer. Den Tisch teile ich mir mit Lisa – einer jungen Frau, die ihr Neugeborenes im Klo ertränkt hat, weil sie glaubte, es wäre mit einer hochinfektiösen Krankheit zur Welt gekommen, die die Menschheit vernichten würde, mit Robert – einem Ex-Junkie, der auf Chrystal zwei Polizisten mit einem Dosenöffner angegriffen und deren Streifenwagen mit einem Baseballschläger schrotreif bearbeitet hat und schließlich Arthur – der längste Insasse der Station. Arthur lebt inzwischen seit 15 Jahren hier. Was er getan hat, weiß niemand. Er spricht nicht und ist von den Gruppentherapien incl. demheißen Stuhl ausgenommen. Das Zimmer teile ich Gottlob mit niemanden.
Die ganze Station, ebenso wie die Zimmer, trägt einen ockerfarbenen Farbanstrich. Die Forensik wurde nach modernen Maßstäben gebaut worden. Und das Orange – so heißt es, ist eine positive Farbe, die Aggressionen nehmen und positive Perspektiven vermitteln soll. Nun ja.
Alle Drei an meinem Tisch sind mit Essen beschäftigt. Ich wünsche freundlich Guten Morgen, erhalte aber nur von Lisa, der Kindesmörderin, ein Kopfnicken als Antwort. Arthur schlürft so laut an seinem Kaffee, als hätte er sich vorgenommen, einen Ozean auszutrinken. Der Ex-Junkie ist der absolute Morgenmuffel und spricht grundsätzlich erst ab Mittag.
Ich gehe in Gedanken meinen heutigen Therapieplan durch. Wir alle hier haben so etwas wie eine Dauertherapie. Bewegungstherapie kann ich vergessen, alles andere gilt der Struktur des Tages. Jeden Tages.
Kapitel 6
Bebersee, 10. Juni 2018
Der erste Weg meiner Recherche nach dem Leben von Christina Buschmann geb. Sens geb. 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August führte mich am Sonntag – am Tag unserer Abreise nach Berlin – ins Pfarrhaus von Bebersee. Christina hatte sich geweigert mitzukommen. Auch sonst war der Samstag eher verhalten verlaufen. Wir waren zum See spaziert, waren zum Essen nach Templin gefahren und früh schlafen gegangen. Über das Grab von Christina Buschmann geb. Sens hatten wir kein Wort verloren.
Es gab einmal im Monat in der kleinen Dorfkirche einen evangelischen Gottesdienst und zu meinem großen Glück, war an diesem Sonntag so ein Tag. Der Pastor empfing mich nach dem Gottesdienst, mit gerademal vier Gläubigen, in dem kleinen Pfarrhaus äußerst zuvorkommend und freundlich. Es war offensichtlich, dass der Pastor hier nicht wohnte. Das Haus wirkte eher wie ein überdachter Schreibtisch mit allerlei Krimskrams. In der unteren Etage befand sich eine Art Esstisch mit vier Stühlen, eine Couch mit zwei Sesseln, einem Vertiko und einigen Regalen. An der Wand über dem Vertiko hing ein Kruzifix. Was in der oberen Etage war, war schwer zu erahnen. Vermutlich nur Gerümpel.
Der Pastor war ein Mann Mitte Sechzig, mit einem gemütlichen Bauch und einem gemütlichen Gemüt. Sein Gesicht war rund wie die Kuppel des Berliner Fernsehturms und seine hellgrauen Augen strahlten Neugier und Interesse aus.
Als Erstes begrüßte er mich als Neuankömmling dieser kleinen Gemeinde, bot mir einen Platz an dem Esstisch mit den vier Stühlen an und fragte, ob wir Interesse an den Gottesdiensten hätten. Ich antwortete, dass wir Agnostiker wären, bedankte mich trotzdem für das Angebot. Dann nahm ich Platz, stellte mich vor und sagte, dass es einen anderen Grund gäbe, warum ich ihn sprechen wolle.
„Auf unserem Grundstück liegt eine Frau begraben. Christina Buschmann geb. Sens geb. 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August. Wussten Sie das?“ Der gemütliche Pastor runzelte seine runde Stirn und überlegte eine Weile. Ich merkte ihm sofort an, dass er herumzudrucksen gedachte.
„Der Name Sens sagt mir etwas“, antwortete er schließlich. „Ich glaube die Familie Sens war einer der Familien, die diesen Ort dem märkischen Sumpf abgetrotzt hatten. Eine der drei Gründerfamilien. Sie kamen alle aus Berlin. Hofften hier wohl auf ein besseres Leben. Was den meisten wohl auch geglückt ist. Der Name Buschmann, hm, weiß nicht. Der sagt mir nix. Vielleicht eine Familie aus den Nachbarorten, wer weiß. Eines der Gemeindemitglieder hat vor Kurzen eine kleine Chronik über den Ort verfasst. Warten Sie, ich glaube, ich habe noch ein Exemplar hier. Wenn Sie wollen, kann ich sie Ihnen gerne überlassen. Es ist nur eine kleine Chronik.“
Der Pastor erhob sich und kramte in einer Schublade des Vertikos unter dem hölzernen Kruzifix.
„Hier“, sagte er und reichte mir eine schmale Broschüre. Ich bedankte mich. Das war ein Anfang.
„Und dass jene Christina Buschmann geb. Sens auf unserem Grundstück, Dorfstraße 4 möglicherweise begraben ist, wussten Sie das?“
Der gemütliche Pastor ruckelte jetzt nervös auf seinem Stuhl herum.
„Hm.“
„Herr Pastor, Ihnen wird doch nicht entgangen sein oder zugetragen worden, dass ein ehemaliges Schaf dieser Gemeinde nicht wie gewöhnlich auf dem Gottesacker hinter der Kirche begraben liegt, sondern außerhalb davon. Auch wenn das alles schon seine Zeit her ist. Eine Selbstmörderin nehme ich an, oder?“
„Nun ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich die ganze Sache vergessen hatte…“
„Die Sache! Welche Sache?“, fragte ich etwas schroffer, als ich beabsichtigt hatte.
„Offen gestanden, es ist ein bisschen kompliziert“, antwortete er und sah mich an, als müsste ich etwas Nachsicht walten lassen.
„Ist es denn ein echtes Grab oder steht da nur ein Grabstein?“ Christina fiel mir ein, und ich hoffte auf Entwarnung.
„Das weiß man nicht so genau.“
„Wie bitte?“
„Es hat noch niemand nachgesehen, will ich damit sagen.“
„Seit 1825?“
„Seit 1825. Korrekt.“
Ich schnappte nach Luft. Im Moment fiel mir keine andere Antwort ein, als sprachlos zu blinzeln. Der gemütliche Pastor faltete seine Hände vor dem Bauch.
„Nun ja“, sagte er schließlich. „Es gab da immer so Geschichten. Geschichten und dummes Zeugs, verstehen Sie. Aberglaube würde ich sagen.“
Ich schenkte dem Pastor einen finsteren Blick.
„Und was bitte sind das für Geschichten?“ Der gemütliche Pastor nestelte nun an seinem Ohrläppchen.
„Sie sind doch ein aufgeklärter Mann, nehme ich an“, sagte er schließlich. Ich nickte und straffte wie zum Beweis meine Schultern. Auf dem hölzernen Kruzifix über dem Vertiko, landete plötzlich ein Sonnenstrahl, der das Gesicht von Jesus beleuchtete und kleine Löcher zum Vorschein brachten. Holzwürmer. Holzwürmerlöcher. Ich war dennoch einen Moment lang irritiert.
„Es steht nicht alles in der Chronik, die ich Ihnen gegeben habe, wegen der Touristen würde ich sagen.“
Ich starrte kurz zu dem kleinen Büchlein in meiner Hand und blickte dann dem gemütlichen Pastor direkt in die Augen.
„Ach ja?“, sagte ich und dachte Touristen? Was für Touristen?
„Es gab wegen des Grabes oder des Grabsteines auf Ihrem Grundstück im Laufe der Zeit ein paar seltsame Ereignisse. Also, verstehen Sie mich nicht falsch. Die Menschen neigen ja immer dazu, bei unnatürlichen Todesfällen eine Menge hinzuzudichten. Zu viel gesehene Tatort, Henning Mankell, Sie wissen schon. Aber Fakt ist, dass es im Laufe der Zeit mindestens drei Versuche gab, herauszufinden, ob es sich nun um ein Grab oder nur um einen Grabstein handelte…“
Mit einem Mal hörte ich wieder diese Stimme: Ich brauche Hilfe, deine Hilfe! Dem gemütlichen Pastor musste meine plötzliche Blässe aufgefallen sein, denn er sah mich besorgt an und fragte:
„Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Einen Kaffee oder ein Glas Wasser.“ Ich schüttelte energisch den Kopf, um meine Kontrolle zurück zu erlangen.
„Und was ist passiert“, fragte ich im Flüsterton.
„Bei diesen drei Versuchen. Der erste Versuch war wohl kurz nach dem Tod von Christina Buschmann, der Zweite zum Ende des zweiten Weltkrieges, Sie wissen vielleicht, dass hier viele Rotarmisten starben bei der Vorbereitung der sowjetischen Offensive auf Berlin – ein sowjetischer Offizier kam dabei ums Leben… Und nun ja der Dritte, das war, lassen Sie mich kurz nachdenken. Das war der Vorvorbesitzer des Hauses… ihres Hauses“, fügte er rasch hinzu. „Sie wollten alle das Grab öffnen. Aus Neugier oder was weiß ich… Was soll ich sagen. Offensichtlich starben Menschen.“
Ich schloss meine Augen zu Schlitzen.
„Und woran sind die Leute beim Versuch das Grab zu öffnen gestorben, wenn ich fragen darf.“
„Über den ersten Versuch gibt es nur einen vagen Bericht. So in etwa wie, dass denjenigen so etwas wie einen Fluch traf und er sich später erhängte, direkt neben dem Grabstein oder dem Grab, aber das ist reine Spekulation. Den sowjetischen Offizier traf ein Blitz, so jedenfalls erzählte es man sich und ihr Vorvorbesitzer, nun ja... Er verschwand. Spurlos!“
„Er verschwand“, wiederholte ich. Der gemütliche Pastor nickte.
„Nie gefunden.“
„Nie!“
Ich rieb mir mit beiden Handflächen über das Gesicht.
„Und… und was denken Sie, sollen wir tun. Ich meine, meine Frau – ich nannte Christina tatsächlich meine Frau – und ich, mit diesem Grab… mit diesem Fluch?“
Der gemütliche Pastor straffte nun seinerseits seine runden Schultern.
„Lassen Sie es so wie es ist, dann passiert Ihnen ganz gewiss nichts. Ja! Einen anderen Rat kann ich Ihnen leider nicht geben.“
Einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich dem gemütlichen Pastor die Geschichte erzählen sollte, die ich am Grab von Christina Buschmann geb. Sens erlebt hatte. Von dem Wispern und Betteln und der plötzlichen Stille und dem Singsang, dass wie ein Kinderlied klang, entschied mich aber dagegen, weil meine Vernunft wieder einsetzte und, ich will es an dieser Stelle nicht verhehlen … ich offen gestanden auch so etwas wie Jagdfieber bekam. Schließlich war ich Schriftsteller. Was für eine Story! Ich musste nur noch herausfinden wie der sowjetische Offizier hieß, wie derjenige um 1825 und den Vorvorbesitzer vom Haus am See, Dorfstraße 4 in Bebersee. Und natürlich alles über Christina Buschmann geb. Sens geb. 1799, gestorben 1825, jeweils an einem 24. August. Eine Geschichte musste her, der Rest würde sich von selbst ergeben, da war ich ganz zuversichtlich.
Auf der Rückfahrt nach Berlin schwiegen wir eine Weile. Ich wusste, dass Christina noch immer haderte. Ich hingegen versuchte das Gehörte irgendwie in ein bestimmtes Licht, in mein Licht zu rücken und vor allem, es Christina so zu verkaufen, dass sie sich beruhigte und keinen Anstoß mehr an unserer neuen Mitbewohnerin nahm. Ich wartete eine ganze Zeitlang auf den richtigen Gedanken und den richtigen Moment. Kurz vor Zerpenschleuse hatte ich eine Idee und erzählte ihr, was ich von dem gemütlichen Pastor über die Gründerfamilien des Ortes Bebersee erfahren hatte.
„Du verstehst das nicht, Trutz! Es interessiert mich nicht, wer und was diese Frau gewesen ist. Ich will kein Grab auf meinem Grundstück, das meinen Namen trägt. Das ist als…“ Christina brach in Tränen aus.
Dieser Versuch war erst einmal gründlich schiefgegangen. Nachdem sich Christina einigermaßen beruhigt hatte, wurde es noch schlimmer.
„Ich will, dass dieser Grabstein oder dieses Grab von unserem Grundstück verschwindet, verstehst du?“, stieß sie, nun wütend, hervor. „Und ich verlange, dass du dich darum kümmerst. Eher werde ich dieses Haus nicht mehr betreten.“
Das war ein Dilemma. Das war ein echtes Dilemma. Eigentlich hätte ich Christina nun reinen Wein einschenken müssen. Aber ich war mittlerweile derart fasziniert von dieser Geschichte, dass ich fürchtete, wenn Christina davon erführe, sie auf der Stelle ein Inserat aufsetzen würde, um das Haus wieder zu verkaufen. Und das wollte ich unter keinen Umständen. Ein Fehler, wie sich später herausstellen sollte. Ein großer Fehler!
Kapitel 7
Berlin, 11. Juni 2018
Am nächsten Tag, nach der erfolgreichen Besprechung mit meinem Verleger, über die bevorstehende Lesereise, nahm ich mir zum ersten Mal die kleine Broschüre über die Chronik von Bebersee zur Hand, die mir der gemütliche Pastor gegeben hatte. Vielleicht fanden sich doch ein paar versteckte Hinweise, dachte ich. Wenn man einen Text ganz gezielt nach bestimmten Dingen durchforstet, findet man in der Regel immer etwas. Und seien es nur kleine Hinweise, Fährten oder sonst dergleichen. Und ich wusste ja sehr genau, wonach ich zu suchen hatte.
Auf der ersten Seite befanden sich zwei Fotographien. Uckermärkerinnen der Jahrhundertwende. Das andere Foto zeigte Schulkinder aus Bebersee und Groß-Väter 1953. Mit dem Foto der Uckermärkerinnen der Jahrhundertwende konnte nur der Übergang vom neunzehnten ins zwanzigste Jahrhundert gemeint sein. Auf dem Foto waren 27 Mädchen im typischen wilhelminischen Stil abgelichtet, in deren Mitte ihre Lehrerin saß. Die Mädchen waren vielleicht dreizehn oder vierzehn Jahre alt. Unter dem Foto der Uckermärkerinnen standen in einer winzigen Fußnote Namen.
Auf dem Foto von 1953 (die Qualität war schlechter) strahlten 16 Jungen und 17 Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren in vier Reihen hintereinander, hingestellt vor die Kamera. Ich erkannte zwischen ihnen einen Pastor an seiner Lutherschleife.
Auf der zweiten Seite der Chronik gab es einen albernen Comic, dass Ereignisse von 1748 bis zur Zweihundertfünfzig-Jahrfeier 1998 darstellen sollten. Diese kleinen Kinderzeichnungen waren jedenfalls irrelevant.
Ich stand auf und suchte in meiner Küche nach einer Lupe, da ich mir sicher war, dass sich dort irgendwo eine befand. Nach zehn Minuten erfolgloser Suche fand ich sie endlich. Zurück an meinem Schreibtisch versuchte ich die Namen zu entziffern. Erna Mädel, Hermine Eßling, Traudel Junge, Frida Buschmann. Buschmann! Der Name sprang mich an, als hätte er die ganze Zeit auf diesen Augenblick gewartet. Ich war elektrisiert, versuchte den Namen einem dazugehörigen Gesicht zuzuordnen.
Wenn die Reihenfolge der Namen mit den jungen Mädchen auf dem Foto stimmte, war Frida Buschmann die Dritte von links. Sie hatte ein schmales Gesicht, blass. Schwarze beziehungsweise sehr dunkle Haare, vermutlich hinten zusammengesteckt. Kleine Wellen ihres Haares umrandeten links und rechts ihr Gesicht. Und sie hielt einen Gegenstand in den Händen. Als Einzige. Die Anderen hielten ihre Hände übereinandergelegt oder gefaltet.
Ich legte die Lupe beiseite und rieb mir die Augen.
Das Gesicht der vermeintlichen Nachkommin, Frida Buschmann war markant, äußerst markant. Dann rechnete ich kurz. Wenn dieses Mädchen auf dem Foto irgendetwas mit unserer Toten auf dem Grundstück, mit Christina Buschmann geb.: Sens, zu schaffen gehabt hätte, dann wäre sie, wenn man von ihrem Alter ausginge, die mögliche Enkelin von Christina Buschmann. Vorausgesetzt, diese hätte überhaupt Kinder gehabt. Wie konnte ich dies herausfinden?
Der gemütliche Pastor fiel mir ein. Ich musste ihn noch einmal kontaktieren. Möglicherweise gab es im Pfarramt so etwas wie ein Geburts- und Sterberegister. Ich griff zu einem Zettel und
schrieb:
Pastor aufsuchen, nach Sterbe- und Geburtsregister fragen
Dann nahm ich erneut die Lupe zur Hand.
Die Kinder auf dem Foto von 1953 waren undeutlicher zu erkennen, und es standen nur die Vornamen der Mädchen darunter. Hannah, Elisabeth, Gisela, Hildegard, Renate und Frida. Ich ließ die Lupe langsam über jedes Kindergesicht gleiten. Die meisten schienen zu blinzeln, möglicherweise waren sie von der Sonne geblendet oder über das plötzliche aufblitzende Blitzlicht erschreckt. Alle lächelten und hielten ihre Köpfe ein wenig nach links. Vermutlich in Richtung des Fotografen oder jemanden, der da plötzlich aufgetaucht war. Außer einem Mädchen. Sie saß neben dem Pfarrer und sah stur geradeaus, ohne zu blinzeln. Ernstes Gesicht. Dunkles Haar, schmales Gesicht. Ein merkwürdiger Gedanke kam mir. Um diesen zu ordnen, legte ich die Lupe abermals beiseite, stand auf und ging in die Küche, um mir einen Kaffee zu kochen. Während die Kaffeemaschine Wasser in den Kaffeefilter hustete, dachte ich an die Christina Buschmann der Gegenwart – meine Christina Buschmann.
Christina schien fest entschlossen, ihre Drohung wahr zu machen. Der Grabstein und das dazugehörige Grab sollten verschwinden, vorher würde sie das Grundstück mit unserem Haus am See nicht mehr betreten. Dabei hatten wir beide, uns zwei Wochen Auszeit genommen, um das Projekt Bebersee voranzubringen. Kräutergarten und wenigstens die ersten Arbeiten an der Wohnetage.
Wir hatten fast zwei Stunden über diese Dinge gestritten, und mir war es nicht gelungen, sie auch nur einen klitzekleinen Schritt zu Zugeständnissen zu bewegen. Im Gegenteil: desto mehr ich argumentierte (Appelle an die Vernunft und den menschlichen Verstand prallten ab wie Regentropfen an einer Scheibe) umso stärker zog sich Christina in ihre Halsstarrigkeit zurück.
Der Kaffee war inzwischen durchgelaufen, und ich goss ihn in eine Tasse und gab Milch und etwas Zucker hinzu.
Zurück am Schreibtisch blätterte ich etwas gedankenverloren in der Chronik von Bebersee.
Auf der nächsten Seite las ich die Überschrift:
Daten, Ereignisse und Zeitzeugnisse aus der Geschichte von Groß-Väter und Bebersee.
1748 – wurden im Amt Zehdenick die Vorwerke Kleindölln, Kurtschlag, Bebersee und Groß-Väter mit Pfälzer Kolonisten besetzt. Diese vier Orte haben eine gemeinsame Gründungsgeschichte…
1756 – besaßen weder Bebersee noch Groß Väter eine eigene Wasserversorgung – Brunnen – sie mussten nach wie vor Wasser aus den Seen entnehmen.
So ging es weiter. Nun ja, 1782 wurden Bebersee und Groß Väter eigenständige Gemeinden. Ob das ein Vor- oder ein Nachteil für die jeweiligen Gemeinden bedeutete, konnte ich nicht beurteilen. Ich las weiter.
1825 – kam es in Bebersee zu einer Brandkatastrophe. Fünf mit Stroh gedeckte Häuser der bäuerlichen Wirtschaften wurden Raub der Flammen, sie brannten bis auf die Grundmauern nieder.
Ich stutzte. Wieder das Gefühl eines Schauders, der langsam den Rücken hinab kriecht.
Und er blieb: der merkwürdige Gedanke. Ich nahm die Lupe und stellte fest, dass meine Hand ein wenig vor Aufregung zitterte. Ich betrachtete die beiden Fotos und dann die Gesichter der Mädchen. Das Foto, das um die Jahrhundertwende geschossen wurde und das von 1953. Auch wenn das Foto von 1953 unschärfer war, als das um die Jahrhundertwende, stand eines fest. Die beiden Gesichter der Mädchen sahen sich verblüffend ähnlich. Und beide hielten etwas in ihren Händen. Was?
1825 kam es in Bebersee zu einer Brandkatastrophe, wiederholte ich in Gedanken den Text der Chronik, bei der fünf Häuser bis auf die Grundmauern niederbrannten. Kein Wort darüber, ob es auch Tote gegeben hatte und wie es zu diesem Brand gekommen war. Kein Wort darüber, welche Höfe betroffen waren und an welchem Tag die Katastrophe im Jahre 1825 über das Dorf hereinbrach. Ich nahm erneut meinen kleinen Zettel und schrieb:
Pastor nach Brandkatastrophe fragen (wen noch?)
Kapitel 8
Brandenburg an der Havel Maßregelvollzug 26. August 2019
Der Alltag in der Forensik ist auszuhalten. Trotz meiner nächtlichen Schmerzattacke mache ich mich nach dem Frühstück auf den Weg zu meiner täglichen Beschäftigung von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Arbeitstherapie! Unsere Aufgabe besteht darin, verschiedene Werbebroschüren in einem Briefkuvert zu stopfen, was man hier Mailing nennt. Diese Arbeit ist so eintönig und banal, dass man problemlos die ganze Zeit seinen Gedanken nachhängen kann. Von meiner Frühstücksgruppe ist nur Lisa – die Kindesmörderin, beim Mailing anwesend. Arthur – der Senior arbeitet derzeit auf dem gesamten Klinikgelände als Gärtner und Robert säbelt Späne in der Holzwerkstatt.
Ich besitze einen Hochschulabschluss, habe bislang vier Romane und zwei Lyrikbände veröffentlicht und stopfe Flyer von Rossmann und Verdi in Briefumschläge. Recht so. Mir gegenüber sitzt heute Gudrun – eine rundliche Frau Mitte Fünfzig. Ihr Haar leuchtet schneeweiß wie das Haar von Saruman dem Weißen. Weswegen sie hier ist, weiß ich nicht. Sie redet nicht viel. Und wenn, dann meist mit sich selbst.





























