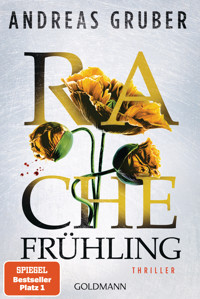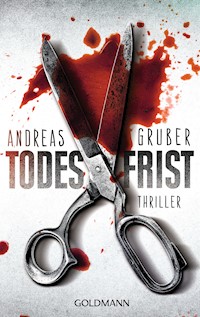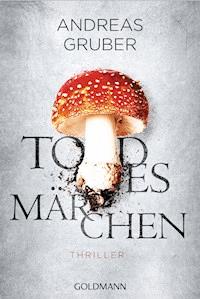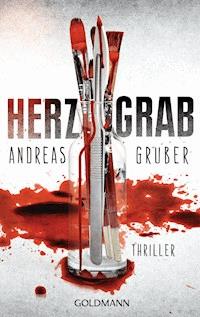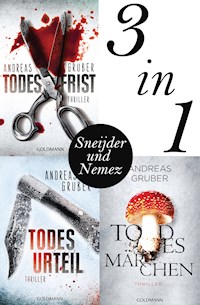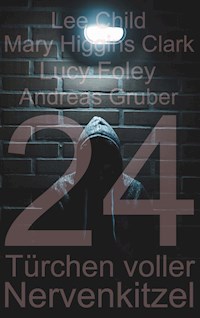Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Andreas Gruber Erzählbände
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Andreas Gruber serviert ein deftiges 15-Gänge-Menü phantastischen Schreckens und menschlicher Abgründe. Treten Sie ein in Friedhöfe, Nervenheilanstalten, verlassene Herrenhäuser und düstere Altbauten, in denen der Wahnsinn nistet. Seien Sie gefasst auf ein unheimliches Brüderpaar, einen geheimnisvollen Fahrstuhl, eine heimtückische Seuche, eine tödliche Buchpräsentation, einen verhängnisvollen Urlaub in das Herzen Marokkos und den finalen Horror biblischen Ausmaßes. BEI Andreas Gruber IST ALLES MÖGLICH! "Nach der Lektüre bin ich einfach nur froh, nicht Andreas Grubers Bruder zu sein. Oder seine Frau. Warum? Lassen Sie sich überraschen." [Boris Koch]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
DER FÜNFTE ERZENGEL
Fünfzehn unheimliche Geschichten
Andreas Gruber
Für Thomas Fröhlich,
ohne den ich weder Dylan Dog, Twilight Zone noch die Musik von Paul Roland kennen würde.
»Angst ist die Dunkelkammer, in der Negative entwickelt werden.«
Sprichwort
Impressum
ISBN E-Book: 978-3-95835-237-7
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Mein Zugang zum Horror
Meine erste Begegnung mit dem Horror-Genre fand an einem Sonntagnachmittag im Wohnzimmer meiner Eltern statt. Ich war etwa fünf Jahre alt und sah die Episode Das Geisterschiff von der TV-Serie Wickie und die starken Männer. Darin trifft Wickie unter Deck eines verlassenen Schiffes auf tanzende Skelette. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ein Skelett war – meine Mutter erklärte es mir – und noch in derselben Nacht hatte ich fürchterliche Angst, selbst auf eines zu treffen.
Meine zweite unheimliche Begegnung fand mit acht Jahren statt, eines Nachts, als ich im Wohnzimmer eine Episode von Raumschiff Enterprise sah. Meine Eltern waren zu Bett gegangen, und ich durfte allein fernsehen, da sie Raumschiff Enterprise für kindertauglich hielten, was es ja auch war, mit Ausnahme dieser einen Folge, die an diesem Abend ausgestrahlt wurde.
Sie hieß Das Spukschloss im Weltall, was mich eigentlich schon hätte stutzig werden lassen müssen, und Captain Kirk, Mister Spock und Pille wurden auf einen Planeten hinuntergebeamt, wo sie drei schrecklich aussehenden Hexen begegneten, die – begleitet von schaurigen Klängen – über den Bildschirm schwebten und dabei aussahen wie die späteren Dämonen aus Tanz der Teufel. Sie können sich vorstellen, wie ich die Nacht verbracht habe.
Viele Jahre später sah ich mir diese Episode noch einmal als Erwachsener auf DVD an, um meine Kindheitsängste aufzuarbeiten. Die Szenen waren immer noch sehr schaurig, und bei der Gelegenheit sah ich, dass das Drehbuch von Robert Bloch stammte, dem Autor von Psycho. Also wen wundert es?
Seit diesen beiden Erlebnissen fasziniert mich dieses Gefühl von Grusel, Angst und Schrecken in all seinen Facetten.
Lange bevor ich wusste, wofür der Begriff Gothic Horror stand, begeisterten mich bereits verfallene Schlossmauern, Geheimgänge, verkrüppelte Bäume, durch den Nebel holpernde Kutschen, Leichen im Moor, Gruften mit Särgen und wahnsinnig gewordene Grafen. Was passte da wohl besser dazu, als ein schaurig schöner Vincent Price mit weißgelben Haaren in weinroter Robe mit irrem Blick, auf dem ein Familienfluch lastet? Der Untergang des Hauses Usher aus dem Jahre 1960 ist die erste von insgesamt acht Edgar-Allan-Poe-Verfilmungen von Roger Corman, die mich in meiner frühesten Jugend fasziniert hat.
Doch dann kam der Rückschlag. Mit etwa zehn Jahren sah ich den Film Der Mann mit den Röntgenaugen abends im Fernsehen. Ich war noch klein genug, um nicht zu realisieren, dass das in diesem Film von Schauspielern gezeigte Geschehen nicht der Wirklichkeit entsprach. Als sich Ray Milland am Ende des Films in einer Kirche die Augen aus dem Kopf reißt und mit leeren Augenhöhlen schmerzverzerrt in die Kamera blickt, weil er durch die Einnahme eines Serums durch alle festen Materialien inklusive seiner Augenlider sehen konnte, was ihn in den Wahnsinn trieb, war ich komplett am Boden zerstört. Ich lag die halbe Nacht wach und hoffte, dass mir das nicht auch eines Tages passieren würde.
Viele Jahre später erfuhr ich, dass mich meine Mutter in meinem Zimmer weinen gehört, mich aber absichtlich nicht zu sich ins Bett geholt und getröstet hatte, weil sie mir eine Lehre erteilen wollte.
Diese Lehre ist ihr tatsächlich gelungen!
Heute bin ich Schriftsteller, schreibe mir meine Ängste mit Thrillern und Horrorgeschichten von der Seele und verdiene mein Geld damit. Das alles habe ich meiner Mutter zu verdanken. Danke Mama, würde Norman Bates vermutlich sagen.
Zu jener Zeit hatte ich auch schon meine Liebe zur Science-Fiction entdeckt und damit auch recht früh den Genremix aus Horror und Science-Fiction kennengelernt.
Einer der ersten Filme jener Art, die ich als Kind im TV sah, war Die Körperfresser kommen aus dem Jahr 1978 mit Donald Sutherland und Leonard Nimoy, den ich bereits als Mister Spock aus Raumschiff Enterprise kannte. Bei dieser Mischung aus Science-Fiction, Horror und paranoider Verschwörungstheorie mit gelungenen Spezialeffekten, basierend auf dem Roman von Jack Finney, spitzt sich die Spannung immer mehr zu, die Situation der letzten Überlebenden wird immer dramatischer, und ich fragte mich, wie es die Figuren in diesem Film noch jemals zu einem Happy End schaffen sollten. Sollten sie das überhaupt? Die Schlussszene, wenn Donald Sutherland schreiend die Hand erhebt, ist wohl eine der besten Szenen der Filmgeschichte, die mich schon als Kind in frühen Jahren geprägt hat. Woooooaaaaahhhh …
In den darauffolgenden Sommerferienwollte ich mit einem gleichaltrigen Freund Alien im Kino sehen, aber wir wurden von einem umsichtigen Kartenverkäufer als Elfjährige noch nicht hineingelassen. Zum Glück. Ich weiß nicht, wie ich den Film damals überstanden hätte. Daher musste ich mich mit der Alien-Verarsche im MAD-Magazin zufriedengeben. Jahre später sah ich Alien dann endlich auf einer VHS-Leihkassette und wusste, falls ich jemals auf einem Raumschiff durchs All fliegen würde, dann nur in Begleitung von Sigourney Weaver als drittem Offizier. H. R. Gigers düstere organische Optik hat diesen SF-Film so einzigartig gemacht, dass er sich von den bis dahin gewohnten fasergeschmeichelten Serien wie Raumschiff Enterprise, Kampfstern Galactica und Mondbasis Alpha 1 deutlich abhob.
Bereits als früher Teenager war eines der schaurigsten Themen, das mich eiskalt am Genick packte, die Kombination von Dämonen und Katholischer Kirche – wobei ich bis heute nicht weiß, was gruseliger ist. Namen wie Pater Damien Karras, Vater Merrin und Regan aus Der Exorzist werden wohl immer in meinem Gedächtnis eingebrannt bleiben. War der Film seinerzeit im Fernsehen schon ziemlich schockierend, setzte der Director's Cut noch eins drauf. Im Kino bin ich aus dem Stuhl hochgefahren, als Linda Blair kopfüber im Spiderwalk die Treppe herunterlief. Zum gleichen Zeitpunkt wusste ich, dass ich dieses Bild länger nicht aus dem Kopf bekommen würde – und ich sehe sie noch heute vor mir, blutüberströmt und schreiend.
Nicht minder schockierend waren für mich die Filme Das Omen und Omen II. Ich war 16 Jahre alt und ging bereits in die Handelsakademie, als die Filme abends im Fernsehen liefen. Allerdings nicht verstümmelt wie im deutschen TV, sondern ungeschnitten im ORF, inklusive rollendem Kopf über die Glasplatte. Das unheimliche Kindermädchen, die Mystik der drei Sechsen, die Dolche aus der Stadt Megiddo, die Friedhofsszene mit dem Skelett des Schakals im Sarg, die mystischen Ausgrabungsszenen, die Fahrstuhlszene und der an der Kupplung des fahrenden Zuges hängende Mann, begleitet von den entsetzlich schaurigen Chören.
Tags darauf war Omen das Gesprächsthema in der Schule. Plötzlich wussten alle Jugendlichen, was der Antichrist und die Offenbarung der Apokalypse waren, und jeder hatte den Carmina Burana ähnlichen Soundtrack von Jerry Goldsmith im Ohr.
Corpus, edimus, corpus, satani!
Gänsehaut pur!
Zu jener Zeit, mit sechzehn Jahren, entdeckte ich auch die Heftroman-Tauschzentralen, die es damals noch an fast jeder Häuserecke gab, und die auch Horror-Heftromane führten, die man damals für einen Schilling – also umgerechnet sieben Euro-Cents – kaufen konnte.
In den 80er Jahren war ja die goldene Ära der Heftromane, und es wimmelte von Geisterjägern. Nachdem ich meine Kinder- und Jugendbücher wie Die drei ??? im Schrank meines Kinderzimmers verstaut hatte, begann ich die Gespenster-Krimi-Serie aus dem Bastei-Verlag zu lesen, aber auch die beiden Ableger John Sinclair und Tony Ballard, die einerseits mit Suko, andererseits mit Mister Silver, einen humorvollen Side-Kick hatten. Noch mehr faszinierten mich allerdings die Heftromane von Dan Shocker aus dem Zauberkreis-Verlag, dem ich damals tatsächlich einen Leserbrief geschrieben habe und noch heute ein Autogramm von ihm besitze.
Dan Shocker schuf die etwas fantasylastige Serie Macabros, aber auch die sehr düstere, wendungs- und actionreiche Horrorserie Larry Brent. Dieser Geheimagent arbeitete für die PSA, eine Spezialabteilung zur Verbrechensbekämpfung, und bekam es im Lauf der knapp zweihundert Hefte, von denen ich – mangels einer Freundin – über hundert am Stück gelesen habe, mit irren Wissenschaftlern zu tun, die in Geheimlaboren schreckliche Experimente durchführten. Aber auch mit Werwölfen, Zombies und Vampiren in verfallenen Schlössern mit zahlreichen Geheimgängen, und mit allerhand Magie, die aber immer wieder halbwegs plausibel mit wissenschaftlichen Erklärungen untermauert wurde – sofern man als Leser bereit war, ein Auge zuzudrücken.
Aber vor allem gefiel mir Larry Brent deshalb eine Spur besser als John Sinclair, weil die Covers der Hefte einfach besser aussahen. Der Maler Lonati schuf geniale Motive, auf denen stets leicht bekleidete und üppige Damen auf der Flucht vor einem Monster zu sehen waren. Wie gesagt, ich war noch ein Teenager und hatte keine Freundin.
Durch Filme wie Carrie oder Shining wurde ich schließlich auf Stephen King aufmerksam, und damals, mit sechzehn Jahren, hatte ich noch keine Ahnung, wie man seinen Vornamen richtig aussprach und dachte noch, man würde ihn so betonen wie das deutsche Stephan und nicht wie Steven.
Jedenfalls waren Kings Romane die erste richtige Erwachsenenliteratur, die ich nach den Heftromanen zu lesen begann, und später stellte ich fest, dass es vielen anderen Horrorautoren meiner Generation ebenso ergangen war. In meinem Fall waren es Brennen muss Salem, Es, Das letzte Gefecht oder die hervorragenden Kurzgeschichtensammlungen Nachtschicht und Frühling, Sommer, Herbst und Tod, die für mich bis heute zu Kings Klassikern gehören und deren Inhalte immer noch in meiner Erinnerung herumspuken.
Aber schon bald war ich nach Stephen Kings oftmals ausufernden Beschreibungen auf der Suche nach etwas Neuem und entdeckte die psychologischen, unheimlichen Romane von John Saul, die literarischen Romane von James Herbert, etwas später die wissenschaftlich recherchierten Horrorthriller von Dean R. Koontz und machte dann auch schon bald die Bekanntschaft mit den großartigen Horrorkurzgeschichten von David Morrell und Joe R. Lansdale und den harten Romanen von Shaun Hutson und Richard Laymon.
Ich habe auch versucht, die richtigen Klassiker zu lesen, wie die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe, Dracula und Frankenstein, wurde aber von der oftmals sehr altmodischen Sprache abgeschreckt. Richtig enttäuscht war ich aber nur von Mary Shelleys Frankenstein, weil die Erschaffung des Monsters in nur einer halben Seite abgehandelt wurde, mir aber gerade dieser Teil in den Verfilmungen am meisten gefallen hat. Vor allem in den alten Hammer-Filmen der 50er und 60er Jahre mit Christopher Lee und Peter Cushing.
Noch in meiner Teenagerzeit kam dann ein völlig neuartiges Genre auf, das mich ebenfalls faszinierte: Der Splatterfilm.
Wobei mich Halloween oder Freitag der 13. nie besonders interessierten, dafür aber Filme wie Tanz der Teufel umso mehr. Diesen Film sah ich mit siebzehn Jahren bereits im Kino, und das gleich zweimal hintereinander, weil ich es nicht fassen konnte, wie brutal und zugleich originell dieser Film alle bisher dagewesenen Grenzen mit seinen unglaublichen Masken und Splattereffekten sprengte. Durch die Anspielungen auf Lovecrafts Necronomicon erfuhr der Film eine zusätzliche Dimension, die sich perfekt mit den irren Kamerafahrten und schrägen Blickwinkeln ergänzte. Seit diesem Film ist mir klar, was man braucht, wenn man nachts allein in einen Wald geht: Schrotflinte und Kettensäge! Bruce Campbell als Ash wurde durch diesen Film zu einer Horror-Ikone … Klaatu Verata Necto.
Im Jahr darauf war ich zum ersten Mal in London, besuchte meine horror-affine englische Brieffreundin, die mir im Gegensatz zur Schule richtiges Englisch beibrachte, und machte die literarische Bekanntschaft mit Clive Barkers Books of Blood, kurz bevor sie ins Deutsche übersetzt wurden. Als dann Hellraiser, basierend auf Barkers Novelle, in die Kinos kam, noch dazu von Barker selbst verfilmt, wurde der Besuch zur Pflicht. Hellraiser und die ersten beiden Fortsetzungen zählen für mich zum Besten, was der mystisch-dämonische Splatterfilm zu bieten hat, und ich habe viele Bilder im Kopf mit nach Hause genommen. Zum Beispiel von fliegenden Ketten mit Widerhaken, sich verändernden eisernen Würfeln und gequälte sowie schrecklich verformte Menschenleiber. Die gleichnamige Novelle ist übrigens fast schon Poesie, die mit dem Stil der Filme kaum vergleichbar ist. Also wer immer noch meint, dass Horror nicht anspruchsvoll sein kann, sollte Hellraiser – Das Tor zur Hölle lesen.
Was mir an diesen alten Splatterfilmen gefällt, ist, dass Latexpuppen und Kunstblut auf mich echter wirken als jeder aus der Dose generierte leblose Computertrick eines Blockbusters. Darum bin ich auch ein Fan von Peter Jacksons Braindead und Robert Rodriguez' From Dusk Till Dawn, die auf Computertricks verzichten und die Effekte in guter alter Tradition auf die Leinwand bringen.
Aber ich will hier keine Lanze für alte Effekte brechen, denn es gibt auch moderne Filme, die verdammt gut aussehen, wie Hellboy oder Pans Labyrinth, um nur ein paar zu nennen.
Bei meiner Liebe zu Horrorfilmen entdeckte ich schon recht früh, dass eine Reihe guter Filme von ein und demselben Regisseur stammten, und so wurde ich ein Fan von John Carpenter und achtete ab da darauf, wer die Filme machte.
In Das Ding aus einer anderen Welt schuf Carpenter, basierend auf einer Kurzgeschichte von John W. Campbell, einen klaustrophobischen Horrorfilm, bei dem á la Agatha Christies Zehn kleine Negerlein die Wissenschaftler einer Antarktis-Station der Reihe nach gekillt werden. Übrigens hört das 2011, also fast dreißig Jahre später gedrehte Prequel The Thing exakt an jener Stelle auf, an der Carpenters Film beginnt, sodass man sich beide Filme ohne logischen Bruch hintereinander ansehen kann. Ein wunderbares Filmerlebnis, das ich nur jedem empfehlen kann!
In Die Fürsten der Dunkelheit schuf Carpenter eines meiner Lieblingsszenarios, in dem ein Team von Wissenschaftlern in einem alten Gebäude übernachtet, in dem es spukt, um es zu erforschen. Dabei handelt es sich um eine Kirche, in deren Keller die Flüssigkeit eines Artefakts gespenstisch nach oben tropft. Carpenter entwarf in diesem Film viele schöne Bilder, die mir noch lange im Gedächtnis blieben.
Und einige Jahre später schuf Carpenter mit Die Mächte des Wahnsinns eine Lovecraft-Hommage, die er mit so vielen Anspielungen, Lovecraft-Motiven und originellen Ideen spickte, dass ich mir diesen Film immer wieder ansehen könnte. Die Atmosphäre des Städtchens Hobb's End, das Geheimnis des Horrorautors Sutter Cane, verkörpert von Jürgen Prochnow, die Landkarte auf seinen Buchcovern, der Wahnsinn seines Lektors, die vergebliche Flucht aus diesem Ort, seine schrecklichen Bewohner und der Schluss, in dem Sam Neil aus dem Irrenhaus hinaus in eine völlig wahnsinnig gewordene Welt stolpert – neunzig Minuten Rollercoaster durch Lovecrafts Welten. Durch diesen Film habe ich mir viele Inspirationen geholt, die immer wieder in leicht veränderter Form in meinen Horrorstorys auftauchen – ob ich nun will oder nicht.
Auch im Bereich der Comics machte ich sehr früh die Bekanntschaft mit dem Unheimlichen. Als Jugendlicher las ich die sehr dünnen auf Pulp-Papier gedruckten Gespenster-Geschichten-Comics und die Comic-Heftserie Yoko Tsuno von Roger Leloup, die teilweise schaurige Erlebnisse in Burgen und Gruften beschrieben, und entdeckte viele Jahre später die italienischen Dylan Dog Comicbände von Tiziano Sclavi, knapp hundertseitige A5-Bücher mit schaurig schönen s/w-Zeichnungen, von denen leider nur sechzig Bücher ins Deutsche übersetzt wurden. Wobei Dylan Dog in einer eigenen bizarren, melancholischen, psychedelischen und surrealen Welt voller Monster, Serienkiller und verrückter Wissenschaftler lebt, die so einzigartig ist, dass sie meines Wissens nach bisher nie kopiert wurde.
Apropos Welt voller Monster … bereits seit einigen Jahren lese ich regelmäßig die The Walking Dead Comics von Robert Kirkman und erwarte jeden neuen Band mit großer Spannung. Die Comics gefallen mir übrigens viel besser als die darauf basierende gleichnamige TV-Serie, weil die stimmigen s/w-Grafiken meiner Fantasie mehr Spielraum lassen, um in die schreckliche Welt der Zombies einzutauchen.
Auch in Sachen Hörspiele hat sich einiges im Lauf der Zeit in meinem Fundus angesammelt. Mein erster Kontakt mit Horror-Hörspielen waren die sehr aufwendig produzierten Larry-Brent-Hörspielkassetten aus dem Haus Europa, die schon damals ausgezeichnete Sprecher hatten, einen guten Erzähler, tolle Soundeffekte und eine packende Musik. Es war die richtige stimmungsvolle Atmosphäre, wenn man nachts nicht einschlafen konnte, mit den Kopfhörern im Bett lag und der Kassettenrekorder neben einem lief.
Dann hörte ich einige Jahrzehnte lang nichts, und erst vor ein paar Jahren habe ich das Hörspiel wieder entdeckt, wenn ich zwischen meinen Schreibeinheiten mit Walking Stöcken und MP3-Player in den Wald gehe oder nachts einen sogenannten Nightwalk mit Stirnlampe mache.
Da höre ich Gabriel Burns, Twilight Mysteries, John Sinclair, Dorian Hunter, MindNapping, die Klassiker aus dem Gruselkabinett oder pseudoreale Hörspiele wie Das Lufer-Haus oder House of Leaves, die mir regelmäßig einen Schauer über den Rücken jagen. Entweder komme ich danach zu Tode erschrocken nach Hause oder voller Inspiration, oder es trifft – wenn ich Glück habe – beides zu.
Eine weitere Inspirationsquelle für meine eigenen Texte sind die sogenannten Plot-Twist-Movies, die aufkamen, als ich meine Teenagerzeit schon längst hinter mir gelassen hatte.
The Sixth Sense hat eine ganze Welle von Filmen mit überraschenden Wendungen losgetreten und war der erste seiner Art, der am Ende eine Plot-Wendung servierte, die so raffiniert war, dass ich mir den Film gleich noch einmal ansehen wollte. Und dabei hätte ich die Pointe fast verpasst, denn ich sah den Film im Kino, kam aber etwa fünf Minuten zu spät in die Vorstellung, weil ich mit dem Auto vor einem Bahnübergang warten musste. Als mich der Kartenabreißer mit der Taschenlampe zu meinem Platz brachte und ich mich gesetzt hatte, sah ich gerade die Szene, in der Bruce Willis angeschossen wird und schwer verletzt rücklings aufs Bett fällt. Wäre ich eine weitere Minute zu spät gekommen, hätte ich die Schlusspointe gar nicht kapiert, und eines der intensivsten Filmerlebnisse wäre spurlos an mir vorüber gegangen.
Und danach kamen sie, diese Filme mit den überraschenden Wendungen, die mich immer wieder ins Kino zogen, weil ich die Wendung vor dem Schluss erraten wollte, was mir aber nie gelungen ist.
Bei The Ring fiel mir im Kino gegen Filmende die Kinnlade hinunter. O Gott, dachte ich, was für eine Wendung – und das zu einem Zeitpunkt, als ich bereits dachte, der Film wäre zu Ende. Und in der nächsten Szene kletterte das Mädchen von der Videokassette im Fernsehgerät dann … na ja, wenn Sie den Film gesehen haben, wissen Sie, was ich meine … jedenfalls fuhr ich erschrocken vom Kinostuhl hoch.
Aber es gab auch entspannte Kinobesuche. Als ich mir mit meiner Frau im Kino Identität ansah, waren wir anfangs beide der Meinung, einen normalen Thriller zu sehen. Doch dieser Trugschluss wurde uns nach den ersten paar Leichen bald bewusst, was mich persönlich nicht störte – aber meine Frau bekam Atembeschwerden. In diesem genialen Verwirrspiel treffen zufällig zehn Menschen in einer sintflutartigen Regennacht in einem Motel aufeinander. Alle zehn haben eine Gemeinsamkeit in ihrem Namen, alle zehn haben am selben Tag Geburtstag. Verrückt genug! Aber alle zehn sterben auf grausame Weise, in absteigender Reihenfolge ihrer Motel-Zimmernummer entsprechend. Der Film beginnt wie ein Thriller und wird nach ein paar exzellenten Rückblenden immer mysteriöser, um im letzten Drittel eine schlagartige Wendung hinzulegen, dass mir nur noch die Spucke wegblieb. Meine Frau hat mich dafür gehasst.
Von den Mindfuck-Movies, die etwa zur selben Zeit aufkamen, hat mich neben den Filmen von David Lynch wohl am meisten Triangle fasziniert. Je mehr man versucht, darüber nachzudenken, umso irrer wird man. In Triangle kommt eine Gruppe junger Leute nach dem Kentern eines Segelbootes auf einen Dampfer, auf dem es nicht geheuer zugeht. Mysteriöse Vorfälle ereignen sich, ein Killer scheint an Bord zu sein und dann durchlebt die Heldin sämtliche Szenen ein weiteres Mal und ein weiteres Mal. Eine Zeitschleife also! Stück für Stück wird es mysteriöser, und am Ende muss man sich selbst eine plausible Lösung zusammenreimen. Ein Riesenspaß für Tüftler und intelligente Horrorfans, die über den Tellerrand blicken.
Neben all diesen Filmen, Heftromanen, Büchern, Comics und Hörspielen hat der Horror aber auch in Form von Musik Eingang in mein Leben gefunden.
Als Fan von Hardrock und Heavy Metal jeder Art gefällt mir auch der sogenannte Gothic oder Doom Metal á la HIM oder Type O Negative, aber auch eine Unterform der Punkmusik, der sogenannte Horrorpunk. Ursprünglich von den Misfits erfunden, gibt es mittlerweile zahlreiche Bands, die rockigen und erfrischend beschwingten gute Laune Horrorpunk spielen, wie Ghoultown, Horrorpops, Mad Sin, Crimson Ghosts, Murderdolls, Wednesday 13 oder Frankenstein Drag Queens. Und es gibt – man höre und staune, und deshalb freue ich mich besonders, das zu erwähnen – auch eine österreichische Band, die sich Bloodsucking Zombies from Outer Space nennt, und dreimal dürfen Sie raten, welche Musikrichtung die spielen.
Jedenfalls keine Volksmusik!
Kürzlich bin ich auch auf die Musik des Briten Paul Roland gestoßen, ein sogenannter Songwriter, der bereits seit 35 Jahren auf der Bühne steht, insgesamt neunzehn Studioalben produziert hat, und den ich mittlerweile schon in einem Wiener Kellerlokal live sehen durfte.
1959 in Kent geboren, ist er selbst Fan klassischer Gruselfilme und hat Songs mit entsprechenden Titeln in seinem Repertoire. Hier eine kleine Kostprobe: Arkham, Bates Motel, Tell-tale-Heart, Re-Animator, Nosferatu, Werewolves of London, Cthulhu, Madhouse, Ghost Ships, Edgar Allan Poe, Aleister Crowley, Walter the Occultist, Madame Guillotine, Doctor Strange oder Reptile House.
Ich muss Ihnen nicht mehr darüber erzählen – Sie können sich denken, worum es in diesen Songs geht.
Musikalisch hat Paul Roland eine fast schon sanfte, kindliche und melancholisch traurige Stimme, die manchmal an einen vom Wahnsinn befallenen Schwindsüchtigen erinnert. Begleitet wird der Gesang entweder von einer sich dramatisch steigernden Akustikgitarre oder einer Orgel, die aus einer unheimlichen Spuk-Kirche stammen könnte, einem Cembalo, das eine herzzerreißende Traurigkeit hervorruft, psychedelischen E-Gitarren, einem Synthesizer, der einprägsame Refrains elektronisch verzerrt, Violinen, die eine düstere Atmosphäre schaffen, ein Piano mit unheimlichen Klängen, Flöten oder ein zu Tränen rührendes Cello.
Ich kann es nicht anders beschreiben, es klingt einfach genial. Aber wenn man diese Musik zu lange hört, kann es passieren, dass man nachts von verrückten Träumen geplagt wird, die von Tentakelwesen in Arkham handeln, von Hexen, Dämonen, Werwölfen und Vampiren in Gruften, dunklen Irrenanstalten und Reptilienhäusern, viktorianischen Luftschiffen, Spuk- und Geistererscheinungen und versunkenen und von Riesenkraken umschlungenen U-Booten, die auf dem Meeresgrund liegen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche – ich habe nämlich ein Jahr lang ausschließlich Musik von Paul Roland gehört.
Aber Horror muss nicht immer verstörend sein, sondern kann – was ihm beizeiten guttut – sich auch mal selbst auf den Arm nehmen.
In meiner Jugend gab es die vermutlich absichtlich in s/w gedrehte Serie The Munsters, weil es eine Hommage an den gotischen Gruselfilm war, und Herman und Lily Munster mit Grandpa, einem Vampir, und ihrem Werwolfsohn Eddie, der Fledermaus Igor und dem feuerspeienden Drachen Spot, der unter der Treppe hauste, in einem verfallenen Schloss wohnten. Und da war es völlig normal, dass Spinnweben im Wohnzimmer hingen, Käfer durch die Küche krabbelten, Blitze ins Haus einschlugen und giftige Elixiere im Keller gebraut wurden.
Eine Leiche zum Dessert mit Peter Falk, Alec Guinness, David Niven und Peter Sellers, Meine teuflischen Nachbarn mit Tom Hanks oder Mel Brooks Dracula mit Leslie Nielsen sind meine absoluten Lieblings-Horrorkomödien, die ich schon zigmal gesehen habe und mir immer wieder gern auf DVD mit in den Urlaub nehme, falls es mal eine stürmische Gewitternacht in der Unterkunft geben sollte.
Abgesehen davon existiert ein weniger bekannter, aber nicht minder guter Film, den ich auch immer wieder gern sehe. Bubba Ho-tep, basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Joe R. Lansdale, ist ein kleiner aber feiner Independent-B-Movie und eine Perle unter den schrägen Horror-Komödien. Die Handlung ist so einzigartig, dass ich sie hier kurz anreißen möchte: Der vom Secret Service als Schwarzer eingefärbte John F. Kennedy lebt nach einer Gehirnamputation als alter Mann im Seniorenheim. Im Nebenzimmer wohnt der ebenfalls gealterte, aber immer noch lebendige Elvis Presley, an dessen Stelle vor vielen Jahren ein Elvis-Double gestorben ist. Beide bemerken, dass sich eine ägyptische Mumie regelmäßig nachts in das Altersheim schleicht, um den Pensionisten – entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise – die Seele aus dem Arschloch zu saugen. Die beiden sagen der Mumie den Kampf an, selbst wenn sie sich nur noch mit einer Gehhilfe fortbewegen können. Frage also nicht, was dein Pflegeheim für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Pflegeheim tun kannst – es ist Zeit für Rock 'n' Roll.
All das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, hat mich im Lauf des Lebens beeinflusst, und so stand dann etwa um 1996 mein Entschluss fest, dass ich Schriftsteller werden und selbst unheimliche Geschichten erzählen wollte. Meine ersten Gehversuche – wie konnte es anders sein – unternahm ich natürlich im Horrorgenre.
1999 machte ich auf einer Horror- und Science-Fiction-Convention in Dortmund die Bekanntschaft mit dem Autor und Herausgeber Boris Koch. Im Jahr darauf erschien in seinem kleinen Verlag Edition Medusenblut mein erstes Buch Der fünfte Erzengel mit neun Horror-Erzählungen. Boris und ich trafen uns in Passau, und da überreichte er mir meine Belegexemplare. Es war ein wunderbares Gefühl, mein erstes eigenes Buch in Händen zu halten.
Die damalige Auflage betrug 200 Exemplare. Jahre später wurde das Buch zwar nachgedruckt, aber mittlerweile sind beide Auflagen vergriffen, darum war ich froh, als mir der Luzifer-Verlag die Möglichkeit bot, diese Storys in neuem Gewand wieder zu veröffentlichen. Das Überarbeiten der Geschichten hat mir großen Spaß gemacht, und an einigen Stellen, sofern es der Story diente, habe ich die Handlung erweitert. Außerdem finden Sie in dieser Sammlung – im Vergleich zur Erstauflage – sechs zusätzliche Geschichten, die, wie ich finde, gut zum Grundtenor des ursprünglichen Bandes passen.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit den vorliegenden fünfzehn Storys. Mögen sie Ihnen den Schlaf rauben – und falls nicht, wünsche ich Ihnen blutrünstige Albträume …
Wahrscheinlich ein kaputter Gasherd
Ich kann mich noch an meinen zweiten Schreibworkshop erinnern, den ich 1996 als junger und – wie ich hoffte – talentierter Schreibanfänger mit anderen Autoren bei einem Deutschprofessor in Berndorf absolviert habe.
Ich wollte schon damals Schriftsteller werden und habe mich im Rahmen dieses Workshops intensiv mit den Biografien klassischer Autoren auseinandergesetzt und dabei etwas Interessantes herausgefunden: Die Selbstmordrate unter Schriftstellern ist enorm hoch.
Das hat mich aber nicht abgeschreckt, selbst schreiben zu wollen. Denn ich überlegte mir: Liegt es an diesem Beruf, dass viele den Freitod wählen? Oder liegt es vielmehr daran, dass sensible und suizidgefährdete Menschen diesen Beruf wählen?
Ich habe versucht, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, und herausgekommen ist dabei eine Geschichte, die den Auftakt dieser Sammlung bilden soll.
Viel Spaß damit.
Guten Abend! Kommen Sie herein, die Wohnungstür ist offen. Behalten Sie die Schuhe ruhig an. Folgen Sie mir ins Arbeitszimmer, aber erschrecken Sie bloß nicht vor den Gedichten, Notizen und Gedankensplittern, die hier überall kleben. Diese Zettel sind mein Lebenswerk – dreißig Jahre Schriftstellerei sozusagen –, als Fragmente an den Wänden verewigt.
Ja, dort steht der Schreibtisch. Wie Sie sehen, arbeite ich gerade an einem Roman, meinem ersten. Dieses Manuskript wird mir den Durchbruch bringen. Es wird ein Meisterwerk, was Dramatik, Handlung und Charakterzeichnung betrifft. Der Titel? Tja, es ist die Geschichte eines Autisten, Titel habe ich noch keinen – um die Wahrheit zu sagen, habe ich nicht einmal ein richtiges Konzept für die Geschichte. Aber Ideen spuken genug in meinem Kopf herum, ich brauche sie nur noch zu Papier bringen – nichts leichter als das.
Etwas vorlesen? Ja gern, aber bis auf den ersten Satz ist der Papierblock noch leer, und selbst dabei handelt es sich um ein Bruchstück, an dem ich bereits seit mehreren Wochen arbeite. Ich weiß, was Sie jetzt denken, aber ein Künstler kann seine kreative Phase nicht erzwingen. Kreativität kommt, wenn die Zeit reif dafür ist, bis dahin muss man eben abwarten und sich in Geduld üben … aber bitte, kommen Sie getrost einen Schritt näher und lesen Sie selbst. Nein, wo denken Sie hin! Ich möchte mich da noch nicht festlegen, ob das Buch tatsächlich mit diesem Satz beginnen wird: Als der autistische Maler heute Morgen aus dem Fenster blickte, schien ihm, als wolle ihm das Leben etwas mitteilen … Ich sagte ja, der Anfang ist bloß ein Fragment, er ist noch nicht ausgegoren, dient lediglich als Gedankenstütze für das fabelhafte Kapitel, das noch folgen wird.
Aber selbstverständlich, öffnen Sie ruhig ein Fenster. Allerdings finde ich nicht, dass es hier muffig riecht. Wie ich mich hier konzentrieren kann? Ich verstehe nicht … ja, Sie haben natürlich recht. Auf meinem Schreibtisch sieht es aus, als würde ich bereits seit Monaten an fünf Erzählungen gleichzeitig arbeiten, und in der Tat sind schon mehrere Monate vergangen, seit ich mich an das Pult gesetzt habe, um mein Buch zu schreiben … oder war es bereits im letzten Sommer, als ich nach meiner Lesung …? Ja richtig, es war im Juli letzten Jahres, bei meiner Dichterlesung im Wiener Literaturhaus, bei der ich einige Gedichte aus meinem Lyrikband vortrug. Die anwesenden Kritiker lobten meine Arbeit, die sie als experimentelle Selbstverarbeitung bezeichneten, mit intertextuellen Bezügen und spielerisch literarischen Ausdrucksmitteln. Einige wenige, die etwas von ihrem Fach verstehen! Jedenfalls gab ich nach jener Lesung bekannt, dass ich mit der Arbeit an einem neuen Projekt beginnen würde.
Stimmt, seit damals ist über ein Jahr vergangen, ein mehr als deprimierender Winter und ein ereignisloser Frühling, um genau zu sein. Aber unterschätzen Sie nicht die belebende Kraft einer schöpferischen Pause. An diesem Morgen habe ich mir allerdings vorgenommen, mich endlich mit dem nötigen Ernst in meine Aufgabe zu stürzen. Die vielen kleinen Zettel, die hier überall kleben, sehen zwar chaotisch aus, doch ich bin gerade mittendrin, meine Gedanken und Ideen zu ordnen. Irgendwo zwischen dem alten Wurstsemmelpapier, den Medikamenten, Weingläsern und leeren Flaschen muss sich eine handgeschriebene Inhaltsangabe verstecken, in der ich vor Monaten einige Gedanken festgehalten habe. Allerdings fürchte ich, dass selbst dort nicht viel mehr zu finden ist, als dieser Satz, den Sie ja bereits kennen. Ich muss gestehen, diese Unordnung ist mir unangenehm, und obwohl ich mir täglich vornehme, das Zimmer aufzuräumen, habe ich mich bis heute nicht dazu aufraffen können. Es ist kräfteraubend, aber das ständige Warten auf die Muse lässt mir kaum Zeit für andere Aktivitäten.
Früher musste ich mir über solche Dinge wie ein sauberes Schreibpult keine Gedanken machen, doch meine Mutter, nun, wie soll ich sagen … kümmert sich schon lange nicht mehr um diese Wohnung. Natürlich gibt es auch Putzfrauen, aber es ist erschreckend … die kosten ein Vermögen, und im Moment könnte ich selbst einen kleinen Nebenverdienst gut gebrauchen. Ach, kommen Sie! Das habe ich doch alles probiert. Tantiemen gibt es keine mehr, meine Förderungsansuchen wurden abgelehnt, sämtliche Beihilfen und Literaturstipendien gestrichen, und selbst meine Sozialrente wurde letztes Jahr auf ein Minimum reduziert. Scheinbar ist es wichtiger, Geld für andere Dinge auszugeben, als Kunst zu fördern. Die Stadt Wien hat mir sogar das Wasser abgedreht! Aber keine Sorge, ich komme schon über die Runden.
Möchten Sie übrigens etwas trinken? In der Küche müsste noch eine Wasserflasche stehen. Nein? Nun, wie dem auch sei, ich war schon lange nicht mehr im hinteren Teil der Wohnung. Vor der Eingangstür steht sicherlich eine Flasche Rotwein. Ein Nachbarjunge hilft mir manchmal dabei, die Wohnung zu verlassen, da mich in letzter Zeit Schwindelanfälle plagen. Er stellt mir fast jede Woche eine neue Flasche vor die Tür, die er heimlich aus dem Keller seines Großvaters … nun, wie soll ich sagen … entlehnt? Später einmal werde ich selbstverständlich alles von meinen Honoraren zurückzahlen.
Wie meinen Sie das, ich hätte mich in letzter Zeit verändert? Sie haben mich doch eben erst kennengelernt. Ach so, Sie meinen das Foto aus jener Zeit, als ich noch Lesungen hielt! Welcher Vollbart? Ich trage auch heute keinen Vollbart. Ich habe mich wohl seit einigen Tagen nicht mehr rasiert, das ist alles. Ich bin keineswegs blass. Nein, wie kommen Sie darauf? Also bitte, ich habe kein Fieber! Es ist nur so, dass ich in diesem Sommer wegen der vielen Arbeit kaum aus der Wohnung gekommen bin. Doch, einmal war ich mithilfe des Jungen draußen, um den Müll rauszutragen.
Abgemagert? Das täuscht. Der Pullover ist mir bloß einige Nummern zu groß, das ist alles … obwohl … letztes Jahr hat er mir noch gepasst. Wahrscheinlich hat er sich im Lauf der Zeit ausgeleiert; der müsste mal wieder heiß gewaschen werden, aber ohne Strom … wohin gehen Sie?
Ach, da ist ja der Wein, ein Côtes du Rhone. Wie das klingt! Darüber könnte man doch glatt ein Gedicht verfassen. Vielen Dank. Einen kleinen Schluck noch, danach werde ich mit meinem großen Roman beginnen … nein, nicht beginnen, sondern ich werde ihn fortsetzen. Jawohl! Wenn ich es mir recht überlege, ist dieser erste Satz doch nicht so schlecht … er ist gewissermaßen ausbaufähig. So etwas erkenne ich auf den ersten Blick! Warum sehen Sie mich so nachdenklich an? Conrad Ferdinand Meyer schrieb sein Gedicht vom Römischen Brunnen innerhalb von zwölf Jahren mehrmals um, und auch Hemingway feilte jahrelang an ein und demselben Satz, bis er endlich damit zufrieden war. Das zeichnet eben ein wahres Genie aus. Von Schriftstellern, die im Akkord ihre Manuskripte runtertippen, halte ich nichts. Wie können die kreativ sein, wenn sie sich dazu zwingen, pro Tag eine ganze Manuskriptseite zu schreiben? Eine Seite! Stellen Sie sich das einmal vor! Wahre Kunst braucht Zeit. Aber davon haben die ja keine Ahnung.
Kommen Sie doch näher, ich zeige Ihnen etwas … hoppla. Vorsicht! Sie können die Pizzakartons ruhig unter die Couch zu den anderen schieben. Hier, werfen Sie einen Blick auf Hemingways In einem anderen Land. Das Ende hat er Neununddreißigmal umgeschrieben. Stellen Sie sich das einmal vor? Neununddreißigmal! Aber ja, legen Sie das Buch getrost auf die Untertassen dort drüben … schieben Sie ruhig die Schachteln und Beipackzettel beiseite.
Wie meinen Sie das? Ich verstehe nicht. Meyer starb an den Folgen seiner psychischen Krankheit, und Hemingway hat sich erschossen! Na und? Wo sehen Sie da einen Zusammenhang? Wollen Sie etwa behaupten, dass … aber ich bitte Sie! Fritsch, Mann, Zweig, Burger, Kräftner, Raimund, Trakl, Stifter, Tucholsky und von Saar … ja, ja, sie alle haben ihrem Leben ein Ende gesetzt – und wenn schon! Aber sie waren unvergleichliche Künstler der Lyrik und Prosa, oder etwa nicht? Hören Sie auf damit! Ja, natürlich – es fällt auf, dass Selbstmord unter Dichtern relativ häufig vorkommt. Wen wundert es, haben doch Schriftsteller bekanntlich eine höhere Sensibilität als Menschen anderer Berufsgruppen. Vergleichen Sie doch nur mal einen Dichter mit einem Kraftfahrer … eben! Damit meine ich: Das Leben eines Schriftstellers ist ein einsames … glauben Sie mir, ich weiß das! Vielleicht hatte Tucholsky das Gefühl, sich nicht mehr weiter entfalten zu können. Und in seiner Ruhe und Abgeschiedenheit, in seiner Melancholie und Traurigkeit … na ja! Vielleicht bedeutet Schreiben auch, sich irgendwann umbringen zu müssen! Weshalb sehen Sie mich so an? Aber ich bitte Sie … der Satz stammt nicht von mir, er ist lediglich ein Zitat. Ja, bloß ein Zitat. Aber ich habe vergessen, von wem. Entspannen Sie sich!
Weshalb fragen Sie mich schon wieder, ob ich Fieber habe? Aber nein, mir geht es gut. Ich habe zuvor bloß ein paar Tabletten gegen die ständigen Kopfschmerzen genommen, aber ich glaube, sie beginnen erst jetzt zu wirken. Nein, Veronal ist nichts Starkes. Machen Sie sich keine Sorgen, und vielen Dank, dass Sie mich besucht haben. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, aber ich fürchte, Sie müssen mich jetzt verlassen … ich werde an meinem Roman weiterarbeiten.
Die Jalousien? Die lasse ich immer runter, wenn ich schreibe. Die Dunkelheit inspiriert mich, wissen Sie! Die Weinflasche können Sie gern mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas daraus trinken werde.
Das hier auf der Kommode? Ach ja, danke, dass Sie mich daran erinnern. Diesen Brief habe ich vor einigen Monaten an meine Frau geschrieben. Sie wohnt schon lange nicht mehr hier. Dürfte ich Sie bitten, ihn bei der Post für mich aufzugeben? Vielen Dank.
Sie entschuldigen mich jetzt bitte! Ich schließe nur noch die Fenster. Die frische Luft … oh, verzeihen Sie bitte, dass ich gähne, aber ich werde plötzlich unheimlich müde.
Wohin ich gehe? Bloß in die Küche, um ein wenig aufzuräumen. Ach, ich glaube, das bilden Sie sich ein. Hier riecht es überhaupt nicht nach Gas. Der Geruch kommt wahrscheinlich aus dem Treppenhaus. Wahrscheinlich ein kaputter Gasherd. Leben Sie wohl!
Die Testamentseröffnung
Wie Sie aus dem Vorwort wissen, bin ich ein Fan gotischer Horrorgeschichten. Ich habe Dracula und Frankenstein gelesen, ebenso Horace Walpoles Schloss Otranto und Poes gesammelte Kurzgeschichten, aber auch Roger Cormans achtteiligen Zyklus von Edgar-Allan-Poe-Verfilmungen mehrmals gesehen.
Schon als Kind war ich von den verkrüppelten Bäumen, dem Nebel, dem Moor, dem verfallenen Schloss und dem Irrsinn der lebendig begrabenen Madeline Usher in Cormans Der Untergang des Hauses Usher fasziniert.
Das alles hat meine Sichtweise auf den Horror geprägt, und darum wollte ich auch einmal eine gotische Horrorgeschichte schreiben. Allerdings musste sie in Wien spielen, denn auch hier gibt, beziehungsweise gab es einmal Nebel, Kutschen, Kopfsteinpflaster, Dornenbüsche, Efeugewächse, schmiedeeiserne Gitter und enge verwinkelte Gassen.
Willkommen im Wien des Jahres 1869.
Die Kutsche hielt in der Ruprechtsgasse, wo es wie überall in Wien nach Pferdedung und Schwefel stank. Mit hochgeschlagenem Mantelkragen sprang ich vom Trittbrett auf die Pflastersteine. Sogleich peitschte mir ein Windstoß den Regen ins Gesicht, während bleigrauer Nebel um meine Stiefel waberte. Der Kutscher, ein großer, behäbiger Mann, hielt die Zügel locker in Händen. Von der breiten Hutkrempe liefen ihm Tropfen über die Schulter, und trotz seiner Öljacke schien er völlig durchnässt zu sein. Die Pferde wieherten, ihre Hufe klapperten auf der Stelle, und noch während ein Blitz den Himmel erhellte, hallte das dumpfe Echo des Donnerschlags bereits zwischen den Häuserreihen.
»An Guldn und zwanzg' Kreuza, da' Herr … ho, ho!« Der Kutscher zog am Riemen des Zaumzeugs.
»Stimmt schon!« Nachdem ich dem Mann eine Handvoll Münzen gereicht hatte, sprang ich mit einem Satz auf den Bürgersteig, aber unter dem Dachvorsprung war es genauso feucht. Aus der Regenrinne schwappte das Wasser über den Dachgiebel auf den Randstein, von wo es mir auf den Mantel spritzte. Ich sah dem Kutscher nach, wie er sein Gespann in eine Seitengasse lenkte und jenseits des Torbogens in Richtung Stephansdom verschwand. Dann wandte ich mich um und lief die Straße entlang, bis ich das Backsteinhaus mit den hohen Erkerfenstern erreichte, das man mir in dem Brief beschrieben hatte. Durch den Spalt der bereits zugezogenen schweren Stoffvorhänge fiel mattes Licht. Auf dem Schild neben dem Türklopfer stand:
Hofrat Dr. Johann Friedl
____________
Notar
Ruprechtsgasse 17
Ich fingerte die Taschenuhr aus dem Mantel und ließ den Deckel aufspringen. Es war vier Uhr nachmittags. Im selben Augenblick hörte ich die Kirchturmuhr die volle Stunde schlagen. Ich war noch nicht zu spät. Sogleich betätigte ich den Türklopfer, einen Messinggriff, der dumpf auf ein Löwengesicht schlug. Ich wartete, die Hände in den Manteltaschen vergraben, wo ich den zusammengefalteten Brief des Notars spürte, der mir heute Morgen, während des Frühstücks, durch einen Postboten überbracht worden war. Die hastig hingekritzelten Zeilen hatten mich sofort die Kutsche von Baden nach Wien nehmen lassen. Interessanterweise war meine Erinnerung an diese Stadt, die sich in den letzten acht Jahren nicht wesentlich verändert hatte, noch nicht verblasst. Erst vor einer halben Stunde hatte mir der Anblick aus dem Kutschenfenster auf die Häuserzeile der Ringstraße mit ihrer Vielzahl an Kaffeehäusern den Brustkorb zusammengepresst. Wie oft hatte ich als kleiner Junge die Wirtshäuser und Spielhöllen betreten, den Zigarrenqualm eingeatmet, mich zwischen den Männern und Huren zu den Spieltischen gedrängt, um nach meinem betrunkenen Vater zu suchen?
Das Knarren der Tür riss mich aus den Gedanken. Ein Mann im dunklen Frack, mit einer Hand auf den Gehstock gestützt, winkte mich ins Haus. Er war einen Kopf kleiner als ich, zudem ließen seine Gesichtszüge erahnen, dass er gut dreimal so alt war. Ich trat in den angenehm warmen Vorraum, wo es nach Pfeifentabak und Brennholz roch. Das von meinem Mantel tropfende Regenwasser sammelte sich auf dem Teppich zu einer Pfütze.
»Erich von Habitz«, stellte ich mich vor.
»Angenehm. Doktor Friedl.« Der Hausherr senkte den Blick wie beiläufig auf den Teppich, sah dann wieder auf. »Werden Sie für ein paar Tage in Wien bleiben?«
»Leider ja.«
»Sie ziehen Baden unserer Metropole vor?«
»Um ehrlich zu sein – ja!«
Er murrte. »Ich habe gehört, die Kurstadt sei etwas für ältere Damen, Künstler und Literaten. Wozu zählen Sie sich?«
»Zu den Literaten. Ich bin Journalist.«
»Aha!« Er starrte mich durch die Linse seines Monokels an, während er das andere Auge zukniff.
Nachdem ich sowohl Mantel als auch Zylinder in einer Nische abgelegt hatte, bat mich der Notar, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. »Wo werden Sie übernachten, junger Mann?«
»Ich habe eine Suite im Hotel Stefanie am Eisernen Tor gebucht.«
»So, so … nicht gerade die erste Wahl, wenn ich so sagen darf, aber dort bekommen Sie wenigstens eine knusprige Semmel zum Frühstück und eine Zeitung, auch wenn sie eine Woche alt ist.« Er tapste mit seinem Gehstock voraus, betrat einen mit schlichten Möbelstücken eingerichteten Salon, in dessen Mitte ein Schreibtisch aus einfach gefertigtem Holz stand. Im offenen Kamin prasselte ein Feuer, und soweit ich erkennen konnte, waren die Bücherregale bis zur Decke mit juristischen Abhandlungen gefüllt. Der Raum sah so aus, wie ich mir das Arbeitszimmer eines alternden Kauzes aus der Biedermeierepoche immer vorgestellt hatte. Alles passte perfekt zusammen, angefangen von seinem Monokel bis zum Tintenfass auf dem Schreibpult.
»Ich bin wohl zu früh da«, bemerkte ich, denn bis auf Doktor Friedl war der Salon leer.
»Keineswegs«, gab er mir zu verstehen, während wir über den Teppich gingen, der die Laute unserer Schritte gänzlich schluckte. Doktor Friedl wies mit einer knappen Geste auf einen der Lederstühle, während er sich hinter dem Schreibtisch auf einen Stuhl setzte. Beim schwerfälligen Ächzen des alten Kauzes schreckte ich hoch, da ich befürchtete, er habe sich alle Knochen im Leib gebrochen. Stattdessen nahm er das Monokel ab und tauschte es gegen eine Brille, jedoch nur, um am Bügel zu knabbern. Ohne das Monokel sah sein Auge aus, als wollte es jeden Moment zwischen den Gesichtsfalten verschwinden.
»Der letzte Wille Ihres Vaters ist lediglich an Sie adressiert«, erläuterte der Notar in einem geringschätzigen Ton. Plötzlich schoss er nach vorn. »Sie sind doch wohl Erich von Habitz, oder etwa nicht, junger Mann?«
»Gewiss, gewiss«, brachte ich mit trockener Kehle hervor.
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ausgerechnet an mich, dachte ich, wo ich doch vom alten von Habitz zu Lebzeiten wie die Pest gehasst worden war. Zuletzt hatte ich von meinem Vater vor fünf Jahren gehört, als er sich wieder einmal vermählte, worüber Max Frieländers Neue Freie Presse in einem zweiseitigen Artikel ausführlich berichtet hatte. Doch auch diese Ehe dauerte kaum länger als drei Monate, was jeder ahnen konnte, der den Lebensstil meines Vaters kannte.
»Sie haben vor acht Jahren das Herrenhaus Ihrer Familie verlassen!« Der Notar klemmte sich die Brille auf die Nase und glotzte mich an. In seinen Gläsern schimmerte mein Spiegelbild – das regennasse, in die Stirn geklebte Haar, die schmalen Gesichtszüge und die typisch spitze von Habitz-Nase. Dahinter flackerte das Kaminfeuer.
»Ja, nach dem Tod meiner Mutter«, erläuterte ich. »Aus welchem Grund wurde sonst niemand aus der Familie vorgeladen?«, fuhr ich rasch fort, um die Ereignisse von damals nicht weiter bereden zu müssen, da sie den alten Kauz nichts angingen.
Doktor Friedl zog die Schultern hoch und musterte mich mit einem Das-kann-ich-Ihnen-leider-nicht-beantworten-Blick. Dann begann er in einem Stapel aus Briefen und Kuverts zu kramen. Das Rascheln des Papiers wurde nur durch das Ticken der Wanduhr und das Knarren der Holzdielen unterbrochen. Draußen rüttelte der Wind an den Fensterläden. Unterdessen hüstelte der Notar, wobei er immer wieder aufblickte, um über den Brillenrand zu gucken.
»Woran ist er gestorben?«, brach ich das Schweigen.
»Herzversagen! Ihr Vater wurde im Arbeitszimmer gefunden, inmitten eines vollkommenen Chaos. Überall auf dem Schreibtisch lagen leere Zettel, Papierbogen klebten an den Schubladen und sogar in den Rocktaschen steckten unbeschriebene Blätter. Ihr Vater lag zusammengesackt über dem Schreibpult, ein Kuvert in der Hand. Doktor Cznaimer hat den Brief sofort an mich ausgehändigt … ich suche ihn bloß noch.«
»Zettel und Blätter?«, wiederholte ich. »Was hatten die zu bedeuten?«
»Das fragen Sie mich?« Der Notar sah kurz auf. »Keine Ahnung.«
Ich rutschte auf der Stuhlkante hin und her, während ich über die Worte nachdachte. Mein Vater hatte trotz seiner fünfundsechzig Jahre noch nie an Herzschwäche oder einer ähnlichen Krankheit gelitten, im Gegensatz zu meiner Mutter, deren Herz er mit seinen Seitensprüngen mehrmals gebrochen hatte. Das Einzige, woran er wirklich gelitten hatte, war seine verhärtete Leber gewesen. Wenn der alte von Habitz nicht gerade zu betrunken war, um aufrecht auf einem Stuhl zu sitzen, verbrachte er die Nächte in diversen Cafés, am Kartentisch beim Skat, Whist oder Tarock. Manchmal war ein Mädchen an der Seite des alten Narren zu sehen, das gut meine jüngere Schwester hätte sein können, aber selbst die abgefeimtesten Dirnen hätten ihn nicht davon abhalten können, das gesamte Familienvermögen und die von Habitz-Fabriken meines Großvaters aufs Spiel zu setzen.
»Hören Sie mir eigentlich zu, junger Mann?«
Ich fuhr hoch. »Wie bitte?«
»Ob Sie eine Tasse Tee möchten, habe ich gefragt?«, knurrte Doktor Friedl.
»Ja, bitte.«
»Mit oder ohne Zucker?«
»Mit Zucker, vielen Dank.«
»Kommt sofort.« Der Notar griff zur Kanne auf dem Servierwagen und goss dampfenden Tee in eine Schale. Natürlich Biedermeierporzellan mit Blumenmuster, wie ich nebenbei bemerkte.
Weshalb ausgerechnet Herzversagen? Im Grunde genommen waren wir von Habitz' mit einem hohen Alter gesegnet, um das uns viele beneideten, und von Alfons war mir nie berichtet worden, dass sich Vaters Gesundheitszustand ernsthaft verschlechtert hätte. Wahrscheinlich hatte sich mein Vater zu Tode gesoffen! Vielleicht war er ermordet worden, dachte ich fasziniert. Von einem eifersüchtigen Ehemann, einem Buchmacher, Dieb oder Erbschleicher?
»Zwei oder drei Löffel Zucker?«
»Nur einen, danke.«
Andererseits war ich, wie es im Moment schien, sein einziger Erbe, was meine Theorie nicht gerade untermauerte. Im Gegenteil, dachte ich erschrocken – wegen meiner Differenzen mit Vater hätte ich sogar einen Grund für diese Tat gehabt, weshalb ich den Gedanken rasch wieder verdrängte. Was mich wieder zu der Frage führte, warum keine seiner Exfrauen oder Geliebten, oder Onkel Hans, Tante Grete, Philip oder Alfons anwesend waren. Immerhin war Vater vollkommen vernarrt in meinen Stiefbruder gewesen – das Ergebnis eines Seitensprungs –, obwohl der nicht einmal eins und eins zusammenzählen konnte. Der gute Alfons wird es schon noch lernen, hatte Vater mich immer beschwichtigt; oder: So meckere doch nicht andauernd mit Alfons herum, er kann doch nichts dafür. Er konnte wirklich nichts dafür, denn die Dummheit war ihm nun mal in die Wiege gelegt worden.
Doktor Friedl reichte mir indessen, mit dem Löffel in der Tasse klimpernd, den Tee. »Sie machen einen zerstreuten Eindruck, junger Mann, wenn ich das anmerken darf.« Der Notar lugte über den Brillenrand, als wollte er meine Gedanken lesen.
»Es ist nichts«, log ich.
»Ich verstehe … nun, dann möchte ich Sie nicht länger auf die Folter spannen … wo ist er denn nur?« Er kramte in einem Briefstapel, aus dem er endlich einen dicken Umschlag fischte. Räuspernd hielt er das Kuvert hoch, auf dem mein Name in krakeliger Handschrift zu erkennen war. Darüber befanden sich einige in gleicher Handschrift gekritzelte Worte, die ich allerdings nicht entziffern konnte. Mit einem Knacken brach das Wachssiegel, worauf Doktor Friedl einige mit blauer Tinte beschriebene Papierbogen herauszog, auseinanderfaltete und mit der Handfläche peinlich genau auf der Tischplatte glättete. Dabei schenkte er mir, den auf dem Lederstuhl zappelnden Erich von Habitz, Erben des von Habitz-Anwesens mit all seinen Villen in Wien und Umgebung, unzähligen Ländereien, Wäldern und den von Habitz-Fabriken, keinerlei Beachtung.
Der Notar streckte das Kreuz durch. »Hier also der letzte Wille Ihres geschätzten Herrn Vaters …« Er begann den Brief mit einer sonoren Stimme vorzutragen, die ich dem alten Kauz gar nicht zugetraut hätte. Steif wie ein Bügelbrett saß ich auf meinem Stuhl und lauschte.
Von Habitz Anwesen, Herrenhaus am Kärntner Ring, am 29. April im Jahre des Herrn 1869!
Mein lieber Erich!
Es ist lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, und in all den Jahren haben wir kaum ein Wort miteinander gewechselt. Du hast damals richtig gehandelt, als du unserer Familie im alten Herrenhaus den Rücken kehrtest und zu Irene nach Baden gezogen bist. Wäre Mutter nicht gewesen, hättest du Wien sicherlich schon eher verlassen. Ich hoffte, du könntest mir mein Verhalten von damals verzeihen, die groben Worte, die Vorwürfe und vor allem meine Affäre mit … mein Gedächtnis lässt mich im Stich, ich kann mich nicht einmal mehr an den Namen des Servierfräuleins erinnern, das uns allen im Salon Moritz den Kopf verdrehte. Ich war ein Narr.
Bestelle Irene bitte meine aufrichtigen Grüße. Ich wünschte, auch sie könnte mir jene Worte verzeihen, die ich ihr damals an den Kopf geworfen habe. Sie ist ein nettes Mädchen, und dass sie keine Kinder zur Welt bringen kann, ist nicht so schmählich, wie ich einst behauptete. Für die Zukunft wünsche ich euch Gottes Segen, auch möge sich deine Zeitung zu einem Erfolg entwickeln. Wie heißt sie noch gleich? Badener Wochenblatt? Ein Exemplar lag sogar einmal im Café Hugelmann aus, wo ich es durchblätterte – dein Feuilleton über die moderne Gesellschaft war vortrefflich. Leider kenne ich keine weiteren Artikel aus deiner Feder, aber bestimmt sind sie genauso scharfzüngig und pointiert.
Zu viel Zeit habe ich in Wirtshäusern und Cafés beim Schach, Kartenspiel und Billard verbracht, hübsche Geldsummen am Roulettetisch und auf der Trabrennbahn zurückgelassen. Du hattest wohl recht: Ich bin kein Industrieller. Für die Werke hätte ich besser einen tüchtigen Geschäftsmann bestellen sollen, statt Alfons mit dieser Aufgabe zu betrauen. Du hingegen bist ein anständiger Bursche geblieben, immer deinen Prinzipien treu, und ich wünschte …
Doktor Friedl blickte kurz auf, um mich zu mustern. »Na ja!« Er schnalzte mit der Zunge, ehe er weiterlas.