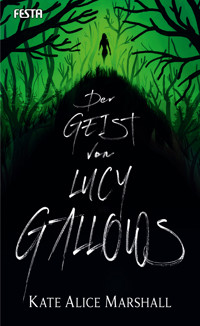
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Einmal im Jahr erscheint in Briar Glen um Mitternacht eine Straße im Wald und der Geist von Lucy Gallows lockt die Ahnungslosen zu sich. Seit Beccas spurlosem Verschwinden ist ein Jahr vergangen. Nur ihre Schwester Sara weiß, was geschehen ist. Becca hat den Geist von Lucy Gallows gesucht und ist auf der Straße gefangen, die zu ihr führt. Und dann erhält Sara eine mysteriöse Nachricht mit der Einladung »das Spiel zu spielen«. Als sie mit ihren Freunden den Wald betritt, erscheint die unheimliche Straße tatsächlich. Sie müssen ihr nur folgen. Lucy Gallows wartet schon auf sie … Stranger Things trifft auf The Blair Witch Project in diesem außergewöhnlichen Geister-Thriller. Metro: »Beunruhigend. Stockdunkel. Einfallsreiche Fantasy.« Natalie C. Parker: »Herrlich gruselig! Ein unwiderstehliches Mysterium.« Kesia Lupo: »Das Horror-Fantasy-Mash-up, von dem ich nicht wusste, dass ich genau darauf gewartet habe.« Dana Mele: »Hat alle Voraussetzungen zum Horror-Klassiker. Erstaunlich originell, herrlich finster und echt unheimlich. Eine spannende und aufregende Lektüre für alle, ob mit oder ohne Puls.« Carousel: »Diese beklemmende Geschichte voller Psychospiele wird im effektiven Pseudo-Stil eines Dokumentarfilms erzählt. Fans des übernatürlichen Horrors werden begeistert sein.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Heiner Eden
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Rules of Vanishing
erschien 2019 im Verlag Viking Books for Young Readers.
Copyright © 2019 by Kathleen Marshall
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Stefanie Saw – www.seventhstarart.com
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-860-5
www.Festa-Verlag.de
Für die No Name Writing Group,
die den Weg mit mir gegangen ist.
Wie gewünscht, haben wir uns Zugang zu den Akten von Dr. Andrew Ashford verschafft, besonders zu denen, die sich mit dem Vorfall in Briar Glen, Massachusetts, befassen.
Es war uns nicht möglich, die eigentlichen Dokumente und Unterlagen unbemerkt aus Dr. Ashfords Akten zu entnehmen, doch wir konnten Transkripte und Zusammenfassungen der Dateiinhalte erstellen und zusätzliches Material beschaffen, das sich als hilfreich erweisen könnte, um den Kontext zu verstehen.
Soweit wir wissen, hat Dr. Ashford nach wie vor keine Kenntnis von Ihrem Interesse.
DIE
ASHFORD
AKTEN
Dokument #74
»Die Geisterstraße von Massachusetts«
Briar Glen, Massachusetts
April/Mai 2017
ERSTER TEIL
DAS SPIEL
INTERVIEW
SARA DONOGHUE
9. Mai 2017
ASHFORD: Ich beginne nun mit der Aufnahme. Dies ist das erste Gespräch mit Sara Donoghue über die Vermissten in Briar Glen, Massachusetts. Heute ist der 9. Mai 2017. Anwesend sind Sara Donoghue und ich, Dr. Andrew Ashford. Vielen Dank für Ihr Kommen, Miss Donoghue.
SARA: Keine Ursache. Schätze ich. Keine Ahnung, was Sie von mir hören wollen.
ASHFORD: Die Wahrheit, Miss Donoghue. Ich denke, Sie werden schnell feststellen, dass wir zu den wenigen gehören, die ein offenes Ohr dafür haben.
SARA: Dann glauben Sie mir also?
ASHFORD: Gibt es einen Grund, Ihnen nicht zu glauben?
Sara beginnt zu lachen, ein leises Geräusch, das ihr in der Kehle stecken bleibt.
ASHFORD: Miss Donoghue …
Sara hört nicht auf zu lachen.
Ihre Schultern erzittern. Ihre Hände bedecken ihr Gesicht.
??: Passen Sie auf.[1]
<Ende der Aufnahme.>
[1] Anmerkung des Transkriptionisten: Die dritte Stimme konnte nicht identifiziert werden. Sie ist stark verrauscht und auf der Aufnahme von einem dumpfen Brummen unterlegt.
ANLAGE A
Textnachrichten, die am Montag, dem 17. April 2017, von allen Schülern der Briar Glen High School empfangen wurden.
WEISST DU, WOHIN LUCY GEGANGEN IST?
SIE GING LOS, UM DAS SPIEL ZU SPIELEN.
DU KANNST ES AUCH SPIELEN.
FINDE EINEN PARTNER.
FINDE EINEN SCHLÜSSEL.
FINDE DIE STRASSE.
DU HAST ZWEI TAGE.
SARA DONOGHUE
SCHRIFTLICHE AUSSAGE
1
Die Nachrichten kommen während der Nacht, und am Montagmorgen sprechen alle über nichts anderes. Die Leute scharen sich um ihre Handys, als würden sie vielleicht einen neuen Hinweis auf den Absender finden, wenn sie die identischen Worte miteinander vergleichen und noch einmal lesen.
»Hey, Sara! Hast du Lust, das Spiel zu spielen?«, fragt Tyler Martinez. Er stürzt sich förmlich auf mich, als ich beim ersten Klingeln das Gebäude betrete, wackelt mit den Augenbrauen und macht einen Schlenker zur Seite, während er über seinen Witz lacht. Ich verschränke die Arme und lehne mich vor, als würde ich mich gegen eine Strömung stemmen.
Geflüster an jeder Ecke, über Lucy. Und über das Spiel. Menschentrauben, zusammengesteckte Köpfe.
Ich habe es so hingebogen, dass ich erst kurz vor dem Klingeln eintreffe. Die Flure leeren sich bereits, denn die Angst vor Verweisen übertrifft den Hunger auf Klatsch und Tratsch. Ein paar Nachzügler werfen mir schräge Blicke zu. Schräger als üblich. Ich stelle mir vor, wie sie sich zuflüstern: Jede Wette, dass sie sie verschickt hat. Sie ist wie besessen.
Das Spiel. Lucy Gallows. Und Mittwoch ist der Jahrestag. Dafür muss man kein Genie sein. Wahrscheinlich würde ich mir auch die Schuld geben.
Ich schlüpfe für die erste Schulstunde in das Klassenzimmer und setze mich auf meinen Platz, ganz hinten in der Ecke.
»Hey. Sara.« Trina sitzt an dem Gruppentisch vor mir, und sie muss sich auf ihrem Stuhl herumdrehen und sich vorlehnen, um mit mir zu sprechen. Ihre blauen Augen stechen vor erlesener Besorgnis, und ihre blonden Haare sind zu einem zwanglosen Pferdeschwanz zusammengebunden, der prächtiger aussieht als alles, was ich hinbekomme, seit der Zeit, als sie sich hinter mich setzte, stundenlang, um meine mattbraunen Haare in die Form eines französischen Zopfes oder einer Fischgrätenfrisur zu zwingen. »Wie geht es dir?«
»Gut«, murmele ich. Ich schaffe es nicht, ihr ins Gesicht zu schauen. Ihr Blick ist auf schmerzhafte Weise mitfühlend, was ich verkraften könnte, wenn ihre Anteilnahme nur vorgetäuscht wäre. Doch sie ist echt. Und sie ist immer da, wenn sie mich ansieht, als fürchtete sie, dass ich jeden Augenblick unter der Last meiner persönlichen Tragödien zerbrechen könnte.
»Ich glaube nicht, dass du es warst«, sagt sie und lehnt sich noch ein bisschen weiter vor. Was bedeutet, die anderen munkeln bereits, dass ich es doch war.
»Ich war’s nicht.«
Sie nickt bedächtig. »Lass dich deswegen von niemandem dumm anmachen«, sagt sie.
»Und was schlägst du vor, wie ich sie davon abhalten soll?«, frage ich.
Sie zuckt ein wenig zusammen, doch die zweite Klingel, die den Beginn des Unterrichts einläutet, erspart es ihr, eine Antwort geben zu müssen. Sie dreht sich wieder um und setzt sich aufrecht hin. Ich sinke in meinen Stuhl, als Mr. Vincent mit seiner täglichen Vorrede beginnt und uns auch heute nicht mit seinen schlechten Scherzen verschont.
»Und da sagt die andere Zapfsäule: ›Mir geht’s super.‹« Gerade als er fertig ist, öffnet sich die Tür. Anthony Beck betritt unter allgemeinem Gemurre den Raum und schlägt sich die flache Hand vor die Stirn.
»Hab ich etwa den Witz des Tages verpasst?«, fragt er mit übertriebener Enttäuschung. Dann grinst er breit. Seine Grübchen sind tief, und seine braunen Augen strahlen halb versteckt unter seinen lockigen schwarzen Haaren. Früher, als wir noch kleiner waren, als wir noch Freunde waren, da war er dürr wie eine Bohnenstange, nur Ellbogen und Knie, und sein Lächeln war viel zu breit für sein Gesicht. In den letzten zwei Jahren hat er Muskeln bekommen, und aus dem Nerd, der über seine eigenen Füße stolpert, ist der Kapitän des Lacrosse-Teams und der Fußballmannschaft geworden. An der Northeastern University wartet ein Sportstipendium auf ihn. In den Ferien hat er sich das Ohr piercen lassen. Der silberne Stecker blinzelt.
»Ich hoffe, es gibt einen guten Grund, warum du dir meinen überschäumenden Humor entgehen lässt.«
»Hab den ganzen Morgen gebraucht, um allen Schülern SMS zu schicken. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr mir die Daumen schmerzen«, sagt Anthony und grinst dabei wie der Joker. »Tut mir leid, Mr. V. Soll nicht wieder vorkommen.« Sein Blick wandert durch den Raum, und als er mich sieht, gerät sein Grinsen einen Moment lang ins Wanken. Wir gehören derselben kleinen Gruppe für unsere aktuelle Projektarbeit an, was bedeutet, dass wir die letzten Wochen nebeneinandergesessen, aber kaum mehr als ein Dutzend Worte gewechselt haben. Elf davon kamen von ihm.
Er zwängt sich hinter das Tischchen neben meinem. Es ist viel zu klein für seinen massigen Körper, und ich ziehe mich noch ein Stück weiter in die Ecke zurück, weg von ihm. Mr. Vincent schüttelt den Kopf.
Anthony wirft mir einen kurzen Seitenblick zu. Ich gehe hinter meinem Schreibheft in Deckung und versuche, ihn zu ignorieren. Es fällt mir nicht leicht.
Anthony Beck und Trina Jeffries gehörten einmal zu meinen besten Freunden. Wir waren zu sechst – zu siebt, wenn Kyle, Trinas kleiner Bruder, mit uns abhängen durfte –, eine durchtriebene Bande von Streunern, die von der ersten Klasse bis zur High School wie Pech und Schwefel zusammenhielt. Wir hatten sogar einen ziemlich dämlichen Namen. Die Wildkatzen. Bis zur fünften Klasse waren wir die Einhorn-Wildkatzen, ein Kompromiss, der auf Trinas Mist gewachsen war, nachdem die Abstimmung keine Mehrheit gebracht hatte – wobei ich und Becca, meine Schwester, wie üblich gegensätzliche Meinungen vertraten. Natürlich war ich für die Einhörner. Damals stand mein Schönheitssinn zu 70 Prozent auf Glanz und Glitzer. Das war, bevor ich in der Mittelschule eine schwere Farballergie entwickelte. Aber Becca? Sie war von Anfang an auf der wilden Seite.
Wir reichten uns alle mit verschränkten Armen die Hände und schlugen darauf ein. Wir sind die Einhorn-Wildkatzen. Freunde für immer. Komme, was wolle.
Ein unzerstörbares Band, glaubten wir damals als Erstklässler. ›Für immer‹ schien möglich zu sein, sogar unausweichlich. Aber nun ist Becca nicht mehr da, und mit den anderen habe ich seit einem Jahr höchstens noch über den Kalten Krieg oder Sinus und Kosinus gesprochen.
Mr. Vincent stellt gerade den Unterrichtsplan für den Tag vor, als in der zweiten Reihe eine Hand in die Höhe schießt. Er hält inne; sein Rhythmus ist gebrochen. Seine Mundwinkel spannen sich an, doch das ist das einzige Anzeichen einer Verärgerung. »Vanessa. Falls du Hilfe für dein Projekt benötigst, können wir beim Check-in darüber sprechen.«
»Es geht nicht um mein P-Projekt«, sagt Vanessa. »Es geht um die T-T-Textnachrichten, die w-w-wir alle bekommen haben.«
»Ja. Die habe ich gesehen. Und natürlich ist das alles höchst interessant«, sagt Mr. Vincent. »Aber ich verstehe nicht so recht, was das mit der industriellen Revolution zu tun hat.«
»A-Aber es hat mit Geschichte zu tun. Heimatgeschichte«, sagt Vanessa und schiebt sich ihre Brille die Nase hoch.
Aus meiner Ecke kann ich nur ihre runde Wange und ihren Hinterkopf erkennen, aber so wie die meisten hier in diesem Raum kenne ich Vanessa Han seit dem Kindergarten, und ich kann mir den Ausdruck von lebhaftem Interesse, mit dem sie Mr. Vincent gerade fixiert, ziemlich genau ausmalen.
»Heimatgeschichte«, wiederholt Mr. Vincent. »Du meinst, weil eine Lucy erwähnt wurde. Womit Lucy Gallows gemeint sein dürfte.« Er reibt sich über das Kinn. »Na, meinetwegen. Das hat zwar nichts mit den Produktionsverfahren des 19. Jahrhunderts zu tun, oder mit ihren Auswirkungen auf die Vorstellungen der Kernfamilie, aber was soll’s. Also gut, wer kann mir etwas über Lucy Gallows erzählen?«
Ein halbes Dutzend Hände heben sich. Er deutet. Jenny Stewart spricht als Erste. »War sie nicht dieses Mädchen von vor 100 Jahren? Ihr Bruder hat sie umgebracht und im Wald verscharrt, und nun spukt es dort.«
Vanessa wirft ihr einen vernichtenden Blick zu. »D-Das ist …« Das nächste Wort verheddert sich in ihrem Mund und sie verstummt für einen Moment, bevor sie mit fester Stimme fortfährt. »Das ist nicht wahr.«
»Nun, das ist ein interessanter Gedanke«, sagt Mr. Vincent. »Was entspricht der Wahrheit und was nicht? Und wie können wir den Unterschied bestimmen? Vergessen wir einmal das Übernatürliche. Ob es nun einen Geist in den Wäldern von Briar Glen gibt oder nicht, es ist Teil der hiesigen Legende, und die hat irgendwo ihren Ursprung. Ist dieses Irgendwo nun eine reine Erfindung, die irgendeine kreative Seele ersponnen hat und die im Laufe der Jahre immer weiter ausgeschmückt wurde? Oder steckt darin ein Fünkchen Wahrheit?«
Ich schließe meine Augen. Niemand weiß, was wirklich mit ihr geschehen ist.
Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sie dieser Stadt schon so lange im Gedächtnis steckt.
»Sara.«
Ich reiße die Augen auf. Mr. Vincent blickt mich an.
»Im letzten Halbjahr, bei dem Projekt zur Beurteilung ungewöhnlicher historischer Quellen, hast du damals nicht die Legende von Lucy Gallows für deinen Aufsatz verwendet?«
»Ich weiß nicht …« Mein Mund ist trocken. Ich befeuchte meine Lippen. Ich hatte gehofft, er würde sich nicht daran erinnern. Nicht dass irgendjemand hätte vergessen können, wie ich mich monatelang in alle Geschichten vergrub, die Lucy betrafen, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, mein Interesse an ihr geheim zu halten. »Ja«, sage ich.
»Und was hast du herausgefunden?«
Alle Augen richten sich auf mich. Köpfe drehen sich herum. Körper winden sich in ihren beengten Sitzplätzen. Nur Anthony nicht. Er blickt demonstrativ in die andere Richtung. Trina sieht mich an und zeigt mir ein kleines, ermutigendes Lächeln. Ich räuspere mich. Falls es noch jemanden gibt, der mich nicht verdächtigt, wird er seine Meinung gleich ändern. »Es gab kein Mädchen mit dem Namen Lucy Gallows. Doch es gab ein Mädchen, das Lucy Callow hieß, und sie verschwand im Wald«, sage ich verhalten.
»Und ihr Geist hat deine Schwester entführt, stimmt’s?«, sagt Jeremy Polk. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf ihn. Anthony macht ein Geräusch, ganz hinten in seiner Kehle, das ein bisschen wie ein Knurren klingt, und wirft seinem besten Freund und Co-Kapitän finstere Blicke zu. Jeremys Grinsen erlischt wie ein Licht. »’tschuldigung«, murmelt er.
»Was soll der Scheiß, Jeremy?«, sagt Anthony.
Mr. Vincent steht von seinem Pult auf und spricht mit ruhiger Stimme. »Jeremy, ich denke, du weißt, wie unpassend deine Bemerkung war. Darüber werden wir uns nach der Stunde unterhalten. Und du, Anthony? Lasst uns versuchen, nicht ausfallend zu werden.«
Jeremy senkt den Kopf, murmelt noch eine Entschuldigung und reibt sich über den Nacken, ein Stückchen unter der Stelle, wo eines seiner Hörgeräte sitzt. Diese Angewohnheit hat er schon so lange, wie ich ihn kenne. Mein Herz pocht in meiner Brust und mein Mund ist so staubtrocken wie die Oberfläche des Mars. Willst du wissen, wohin Lucy gegangen ist?
Ja.
Denn dorthin ist auch Becca gegangen.
»Sara hat recht«, sagt Mr. Vincent und kehrt fast fließend zum eigentlichen Thema zurück. »Lucy Callow war 15, als sie im April des Jahres 1953 verschwand. Die Namensänderung kam erst später, zusammen mit der Geistergeschichte. In Fällen wie diesem ist es wichtig, sich so weit wie möglich auf die offiziellen Quellen der damaligen Zeit zu beziehen. Es gibt noch eine Menge, das wir nicht über Lucy Callow wissen, aber viele der verbreiteten Geschichten lassen sich leicht widerlegen. Doch auch wenn diese Geschichten nicht den Tatsachen entsprechen, so helfen sie uns doch, die Leute zu verstehen, die sie verbreiten. Was war ihnen wichtig, wovor fürchteten sie sich? Geistergeschichten sind ein lebendiger und maßgeblicher Teil der regionalen Kultur.«
Er macht weiter und fordert die Schüler auf, von anderen Geistergeschichten und Legenden zu erzählen und Ideen zu entwickeln, wie man ihren Ursprüngen auf die Schliche kommen kann.
Ich höre kaum etwas davon. Alles, was ich höre, sind die letzten Worte meiner Schwester, die sie in ihr Telefon flüsterte. Vor einem Jahr, am 18. April.
Wir wissen, wo die Straße ist. Wir haben die Schlüssel. Mehr brauchen wir nicht, um sie zu finden. Ich werde jetzt keinen Rückzieher machen. Nicht nach allem, was wir getan haben, um ihr so nahe zu kommen.
Und dann drehte sie sich um und sah mich. Sie schlug ihre Zimmertür zu.
Am nächsten Morgen war sie weg und ist nie wieder nach Hause gekommen.
ANLAGE B
»Die Legende von Lucy Gallows«
Ein Auszug aus
Heimatsagen:
Geschichten aus Briar Glen
von Jason Sweet
Es war ein Sonntag, der 19. April 1953, und Lucy Gallows’ Schwester feierte gerade ihre Hochzeit auf einem weitläufigen Stück Land am Rande des Waldes von Briar Glen. Die zwölfjährige Lucy war das Blumenmädchen. Doch nach einem Streit mit ihrer Mutter rannte sie in ihrem adretten weißen Kleid mit dem blauen Bändchen an der Taille fort in den Wald. Alle glaubten, sie würde nach ein, zwei Minuten zurückkehren, sobald sie sich beruhigt hatte, doch zehn Minuten später war sie immer noch nicht wieder da – auch nicht nach 20 Minuten und auch nicht nach einer halben Stunde.
Lucys Bruder Billy wurde losgeschickt, um seine Schwester zu holen. Er ging in den Wald. Der einzige Weg, der durch die Bäume führte, war ein schmaler Pfad, den die Hirsche benutzten. Er rief ihren Namen – Lucy! Lucy! –, doch die einzige Antwort, die er bekam, war das Krächzen der Krähen.
Und dann sah er sie: die Straße. Hier und dort gab es Straßen im Wald. Sie waren die Überbleibsel der ursprünglichen Siedlung von Briar Glen, die im Jahre 1863 niedergebrannt war, und nun kaum mehr als eine Reihe von Bäumen, die zu gerade verlief, um natürlichen Ursprungs zu sein. Manchmal lag noch ein Stein eng an einen anderen gepresst, doch der Rest war schon vor langer Zeit herausgeklopft worden. Zuerst sah diese Straße genau so aus – eine Mulde im Unterholz und ein paar verstreute Steine, die mit menschlichen Werkzeugen bearbeitet worden waren. Aber je weiter Billy lief, desto breiter wurde die Straße und desto zahlreicher und enger lagen die Steine, bis sie einen ebenen Pfad durch den dichten Wald bildeten.
Er war sich sicher, dass Lucy der Straße gefolgt war, auch wenn er später niemandem so recht erklären konnte, woher diese Überzeugung kam. Doch trotz seiner Gewissheit schien jeder Schritt, den er machte, anstrengender als der vorherige zu sein. Vielleicht wurde die Straße besser, doch der Weg wurde immer beschwerlicher, als würde er sich gegen eine unsichtbare Kraft abmühen müssen.
Seine Füße wurden ihm schwer. Die Luft, so schien es, lehnte sich gegen ihn auf. Es war kaum noch zu ertragen – und dann sah er Lucy. Sie lief ein gutes Stück vor ihm und durchquerte eine leichte Biegung. Sie sprach zu jemandem – einem Mann mit einem braunen, abgerissenen Anzug und einem Hut mit breiter Krempe. Billy rief ihren Namen. Sie drehte sich nicht um. Der Mann lehnte sich leicht zu ihr hinunter, sprach zu ihr und lächelte. Er reichte ihr seine Hand.
Wieder rief Billy ihren Namen, und er preschte in ihre Richtung. Aber Lucy schien ihn nicht zu hören. Sie nahm die Hand des Fremden, und zusammen liefen sie die Straße hinunter. Sie bewegten sich zügig und viel leichter als Billy. Die Straße schien ihnen zu folgen, denn sie verschwand unter Billys Füßen. Nur einen Augenblick später waren die Straße und der Mann und die kleine Lucy Gallows nicht mehr zu sehen.
Die Leute aus der Stadt durchkämmten die Wälder noch wochenlang, fanden aber nicht das kleinste Lebenszeichen von Lucy. Doch hin und wieder stößt jemand auf die Straße, die sich durch den Wald schlängelt, und sieht ein Mädchen in einem weißen Kleid mit blauem Bändchen darüber rennen. Es ist unmöglich, sie einzuholen, sagt man, und dann steht man plötzlich ganz allein in dem Wirrwarr aus Bäumen, ohne einen Hinweis auf eine Straße oder ein Mädchen oder einen erkennbaren Weg nach draußen.
Passen Sie also auf, welche Straße Sie nehmen, und seien Sie vorsichtig, wem Sie darauf folgen.
INTERVIEW
SARA DONOGHUE
9. Mai 2017
Sara Donoghue sitzt in dem Befragungsraum. Es ist schwer zu sagen, in welcher Art von Gebäude er sich befinden könnte. Die Wände sind aus Beton und in einem matten Weiß gestrichen. An einer Seite steht ein leeres Bücherregal aus Metall. Der Tisch in der Mitte ist ein billiger, aufklappbarer Campingtisch.
Dr. Andrew Ashford betritt den Raum und nimmt wieder auf dem Stuhl gegenüber von Sara Donoghue Platz. Ashford ist farbig; dunkle Haut, silbergraues Haar. Ein dunkles Netz aus Narben überzieht die Haut auf seinem Handrücken. Er führt eine Aktentasche mit sich, die er neben sich auf dem Fußboden abstellt. Sara Donoghue dagegen ist ein schmächtiges Mädchen mit mittelbraunem Haar. Sie trägt schwarze Jeans, ein schwarzes, ärmelloses T-Shirt und einen schwarzen Pullover, der auf einer Seite heruntergerutscht ist und eine mit Sommersprossen bedeckte Schulter freilegt. Es scheint, als wäre sie in sich zusammengesunken und sehr nervös.
ASHFORD: Das tut mir leid. Eigentlich ist unser Equipment zuverlässig, doch manchmal kommt es bei Ereignissen wie diesem zu technischen Problemen.
Sara blickt desinteressiert zur Seite.
ASHFORD: Erzählen Sie mir von Ihrer Schwester.
SARA: Becca?
ASHFORD: Haben Sie noch eine andere Schwester?
SARA: Nein, aber … Was wollen Sie noch wissen? Es steht doch schon alles in den offiziellen Berichten.
ASHFORD: Ich möchte Ihre Schwester aus Ihrem Blickwinkel kennenlernen. Vor ihrem Verschwinden. Wie war sie so? Hatte sie viele Freunde?
SARA: Sie hatte uns. Uns fünf.
ASHFORD: Die »Wildkatzen«?
SARA: Genau. Aber irgendwann, bevor sie verschwand, verbrachten wir kaum noch Zeit miteinander. Wir kamen in die High School, und Anthony und Trina hatten ihre Sportteams, Mel hing nur noch mit den Kids von der Theatergruppe rum, und Becca … Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was mit Becca war.
ASHFORD: Hatte sie noch andere Freunde?
SARA: Sie war eigentlich mit allen befreundet. Aber richtig enge Freunde, außer uns, hatte sie nicht.
ASHFORD: Sie hat niemanden kennengelernt, mit dem sie sich besonders gut verstand?
SARA: Sie meinen ihren Freund? Schon möglich. Aber es war ihr nie ernst mit ihm.
ASHFORD: Wie kommen Sie darauf?
SARA: Sie mochte ihn, weil er ihr zuhörte. Aber sie passten einfach nicht zusammen.
Sara kaut auf ihrem Daumennagel.
SARA: Irgendwie hatte man immer den Eindruck, sie würde hier überhaupt nicht hergehören.
ASHFORD: Lag es daran, dass sie adoptiert war?
SARA: Was? Nein. Na gut, es war nicht immer leicht für sie, schätze ich. Briar Glen ist durch und durch weiß, und die Leute hier können ganz schön rassistisch sein, auch wenn sie es nicht so meinen, aber das war nie ein Problem – wenigstens bei uns zu Hause. Es ging mir nicht darum, dass sie nicht hierher gehörte, sondern dass sie es verdient hätte, woanders zu sein, an einem größeren, besseren Ort.
ASHFORD: Wo zum Beispiel?
SARA: New York. L. A. Paris. An einem Ort, der sie und ihre Kunst weitergebracht hätte.
ASHFORD: Ich habe mir ein paar ihrer Fotografien angesehen.
Ashford öffnet einen Ordner und verteilt mehrere Hochglanzfotos auf dem Tisch. Das oberste zeigt sechs vorpubertäre Kinder. Ein Etikett auf der Vorderseite ist mit den Namen der Kinder bedruckt. Becca und Sara stehen in der Mitte, Arm in Arm. Beccas Silhouette ist leicht verschwommen, so als hätte sie es nur gerade so auf das Bild geschafft. Trotz ihrer unterschiedlichen Ethnien – Sara ist weiß, Becca asiatisch – lässt etwas an ihrer Körperhaltung erkennen, dass sie ganz klar miteinander verwandt sind. Anthony Beck und Nick Dessen, beide weiß, stehen links von den Schwestern. Anthony hebt das Kinn zu einer lässigen Pose, in die er noch nicht ganz hineingewachsen ist. Nick, ein schlaksiger Junge in einem zu großen Anorak, versucht es ihm nachzumachen. Auf der rechten Seite durchbricht Trina Jeffries die Stimmung des Bildes mit einem Lächeln. Sie schiebt sich ihre Haare hinter die Ohren. Neben ihr steht Melanie Whittaker, ein farbiges Mädchen in einer Jeansjacke voller aufgebügelter Flicken. Sie zieht die Mundwinkel hoch, als würde sie sich selbst nicht allzu ernst nehmen.
Ashford schiebt das Foto beiseite und enthüllt ein anderes. Sara runzelt leicht verwirrt die Stirn. Er tippt mit dem Finger auf das neue Foto, das einen jungen Mann zeigt, dessen Gesicht von einem Schatten bedeckt ist. An seinen Schultern kräuselt sich das Licht, als würde seine Silhouette zerbrechen.
ASHFORD: Was wissen Sie über dieses Foto?
SARA: Ich sehe es zum ersten Mal.
ASHFORD: Was können Sie mir über Nick Dessen erzählen?
SARA: Wollen Sie mich nicht nach dem anderen Foto fragen?
ASHFORD: Welches meinen Sie? Dieses hier?
Er legt das Foto von Nick Dessen weg und rückt ein anderes in die Mitte des Tisches. Es zeigt Sara mit feuchten Haaren, die schlaff um ihr Gesicht hängen. Sie steht neben einer jungen Frau in einem weißen Kleid mit einem blauen Band an der Taille. Die junge Frau streckt ihre Hand aus und Sara hebt ihre eigene, als wollte sie sie nehmen.
ASHFORD: Finden Sie dieses Foto bemerkenswert?
SARA: Sie etwa nicht?
ASHFORD: Nicht besonders. Zwei Mädchen. Kurz vorm Händehalten.
SARA: Aber sie ist …
ASHFORD: Lucy Callow? Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit mit den Aufnahmen, die wir kennen, aber die Fotos von Lucy Callow haben keine gute Qualität. Diese Person? Sie könnte sonst wer sein. [Pause]. Aber sie ist nicht irgendwer, richtig? Sie ist Lucy. Sie haben sie gefunden.
Sara blickt Ashford in die Augen. Sie schweigt für einen Augenblick. Dann stößt sie ein kurzes, abgehacktes Lachen aus.
SARA: Nein. Wir haben Lucy nicht gefunden.
ASHFORD: Dann …
SARA: Sie hat uns gefunden.
2
Becca hat für jedes Jahrbuch Fotos gemacht, und man konnte sofort sehen, welche von ihr stammten. Die meisten der anderen Aufnahmen wirkten gestellt und unbeholfen, Kontraste gab es keine und die Schüler waren beliebig austauschbar. Beccas Fotos waren anders. Sie zeigten die Sehnsucht einer unerwiderten Liebe in der Art und Weise, wie ein Mädchen durchs Klassenzimmer blickte, während sie zusammengesunken an ihrem Tisch saß und ihr Kinn mit der Faust abstützte. In der langen, athletischen Linie von Anthonys Körper, hoch aufgerichtet auf dem Rasen, die Flugbahn des Fußballes, den er zu erwischen versuchte, selbst auf dem unbeweglichen Bild unverkennbar, fand sie Euphorie und Konzentration. Becca schaffte es, dass jeder sich gesehen fühlte.
So gesehen war es schon verwunderlich, wie wenig Zeit die Leute aufwendeten, um nach ihr zu suchen.
Die offizielle Darstellung lautet, dass sie mit einem Jungen durchgebrannt ist. Zachary Kent. Ein schlechter Umgang, sagen meine Eltern. Er war älter als sie. Meine Eltern haben versucht, ihr die Beziehung zu ihm zu verbieten. Sie hassten sein Lippenpiercing, seine gefärbten Haare, seine Musik, seinen Wagen. Ich habe ihn nur einmal getroffen. Ich hätte ihn und Becca fast umgerannt, als sie aus dem Half Moon Diner kamen. Er hatte seinen Arm um ihre Schulter gelegt. Becca stellte ihn mir vor, doch mehr als ein »Hey« sagte er nicht zu mir. Dann stiegen sie in sein Auto und fuhren davon. Ich sah, wie sie ihn anblickte, und ich sah das Foto, das sie von ihm gemacht hatte: ein Knöchel über dem Knie, ein Notizbuch in seinem Schoß, die Augen zusammengekniffen und in die Ferne gerichtet.
Diese Art von Fotos hatte Becca am liebsten. Solche, die die Persönlichkeit eines Menschen Schicht um Schicht freilegten und analysierten. Dieses Foto von ihm war voller Neugierde, aber ohne Liebe. Keine stürmische Hingabe. Vielleicht war sie wirklich von zu Hause weggelaufen, aber bestimmt nicht seinetwegen.
Und doch waren sie verschwunden, zusammen verschwunden, und da waren all diese Streitigkeiten mit Mom und Dad gewesen – monatelang. Becca, die unsere Eltern abwechselnd mit Schweigen bedachte oder anschrie, weil sie zu bestimmend waren, während sie an allem, was sie tat, herummäkelten: mit Zachary abhängen, den Schulchor verlassen, sich auf diese nächtlichen Ausflüge fortstehlen, ohne davon zu erzählen. Als sie dann verschwand, haben sie zwar nach ihr gesucht, aber nicht besonders gründlich. Sie glaubten wohl nicht, dass sie gefunden werden wollte.
Ich versuchte ihnen von dem Telefonat zu erzählen, das ich mitgehört hatte, und von dem, was Becca über die Straße gesagt hatte – Lucy Gallows’ Straße, wie ich glaubte, aber nicht mit Bestimmtheit wusste.
Und dann erzählte meine Mutter einer Freundin davon, und die Tochter ihrer Freundin bekam es mit, und plötzlich schien die ganze Schule davon zu wissen. So entstand dieses Gerücht, eine Mischung aus Tratsch und Witz. Es war die Art von verklemmter Gemeinheit, die Kinder ohne nachzudenken herausspucken, um ihre eigene Unsicherheit zu überspielen.
Lucy Gallows brachte Becca Donoghue in den Wald und ließ sie nicht mehr raus.
Natürlich glaubte niemand wirklich daran. Es war nur ein makabrer Scherz. Aber Becca hatte nichts für Scherze oder düstere Legenden übrig. Sie glaubte es wirklich. Und das bedeutete, dass meine Schwester den Verstand verlor, oder dass ich ebenfalls daran glauben musste.
Und so begann ich meine Suche. Nach der Straße. Nach Lucy. Nach meiner Schwester. Gefunden habe ich nichts.
Bis jetzt.
Kurz vor der Mittagspause ebbt das Getratsche um die Textnachrichten langsam ab. Trotzdem vertreibt mich das Geflüster aus der Cafeteria, und ich setze mich mit meinem Lunchpaket auf die Hintertreppe und glotze über den Hinterhof zu den hochragenden Bäumen. Eine einzelne Krähe hockt irgendwo oben auf einem der Äste, die sich im Wind wiegen.
Die Tür hinter mir öffnet sich. Der Vogel fliegt davon. Ich rücke zur Seite, damit wer auch immer an mir vorbeigehen kann. Doch wer auch immer bleibt stehen. Ich drehe mich um und blinzle. Es ist Vanessa. Sie hält ihr Handy fest in einer Hand und ihr Rucksack hängt halb von ihrer Schulter. »D-Da bist du ja«, sagt sie.
»Ähm, ja. Hi«, sage ich. »Kann ich dir irgendwie helfen?«
»Vielleicht«, sagt sie. »Wirst du es tun?«
»Was tun?«, frage ich.
»Das Sp-Spiel spielen«, sagt sie. »Das ganze Ding. Die Straße, die Sch-Schlüssel, einen P-P-Partner finden …« Ihr Stottern ist nicht zu überhören, aber sie kämpft nicht mehr dagegen an, so wie sie es getan hat, als wir noch kleiner waren, und ihr Sprechfluss hat einen ganz eigenen, entspannten Rhythmus. Sie sagt gern, dass es sich lohnt, darauf zu warten, was sie zu erzählen hat.
»Warum sollte ich?«
»Wegen Becca.«
Sie sagt ›Becca‹, nicht ›deine Schwester‹, und ich denke, das ist der einzige Grund, warum ich nicht sofort aufstehe und gehe. Kaum einer spricht ihren Namen noch aus. Als würde es Unglück bringen. »Du glaubst doch nicht etwa diesen dämlichen Quatsch, oder? Dass Lucy Gallows sich meine Schwester geschnappt hat?« Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich nicht daran glaube.
»Nein. Aber du fragst dich doch bestimmt, ob die N-Nachrichten etwas mit ihr zu tun haben. Mit Becca.«
»Natürlich«, blaffe ich. Ihre Wangen erröten, und sie schiebt ihre Brille hoch, was zur Folge hat, dass ihr Gesicht zur Hälfte hinter dem Ärmel ihres Pullovers verschwindet. »Was kümmert’s dich überhaupt?«
»I-Ich glaube nicht an Gespenster«, sagt Vanessa. »Aber ich mag Geschichte. Und Rätsel. Mich interessiert, wer diese SMS geschrieben hat. Und was sie bedeuten sollen. Ich dachte, dass du wegen deiner ganzen Nachforschungen vielleicht eine Idee hast.«
»Oh.« Seit Beccas Verschwinden stimmt etwas mit mir nicht. Sobald jemand auch nur eine leise Andeutung über die Geschehnisse macht, reagiere ich, als würde man mich persönlich angreifen. Sogar bei meinen Freunden. Wahrscheinlich habe ich deswegen keine mehr. »Hier. Setz dich«, sage ich und winke sie zu mir herunter. Sie hockt sich ein kleines Stück über mir auf die oberste Stufe.
»Also. Lucy Gallows«, sage ich. »Eigentlich Lucy Callow. Verschwunden am 19. April 1953. Am Mittwoch ist der Jahrestag. Ihr Bruder wurde wegen Mordes verhaftet, doch sie konnten ihm nichts nachweisen und ließen ihn wieder laufen. Sie war 15, nicht zwölf, und sie war eine Brautjungfer, kein Blumenmädchen, aber sonst stimmt die Geschichte, wie man sie erzählt.«
»Und das Spiel ist diese dumme Sache, die alle als Kind gespielt haben«, sagt Vanessa.
»Nicht ganz«, sage ich. »Hast du es gespielt?«
»Klar. Als ich u-u-ungefähr acht war«, sagt sie.
»Ich auch«, sage ich. Mit Anthony. Wir standen am Ende der Straße, die in den Wald führt, die Mittellinie zwischen uns. Haltet eure Hände. Schließt die Augen. Macht 13 Schritte. Angeblich beschwört man so den Geist von Lucy Gallows herauf.
»Ist irgendetwas geschehen?«, fragt Vanessa und lehnt sich vor.
»Natürlich nicht.« Das Spiel funktioniert nur auf zwei Arten: Entweder man ist jung und so fantasievoll, dass man einen Windhauch als eine Berührung von Lucys Hand wahrnimmt, das Rascheln der Blätter als ihre Schritte, das Ächzen der Bäume als ihre geisterhaften Rufe – oder aber man hat Freunde, die sich von hinten heranschleichen und einem einen Streich spielen. Ebenso gibt es nur zwei Sorten von Menschen, die dieses Spiel spielen: Kinder, die noch jung genug sind, um an Magie zu glauben, und Teenager, die versuchen, ihren Schwarm zu beeindrucken.
»Aber du sagtest n-nicht ganz. Was ist anders?«
»Es gibt eine ältere Variante«, sage ich. »Oder wenigstens eine andere. Man soll es noch immer mit einem Partner machen und 13 Schritte gehen, aber es hat nichts mit Lucy zu tun. Es soll die Straße heraufbeschwören – oder zeigen, wie man die Straße hinuntergelangt oder so etwas in der Art. Die Straße hat sieben Tore. Wenn man sie alle passiert, dann bekommt man … etwas. Hat einen Wunsch frei oder so. Diese Sage ist viel älter als die von Lucy Gallows. Einige Leute behaupten, dass sie die Sage kannte und darum die Straße genommen hat, als sie vor ihr auftauchte.«
»Einige Leute«, fragt Vanessa und zieht die Augenbrauen hoch.
»Miss Evans«, erkläre ich. Die Stadtbibliothekarin war im selben Alter wie Lucy, als diese verschwand, und sie war meine beste Quelle für alles, was mit dem Spiel zu tun hatte. Eine Zeit lang sprach ich mit niemandem öfter als mit dieser 78-jährigen Frau.
»Von diesem Teil des Sp-Spiels habe ich noch nie gehört«, sagt Vanessa und rückt mit dem Daumen ihre Brille zurecht.
»Ich schätze, es ist irgendwann weggelassen worden«, sage ich. »Vielleicht in den Achtzigern, als diese Kinder verschwanden.«
»War das nicht nur ein Gerücht?«, sagt Vanessa. »Angst vor S-Satanismus und so? Die Kids sind einfach nur abgehauen.«
»Darauf hat man sich schließlich geeinigt«, entgegne ich mit tonloser Stimme. Vanessa beißt sich auf die Lippe und wendet ihren Blick von mir ab. Ich schätze, ich bin nun offiziell das Trauma-Mädchen, mit den passenden schwarzen Klamotten und dem asozialen Ruf dazu. Ich habe mich an diese Reaktion schon längst gewöhnt, denn ich weigere mich, artig vorzuheucheln, dass es Becca nie gegeben hat.
Vanessa räuspert sich. »Du brauchst also einen Partner«, sagt sie. »Und einen Schlüssel?«
Das ist der Teil der Textnachrichten, der mir ein mulmiges Gefühl bereitet. Ich habe die Schlüssel nie erwähnt. Ich habe niemanden außer Becca je darüber sprechen gehört. Und ich habe nur eine Stelle gefunden, an der sie überhaupt erwähnt werden, von dem belauschten Telefongespräch einmal abgesehen: Beccas Notizbuch, das sie zurückließ, bevor sie verschwand. »Die Schlüssel öffnen die Tore. Es müssen deine Schlüssel sein. Sie verbinden dich mit den Toren – und der Straße, schätze ich.« Beccas Notizen waren zu diesem Punkt alles andere als eindeutig.
»Dann bleibt nur noch, die Straße z-zu finden«, sagt Vanessa. »Gleich hinter Cartwright, oder?«
»Dort spielen die meisten das Spiel, aber die Stelle, an der Lucys Bruder sie gesehen haben will, liegt gute fünf Meilen westlich davon«, sage ich.
»Und dort gibt es eine Straße?«
»Eben nicht«, sage ich und zucke mit den Schultern. »Aber warum auch, wenn es eine Geistererscheinung ist, stimmt’s? Außer natürlich wenn Lucy gerade herumspukt.« Ich versuche, so beiläufig wie möglich zu klingen, und nicht als ob sich mit jedem Wort eine Hand enger um meine Kehle schließt. Denn wäre ich ein normales Mädchen und hätte einfach »mein Leben weitergelebt« und diese »abstruse Bewältigungsstrategie« abgelegt, so wie es meine Mutter mir einmal eingeschärft hat, dann würde mir nichts von alledem zu Herzen gehen.
»Ich glaube nicht an Gespenster«, wiederholt Vanessa. »Und du?«
Ich stochere in der Kruste meines Sandwichs. Gern würde ich die Frage verneinen, doch das entspräche nicht der Wahrheit. Nicht mehr. Ich habe meine Gründe, daran zu glauben. Wegen Becca und wegen …
Darauf gibt es keine einfache Antwort mehr.
Sie schiebt die Hände unter ihre Oberschenkel. »Ich w-w-will’s ausprobieren. Das Sp-Spiel und die Straße und alles.«
»Warum«, frage ich, »wenn du nicht daran glaubst?«
»Ich will mir nur sicher sein.«
»Willst du etwa, dass ich dein Partner bin?«, frage ich und hoffe fast, dass es stimmt.
»N-Nein. Ich habe schon einen. Tut mir leid«, sagt sie. Ihre Wangen sind mittlerweile rot wie Tomaten. »Danke für deine Hilfe.«
»Klar doch«, sage ich, während sie hastig aufsteht. »Kein Problem.«
Doch da ist sie schon wieder im Schulgebäude verschwunden.
Ich hole mein Handy aus dem Rucksack und entsperre es. Die SMS steht schon auf dem Bildschirm, als würde sie nur auf mich warten. Eine Straße, ein Partner, ein Schlüssel. Und zwei Tage Zeit, sie zu finden, wenn man spielen will.
Will ich?
Ich erinnere mich an die Tür, die vor meiner Nase zuschlägt, und an Beccas undurchdringlichen Gesichtsausdruck. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte, aber ich schwieg. Tagelang. Bis es offensichtlich war, dass sie nicht nach Hause kommen würde.
Meine beiläufige Antwort an Vanessa entsprach der Wahrheit – es gibt an jener Stelle im Wald keine Straße. Was ich nicht erwähnte: In den Monaten nach Beccas Verschwinden war ich ein Dutzend Mal dort. Ich lief durch das Gehölz und rief ihren Namen. Ihren und Lucys. Doch mir hat nie jemand geantwortet.
Aber was, wenn ich nur den falschen Tag erwischt habe? Becca ist im April verschwunden. Jetzt ist es wieder April.
Ich glaube nicht an Gespenster. Aber ich glaube auch nicht, dass Becca tot ist. Und das bedeutet, dass sie dort draußen ist, irgendwo, und niemand sucht nach ihr. Nur ich.
3
Einige Eltern belassen das Zimmer ihres Kindes, wenn es verschwindet, genau so wie es war, und bewahren es wie einen Schrein, als würde eine mitfühlende Zauberhand das Kind deswegen zurück nach Hause beschwören, wo immer es auch stecken mag.
Meine Eltern sind nicht so. Drei Tage nach Beccas Verschwinden ging meine Mutter in ihr Zimmer, um es aufzuräumen. Sie wusch ihre Wäsche, wischte ihren Schreibtisch sauber, bezog ihr Bett neu, schuf Ordnung. Dann schloss sie die Tür und öffnete sie acht Monate lang nicht wieder.
Als sie es tat, verpackte sie alles in Kartons. 13 Kisten. Zehn davon landeten in Trödelläden oder auf dem Müll. Drei wanderten auf den Dachboden zu den Kisten mit den Projekten aus der Grundschule und zu den Makkaroni-Basteleien: Artefakte einer längst vergangenen Zeit. Das Bett und der Schreibtisch gingen auch an einen Trödelladen. Es wäre vermutlich weniger schmerzhaft gewesen, wenn meine Mutter alle Möbel entsorgt und das Haus komplett von Beccas Gegenwart befreit hätte, aber sie behielt das Bücherregal und den Stuhl und stellte sie ins Wohnzimmer. Es war, als hätte sie Becca vollständig aus ihrem Gedächtnis gestrichen und würde beim Anblick dieser Dinge keine quälenden Erinnerungen empfinden.
Ich habe nicht dagegen protestiert. Meine Eltern gaben mir keine Schuld an Beccas Verschwinden, aber sie hassten mich für meinen Beitrag zu dem, was danach kam. Die seltsamen Gerüchte, der Hohn. Meine Weigerung zuzugeben, dass meine Schwester uns für einen Jungen, den sie erst drei Monate lang kannte, verlassen hatte.
Protestiert habe ich nicht, aber ich bin in das Zimmer meiner Schwester geschlichen, als meine Mutter gerade im Badezimmer war, um mir die Schachtel zu nehmen, die unter ihrem Bett stand und in der sie ihre wertvollsten Besitztümer aufbewahrte: ein paar frühe Fotos, die zwar zu peinlich und dilettantisch waren, um sie vorzuzeigen, aber schon ihr verheißungsvolles Talent erkennen ließen; ihr Notizbuch – kein Tagebuch –, in dem sie Gedankensplitter und philosophische Überlegungen festhielt; ein paar Kinkerlitzchen von unseren sporadischen Ferienreisen und den Ehering meiner Großmutter, den Becca einmal bei ihrer eigenen Hochzeit tragen sollte.
Ich fand die Inschrift im Notizbuch, auf der Innenseite des Umschlags.
FINDE DIE STRASSE. FINDE DIE TORE. FINDE DAS MÄDCHEN.
Jetzt sitze ich auf meinem Bett, das Notizbuch auf meinem Schoß, und blättere mich durch die Seiten. Das meiste davon sind kritische Anmerkungen zu Fotos, die sie gemacht hat, oder Ideen für spätere Aufnahmen. Dazwischen finde ich Fragmente von Gedichten und abschweifende Textstücke zu Liedern. Sie hat zusammen mit Zachary ein paar Songs geschrieben, und ich erkenne seine Handschrift neben ihrer. Sein Gekritzel scheint ihres zu bedrängen, und ich verachte jedes Wort und jeden Buchstaben davon.
Ich hab’s gesehen / Noch einmal / In meinem Augenwinkel / Ganz egal / Wo ich bin, wie ich versuche / Abzuhau’n.
Es wartet / Wartet auf mich.
Genau wie sie.
Danach ändern sich die Notizen. In großen Blockbuchstaben, die Linien immer und immer wieder nachgezeichnet, bis sie verschwommen und ganz grau geworden waren, steht dort: DIE STRASSE. Und gleich darunter hatte Becca geschrieben:
Wenn es dunkel ist, lass nicht los.
Es gibt dort andere Straßen. Folge ihnen nicht.
Die Seiten danach sind eng beschrieben mit Vermerken zu Lucy Gallows und dem Spiel, den Schlüsseln, dem Wald und einer Stadt, die Becca nicht benennt. Zwischen die Seiten hat sie Fotos von dem Wald gesteckt. Auf einigen davon ist Zachary zu sehen. Sogar ein Foto von Lucys Grabstein ist dabei – auch wenn darunter niemand liegt.
Schließlich verkommen die säuberlich in Listen festgehaltenen Notizen zu eigenartigem Blödsinn: zusammenhanglose Satzteile, verstörende Zeichnungen von Augen und Händen und einer Figur, deren Körper mitsamt Armen und Beinen in die Länge gezogen scheint. Sie hat den Körper eines Mannes, doch der Kopf sieht aus wie der eines wilden Tieres, fast dreieckig und mit einem Geweih versehen, das sich in die Höhe reckt und stellenweise die ganze Seite ausfüllt.
Ich lese jedes Wort.
die vögel kommen wenn es dunkel wird
sieben tore
folge den regeln
bleib nicht stehen
Und so geht es immer weiter. Viele der Satzschnipsel lesen sich wie Anweisungen, doch es gibt auch andere ohne eindeutige Aufforderungen, wie diese eine, die sich wie eine Spirale über das ganze Blatt zieht.
in dem haus in der stadt in dem wald an der straße gibt es flure die atmen. der gesang wird dich verführen der rauch wird dich überkommen die worte werden dich zerstören und die frau wird dich verachten.
Ich habe Stunden damit verbracht, die Seiten des Notizbuches immer und immer wieder durchzublättern, doch kein einziges Geheimnis wollte sich mir offenbaren. Ich bin zu der Stelle in den Wald gegangen, wo Lucy Gallows verschwunden ist, bei Tag und in der Dunkelheit, wenn der Vollmond schien, in einem weißen Kleid, wie es die Legenden sagen.
Ich glaube nicht an Gespenster. Dabei würde ich es so gern tun. Ich weiß, dass Becca nicht davongelaufen ist. Das lässt nur eine Möglichkeit und eine Unmöglichkeit offen, und ich hoffe auf das Unmögliche. Wenn sie nicht tot ist, wenn sie nur entführt wurde, dann kann sie zurückkommen.
Die Haustür öffnet sich, und ich höre die vertraute Folge von Geräuschen, die die Ankunft meiner Mutter verkünden: Schlüssel, die in der Schale neben der Tür rasseln; Schuhe, die achtlos in die Ecke plumpsen; schnelle Schritte, die zur Küche huschen; der Plopp des Korkens einer halb vollen Flasche. Sie hat bestimmt schon von den Textnachrichten gehört. Es ist eine kleine Stadt.
Ich lege das Notizbuch zurück in die Schachtel und schiebe sie unter mein Bett. Ich ziehe meine Füße hinauf auf die Decke und setze mich auf sie. Unzählige Varianten der bevorstehenden Unterhaltung schießen mir durch den Kopf, und ich überlege mir genauso viele Wege, meine Mutter zu überzeugen, dass es nichts gibt, worüber sie sich Sorgen machen muss.
Ihre Schritte kommen die Treppe hinauf, und sie klopft sacht an meine Tür, bevor sie sie öffnet. »Wie war’s in der Schule?«, fragt sie.
Hört sich an, als würde sie sich langsam herantasten wollen. »Gut«, sage ich.
Sie hält inne. Anscheinend sucht sie in meinem Gesicht nach einer Antwort – doch auf welche Frage? Interessiert es sie, ob mich die SMS beunruhigen? Will sie wissen, ob ich es war, die sie verschickt hat?
»Gut«, sagt sie. Ich blinzle. »Ich glaube, ich bestelle etwas fürs Abendessen. Ist Pizza okay?« Wie es aussieht, werden wir nicht darüber sprechen.
»Ja«, sage ich.
»Oder Chinesisch.«
»Okay«, sage ich. Das einzige chinesische Restaurant in Briar Glen gehört einem Italiener namens Aurelio, was bedeutet, dass die Küche nicht gerade authentisch ist, aber das Essen schmeckt. Henry Lins Eltern betreiben die Pizzeria in einer Art gastronomischer Symmetrie, und die meisten Abende bestellen wir unser Essen bei einem der beiden Betriebe. An den anderen Abenden ernähren wir uns von den Resten.
Meine Eltern sind nicht geschieden, jedenfalls nicht offiziell. Aber schon vor der Sache mit Becca hat es zwischen ihnen gebrodelt. Drei Monate ist Dad noch geblieben. Hat einen Job in New York angenommen, und obwohl er behauptet, dass er sich mit niemandem trifft, gibt es da diese Arbeitskollegin, die ihre gemeinsamen Selfies von »geschäftlichen Veranstaltungen« mit einer fast schon psychisch gestörten Anzahl an Emojis schmückt. Er bezahlt noch immer für den Detektiv, der nach Becca sucht und alle paar Wochen Neuigkeiten vermeldet – immer sind es irgendwelche vielversprechenden Hinweise, aber nie etwas Konkretes. Auch wenn Dad die Hoffnung schon verloren hat, ist er doch nicht bereit, die Suche einzustellen. Noch nicht.
Anders als Mom. Sie wird mich nicht nach den SMS fragen, denn das würde zwangsläufig bedeuten, dass wir über Becca sprechen müssen. Und das ist eine Sache, die wir einfach nicht können. Schweigen ist das einzige Mittel, das sie gegen den Schmerz kennt. Als würde es das Leid lindern, wenn sie einfach nur so tut, als hätte sie die ganze Angelegenheit hinter sich gelassen. Eigentlich bedeutet es nur, dass wir den Schmerz allein ertragen müssen und nicht für einander da sein können.
Ich habe nicht nur meine Schwester verloren, sondern meine ganze Familie. Keine Ahnung, ob ich sie je zurückbekommen werde. Aber ich kann Becca finden.
Wenigstens kann ich es versuchen.
Ich hatte befürchtet, nicht einschlafen zu können, aber wie es scheint, fange ich an zu träumen, sobald ich die Augen schließe. Ich stehe auf einer Straße. Es ist eine normale Straße mit einer weißen Linie in der Mitte. Der Asphalt schillert vor Hitze. Ich laufe die Mittellinie entlang, und ein anderes Mädchen läuft neben mir her. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Sie ist in meinem Alter, hat langes, dunkles Haar und ein Tattoo von einer Feder auf der Innenseite ihres linken Handgelenks. Über uns fliegen fünf Krähen hinweg und krächzen.
»Ist sie das?«, frage ich.
»Die Straße?«, rät sie und lächelt. Sie hat nur auf einer Wange ein Grübchen. »Nein. Nur eine Straße. Eine sichere, fürs Erste.«
»Ich muss die andere finden«, sage ich.
»Nicht so sicher«, bemerkt sie. Ich nicke. Die ganze Situation ist so normal, wie sie in Träumen eben ist. »Sie wird dich finden. Solange ihr alle zusammen seid und nach ihr sucht, wird sie da sein.«
»Bist du sicher?«, frage ich.
»Ich vermeide es, mir allzu sicher zu sein«, sagt sie. Dann deutet sie mit einem Nicken zum Horizont. Er verdunkelt sich. Die Finsternis wird immer größer, schwillt über die Hügel in der Ferne, über die Bäume, und zieht wie ein Tsunami auf uns zu. Sie reicht mir ihre Hand, und ich strecke meine aus, um sie zu nehmen.
Und dann erwache ich. Ich starre für einige Minuten hinauf zur Decke und warte darauf, dass sich mein pochendes Herz wieder beruhigt. Dann setze ich mich auf. Ich blicke zur Uhr. Es ist gerade einmal kurz nach zehn, aber wenn mich so etwas erwartet, dann werde ich nicht versuchen, wieder einzuschlafen.
Ich nehme Beccas Notizbuch und ihre alte Kamera und schleiche mich zur Hintertür hinaus. Besonders leise muss ich nicht sein – Mom nimmt fast jeden Abend Schlaftabletten. Seit Becca.
Ich bin mir nicht sicher, wohin ich überhaupt gehe, bis ich die Richtung schon eingeschlagen habe. Es gibt einen Park an der Galveston und Grand. Ein Bach fließt durch seine Mitte, Bäume wachsen entlang des Ufers. Dort ist man im Grünen und doch so weit weg von der Wildnis, wie es nur möglich ist, aber für die Wildkatzen war es dort wie in Narnia, in Mittelerde und dem Amazonas-Regenwald.
Wir trafen uns immer an der Brücke. Sie ist fast zwei Meter breit und aus ungestrichenen Holzbrettern gemacht. Das Geländer rammt einem Splitter in die Finger, wenn man mit der Hand drüberfährt. Becca und ich waren fast immer die Ersten, und wir schmissen Stöcke ins Wasser und sahen zu, wie sie wegtrieben. Ich lehne mich an das Geländer und versuche, ihre Gegenwart zu spüren, so wie sie immer neben mir stand, die Ellbogen auf den Handlauf gestützt, während sie mit dem Ring an ihrem Daumen spielte.
Wenn man jemanden verliert, so habe ich immer geglaubt, vergisst man zuerst die Kleinigkeiten, aber es sind die Kleinigkeiten, die mir noch geblieben sind – die Fältchen an ihren Augenwinkeln, wenn sie sich über mich lustig machte, und die Art, wie sie an ihrem Daumennagel kaute, wenn sie sich konzentrierte. Die großen Sachen dagegen gehen mir verloren. Ihr Gesicht. Ihre Stimme. Wie es sich anfühlte, in ihrer Nähe zu sein.
Becca war – ist – sechs Monate älter als ich. Unsere Eltern versuchten fünf Jahre lang, ein Kind zu bekommen. Es funktionierte nicht, und so nahmen sie den langen, mühsamen Weg einer Adoption auf sich. Eine leibliche Mutter änderte noch im Kreißsaal ihre Meinung, bevor sie Becca fanden und sie – klein und perfekt, wie sie war – als ihr Kind adoptierten.
Nicht einmal einen Monat später erfuhren sie von mir. Sie hatten sich immer zwei Kinder gewünscht, also nahmen sie es mit einem Schulterzucken, einem Lachen und dem Entschluss, uns nicht unterschiedlich zu behandeln. Das gelang ihnen auch, zumindest meistens. Doch man spürte irgendwie immer, wie sehr sie sich bemühen mussten: die ständigen Selbstzweifel, die übertriebene Wiedergutmachung, wenn sie glaubten, Becca nicht genauso zu behandeln wie mich, und ihr ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit und Lob zukommen ließen, um noch aufrichtig zu erscheinen. Vielleicht war das der Grund, warum die Beziehung zwischen ihr und ihnen mit dem Beginn der High School zu zerbrechen begann. Vielleicht aber gab es auch einen anderen Grund für ihr Schweigen, ihre seltsamen Launen, ihr Fernbleiben von zu Hause, wann immer es ihr möglich war.
Doch ich eiferte ihr nach, schon lange vor der High School. In der Woche, als sie zum ersten Mal allein auf ihren Füßen stehen konnte, versuchte ich, es ihr nachzumachen. Ich konnte laufen, nur einen Monat später als sie. Alles, was sie berührte, musste ich haben. Das erste Wort, das mir über die Lippen kam, war der Name meiner Schwester, und ich schrie ihn in der Nacht, bis meine Eltern mich zu ihr in die Krippe legten.
Ich habe immer geglaubt, dass wir beide der Schwerpunkt wären, um den der Rest der Gruppe kreist, doch das stimmte nicht. Das war nur Becca. Sie hielt uns zusammen. Und sie war es, die sich als Erste von der Gruppe löste. Nachdem sie verschwunden war, zerbrach die Gang für immer.
Ich hebe die Kamera und schieße ein Foto. Der Blitz leuchtet auf. Ich blicke auf das Display. Das Wasser ist ein Wirrwarr aus reflektiertem Licht, die Bäume nicht mehr als verschwommene Schatten. Ich bin nicht annähernd solch eine gute Fotografin, wie es meine Schwester war. Ist.
War.
»Sara?« Ich bin nicht unbedingt überrascht, Anthonys Stimme zu hören, aber ich freue mich auch nicht. Seine Schritte knirschen zu mir herüber und klingen plötzlich dumpf, als er die Brücke betritt.
»Hey«, sagt er, lehnt sich neben mich an das Geländer und blickt hinunter in den Bach. Die Lampen im Park scheinen gerade hell genug, um auf der Wasseroberfläche zu schimmern, dort, wo ihre feinen Wellen über die Steine schlagen. »Hab mir fast gedacht, dass du hier bist. Oder im Wald.«
»Hat keinen Sinn, jetzt schon dorthin zu gehen«, sage ich. »Nicht heute Nacht.«
»Bist du sicher?«
»Erst am Jahrestag. Mittwoch, kurz nach Mitternacht. Genau zwei Tage nachdem die SMS verschickt worden sind.«
Seine Finger klammern sich fest an das Geländer, und seine Kieferknochen wölben sich, als er seine Zähne aufeinanderpresst. »Ja. Ich weiß.« Er wirft mir einen kurzen Blick zu.
»Du glaubst, dass ich es war«, sage ich. Mein Tonfall ist ausdruckslos, doch das Gefühl des Verrats schneidet tief in mich hinein. »Du glaubst, dass ich die Nachrichten verschickt habe.«
»Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht für einen Augenblick. Aber nicht länger«, sagt er.
»Alle anderen denken, dass ich es war«, sage ich. Ich schlurfe mit dem Schuh über die Brücke und schubse einen Stein hinunter, der mit einem kaum hörbaren Plopp im Wasser landet. Anthony stupst meine Schulter mit seiner, und ich stutze kurz wegen dieser freundschaftlichen Nähe, von der ich glaubte, dass sie lange hinter uns liegt.
»Nur die Idioten«, versichert er mir.
»Du hast gerade gesagt, dass du es selbst einen Augenblick lang geglaubt hast.«
»Und da war ich einen Augenblick lang ein Idiot«, sagt Anthony, und für den Bruchteil einer Sekunde zeigt er mir dieses Grinsen, das man unmöglich nicht erwidern kann. »Trina glaubt es auch nicht.«
»Du hast mit ihr darüber gesprochen?«
Er zuckt mit den Schultern. »Sie macht sich deinetwegen Sorgen.«
»Ihr sprecht also miteinander – über mich«, sage ich.
Anthony seufzt frustriert. Er dreht sich zu mir um, doch ich rühre mich nicht und blicke stur hinunter ins Wasser. »Komm schon, Sara. Wir hätten ja mit dir gesprochen, aber du hast ja kaum mehr als drei Worte für einen von uns übrig.«
»Ach, dann ist das alles meine Schuld?« Jetzt wende ich meinen Kopf zu ihm und stiere ihn wütend an.
»Wir alle haben Becca geliebt«, sagt er. Einige mehr als die anderen, doch das sage ich ihm nicht, denn eigentlich darf ich es nicht wissen.
»Ist auch egal«, flüstere ich. »Es spielt jetzt keine Rolle mehr.«
»Nein, das tut es nicht«, sagt Anthony. »Was immer auch passiert ist, ich bin jetzt für dich da. Keine Ahnung, ob es ein Scherz oder eine Falle ist oder ob sich dort draußen in dem Wald wirklich etwas versteckt hält, aber ich werde dich nicht allein gehen lassen.«
Ich starre ihn an. Es fühlt sich an, als hätte ich das Gleichgewicht verloren, als wäre ich gestolpert und würde noch nach Halt suchen. Einen Moment lang bebt mein ganzer Körper vor Dankbarkeit und Erleichterung. Er tut es für mich, er ist noch immer mein Freund, ich bin ihm nicht egal. Doch dann weiche ich zurück, und ein tiefer Zorn zieht in mir auf.
»Du lässt mich nicht?«, sage ich.
»Ich wollte sagen, dass ich mit dir gehen werde«, sagt er. »Als dein Partner, so wie es in der SMS steht.«
»Ich hab dich nicht gebeten, mit mir zu gehen«, sage ich.
»Aber du gehst.«
»Selbstverständlich.«
Er nickt, als wäre die Angelegenheit damit erledigt. »Dann gehe ich mit.«
»Du unterstellst einfach, dass ich sonst niemanden habe? Dass ich nur mit dir gehen will?«
»Warum denn nicht?«
»Echt jetzt? Mal sehen.« Ich hole mein Handy hervor und öffne meine Textnachrichten. Ich scrolle nach unten, immer weiter, bis ich die Einträge mit Anthonys Namen finde.
Die neueste SMS ist schon ein paar Monate alt. Sie zeigt das Emoji einer Geburtstagstorte. Die davor liegt schon fast ein Jahr zurück. Alles okay?, lautet sie.





























