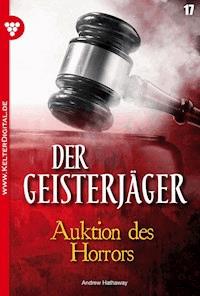Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Martin Kelter Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Der Geisterjäger
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Sie sind die Besten, und sie wissen genau, was sie tun und vor allem, mit welchen Horrorgestalten sie es zu tun haben: Geisterjäger nehmen im Kampf gegen das Böse die größten Gefahren und Herausforderungen auf sich. Der dramatische Streit zwischen Gut und Böse wird in diesen Gruselromanen von exzellenten Autoren mit Spannung zur Entscheidung geführt. Paul Tamy war achtzehn Jahre alt und arbeitete im Londoner Hafen. Paul Tamy war groß und athletisch, hatte blaue Augen und schwarze Haare. Er verdiente gut, und die Mädchen schwärmten für ihn. Er war zufrieden. Und er genoß sein Leben ohne Einschränkung. Bis zu jenem 16. September. Das Grauen schlug kurz vor Mitternacht zu. Zuerst glaubte Paul, verrückt zu werden. Später erkannte er, daß er sich nicht täuschte. Satan war im Londoner Hafen angekommen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Geisterjäger –19–
Dem Satan auf der Spur
Roman von Andrew Hathaway
Paul Tamy war achtzehn Jahre alt und arbeitete im Londoner Hafen. Paul Tamy war groß und athletisch, hatte blaue Augen und schwarze Haare. Er verdiente gut, und die Mädchen schwärmten für ihn. Er war zufrieden. Und er genoß sein Leben ohne Einschränkung.
Bis zu jenem 16. September.
Das Grauen schlug kurz vor Mitternacht zu.
Zuerst glaubte Paul, verrückt zu werden. Später erkannte er, daß er sich nicht täuschte.
Satan war im Londoner Hafen angekommen!
*
Die Samstagnacht war Paul Tamys beste Zeit. Er ließ keine Disco aus, tanzte bis zum Umfallen und machte sogar dann noch weiter. So schnell wurde Paul Tamy nicht müde.
Unter der Woche schuftete er im Hafen für zwei. Jeder dachte, das müsse alle seine Energien aufzehren. Aber Paul zeigte es den Besserwissern. Wenn am Samstagabend die Lichter angingen, war er zur Stelle.
Die Girls in den Discos kannten ihn. Sie rissen sich darum, mit dem großen, gutaussehenden jungen Mann zu tanzen. Vielleicht gab es welche, die besser als Paul tanzten. Aber er unterhielt sich auch gern, war sympathisch und kümmerte sich um seine Partnerinnen.
Paul mochte Rita Lynch besonders. Sie war genauso alt wie er und sah ihm auch verblüffend ähnlich, hatte ebenfalls schwarze Haare und blaue Augen, war nur eine Handbreit kleiner als er und eine fabelhafte Tänzerin.
Am Freitag hatten sie sich verabredet und in einer Boutique am Piccadilly Circus zwei schwarze Overalls gekauft. An diesem Samstag erschienen sie völlig gleich gekleidet in der Disco und waren die Sensation des Abends.
»Gehen wir?« fragte Paul um elf Uhr nachts.
Rita sah ihn überrascht an. »Jetzt schon? Wir sind doch gerade erst warmgelaufen. Wollen wir den anderen nicht zeigen, wie man richtig tanzt?«
Er legte seine Hände auf ihre Schultern und lächelte unternehmungslustig. »Ich möchte dir noch etwas zeigen. Komm!«
»Was denn?« fragte Rita zurückhaltend.
»Ist eine Überraschung«, tat Paul geheimnisvoll, beugte sich vor und küßte sie flüchtig auf den Mund und sah sie so bittend und nett an, daß sie nicht ablehnen konnte.
»Okay, aber mach keinen Unsinn«, warnte Rita. »Irre Partys mit Rauschgift laufen bei mir nicht.«
»Bei mir auch nicht«, versicherte Paul Tamy. »Wir kommst du auf die Idee? Los, wir verschwinden hier.«
Er hatte sein Motorrad vor der Disco stehen. Sie setzten ihre schwarzen Schutzhelme auf, und Paul fuhr das kurze Stück zum Hafen.
»Willst du mir die Piers zeigen?« rief Rita und klammerte sich fester an ihn.
Paul nickte nur.
Der Themsehafen war auch nachts erleuchtet und in Betrieb, obwohl nicht viel los war. Kräne arbeiteten, Scheinwerfer schwenkten herum und beleuchteten die Schiffe, die entladen wurden.
Paul stellte das Motorrad hinter dem Tor ab, nahm den Sturzhelm ab und lachte über das ganze Gesicht.
»Siehst du dort drüben das Bürogebäude?« fragte er und legte seinen Arm um Rita.
Sie sträubte sich nicht und nickte.
»Siehst du die Fenster im dritten Stock?« fuhr Paul fort »Es sind vier Fenster. Ich meine das ganz links.«
»Sehe ich«, bestätigte Rita. »Was ist damit?«
»Dort oben arbeite ich ab Montag«, erklärte Paul stolz. »Mein Chef hat es mir angeboten. Und ich habe natürlich angenommen. Ich brauche mich nicht mehr an den Piers zu plagen, und eine Gehaltsaufbesserung gibt es auch.«
»Wunderbar!« rief Rita Lynch begeistert und fiel ihm um den Hals. »Das ist toll, Paul! Ehrlich! Ganz toll!«
Sie freute sich wirklich mit ihm. Als er ihren lächelnden Mund so dicht vor sich sah, konnte er nicht widerstehen. Er zog sie an sich und wollte sie küssen.
In diesem Moment knallte es.
Erschrocken fuhr Paul Tamy herum. Es war die Tür des Verwaltungsgebäudes, die gegen die Wand schlug. Aus dem Bürohaus stürmte ein Mann, den er gut kannte.
»He, Eric«, rief Paul Tamy.
Eric Ivy arbeitete als Schauermann im Hafen. Er war Mitte vierzig, ein gutmütiger Kerl mit Fäusten wie Schmiedehämmer. Nichts konnte ihn aus der Ruhe bringen.
Im Moment jedoch floh Eric Ivy in blinder Panik.
»Eric, was ist los?« rief Paul und löste sich von Rita.
Er wollte seinen Kollegen aufhalten, schaffte es jedoch nicht. Ivy rannte auf die Kräne zu, die sich pausenlos drehten und schwere Container ausluden.
»Warte hier!« sagte Paul zu Rita und lief hinter Eric her.
Eric Ivy war bärenstark, wenn er eine Kiste heben sollte. Er war jedoch kein schneller Läufer. Paul Tamy hätte ihn eigentlich mühelos einholen müssen.
An diesem Abend schaffte er es jedoch nicht. Hinter Eric Ivy schien der Teufel her zu sein!
»Eric!« Paul wäre beinahe über ein herumliegendes Eisenstück gestolpert. Im letzten Moment schnellte er sich mit einem weiten Satz darüber hinweg.
Sein Kollege verschwand hinter einem hohen Stapel Container.
Paul wollte ihm folgen, blieb jedoch wie angewurzelt stehen.
Zufällig fiel sein Blick auf den obersten Container.
Pauls Mund öffnete sich zu einem Schrei. Aus einer Kehle drang jedoch nur ein heiseres Stöhnen.
Das Wesen dort oben auf den Containern konnte es gar nicht geben! Und doch sah er es vor sich.
Es besaß die Größe eines Menschen, auch ungefähr seine Figur. Der Körper war jedoch mit dichtem schwarzem Fell bedeckt. Zumindest erschien es auf diese Entfernung und bei der unsicheren Beleuchtung so. Das Gesicht verschwand zum größten Teil ebenfalls unter diesem schaurigen Fell.
Dafür sah Paul die Augen um so deutlicher. Sie waren wie rote, glühende Abgründe, aus denen ihm Haß entgegenschlug. Ein Blick in diese Augen genügte, um ihn vor der gefährlichen Bestie zu warnen.
Mit Händen, die in lange Klauen ausliefen, umklammerte das Ungeheuer den obersten Container und stemmte sich dagegen.
Als wäre er eine leere Pappschachtel, kippte der Container.
In diesem Moment löste sich Pauls Sperre. Er schrie entsetzt auf.
Sein Schrei ging in dem donnernden Getöse des Containers unter, der auf den Pier prallte.
Der Betonboden erzitterte. Für einen Moment herrschte tödliche Stille.
Im nächsten Moment liefen von allen Seiten Männer herbei.
Der Stapel versperrte Paul Tamy die Sicht. Er umrundete ihn und zuckte zurück.
Vor ihm lag Eric Ivy.
Der Container hatte ihn voll getroffen!
Pauls Blick zuckte nach oben.
Die Bestie war verschwunden…
*
Der Londoner Privat- und Geisterdetektiv Rick Masters frühstückte ungewöhnlich früh. Außerdem tat er es nicht in seinem Wohnbüro in der Londoner City, sondern bei seiner Freundin Hazel Kent in deren Haus in Westminster.
»Ganze drei Wochen Urlaub!« Hazel schüttelte den Kopf. »Das ist wirklich eine Herausforderung für jeden Menschen, der zu Hause bleiben und arbeiten muß!«
Rick Masters grinste jungenhaft. »Und ich freue mich sogar auf meinen Urlaub«, versicherte er. »Nur schade, daß ich Dracula nicht mitnehmen kann.«
Er beugte sich herunter und streichelte seinen kleinen Hund namens Dracula.
»Ach, daß du mich nicht mitnehmen kannst, stört dich nicht?« rief Hazel Kent. »Das ist ja interessant!«
»Ich hatte dir angeboten, mit mir drei Wochen lang auf die Bahamas zu kommen, Darling«, erwiderte Rick Masters ungerührt. »Du wolltest nicht.«
»Ich wollte schon, aber ich kann nicht«, sagte Hazel seufzend. »Ich darf meine Firmen nicht im Stich lassen. Die Kent-Werke müssen weiterlaufen, besonders in dieser schwierigen Zeit. Die Chefin darf sich eben keine drei Wochen Urlaub gönnen.«
»Du tust mir ja leid, Darling«, versicherte der Geisterdetektiv. »Aber ich kann nun einmal nicht eine Luxusreise ausschlagen, die ich bei irgendeinem Preisausschreiben gewonnen habe. Drei Wochen Bahamas mit Flug und Luxushotel. Ich muß ganz einfach fliegen.«
»Schreib mir«, bat Hazel Kent. Es tat ihr leid, Rick drei Wochen lang nicht zu sehen. Er hatte als Geisterdetektiv zwar immer viel zu tun, aber die wenigen gemeinsamen Stunden entschädigten sie beide für alles. »Ich werde dich im Hotel anrufen.«
»Ich freue mich darauf«, versicherte Rick, beugte sich über den Frühstückstisch und küßte Hazel.
Butler Seton trat ein, verneigte sich und räusperte sich dezent.
»Es wäre angebracht, Mr. Masters, sich auf den Weg zu machen«, erklärte er in seiner etwas altmodischen Ausdrucksweise. »Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.«
»Ja, Seton, Sie haben recht«, meinte Rick nach einem Blick auf seine Uhr. »Ich muß mich von euch verabschieden.«
»Ich kann dich nicht einmal zum Flughafen bringen«, sagte Hazel betrübt. »Was für ein Pech! Ausgerechnet heute muß die japanische Wirtschaftsdelegation bei mir vorsprechen.«
»Das Taxi wird ebenfalls aus der Reisekasse bezahlt«, tröstete Rick seine Freundin. »Machen wir es kurz und schmerzlos! Leb wohl. Paß gut auf dich und Dracula auf.«
Rick umarmte und küßte Hazel, streichelte seinen Hund Dracula und eilte hinter Butler Seton aus dem Raum.
Rick Masters haßte Abschiedsszenen. Sie verdarben ihm jeden Urlaub. Diesmal ließ es sich jedoch nicht vermeiden.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, hastete er zu dem wartenden Taxi, in dem schon seine Koffer verstaut waren. Der Fahrer wußte schon Bescheid und fuhr sofort los.
Auf der Fahrt zum Flughafen Heathrow hatte Rick ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Er kümmerte sich nicht weiter darum. Wer sollte ihn schon beschatten? Er hatte in der letzten Zeit sehr viele heikle Fälle bearbeitet, in denen Übersinnliches eine Rolle gespielt hatte. Davon waren seine Nerven strapaziert. Der Urlaub würde ihm guttun. Bestimmt fühlte er sich nur verfolgt, weil er so abgearbeitet war.
Alles verlief ganz normal, die Abfertigung, der Start und der Flug.
Ungewöhnlich war, daß die Maschine zuerst Teneriffa anflog und dort eine Zwischenlandung einlegte. Rick zerbrach sich jedoch nicht weiter den Kopf darüber.
Er dachte sich auch nichts dabei, daß von London nach Teneriffa der Platz neben ihm leer blieb. Er blickte nicht einmal hoch, als sich unmittelbar vor dem Start von Teneriffa ein Mann neben ihn setzte. Rick sah aus dem Fenster und kümmerte sich nicht um seinen Nachbarn.
Erst als die Stewardeß kam und Kaffee und Tee anbot, wandte Rick Masters den Kopf.
Augenblicklich vergaß er die hübsche Stewardeß und winkte nur ungeduldig ab, als sie ihre Frage wiederholte. Aus zusammengekniffenenAugen starrte er auf seinen Sitznachbarn:
»Was machen Sie hier?« fragte er mit zusammengebissenen Zähnen. Er gab sich selbst gleich die Antwort. »Sie wollen mir den Urlaub vermiesen, Red.«
»Richtig«, bestätigte der Agent des Secret Service. »So lautet mein Auftrag!«
*
Paul Tamys Eltern wohnten in Mittelengland. Dort herrschte noch größerer Arbeitsmangel als anderswo im Land. Deshalb war Paul Tamy nach London gegangen, hatte Arbeit gefunden und eine kleine Wohnung direkt am Hafen gemietet.
Als er an diesem Sonntagmorgen die Augen aufschlug, blinzelte er gegen helles Sonnenlicht an. Stöhnend griff er sich an die Stirn.
»Wie geht es dir, Darling?« drang eine sanfte Stimme an sein Ohr.
»Erbärmlich!« Er wälzte sich herum und starrte Rita Lynch verwirrt an.
»Du siehst krank aus«, stellte Rita fest.
»So fühle ich mich auch.« Paul schluckte schwer. »Habe ich alles nur geträumt, oder ist Eric Ivy wirklich von einem Container erschlagen worden?«
»Das stimmt«, sagte Rita mit merkwürdiger Betonung. »Das schon, aber alles andere hast du geträumt.«
»Alles andere?« Paul rieb sich die Schläfen, als müsse er sein Gehirn wieder anregen. Mit einem Schrei setzte er sich auf. »Die Bestie!«
»Nicht schon wieder, Darling«, bat Rita flehentlich. »Damit hast du letzte Nacht schon die Polizisten verrückt gemacht!«
»Ich habe dieses bepelzte Ungeheuer aber deutlich gesehen!« rief Paul. Er schüttelte sich. Auf seinem nackten Oberkörper erschien Gänsehaut. »Ich… ach was!«
Er brach ab und zuckte die breiten Schultern. Allmählich begann er einzusehen, daß ihm niemand glaubte.
Rita legte ihre Arme um ihn und streichelte besänftigend seinen Nacken. »Ist ja gut, ist ja schon gut«, murmelte sie dabei. »Du darfst dich nicht so aufregen. Es war für dich ein scheußlicher Schock, das verstehe ich. Aber was du angeblich gesehen hast, gibt es nicht. Verstehst du?«
Paul wollte heftig protestieren, doch mittlerweile fragte er sich selbst, ob es nicht nur Einbildung gewesen war. Ein menschenähnliches Wesen, das an Zeichnungen von Höllenbestien erinnerte, gab es nicht. Rita hatte recht.
»Ich mache uns Kaffee«, sagte er und stieg aus dem Bett.
»Ist schon fertig.« Rita deutete auf den gedeckten Tisch. »Du bist zwar mit Geschirr nicht gerade reichlich ausgestattet, aber es hat gereicht. Ein richtiges Frühstück. Geh unter die Dusche, ich koche die Eier.«
Paul wollte ihr zulächeln, doch es mißlang. Er fühlte sich zu elend und verwirrt.
Nach dem Frühstück mußte Rita gehen. Sie hatte ihren Eltern versprochen, zum Mittagessen zu Hause zu sein.
»Ich rufe dich an«, sagte sie, bevor sie die Wohnung verließ. »Okay?«
»Ja, okay«, erwiderte Paul. »Heute abend möchte ich aber lieber nicht ausgehen. Ich bin nicht in der Stimmung.«
Rita verstand es. Paul sagte ihr jedoch nicht, was er wirklich vorhatte.
Kaum war sie weg, als er in den Hafen fuhr. Um die Mittagszeit stand er neben den Containern, die seinem Kollegen Eric Ivy den Tod gebracht hatten.
Es gab keine Spuren mehr. Alles war beseitigt worden. Die Polizei hatte den abgestürzten Container beschlagnahmt.
Aber die anderen, übereinandergestapelten Container waren noch da.
Niemand hielt Paul auf, als er zu klettern begann. Er war hier im Hafen gut bekannt. Er erklomm den Stapel und stand zuletzt auf den beiden obersten Containern. Da oben befand er sich in schwindelerregender Höhe.
Auf diesen Containern hatte jener Behälter geruht, den die Bestie hinuntergestoßen hatte. Oder der von sich aus gefallen war, wie die Polizei annahm!
Paul sah sich um und zuckte zusammen.
Er entdeckte nämlich einen Fußabdruck.
Auf den ersten Blick schien es der Abdruck eines normalen nackten menschlichen Fußes zu sein. Bei genauerem Hinsehen waren einige Unterschiede nicht zu übersehen.
Erstens war der Abdruck doppelt so groß wie der Fuß eines Menschen. Und zweitens hatte er sich schwarz in die Metallwand des Containers eingebrannt. Und das war völlig unmöglich.
Wo sich der Fuß abzeichnete, war das Metall richtiggehend eingeschmolzen.
Paul wußte noch nicht, ob er seine Entdeckung melden sollte, als sein unsichtbarer Gegner mit voller Macht zuschlug!
*
»Ich mag Sie nicht besonders«, sagte Rick Masters zu Red und verriet dem Geheimdienstmann kein Geheimnis. »Noch viel weniger mag ich es, daß Sie sich im selben Flugzeug befinden wie ich und mich in den Urlaub begleiten.«
Der Geisterdetektiv Rick Masters arbeitete meistens sehr eng mit Scotland Yard zusammen. Gelegentlich hatte er auch einen Auftrag für den Secret Service erledigt, wenn Geister, Dämonen oder Schwarze Magie im Spiel waren.
Er hatte sich jedoch gegen die Methoden von Red, seinem Verbindungsmann zum Secret Service, gestemmt. Daher war das Verhältnis der beiden Männer stets gespannt gewesen.
»Sie täuschen sich in mehrfacher Hinsicht, Mr. Masters«, entgegnete Red ruhig. Der Mann mit den roten Haaren und dem Durchschnittsgesicht blieb ungerührt. »Sie fliegen überhaupt nicht in Urlaub. Es tut mir leid, aber Sie haben gar nicht im Preisausschreiben gewonnen.«
Ricks Augen weiteten sich. »Sagen Sie das noch einmal!« verlangte er.
Red, dessen wirklichen Namen Rick nicht kannte, nickte. »Es stimmt, Mr. Masters, Sie haben nichts gewonnen. Alles hat der Secret Service aufgezogen. Diesen Flug bezahlt auch meine Organisation. Auf den Bahamas angekommen, setzen Sie sich in das nächste Flugzeug, das nach London zurückfliegt.«
»Sind Sie verrückt?« fauchte Rick seinen Nebenmann an. »Ich mache drei Wochen Urlaub im besten Hotel auf den Bahamas.«
»Ich kann Sie nicht daran hindern«, sagte Red kalt. »Auf eigene Kosten können Sie machen, was Sie wollen. Wir bezahlen nichts, und Sie haben nichts gewonnen. Ich wiederhole es. Wir wollten Sie aus London offiziell wegschaffen. Die Gegenseite denkt jetzt, Sie wären drei Wochen lang auf den Bahamas, während Sie in London für uns ermitteln. Dieser Flug dient nur der Tarnung.«
»Ihr Plan besteht nur aus Denkfehlern«, wandte Rick ein. »Mrs. Kent erwartet von mir Ansichtskarten von den Bahamas.«
»Die wird sie erhalten«, versicherte Red. »Sie schreiben sie im Flugzeug auf Vorrat, und ein Vertrauensmann steckt sie in Nassau in den Briefkasten.«
»Sie wird mich im Hotel anrufen«, führte Rick an.
»Das wird sie, aber dort sitzt ebenfalls ein Vertrauensmann, der ihr erklären wird, Sie seien im Moment nicht im Hotel, würden Sie aber zurückrufen. Und das tun Sie dann von London aus.«
»Und wozu das alles?« Rick Masters konnte sich noch nicht an den Gedanken gewöhnen, daß sein Urlaub ins Wasser fiel.
»Unser Land wird von einer feindlichen Macht bedroht«, erklärte Red. Er konnte offen sprechen, da sie allein saßen. Im weiten Umkreis waren die Sitze leer. »Unwichtig, welches Land dahintersteckt. Ein großer Schlag gegen Großbritannien ist geplant. Wir wissen allerdings noch nicht, in welcher Form er stattfinden wird.«
»Wann, wo, wie?« Rick hob die Schultern. »Wollen Sie mir gar keinen Anhaltspunkt geben?«
»Ich kann nicht, weil ich selbst nichts weiß.« Red räusperte sich. »Wir haben einen vertraulichen Hinweis erhalten, daß alles im Londoner Hafen beginnen wird. Daraufhin schleusten wir Beobachter in den Hafen ein. Wir haben jedoch noch nichts herausgefunden.«
»Und ich soll aufdecken, wie ein fremder Geheimdienst gegen unser Land vorgeht?« Rick schüttelte den Kopf. »Ich könnte lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Ich bin Geisterdetektiv! Ich habe nichts mit Spionage und Landesverrat zu tun!«
»Unser Informant, der uns den Tip mit dem Londoner Hafen gab, ist tot«, fügte Red hinzu.
»Das kann mich nicht umstimmen.« Rick sagte es so entschieden, als wäre es sein letztes Wort.
»Er wurde von einem herabfallenden Container erschlagen, Mr. Masters«, erklärte Red.
»Ich bin nicht interessiert«, sagte Rick seufzend.
»Die Polizei hat entschieden, daß es ein Unfall war.« Red räusperte sich wieder. »Ein junger Hafenarbeiter will gesehen haben, wie jemand den Container auf den Informanten warf.«
»Dann war es Mord«, sagte Rick desinteressiert. »Ihr Problem, Red!«
»Die Polizei lehnt offiziell eine weiter Untersuchung ab«, fuhr der Geheimdienstmann fort, »weil die Behauptungen des jungen Hafenarbeiters Paul Tamy verrückt klingen. Ich weiß aber, daß er recht hat. Einer meiner Agenten sah nämlich auch den Mörder und identifizierte ihn.«
»Und wer war es?« erkundigte sich Rick Masters und gähnte absichtlich, um zu zeigen, wie wenig er sich locken ließ.