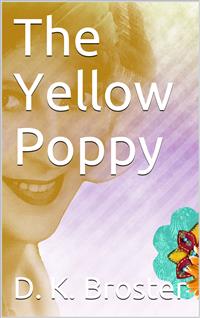0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Neu übersetzt Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der gelbe Mohn von D. K. Broster spielt in der unruhigen Zeit nach der Französischen Revolution und erzählt eine Geschichte voller Leidenschaft, Gefahr und unerwarteter Wiederbegegnungen. Im Zentrum steht das adlige Ehepaar Duc und Duchesse de Trélan, dessen Leben durch die politischen Wirren auseinandergerissen wurde. Der Duc hat die Revolution im Exil in England überlebt, während seine Frau in Frankreich geblieben ist – unter falschem Namen und als treue Verwalterin des einstigen Familienbesitzes, im festen Glauben, ihr Mann sei im Terror gefallen. Als der Duc heimlich nach Frankreich zurückkehrt, um sich einer royalistischen Verschwörung gegen das neue Regime anzuschließen, kreuzen sich ihre Wege erneut. Obwohl die beiden Protagonisten schon lange verheiratet sind, haben sie sich kaum je wirklich gekannt. Der Duc, stolz und unbeugsam, getragen von aristokratischem Ehrgefühl und dem Traum von der alten Ordnung, wagt den gefährlichen Schritt zurück nach Frankreich, entschlossen, das Familienerbe und seine Ehre zurückzugewinnen. Die Duchesse hingegen hat im Verborgenen überlebt: als stille Hüterin des Schlosses, als Frau, die gelernt hat, ihre Stärke hinter Zurückhaltung zu verbergen, getrieben von Pflichtbewusstsein und innerer Würde. Die Begegnung ist von Spannung, Unglauben und tiefen Gefühlen geprägt. Beide müssen sich ihrer Vergangenheit stellen – einer Liebe, die durch Stolz, Pflichtgefühl und politische Überzeugungen auf eine harte Probe gestellt wird. Der Duc ist ein Mann von unbeugsamer Ehre, stolz, entschlossen und getrieben von dem Wunsch, das alte Frankreich zu retten. Die Duchesse dagegen hat gelernt, im Verborgenen zu leben, mutig und selbstlos, ohne Hoffnung auf Anerkennung. Broster schildert ihre innere Stärke mit feiner psychologischer Tiefe: eine Frau, die trotz aller Verluste an ihrer Würde festhält. Im Hintergrund toben Spionage, Verrat und Aufstände – doch im Mittelpunkt stehen die moralischen Entscheidungen, die Liebe und Pflicht gegeneinanderstellen. Der gelbe Mohn, zart und vergänglich, wird zum Sinnbild für das Schicksal der beiden: schön, aber gefährdet, wie die Welt, in der sie leben. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der gelbe Mohn
Inhaltsverzeichnis
Ich liebe dich, habe dich geliebt ... habe dich als Erste und Letzte geliebt, Und werde dich für immer lieben ... ... Ich hätte das gewusst, Nur war ich stolzer, als ich wusste, Und nicht so ehrlich. Ja, und solange ich lebe hätte ich so sterben sollen, diese Rose der Liebe in meiner Hand zerdrückend mit der Wespe darin und allem und meiner Seele und dir gegenüber ignorierend
BUCH I DAS HOCHZEITSGESCHENK
„Und so, mit zerrissenen Fetzen der Hoffnung umgürtet, nahm er sein Leben in die Hand, als ginge es um den Tod (nur zu einem einzigen heldenhaften Ziel fähig),
HINWEIS
Jeder, der die Figur des tapferen und unglücklichen Louis de Frotté kennt, wird verstehen, warum weder er noch die Normandie, die er so gut geführt hat, in diesem Buch vorkommen – nicht, weil er als Vorlage für eine Figur gedient hätte, sondern weil seine Erwähnung den Ruf Bonapartes zu sehr geschmälert hätte. Was dem Ersten Konsul hier vorgeworfen wird, ist aber keine Verleumdung, denn die Taten, die Mitte Februar 1800 in Alençon und Verneuil passiert sind, sind in der Geschichte festgehalten.
KAPITEL I „WAS IST MIRABEL?“
„Ich wünschte, mir hätte jemand gezeigt, wie man ein Bett macht!“, meckerte Roland de Céligny, während er im Halbdunkel des Dachbodens mit seiner Decke rumkämpfte.
„Du kannst dich glücklich schätzen, dass du ein Bett machen kannst!“, gab ein Kumpel zurück, der mit gekreuzten Beinen auf einem Sackhaufen neben ihm saß. „Meins kann man nicht ‚machen‘, obwohl eine unachtsame Bewegung es in seine Einzelteile zerlegt.“
„Verdammt! Wenn ich die Decke auf dieser Seite einstecke, reicht sie nicht bis zur anderen Seite!“, fuhr der junge Nörgler fort und demonstrierte eindringlich die Richtigkeit seiner Behauptung, während er neben einer direkt auf dem Boden liegenden Matratze kniete.
„Daraus, mein Freund, kannst du lernen, dass die Gaben des Schicksals gleichmäßig verteilt sind“, erwiderte der auf dem Sackhaufen. Da einer seiner Arme in einer Schlinge lag, wäre er wahrscheinlich nicht einmal zu den erfolglosen Anstrengungen des Vicomte de Céligny in der Lage gewesen, aber das sagte er nicht. Im Gegenteil, er sah die Leistung seines Freundes mit der Miene eines Menschen an, der jeden Moment sagen würde: „Lass mich das machen!“
„Wenn du nur weniger nehmen würdest ...“, fing er an.
„Seid doch bitte still, ihr beiden!“, bat eine dritte Stimme. „Bei eurem Geplapper kann man weder zählen noch nachdenken ... Zwei Majore ...“
Der Besitzer dieser Stimme, ein Mann von etwa fünfundvierzig oder fünfzig Jahren, saß an einem Tisch in einer Ecke und spielte bei Kerzenlicht mit einem anderen Piquet. Es gibt keinen Grund, warum man nicht Piquet spielen sollte, selbst wenn man ein Chouan-Offizier im späten April des Jahres 1799 ist – oder, wenn man es vorzieht, was in diesem Fall unwahrscheinlich ist, im Floréal des Jahres VII der Republik – und du versteckst dich oben in einem alten Haus in Hennebont in der Bretagne mit einem Verband um den Kopf und einem Schmerz darin, der ein wenig Ungeduld gegenüber Lärm durchaus rechtfertigen kann. Wenn dein Partner sich außerdem weigert, um Geld zu spielen, wird das Spiel so harmlos, dass es fast schon verdienstvoll ist.
Auf die Bitte des Piquet-Spielers – der zufällig sein Vorgesetzter war – antwortete der verwundete Kritiker des Plünderers nur mit einer Grimasse. Die Zeit, die der sehr gut aussehende junge Mann, der damit beschäftigt war, für das Bettenmachen gewählt hatte, war nicht, wie man vermuten könnte, eine Morgenstunde, sondern im Gegenteil neun Uhr abends. Zwei Kerzen, die in Flaschenhälsen steckten, gaben den Kartenspielern das nötige Licht; eine weitere, die auf einer heruntergekommenen Kommode stand, beleuchtete das Buch, das ein dritter junger Mann, der rittlings auf einem Stuhl saß, auf dessen Rücken gelehnt hatte und in das er vertieft zu sein schien.
Der so spärlich beleuchtete Dachboden war geräumig und voller seltsamer Ecken, aber vollgestellt mit Tischen, Stühlen und Schränken, denn es war das oberste Stockwerk eines Möbelhändlers, wo er seine alten oder unmodernen Waren lagerte, von denen viele übereinander gestapelt waren, um mehr Platz zu schaffen, und wo zwei oder drei riesige alte Kleiderschränke, die wie dunkle, schattige Felsen aus den Wänden ragten, den verfügbaren Platz noch weiter einschränkten. Doch obwohl es offensichtlich ein Zufluchtsort war, war es auch ein Treffpunkt.
In diesem Frühjahr 1799 verlängerte das grausame und unfähige Direktorium noch immer seine entehrte Existenz, und nach zehn Jahren der Qual war das französische Volk immer noch versklavt – nun nicht mehr von einer Monarchie, sondern von einer Oligarchie. Die Freiheit, die so lange vor ihren Augen baumelte, die Freiheit, in deren Namen so viele schreckliche Verbrechen begangen worden waren, schien weiter entfernt denn je. Träge und erschöpft, geplagt von politischer Korruption, mit fast ruiniertem Ansehen und Handel, nur noch ein Schatten seiner selbst, sehnte sich Frankreich nach einem Herrscher, den es sich selbst nicht geben konnte, nach einem Mann, der seine neuen Tyrannen stürzen und es wieder zu seiner vollen Größe erheben würde. Und für die meisten Menschen im Westen, dieser Heimat der Loyalität, kam nur ein Herrscher in Frage, und das war Ludwig XVIII., der König, der nie regiert hatte.
Außerdem gab es im Westen zu dieser Zeit Anzeichen für ein Wiederaufleben der Chouannerie, dieser sporadischen Guerillakämpfe mit stark royalistischer und katholischer Prägung, die seit dem Scheitern der großen Vendée-Bewegung im Jahr 1793 in der Bretagne, in Anjou und in Maine zu Hause waren – unter Verfolgung. Sie war zwar vor drei Jahren durch die Befriedung vorübergehend ausgerottet worden, aber diese Befriedung hatte die Royalisten der Bretagne und der benachbarten Departements in eine Lage gebracht, die sich allmählich als unerträglich erwies. Sie befanden sich nicht im Krieg, lebten aber in ständiger Gefahr, keiner von ihnen war sich seiner Freiheit oder gar seines Lebens sicher. Nach dem skandalösen Staatsstreich von Fructidor 97 war die versprochene Religionsfreiheit nur noch ein leerer Begriff, und die politische Freiheit, vor allem in den westlichen Departements, deren Wahlen so zynisch annulliert worden waren, war eine reine Farce. Es kam schließlich sogar so weit, dass der Polizeiminister empfehlen konnte, die Royalisten dieser Regionen notfalls „verschwinden zu lassen”; unverhohlene Tyrannei hatte die Unterdrückung abgelöst.
Es war also klar, dass 1798 die Chouans wieder auftauchten. Zuerst raubten sie nur Kuriere und Postkutschen mit öffentlichen Geldern aus. Aber diese nicht sehr rühmliche Tätigkeit war nur die Oberfläche; darunter, meist in den Händen von Gentlemen, wurde heimlich daran gearbeitet, diese unbeugsamen und hartnäckigen Bauern, die zugleich fromm und grausam waren, zu organisieren und das Banditentum in einen echten Krieg zu verwandeln; und so konnte man im ganzen Westen wandernde royalistische Anführer mit ihren kleinen Stäben antreffen, die sich bemühten, die einst gekämpften Chouans kampfbereit zu halten und neue Freiwillige zu rekrutieren und zu bewaffnen. Zu einer solchen Bande, angeführt vom Marquis de Kersaint, einem Emigranten, der sich im österreichischen Dienst ausgezeichnet hatte und vor kurzem aus England gekommen war, gehörten diese fünf Männer auf dem Dachboden des Möbelhändlers.
Sie waren gerade nicht in einer besonders beneidenswerten Lage, denn nicht nur waren zwei von ihnen verletzt, sondern sie und ihre Handvoll Bauern – die inzwischen verstreut waren – hatten gestern bei einem unerwarteten Zusammenstoß mit Regierungstruppen im benachbarten Departement Finistère den Kürzeren gezogen, und außerdem machten sie sich jetzt Sorgen um die Sicherheit ihres Anführers, der mit einem Führer einen Umweg nach Hennebont genommen hatte, um bestimmte Informationen zu sammeln. Seine Anwesenheit hier war dringend erforderlich, da seit langem vereinbart war, dass er und seine beiden älteren Untergebenen sich in Hennebont mit Georges Cadoudal, dem berühmten Bauernführer aus dem Morbihan, treffen und beraten sollten, um die wildere und westlichere Region Finistère besser zu organisieren, die, wie man flüsterte, Herr de Kersaint schließlich vollständig befehligen sollte. Das Unglück vom Vortag hatte ein solches Treffen nicht weniger, sondern noch notwendiger gemacht; und so befanden sich die Offiziere von Herr de Kersaint, die das Glück gehabt hatten, in der Dämmerung unbemerkt in die kleine Stadt zu schlüpfen, hier, halb auf der Flucht. Aber jetzt gab es Gerüchte über eine mobile Kolonne auf der Straße, die ihr Anführer wahrscheinlich nehmen würde; und auf jeden Fall bestand immer Gefahr – eine Gefahr, die die drei jungen Männer, die eine Art Leibwache aus Adjutanten für ihn bildeten, für geringer gehalten hätten, wenn sie seine Odyssee mitgemacht hätten. Aber Herr de Kersaint hatte offenbar anders gedacht.
* * * * *
Das Kartenspiel in der Ecke war endlich zu Ende, und die Gegner zählten ihre Punkte zusammen.
„Sie haben gewonnen, Comte“, sagte der Gegner des bandagierten Spielers und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Das Kerzenlicht, das die etwas strengen Gesichtszüge seines Begleiters hervorhob, beleuchtete in seinem Fall ein unscheinbares rundes Gesicht ohne auffällige Merkmale. Aufgrund dessen und seiner bäuerlichen Kleidung hätte er gut ein Kleinbauer sein können; andererseits passten die bunt bestickte bretonische Weste und der kurze Mantel weniger gut zu ihm, der als „Comte“ angesprochen wurde.
„Ja, ich denke schon“, antwortete dieser. Er zog seine Uhr heraus und runzelte die Stirn. „Sie sollten eigentlich schon hier sein“, bemerkte er.
„Ich bezweifle, dass es draußen schon dunkel genug ist“, antwortete sein ehemaliger Gegner. „Le Blé-aux-Champs würde es kaum riskieren, Herr de Kersaint nach Hennebont zu bringen, solange es noch hell ist.“
„Ich wünschte, er wäre nicht nach Scaër gefahren“, murmelte der andere.
„Du glaubst doch nicht, dass dem Marquis was zugestoßen ist, oder?“, fragte Roland de Céligny.
„Nein“, antwortete der Stellvertreter von Herr de Kersaint. „Ich will nicht an Unglück glauben, denn das würde es nur heraufbeschwören.“
„Vielleicht sind sie es“, meinte Artamène de la Vergne, der junge Mann mit dem Arm in einer Schlinge, als Schritte auf der hallenden Treppe zu hören waren. Selbst der stille Leser hob den Kopf von seinem Buch, um zu lauschen.
Aber die Spannung, die darauf folgte, wurde nicht geringer, als sich die Tür öffnete und der alte Herr Charlot, der Möbelhändler, selbst mit einer Kerze in der Hand und einer getönten Brille auf der Nase in der Tür erschien. In erwartungsvoller Stille kam er herein und schloss die Tür vorsichtig hinter sich, während fünf Paar Augen ihn unruhig anstarrten.
„Meine Herren“, begann er mit vorsichtiger Stimme und blickte auf die Gestalten, die sich zwischen seinen schattenhaften Möbeln versteckt hatten, „ist einer von Ihnen ein Priester?“
Der zweite Piquet-Spieler beugte sich vor. „Ja, das bin ich“, gab er überraschenderweise zu. „Brauchen Sie mich?“
„Nebenan liegt eine alte Dame sehr krank, Herr l’Abbé, eine gewisse Fräulein Magny, die seit vielen Jahren eine geachtete Bewohnerin dieser Stadt ist. Es geht nicht darum, dass sie einen Beichtvater oder die Letzten Sakramente bräuchte – die hat sie vor zwei oder drei Tagen bereits empfangen –, sondern darum, dass sie heute Nacht so sehr im Delirium ist, dass ihre Nichte, die sich um sie kümmert, eben ganz aufgelöst zu mir kam. Die alte Dame scheint etwas auf dem Herzen zu haben, und Frau Leclerc meinte, wenn man einen Priester holen könnte, einen insermenté natürlich——“
Der Abbé, der so gar nicht wie ein Abbé aussah, unterbrach ihn. „Ich bin bereit, zu ihr zu gehen, Herr Charlot, wenn es nötig ist, aber ich hätte gedacht, dass die Verwandten der armen Dame, anstatt einen Fremden zu rufen, sich an den Priester gewandt hätten, der ihr neulich die Beichte abgenommen hat.“
„Ja, mon père“, antwortete der alte Mann, „aber Sie sehen, er lebt seit Fructidor sehr zurückgezogen außerhalb der Stadt, und es ist immer ein gewisses Risiko für ihn, hierher zu kommen, und da Sie vor Ort waren und hier nicht als Priester bekannt sind ...“
Das Wort „Risiko“ schien die Frage entschieden zu haben, denn daraufhin stand der Abbé in Bauernkleidung auf.
„Ich komme sofort“, sagte er ohne Umschweife und ging um eine Barriere aus umgedrehten Stühlen herum.
„Das ist sehr nett von Ihnen, Euer Ehrwürdigkeit“, sagte Herr Charlot erleichtert und ging zur Tür. „Die arme Frau war zu ihrer Zeit eine ausgezeichnete Christin und auch ziemlich schlau, aber jetzt liegt sie da, wie ihre Nichte sagt, und redet ständig von einem Ort – oder vielleicht einer Person – namens Mirabel und von einer Hochzeit. Und nichts ...“
„Mirabel!“ , rief der Abbé aus und blieb stehen.
„Oh, Herr l'Abbé!“, rief Herr Charlot, beeindruckt von seinem Tonfall, „wenn du etwas über dieses Mirabel weißt, dann hat dich der liebe Gott sicher zu dieser armen Seele geschickt! Ich bringe dich sofort dorthin.“
Er öffnete dem Priester die Tür, der ohne ein weiteres Wort hinausging. Keiner der drei jungen Männer, die diese beiden Protagonisten beobachteten, bemerkte, dass auch der verwundete Piquet-Spieler bei der Erwähnung des Namens, der seinen Begleiter so bewegt hatte, abrupt von seinem Platz aufgestanden war, ihnen ein oder zwei Sekunden lang nachgestarrt hatte und sich nun mit einer verzweifelten Geste wieder in seinen Stuhl fallen ließ und seinen bandagierten Kopf in die Hände nahm.
„Jetzt hat der Abbé eine Aufgabe, die ihn beschäftigt“, sagte Artamène de la Vergne mit schläfriger Stimme. „Ich wünschte, ich hätte auch eine; oder dass Herr de Kersaint und Le Blé-aux-Champs schnell eintreffen würden, damit ich schlafen gehen könnte, ohne damit rechnen zu müssen, sofort wieder geweckt zu werden.“
„Ein echter Kämpfer kann jederzeit und so lange schlafen, wie er will“, meinte Roland selbstzufrieden. „Es ist noch früh, zumindest denke ich das. Meine Uhr ist stehen geblieben.“
„Und meine ist weg“, antwortete der Chevalier de la Vergne. „Lucien hat bestimmt seine dabei, und die geht bestimmt richtig. Frag ihn, wie spät es ist.“
„Lucien!“, sagte Roland. Keine Antwort vom Leser.
„Lucien, du taube Schlange!“, fügte Artamène hinzu.
„Ich glaube, er schläft“, murmelte der Vicomte de Céligny, und mit einer schlangenartigen Verlängerung seines Körpers und Arms gelang es ihm, ein Bein des Stuhls des Studenten zu erreichen und daran zu rütteln.
„Ich wünschte, du würdest schlafen!“, rief sein Opfer und hob sein leicht genervtes Gesicht. „Was in aller Welt willst du?“
„Die Uhrzeit, lieber Freund.“
Lucien du Boisfossé zog die Uhr aus seiner Uhrenkette. „Viertel nach – nein, siebzehn Minuten nach neun.“
„Was liest du da?“, fragte Artamène.
„Die Aeneis von Vergil“, antwortete Lucien und richtete seinen Blick wieder auf die Seite.
Der Fragende stieß einen fast entsetzten Ausruf aus. „Bei den Göttern! Er liest Latein – zum Vergnügen!“
„Viertel nach neun“, bemerkte Roland nachdenklich. „Gestern um diese Zeit war ich ...“
„Rede nicht so viel, Roland le preux! Du störst unseren Lateinisten ... und außerdem“, fügte Artamène mit leiserer Stimme hinzu, „läufst du Gefahr, die Gedanken von Herr de Brencourt zu stören. Schau ihn dir an!“
Der bandagierte Piquet-Spieler, der immer noch am Tisch saß, schien tatsächlich in tiefe Gedanken versunken zu sein und ließ die Karten eine nach der anderen aus seinen Fingern fallen. Es war offensichtlich, dass er nicht wusste, was er tat.
„Ich wette, er denkt an eine Frau“, flüsterte Artamène und rückte näher an seinen Freund heran. „Das scheint eine beruhigende Beschäftigung zu sein; denken wir doch auch an eine! Aber an wen soll ich meine Gedanken richten ... und du, Roland?“
Ein leichtes Erröten, das im schlechten Licht nicht zu sehen war, überzog die Wangen des jungen de Céligny, als er mit einer Spur von Verlegenheit antwortete: „Ich werde an die arme alte Dame von nebenan denken. Glaubst du, der Abbé wird sie von dem Bann befreien ... wie hieß das noch – Mirabel? Und übrigens, was ist Mirabel?“
„Der Name einer Pflaumensorte, Ignorant“, antwortete Lucien du Boisfossé unerwartet. Während er sprach, gähnte er.
„Offensichtlich hat unser Lucien auch die Georgica studiert“, kommentierte Artamène.
„Eine Enzyklopädie wäre passender!“, entgegnete Roland. Und mit lauter Stimme fragte er: „Comte, was ist Mirabel?“
Der ältere Mann hörte ihn, sogar mit einem kleinen Schreck. Er legte die Karten beiseite und kam aus seinen Gedanken zurück.
„Mirabel, meine Herren, ist der Name eines Anwesens und Schlosses in der Nähe von Paris, das für François I. erbaut wurde. Vielleicht haben Sie schon davon gehört. Es gehört oder gehörte dem Duc de Trélan.“
„Trélan“, meinte der junge Chevalier de la Vergne nachdenklich. „Ich glaube, ich erinnere mich an diesen Namen im Zusammenhang mit den Massakern in den Gefängnissen im September 1792. Er wurde dabei getötet, glaube ich?“
„Nein“, antwortete der Comte de Brencourt düster. „Er war nie im Gefängnis. Er war emigriert. Es war seine Frau, die ermordet wurde – zusammen mit Frau de Lamballe.“
„Morbleu!“, rief Artamène aus. „Und der Duc lebt also noch?“
„Ich glaube schon“, antwortete Herr de Brencourt noch düsterer.
„Wo ist er jetzt?“, fragte Roland.
„Irgendwo im Ausland – in England oder Deutschland.“
„Schlimmer als tot zu sein!“, meinte Artamène, legte sich hin und zog die Decke über sich.
KAPITEL II DAS GESCHENK WIRD ANGEBOTEN
Und nebenan, in einem ordentlichen, aber überfüllten Schlafzimmer, saß Abbé Chassin, ohne irgendwelche Zeichen seines Amtes, und hörte dem Geschwätz einer alten Jungfer zu, die ein ereignisloses und einzigartig respektables Leben als Botin des Schicksals für nicht wenige Menschen beenden sollte.
Die schweren Vorhänge waren zur Seite gezogen worden, vom kleinen Himmelbett, an dem der Priester saß, und das Kerzenlicht fiel sanft und gleichmäßig auf das alte, alte gebleichte Gesicht unter der ordentlichen Spitzenhaube, die kaum weißer war als das Antlitz, das sie umrahmte. Auf dem wächsernen Antlitz, das alle Zeichen des nahenden Todes trug, lag der Ausdruck jener Herrschsucht, die mitunter im Alter auf eine bestimmte Art alter Damen herabzusteigen pflegt. Und Fräulein Magny sprach, sprach unaufhörlich und kläglich, die Augen starr, die verschrumpelten Finger nestelten und zupften am Rand des Lakens in jener letzten, tödlichen Unruhe. Diese Hände waren das Einzige, was sich noch bewegte.
„Ich hätte es bereit haben sollen ... aber ich wusste es nicht rechtzeitig, ich wusste es nicht! All die Jahre hatte ich es in der Familie und wusste nicht, dass es da war! Aber vielleicht schaffe ich es doch noch rechtzeitig – sie können doch noch nicht aus der Kapelle zurückgekommen sein. Aber ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen! ... Und wenn die Braut die Schwertknoten und Fächer an alle Anwesenden verteilt, werde ich dem jungen Herzog mein Geschenk überreichen. Aber ich muss mich beeilen ...“
Und die verwelkten Hände ließen das Laken los und begannen, über das Bett zu tasten, als suchten sie etwas.
Der Abbé beugte sich vor und legte eine seiner Hände sanft auf die näher gelegene.
„Kann ich dir nicht helfen, meine Tochter – kann ich nicht etwas für dich tun?“
Die Augen drehten sich für einen Moment; das Gehirn, obwohl tief in die Vergangenheit versunken, schien diese Einmischung aus der Gegenwart zu begreifen, sogar die pastorale Ansprache.
„Du bist Priester, Herr? Das ist gut – das ist gut! Ja, du kannst diesen Kasten für mich öffnen“, und sie tat so, als würde sie ihn festhalten. „Und darin findest du das Hochzeitsgeschenk für den jungen Duc de Trélan – aber du musst dich beeilen, beeilen! Sie werden bald aus der Kapelle zurück sein! ... Ach, ich kann den Schlüssel nicht finden – ich kann das Schloss nicht aufschließen! Mein Gott, wenn ich doch zu spät komme! Mon père, mon père, hilf mir! ... Aber, mon père, du machst doch gar nichts!“
Der Abbé schaute sich verzweifelt um. Er konnte unter den kleinen Schätzen im Zimmer der alten Dame, den Nadelkissen, den Andachtsbildern, der ganzen sittsamen Sammlung eines untadeligen Lebens, nichts entdecken, was auch nur annähernd einem verschlossenen Kästchen ähnelte. Aber schon nach einem Augenblick war der Kampf mit dem imaginären Schloss vorbei, und als sich die müden Hände entspannten, huschte ein Lächeln über Fräulein Magnys eingefallenen Mund.
„Wie gut er aussieht, Monseigneur Gaston!“, sagte sie bewundernd. „Meine liebe Dame wird heute stolz auf ihn sein! Nach der Hochzeit werden sie heute Abend tanzen, und ich werde alles sehen, wie meine Dame es wünscht. Aber keine der vornehmen Damen dort wird der Braut ein so schönes Geschenk machen wie ich dem Bräutigam, obwohl ich nur die Zofe seiner lieben Mutter bin ... Aber warum bringt der Abbé es mir nicht? Wenn die Braut die Schwertknoten und die Fächer verteilt ...“
„Frau“, unterbrach der Priester sie sanft, „wenn Sie mir sagen, wo Ihr Geschenk ist, werde ich es Ihnen sofort bringen.“
Ein verschmitzter Ausdruck huschte über das Gesicht der sterbenden alten Frau, und ein leises Geräusch, das wie ein Kichern klang, kam über ihre Lippen.
„Ach nein, ich habe es gut versteckt!“, antwortete sie unerwartet, „fast so sicher wie den Schatz von Mirabel selbst. Du wirst es nicht so schnell finden, Clotilde!“
Wer war Clotilde, fragte sich der Priester? Wahrscheinlich die Nichte, mit der sie zusammenlebte. Aber was hatte es mit diesem „Schatz“ in Mirabel auf sich?
„Man stelle sich vor“, fuhr die alte Stimme sinnend fort, „dass das kostbare Dokument all die Jahre im Speisezimmer von Vetter François lag – und all die Jahrzehnte davor, seit der Zeit, da es gestohlen wurde. Und all die längst dahingegangenen Herzoginnen hätten die Rubine tragen können. Ich hätte das Collier um den Hals meiner seligen Dame legen können. Nun wird die neue Herzogin die Erste sein, die es um ihren hübschen Hals legt.“
Der Priester zitterte ein wenig. Immer noch diese Hochzeit vor achtundzwanzig Jahren! ... Seitdem hatte der hübsche Hals, von dem sie sprach, eine ganz andere Halskette getragen ... aber in derselben Farbe ...
„Aber wenn Sie die Rubine versteckt haben, Frau“, wagte er zu sagen, verwirrt zwischen dem „Schatz“ und dem „Papier“, dem „Geschenk“ und dem, was verborgen war, „können Sie sie der Braut nicht geben.“
„Ich habe sie nicht versteckt!“, antwortete Fräulein Magny ungeduldig. „Es war der erste Herzog, zu Zeiten Mazarins, der einen großen Vorrat an Geld und Juwelen in Mirabel versteckt hat. Und niemand hat sie jemals wiedergefunden. Gestohlen ... versteckt ... versteckt ... gestohlen ... sie sind ein wunderschönes Paar, und wenn Monseigneur de Paris sie getraut hat und die Hochzeitsmesse vorbei ist ...“
Eine lange Pause. Dann flüsterte die alte Dame: „Sainte Vierge, wie müde ich bin!“ und faltete die Hände vor der Brust. Der Abbé stand auf und beugte sich über sie. Ihre Augen waren geschlossen, und er hörte sie undeutlich murmeln: „Mater amabilis, virgo prudentissima, gewähre mir, bald meine heilige Dame zu sehen!“
So kurz vor der Enthüllung eines so wichtigen, so lange verborgenen Geheimnisses zu stehen – zu spät, um noch etwas damit anzufangen ... und doch vielleicht doch nicht zu spät – und gerade im Moment der Entdeckung ausgebremst zu werden! Dass ausgerechnet ihn, von allen Menschen auf der Welt, eine so außergewöhnliche Fügung an dieses Bett geführt hatte, nur damit die Besitzerin das Geheimnis ungelüftet mit ins Grab nahm! Das war hart!
Doch da Herr Chassin ein Priester war, schob er alle Reue beiseite und bemühte sich, nur an das Seelenheil der Sterbenden zu denken, die im Begriff stand, durch das große Tor zu schreiten. Fräulein Magny hatte die letzten Sakramente empfangen, das wusste er. War nun der Moment für das Gebet der Empfehlung gekommen? Er legte behutsam die Finger an ihr Handgelenk. Doch der Puls, wenn auch schwach und unregelmäßig, war noch nicht am Erlöschen. Und langsam, als hätte seine Berührung sie geweckt, öffnete die alte Dame erneut die Augen. Der Blick darin war verändert; als er ihm begegnete, wusste der Priester, dass sie nicht länger in den Nebeln von vor beinahe dreißig Jahren umherirrte. Sie war in die Gegenwart zurückgekehrt – so sehr sogar, dass sie fähig war, sich über den Anblick dieses unbekannten Mannes in bäuerlicher Kleidung, der sich über sie beugte, zu wundern – ja, ihn sogar zu missbilligen.
„Wer bist du, Herr, und ... was ... was machst du hier?“, fragte sie mit einer Stimme, die zwar kaum mehr als ein leises Flüstern war, aber dennoch etwas von der Herrschaftlichkeit vermittelte, die in ihrem Gesicht geschrieben stand.
„Ich bin Priester, Frau, ein insermenté, und Herr Charlot, Ihr Nachbar, hat mich auf Wunsch Ihrer Nichte hierher gebracht.“
„Clotilde nimmt sich immer zu viel vor“, sagte eine leise Stimme in einem unzufriedenen Tonfall. „Ich habe bereits die letzte Ölung erhalten.“
„Ja, Frau“, stimmte Herr Chassin zu, da ihm bewusst wurde, dass das Wiedererlangen des Bewusstseins durch Fräulein Magny ihn nicht wesentlich weiterbrachte. „Ich bin nicht gekommen, um Ihnen Arznei zu verabreichen.“
Ihr Blick fragte ihn, was sein Anliegen sei.
„Weil du, meine Tochter, von Mirabel gesprochen hast.“
„Unsinn!“, erwiderte Fräulein Magny ziemlich scharf. „Ich habe nicht die Angewohnheit, mit Fremden über mein früheres Leben zu sprechen!“
„Sie waren krank, Frau“, sagte der Priester sanft. „Und hat Mirabel nicht auch etwas mit Ihrem gegenwärtigen Leben zu tun?“ Da er ein Mann war, der zu warten wusste, setzte er sich wieder neben sie und nutzte diese Fähigkeit.
„Habe ich mich verirrt?“, fragte die sterbende Frau und wandte plötzlich ihren Blick ihm zu.
„Ein wenig, ja.“
„Ich war sehr krank ... und man sagt mir, dass ich nicht mehr gesund werde ... Ist das so, Vater?“
„Das ist es, was mir gesagt wurde, meine Tochter. Aber du hast deinen Frieden mit Gott gemacht.“
„Ja“, sagte sie. „Aber es gibt noch etwas, das ich tun möchte ... bevor ich sterbe ... doch Gott weiß, wie ich es tun soll.“
Der Priester beugte sich vor. „Gott weiß es in der Tat, meine Tochter, und zweifellos war er es, der mich heute hierher geschickt hat. Du möchtest dem Herzog von Trélan ein Dokument übergeben, das sich jetzt in deinem Besitz befindet und einen Schatz betrifft, der seit vielen Jahren in seinem Schloss Mirabel versteckt ist.“
Eine Röte stieg in das elfenbeinfarbene Gesicht. „Ich habe darüber gesprochen?“
„Darüber – und über eine Hochzeit in Mirabel.“
Fräulein Magny legte zitternd eine Hand über die Augen. „Verzeihen Sie mir, ich bitte Sie! … All die Jahre kann ich es nicht vergessen – die Lichter, die Juwelen, die Schönheit dieses Paares, das Glück meiner Herrin. Denn ich war viele Jahre lang Kammerfrau, mon père, der Herzogin Eléonore, der verwitweten Herzogin, einer Heiligen auf Erden. Gott habe sie selig! Sie lebte nur kurze Zeit nach der Vermählung ihres Sohnes.“
Der Priester nickte, als wüsste er bereits Bescheid. „Auch ich habe Grund zu sagen: ‚Gott gebe ihr Frieden!‘ – Und das Papier, von dem du gesprochen hast?“
„Welches Papier?“, fragte die alte Stimme, plötzlich wieder misstrauisch.
„Das Papier, das das Geheimnis des in Mirabel zu Mazarins Zeiten versteckten Schatzes enthält, das in Ihre Hände gelangt ist, Frau, und das Sie dem Duc de Trélan vor so vielen Jahren an seinem Hochzeitstag gerne gegeben hätten.“
Es herrschte Stille am Bett. „Nun“, sagte die alte Dame schließlich mit mehr Lebhaftigkeit, „wenn ich dir das alles erzählt habe, kann ich dir auch den Rest erzählen.“
Und langsam, mit Pausen zum Atemholen, erzählte sie ihm, wie der Herzog von Trélan zur Zeit Mazarins, verwickelt in die Rebellion der Fronde und unsicher, welche Partei in jenem Kaleidoskop des Bürgerkriegs schließlich obsiegen würde, Gold und Juwelen in seinem einst königlichen Schloss Mirabel vergraben und eine Notiz über das Versteck für seinen Sohn hinterlassen hatte, der damals mit Condé im Felde stand. Der Herzog selbst musste vor Mazarins Rache fliehen und starb im Exil; Mirabel wurde eine Zeit lang konfisziert, und als der nächste Herzog wieder eingesetzt wurde, war der Schatz unauffindbar. Die Notiz über das Versteck war vom Verwalter des verstorbenen Herzogs gestohlen worden, der sie dem Nachfolger im Titel für eine hohe Summe zum Kauf anbot. Dieser, argwöhnisch, witterte einen Schwindel und lehnte ab; doch, wie es für einen großen Adeligen jener Tage nicht schwer war, erwirkte er eine lettre de cachet gegen den Übeltäter, der den Rest seines Lebens im Gefängnis fristete. Vor seiner Verhaftung jedoch hatte er die Notiz einem Freund anvertraut; doch dieser Freund unternahm nie etwas, um sie zu nutzen, sondern bewahrte sie lediglich auf eine Weise, die sie de facto unauffindbar machte – er klebte das Pergament, mit der Schriftseite nach unten, auf die Rückseite des Porträts seiner Frau. Wahrscheinlich, sagte die alte Dame, habe er gewartet, bis der Mann, der ihm das Dokument anvertraut hatte, aus dem Gefängnis entlassen würde; doch der Verwalter kam nie frei, und kurz vor dessen Tod in der Gefangenschaft starb auch sein Freund, Fräulein Magnys Ururgroßvater. Und dort, auf die Rückseite des Bildnisses einer wohlgenährten bürgerlichen Dame aus der Zeit Ludwigs XIII. geklebt, hatte das Pergament fast hundertfünfzig Jahre lang überdauert – bis vor etwa zwei Jahren, als das Porträt nach dem Tod von Cousin François in Fräulein Magnys Besitz überging, und die alte Dame selbst bei dessen Untersuchung auf das Pergament stieß und erkannte, zu welch bitterer Ironie das Schicksal fähig war.
„Ach, hätte ich es doch nur früher gehabt!“, schloss sie wehmütig. „Was für ein Geschenk für meine heilige Dame, die manchmal knapp bei Kasse war für ihre Wohltätigkeitszwecke, da sowohl ihr Mann als auch ihr Sohn, wie alle Saint-Chamans, ihr Vermögen großzügig ausgaben. Und jetzt, wo ich es seit zwei Jahren habe, ist es nutzlos! Wo ist der Duc de Trélan jetzt? Leider wissen wir, wohin seine Frau, die Duchesse Valentine, gegangen ist! ... Und was ist Mirabel heute?“
„Nein, Frau“, sagte der Priester, als die Stimme erschöpft verstummte, „vor zwei Jahren hätten Sie nichts tun können. Aber heute, da der Himmel es so gewollt hat, können Sie dieses Papier dem Duc de Trélan geben, wenn Sie wollen.“
Sie wandte ihre eingefallenen Augen wieder ihm zu. Der Glanz war bereits verblasst.
„Und wie kommt das, wenn ich fragen darf?“
„Weil ich ... in engem Kontakt mit dem Duc stehe. Wenn Sie mir das Papier anvertrauen, wird er es bekommen, bevor – bevor ich viele Tage älter bin.“
„Aber – wenn er noch lebt – ist er ein Emigrant ... seit vielen Jahren ein Emigrant!“, wandte Fräulein Magny ungläubig ein.
„Trotzdem stehe ich in engem Kontakt mit ihm.“
Die schwachen Augen der kranken Frau suchten sein Gesicht ab – dieses gewöhnliche Gesicht, das weder Gutes noch Böses ausdrückte. Es war schwer zu deuten.
„Ich habe nur Ihr Wort dafür“, sagte sie, während Misstrauen und der sehnsüchtige Wunsch, ihm zu vertrauen, in ihrem Blick und Tonfall miteinander rangen.
Der Priester griff in eine Tasche seiner bestickten Weste und zog einen kunstvoll gearbeiteten Rosenkranz aus Ebenholz und Silber hervor. Er nahm eine der silbernen Paternoster-Perlen zwischen Finger und Daumen, beugte sich über Fräulein Magny und hielt sie dicht vor ihre Augen. „Können Sie erkennen, was auf dieser Perle eingraviert ist, Frau? Es ist kein heiliges Symbol.“
Die alte Dame hob ihre schwache Hand und versuchte, seine ein wenig weiter wegzuschieben. „Sie halten ihn zu nah, mon père“, sagte sie gereizt. „So blind bin ich nun auch wieder nicht ... Es sieht aus wie ... es ist sehr abgenutzt ... aber es sieht aus wie eine Art Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Was macht das auf einem Rosenkranz? Ist es auch auf den anderen Perlen?“
Er zeigte es ihr. „Victor, Kardinal de Trélan, scheint zu Beginn des Jahrhunderts eine seltsame Vorliebe für sein Familienwappen auf seinem Rosenkranz gehabt zu haben. Auf einer Perle ist sein Monogramm zu sehen. Dieser Vogel, Frau, ist der Trélan-Phönix, und der derzeitige Herzog schenkte mir diesen alten Rosenkranz bei meiner Priesterweihe.“
Sofort ergriff sie seine Hand. „Der Trélan-Phönix! Lass mich noch einmal schauen! Ja, das ist er, das ist er! Ah, ihn nach all den Jahren noch einmal zu sehen!“ Und als der Priester den Rosenkranz losließ, legte die Kammerzofe der Herzogin Eléonore ihn fast schluchzend an ihre Lippen.
Der Abbé wartete, und nach einem Moment wandte sie sich mit feuchten Augen zu ihm um und sagte verwirrt: „Aber ... aber ... ich glaube mich zu erinnern ... Weihe ... der Rosenkranz des Kardinals ... er wurde doch sicher dem Pflegebruder des jungen Herzogs gegeben, einem bretonischen Bauern, den ich nie gesehen habe ... als er die Weihe empfing?“
„Sie erinnern sich ganz richtig, Frau. Und ich bin dieser Pflegebruder, dieser bretonische Bauer, Pierre Chassin.“
Hätte er sich plötzlich als Ludwig XVIII. oder der Comte d'Artois zu erkennen gegeben, hätte die hingebungsvolle alte Jungfer kaum mehr Emotionen zeigen können.
„Gott sei gepriesen! Gott sei gepriesen für diese Gnade!“, sagte sie mit zitternder Stimme. „Sein Pflegebruder! Ja, ich erinnere mich, dass meine Herrin mir alles über deine Mutter erzählt hat. Sechs Jahre bevor ich in ihren Dienst trat, war es ...“
„– In Erinnerung daran, Frau, was auch ich Ihrer Frau seligen Angedenkens und dem Duc zu verdanken habe, der mich, wie Sie wahrscheinlich wissen, ausbilden ließ und mir eine Pfarrei auf seinen Ländereien im Süden gab, können Sie mir doch das Dokument anvertrauen, oder?“
„Ja, natürlich!“, antwortete die alte Dame, und jetzt war kein Zweifel mehr in ihrer Stimme zu hören. Aber der Schock der Freude, ihre Hingabe an die große Familie, mit der ihr Leben verbunden war, und das Auftauchen dieses Mannes, der, wenn er nicht selbst die Rose war, doch fast ein Ableger des Baumes war – all das schien ihre Sinne betäubt zu haben, denn sie lag still da, und Tränen der Schwäche und des Glücks rannen unter ihren geschlossenen Lidern hervor. Dann sagte sie:
„Er ist also wieder in Frankreich, der Herzog?“
„Ich fürchte, das kann ich dir nicht sagen, meine Tochter. Aber auf das Wort eines Christen und Priesters hin soll er das Geheimnis sehr bald in seinen Händen halten.“
„Er wird es jetzt nicht nutzen können.“
„Wer weiß? Und wenn nicht jetzt, dann vielleicht, wenn glücklichere Tage kommen. Wenn er es nutzen kann, wird es ihm heute unermesslich mehr nützen als jemals vor einem Vierteljahrhundert. So viel kann ich dir sagen, Frau, dass er, wo immer er auch ist, für den König kämpft.“
„Wie es sich für einen Trélan gehört!“, flüsterte sie mit einem Lächeln. Aber das Lächeln war verschwunden, als sie hinzufügte: „Und das schreckliche Schicksal seiner Frau, der Herzogin Valentine?“
„Es hat ihm das Herz gebrochen“, sagte der Priester knapp.
„Meiner Herrin wurde viel erspart“, flüsterte Fräulein Magny. Sie fuhr sich mit zitternder Hand über die Augen. „So viel Blut ... und Mirabel hat ihn verlassen ... Gehen die Kerzen aus, mon père, oder sind es meine Augen? N'importe – du kannst immer noch das Pergament finden ... diesen kleinen geschlossenen Rahmen neben dem Spiegel dort drüben. Wenn du ihn öffnest, wirst du das Gesicht erkennen.“
Er tat es. Es war eine kleine Pastellzeichnung der Herzogin Eléonore, seiner Gönnerin, die die Witwenkleidung trug, in der er sie am besten in Erinnerung hatte. Er kam mit dem Bild zurück zum Bett.
„Dieses kleine Bild sollte mit mir begraben werden ... und das soll es auch noch. Clotilde wusste, wie sehr ich es mochte – aber sie hätte nie etwas anderes vermutet, die arme Närrin ... Ich habe aus der Erfahrung meiner Vorfahren gelernt ... Reiß das Papier auf der Rückseite ab, mon père.“
M. Chassin gehorchte, und als er das rosafarbene, fleckige Papier ablöste, das kürzlich dort aufgeklebt worden war, kam ein Stück gelbes Pergament zum Vorschein, das gegen die Rückseite des Bildes gefaltet war. Es war viermal gefaltet, und darauf stand mit bräunlicher Tinte das einzige Wort „Mirabel“.
„Öffne es!“, sagte die Stimme vom Bett aus, die jetzt sehr schwach geworden war.
Der Priester tat, wie ihm geheißen. Als er das Pergament mit nicht ganz ruhigen Händen entfaltete, sah er eine Art grobe Skizze einer ziemlich komplexen Karte, unter der in einer krakeligen Handschrift aus dem 17. Jahrhundert geschrieben stand:
„Plan des Ortes in meinem Schloss Mirabel, wo ich mehrere Tausend Pistolen und verschiedene Schmuckstücke aus dem Nachlass meiner verstorbenen Frau vergraben ließ, wegen der Unruhen, die in diesem Königreich herrschen.“ Und er erblickte: „Item, 10 Säcke, jeder enthaltend 2.500 Pistolen ... Item, ein Halsband aus indischen Rubinen, sehr kunstvoll gearbeitet ... Item, ein Becher aus ziseliertem Gold, genannt der der Königin Margarete“ ...
Das Ganze war beschriftet mit „Für meinen Sohn, den hohen und mächtigen Herrn Gui de Saint-Chamans, Marquis de la Ganache, Vicomte de Saint-Chamans” und unterschrieben mit “Von mir in meinem Schloss Mirabel am sechsten April des Jahres eintausendsechshundertzweiundfünfzig, Antoine-Louis de Saint-Chamans, Duc de Treslan”.
„Das ist in der Tat——“, begann der Priester, sobald er wieder sprechen konnte, als er, den Blick vom Pergament hebend, die Veränderung bemerkte, die sich während der kurzen Zeit, in der er das Dokument studiert hatte, über das Gesicht auf dem Kissen gelegt hatte. Fräulein Magny hatte ihre letzte Kraftreserve für diese Angelegenheit aufgewendet; nun war sie erschöpft – und auch sie war im Begriff zu gehen.
„Versprich mir das, Vater!“, keuchte sie, als er sich über sie beugte.
„Ich verspreche es dir, meine Tochter, so wie ich selbst auf Erlösung hoffe!“
Die zusammengepressten Lippen lächelten. „Ich kann mein Nunc Dimittis sprechen ... Segne mich, Pierre Chassin!“
Er hob die Hand. „Benedicat te …“ und fuhr sogleich fort mit: „Fahre hin, christliche Seele …“
Am Ende war sie bewusstlos, und eine Viertelstunde später, während die weinende Clotilde an einer Seite des Bettes kniete und der verbannte Priester an der anderen Seite betete, schritt Fräulein Magny, deren letzte Gedanken auf Erden dem Hause Trélan galten, durch das große Tor, um ihrer heiligen Herrin zu begegnen – und ließ diesseits jenes Tores das Geheimnis von Mirabel zurück, das Folgen zeitigen sollte, wie sie niemand je erträumt hatte.
KAPITEL III DAS GESCHENK WIRD ANGENOMMEN
Währenddessen waren die Leute auf dem Dachboden von Herr Charlot, den der Abbé so plötzlich verlassen hatte, mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt, und obwohl sie endlich still geworden waren, war die Atmosphäre in ihrer Unterkunft ziemlich angespannt. Warum brauchte ihr Anführer, der einen absolut vertrauenswürdigen Führer hatte, so lange, um den Weg von Scaër zu finden?
Endlich, gerade als Herr Chassin nebenan das Proficiscere beendet hatte und nach „Clotilde” rief, rief der Vicomte de Céligny nicht zum ersten Mal: “Das müssen sie sein!” Die vier Männer spitzten die Ohren, denn auf der Treppe war tatsächlich ein Geräusch zu hören.
„Dame! Es klingt, als wäre Le Blé-aux-Champs betrunken!“, meinte Artamène.
„Oder verletzt!“, fügte der Comte de Brencourt hinzu, der unruhig lauschte.
Die schweren, schlurfenden Schritte, die sie die Treppe hinaufkommen gehört hatten, blieben vor der Tür stehen. Roland sprang auf, öffnete sie und wich sofort mit einem kleinen Schrei zurück. Zwei Männer in bretonischer Tracht standen auf der Schwelle, der ältere und größere stützte den anderen, einen jungen, saturnisch aussehenden Bauern, dessen Gesicht vor Schmerz verkniffen war und dessen unbeschuhter linker Fuß in ein fleckiges und schlammiges Taschentuch gewickelt war.
„Herr le Marquis!“, riefen Roland und Artamène gleichzeitig, „Was ist passiert?“
„Nichts Schlimmes“, antwortete der Ältere fröhlich. „Wir haben in der Dämmerung eine Colonne mobile aufgeschreckt, das ist alles, und unser armer Blé-aux-Champs hat eine Kugel im Fuß.“
„Aber Sie selbst sind hoffentlich unverletzt, de Kersaint?“, fragte der Comte de Brencourt nicht ohne Besorgnis, als er aus seiner Ecke herantrat. „Wir haben uns schon große Sorgen um Sie gemacht.“
„Mir geht es gut, danke. Aber mein Junge ...“
„Lass ihn sich auf meine Matratze legen, Sir“, schlug der Vicomte de Céligny vor, und da diese zufällig am nächsten zur Tür stand, humpelte der junge Chouan nach vergeblichen Protesten dorthin, den Arm immer noch um den Hals seines Anführers gelegt.
„Ja, leg dich hin, mon gars“, sagte Herr de Kersaint und legte ihn auf die Pritsche, „und wir werden sehen, was wir für diesen Fuß tun können.“ Er sah sich um. „Wo ist unser Chefarzt, der Abbé?“
„Er beichtet gerade einer sterbenden Frau nebenan oder leistet ihr anderweitig Beistand“, antwortete Herr de Brencourt. „M. Charlot ist für ihn eingesprungen.“
Der Marquis de Kersaint hob leicht die Augenbrauen, sagte aber nichts dazu. „Ich fürchte, wir sind hier insgesamt eher eine Krankenstation“, bemerkte er. „Was ist mit Ihren Verletzungen, Comte – und Ihren, La Vergne?“
„Ich leugne nicht, dass ich Kopfschmerzen habe“, antwortete Herr de Brencourt. „Aber was die Ursache angeht, so hat der Abbé heute Nachmittag die Wunde versorgt und berichtet, dass sie hervorragend verheilt. Mein Handgelenk“, er zeigte einen Verband, „wird seiner Meinung nach etwas länger brauchen, um zu heilen.“
„Und deine sichere Ankunft, Herr le Marquis, hat meinem Arm noch mehr geholfen als die Behandlung durch den Abbé“, sagte Artamène.
Herr de Kersaint lächelte ihn an und schüttelte den Kopf, während er sich neben den am Boden liegenden Führer kniete und begann, ihm das Taschentuch vom Fuß zu nehmen. Er wäre mehr oder weniger als menschlich gewesen, hätte er nicht gewusst, dass er von diesen wohlgebürtigen jungen Anhängern sowohl verehrt als auch gefürchtet wurde.
„Lass mich das machen, Herr le Marquis!“, bat Roland nun, während der nachdenkliche Lucien aus den Tiefen des Dachbodens eine Schüssel mit Wasser und etwas zerrissenem Leinen hervorholte.
Aber der Marquis de Kersaint fragte Roland, wann er jemals eine Schusswunde versorgt habe, und führte den Vorgang mit einer Geschicklichkeit durch, die darauf hindeutete, dass er selbst schon nicht wenige versorgt hatte. Der junge Bauer, der mit dem Gesicht im Kissen gelegen hatte, ergriff seine Hand, als er fertig war, und führte sie stumm an seine Lippen.
„So, mein Junge“, sagte sein Anführer freundlich, als er sie zurückzog. „Bleib liegen und mach es dir so bequem wie möglich unter den gegebenen Umständen. Die Kugel ist glatt durchgegangen, was ein großes Glück ist. Roland, leg ihm irgendwas zum Zudecken über. Danke, Lucien; ja, ich hätte gern etwas frisches Wasser. Du kannst es auf die praktische Kommode dort drüben stellen.“
Als er dort stand und sich das Blut von den Händen wusch, war es nicht schwer zu verstehen, welche Anziehungskraft der Marquis de Kersaint auf beide Geschlechter und jedes Alter ausüben konnte. Als junger Mann muss er außerordentlich gut ausgesehen haben, und jetzt unterstrichen die grauen Schläfen nur noch sein äußerst vornehmales Aussehen. So wie sein dunkles, leicht gewelltes Haar durch den Kontrast zu den grauen Strähnen an Ausdruckskraft gewann, so unterstrich die Bauernkleidung, die er trug, nur die natürliche Autorität, die ihn umgab – eine Ausstrahlung, die er selbst zum Zwecke der Verkleidung unmöglich ablegen konnte. Sie war Teil seiner ganzen Haltung, seiner großen Gestalt, seiner Adlernase mit den feinen Nasenflügeln und dem gebieterischen Blick seiner schönen grauen Augen. Dennoch hatte sein Mund etwas Freundliches an sich – etwas, das man besser nicht ausnutzen sollte. Das wusste jeder auf dem Dachboden.
„Also, meine Kinder, was habt ihr seit eurer Ankunft gemacht?“, fragte er und sah sich um, während er sich die Hände abtrocknete. „Lucien hat sich wie immer ein Buch geschnappt. Was hast du gelesen, Lucien?“
„Das hat er gelesen, Herr le Marquis!“, rief der junge Chevalier de la Vergne und griff nach du Boisfossés Vergil, das er mit dem Gesicht nach unten auf seinen Stuhl gelegt hatte. Er hielt das Buch mit der Hand, die in der Schlinge lag und die er noch benutzen konnte, und schwang seinen anderen Arm in Richtung Roland, der in der Nähe stand, und begann, ihm die berühmte Klage aus dem sechsten Buch für den früh verstorbenen Marcellus vorzutragen:
„Ach, unglückseliger Knabe! Wenn du nur irgendein hartes Schicksal durchbrechen könntest,Dann wirst du Marcellus sein. Gebt Lilien mit vollen HändenPurpurfarbene——“
Er war noch nicht weiter gekommen, als ihm zu seiner großen Überraschung das Buch sanft, aber bestimmt aus der Hand genommen wurde.
„Wiederhole diese Zeilen nicht, Junge, vor jemandem, der so jung ist wie du“, sagte Herr de Kersaint ruhig, ohne ihn anzusehen, sondern Roland. „Ich finde sie immer unglückbringend ...“
Und bevor die beiden jungen Männer sich von ihrer Verwunderung erholen konnten, war er schon auf die andere Seite des Dachbodens gegangen und hatte sich zu seinem Stellvertreter an den kleinen Tisch gesetzt, an den dieser zurückgekehrt war.
„Ich habe hier einige Papiere, de Brencourt“, sagte er, als er sich setzte, „die wir uns ansehen könnten, bis der Abbé zurückkommt. Zweifellos war unser Versuch verfrüht ... aber wenn wir kein Geld bekommen, wird er immer verfrüht bleiben. Ich habe “Sincère„ getroffen; er könnte uns mit mindestens zweihundertfünfzig Mann unterstützen, wenn wir nur Waffen für sie bereitstellen könnten.“
„Immer das Gleiche – nicht genug Waffen und Munition“, meinte sein Leutnant ziemlich bitter. „Wie soll man in Finistère was Großes machen, wenn es immer an dem mangelt? Und wir könnten beides reichlich aus England bekommen, wenn wir nur das Geld hätten, um es zu kaufen.“
„Genau“, sagte der Marquis. „Aber woher das Geld kommen soll, weiß ich nicht – abgesehen von der nicht sehr großzügigen Subvention, die mir die britische Regierung für den Sommer versprochen hat. Nun, wir müssen uns mit Georges beraten, wenn er kommt. Seht euch jetzt diese Zahlen an.“
Und er und der Comte de Brencourt beugten sich immer noch über die Papiere, die er auf dem Tisch ausgebreitet hatte, als die drei jungen Männer, die sich so weit wie möglich von der Versammlung ihrer Vorgesetzten entfernt hatten, bemerkten, dass der Priester wieder unter ihnen war. Er war ganz leise in den Schatten getreten.
„A la bonne heure, Herr l'Abbé!“, sagte Roland de Céligny. „Herr le Marquis ist angekommen.“ Und er deutete auf die andere Seite des Dachbodens.
„Und waren Sie bei der Hochzeit in Mirabel?“, fragte Artamène schelmisch.
Abbé Chassin drehte sich schnell mit gerunzelter Stirn zu ihm um und legte den Finger auf die Lippen. Aber es war zu spät; die Worte waren schon raus, und obwohl der Übeltäter seine Stimme gedämpft hatte, waren sie zu hören gewesen. Und Artamène, der durch die Geste des Priesters sofort interessiert und aufmerksam geworden war, bemerkte irgendwie eine plötzliche Versteifung der gesamten Gestalt von Herr de Kersaint, bevor dieser sich vom Tisch umdrehte und sagte: „Was hat das mit ... Mirabel zu tun?“
Da der Abbé keine große Eile zu haben schien, zu antworten, war es Herr de Brencourt, der antwortete: „Die alte Dame, die der Abbé nebenan besucht hat, leidet offenbar unter Wahnvorstellungen über Mirabel – das Schloss des Duc de Trélan in der Nähe von Paris. Das ist es, was Herr de la Vergne meint.“
„Das ist interessant“, meinte der Marquis de Kersaint und drehte sich weiter um, um den kleinen Priester anzusehen, der seit Artamènes Scherz keinen Schritt weitergegangen war. „Und haben Sie etwas Neues über Mirabel erfahren, Abbé?“
„Ja, Herr le Marquis“, antwortete der Priester ziemlich knapp.
„Dürfen wir es hören?“
M. Chassin schwieg und schien über diese Bitte nachzudenken. Artamène sah sein Gesicht, und es war seltsam beunruhigt.
„Wir bitten dich doch hoffentlich nicht, die Geheimnisse der Beichte preiszugeben?“
„Nein.“
„Warum dürfen wir es dann nicht hören?“
„Weil“, sagte der Abbé ernst, „es eher für Ihr privates Ohr bestimmt ist, Herr le Marquis.“
„Warum?“, fragte Herr de Brencourt sofort und sah von einem zum anderen, „warum für Herr de Kersaints private Ohren?“
Der Abbé schien auf diese Frage überhaupt keine Antwort zu wissen, und nach ein oder zwei Sekunden sagte der Marquis de Kersaint lässig zu seinem Untergebenen: „Weil Herr Chassin weiß, dass ich ein Verwandter des Duc de Trélan bin, nehme ich an.“
„Ein Verwandter des Duc de Trélan – du!“, rief der Comte de Brencourt sichtlich überrascht aus. „Ein naher Verwandter?“
„Nein, nein, sehr entfernt“, antwortete sein Anführer schnell. „Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, wie eine Enthüllung, die sein Eigentum betrifft, nur für meine Ohren bestimmt sein kann. Also lass es uns alle hören, wenn du so nett wärst, Herr l'Abbé.“
Herr de Brencourt, der immer noch von Überraschung oder einer anderen Emotion überwältigt war, starrte diesen Verwandten von Herr de Trélan weiterhin sehr intensiv an; ebenso wie der Priester, der immer noch in der Nähe der Tür stand. Bei besserem Licht hätte man die Bitte in seinen Augen erkennen können.
„Also, Herr l'Abbé, ich warte!“, sagte der Marquis de Kersaint ziemlich hochmütig und in der Art eines Mannes, der diese Disziplin nicht gewohnt ist.
Der Abbé presste die Lippen zusammen. „Das kann bis morgen warten, Herr le Marquis.“
„Was, eine Mitteilung eines Sterbenden? Und wer weiß, ob wir alle morgen noch da sein werden? Komm, Abbé, ich befehle es dir! – Roland, bring einen Stuhl für Herr Chassin.“
Ob der Priester sich gegen diese herrische Stimme und Geste hätte wehren können, wenn er gewollt hätte, weiß man nicht, jedenfalls tat er es nicht.
„Sehr gut, Marquis“, sagte er, und Artamène, der bis ins Mark erschüttert war, dachte: „Tu l'as voulu, Georges Dandin!“ Das würde unser Abbé wirklich gerne sagen! Und da ihr Anführer angedeutet hatte, dass die Angelegenheit doch nicht privat war, bemühte er sich, mit gespitzten Ohren zuzuhören. Roland, der ziemlich beunruhigt aussah, stellte einen Stuhl für den Priester an den Tisch und trat zurück.
„Sie müssen wissen, Herr le Marquis“, begann der Abbé mit leiser Stimme, „dass die alte Dame, die ich besucht habe, bei den Feierlichkeiten im Jahr 1771 dabei war, als der ... der junge Duc de Trélan seine Braut heiratete.“
„Diese schöne und höchst unglückliche Dame!“, kommentierte Herr de Brencourt leise.
Der Marquis warf ihm einen kurzen Blick zu, und der Priester fuhr fort, nervös seine Hände aneinander reibend und ziemlich blass:
„Es gibt anscheinend eine Legende über einen Schatz, der seit den Tagen der Fronde in Mirabel versteckt ist, einen Schatz, dessen Verbleib niemand jemals herausfinden konnte. Da du ein Verwandter von Herr de Trélan bist, Herr le Marquis, hast du vielleicht schon von dieser Legende gehört?“
Herr de Kersaint nickte nachdenklich. „Ich glaube, ich habe davon gehört. Ja?“
„Die Geschichte scheint wahr zu sein. Das Dokument, das den Versteckort des Schatzes beschreibt, wurde damals – vor fast hundertfünfzig Jahren – gestohlen und gelangte in den Besitz der Familie dieser alten Dame, aber auf eine Weise, dass es erst kürzlich von der alten Dame selbst wiederentdeckt wurde.“
„Was für eine außergewöhnliche Geschichte! Und?“
„Seitdem wollte sie es dem Herzog geben, konnte es aber nicht, da er nicht in Frankreich war. Und in ihrem Wahn gerade eben, als sie sich in die Hochzeit zurückversetzt wähnte, sprach sie so beharrlich davon, dem ... dem jungen Paar dieses Papier als Hochzeitsgeschenk anzubieten, das ihnen zu dem verhelfen würde, was ihnen schließlich gehörte, dass Herr Charlot ...“
„Ein Hochzeitsgeschenk für de Trélan und seine Frau!“, warf der Comte de Brencourt lachend ein. „Bon Dieu, was für eine Ironie, wenn man bedenkt, wie ihr Eheleben endete!“
„Das muss uns jetzt doch nicht interessieren, Herr de Brencourt!“, sagte sein Anführer kühl. „Bitte fahren Sie fort, Abbé.“
„Durch einen höchst merkwürdigen Zufall“, fuhr Herr Chassin fort, seinen Blick auf den Marquis gerichtet, „bat mich Herr Charlot als Priester, zu versuchen, die alte Dame irgendwie zu beruhigen. Schließlich kam sie wieder zu Sinnen, und ich konnte ihr versichern, dass ich das Dokument, wenn sie es mir anvertrauen würde, an die zuständige Stelle weiterleiten könnte und würde.“
„Und sie hat es Ihnen gegeben?“, fragte der Marquis und beugte sich mit einiger Ungeduld vor.
„Ich habe es jetzt hier“, antwortete der Priester und berührte seine Brust.
Herr de Kersaint lehnte sich wieder zurück, und Artamène fiel auf, wie sehr er einem Schachspieler ähnelte, der über seinen nächsten Zug nachdenkt. Aber nur der Marquis de Kersaint selbst und der Mann, den er gezwungen hatte, dieses Spiel mit ihm zu spielen, waren sich der unangenehmen Lage bewusst, in die ihn seine Beharrlichkeit gebracht hatte.
„Also muss ich es irgendwie schaffen, es an Herr le Duc zu schicken“, schloss der Abbé. „Ich wusste natürlich, dass Sie mit ihm verwandt sind, Herr le Marquis, weshalb ich diese Aufgabe übernommen habe, da ich wusste, dass ich auf Ihre Hilfe zählen konnte.“
Aber der Marquis schaute auf den Tisch und sagte nichts.
„Das Dokument wird Herr de Trélan kaum von Nutzen sein, wenn er es erhält“, bemerkte der Comte de Brencourt. „Mirabel ist, wie ich gehört habe, jetzt ein Museum oder etwas in der Art; jedenfalls ist es in der Hand der Regierung. Und Herr de Trélan – wo ist Herr de Trélan? Immer noch in England? Nein, kaum. Man hört nie etwas von ihm. Vielleicht ist er tot.“
„Nein, er lebt“, antwortete sein Verwandter knapp und hob für einen Moment den Blick.
„Ah! Aber wie will er von diesem Schatz profitieren, selbst wenn er noch da ist?“
„Trotzdem muss ich meine Aufgabe erfüllen“, meinte Herr Chassin und schaute über den Tisch hinweg auf Herr de Kersaints gesenkten Kopf.
„Oh, zweifellos, Abbé, obwohl ich nicht weiß, wie du das machen willst, selbst mit der Hilfe von Herr de Kersaints Cousin ... ist es Cousin? ... Was denkst du selbst über das Problem, Marquis?“
Der Marquis de Kersaint hob den Kopf. „Ich denke“, sagte er langsam und sah Herr Chassin eindringlich an, „dass der Abbé Recht hat. Herr de Trélan muss irgendwie informiert werden. Aber da es für ihn im Exil praktisch unmöglich ist, in dieser Angelegenheit etwas zu unternehmen – und selbst in Frankreich wäre es schwierig und gefährlich –, und da wir im Moment so dringend Geld brauchen, würde ich vorschlagen ...“
„Was?“, fragte der Comte.
„Als sein Verwandter um seine Erlaubnis zu bitten, den Schatz, wenn wir ihn bekommen können, für die Bedürfnisse von Finistère zu verwenden – das heißt, für den Dienst des Königs.“
„Oh, mein Herr, glauben Sie, das wäre möglich?“, rief Roland begeistert und sprang auf.
„Oh, Herr le Marquis, schick uns nach Mirabel!“, rief Artamène.
„Ihr geht zu schnell voran, meine Herren. Wir müssen zuerst die Erlaubnis des Herzogs einholen, sein Eigentum zu plündern, auch wenn es beschlagnahmt ist.“
„Glaubst du, dass es schwierig sein wird, diese zu bekommen?“, fragte der Comte de Brencourt und kniff die Augen zusammen.
„Nein, ich glaube nicht. Wie Sie selbst gesagt haben, Comte, wie soll Herr de Trélan in diesem Fall von diesem plötzlich aufgetauchten Schatz profitieren?“
„Nun, wenn der König wieder an die Macht kommt, wäre es für den Herzog von großem Nutzen, einen Fonds in seinem eigenen Schloss zu haben! Ich gehe davon aus, dass seine finanziellen Mittel, so groß sie auch einmal waren, jetzt sehr begrenzt sind. Man kann ihm kaum vorwerfen, dass er sparsam damit umgegangen ist!“
„Du scheinst viel über die privaten Angelegenheiten von Herr de Trélan zu wissen, Comte!“, bemerkte Herr de Kersaint trocken, drehte sich um und sah ihn an. „Ich möchte anmerken, dass kein ehrlicher Mensch durch die Revolution gewonnen hat und dass diejenigen, die viel zu verlieren hatten, entsprechend viel verloren haben. Wenn mein Verwandter jedoch die von Ihnen vorgeschlagene Sichtweise vertritt – was ich nicht glaube –, muss er dazu gebracht werden, unsere derzeitige Verwendung des Geldes als Darlehen an Seine Majestät zu betrachten. Schließlich hatte er nie einen Vorteil davon, solange er nichts von seiner Existenz oder seinem Verbleib wusste, und davon hätte er offenbar ohne den außergewöhnlichen Zufall, von dem uns der Abbé gerade berichtet hat, nie erfahren.“
„Aber“, schlug Herr de Brencourt vor, „bevor wir ihn – durch Sie – auf dieses Thema ansprechen, wäre es dann nicht gut, einen Blick auf dieses wertvolle Dokument zu werfen, damit wir uns ein Bild davon machen können, ob der Betrag das Risiko wert ist, sein Leben zu riskieren, um es zu finden, und ob es leicht sein wird, an es heranzukommen?“
Der Priester und Herr de Kersaint sahen sich an. „Ja. Ich denke, das könnten wir tun, ohne indiskret zu sein“, sagte letzterer nach einem Moment des Zögerns. „Meinst du nicht auch, Abbé?“
M. Chassin antwortete nicht mit Worten, sondern zog das Pergament, das er von der sterbenden Frau bekommen hatte, aus seinem Mantel und gab es seinem Anführer. Der Marquis de Kersaint breitete das alte Dokument auf dem Tisch aus, rückte die Kerzen in ihren Flaschen näher heran, und die drei Männer studierten schweigend die grobe Skizze und ihre Legende. Auch Roland und Artamène, die im Hintergrund standen, reckten neugierig ihre Hälse, um ebenfalls einen Blick darauf zu werfen.
„Zehn Säcke – jeder mit zweitausendfünfhundert Pistolen“, murmelte der Comte nachdenklich. „Wie viel ist das wohl in heutiger Währung? Und anscheinend gibt es auch Juwelen.“
Der Marquis de Kersaint presste die Lippen zusammen, sein Gesicht war ein Rätsel. „Es scheint auf jeden Fall das Risiko wert zu sein“, sagte er schließlich. „Geld ist das, was wir jetzt für Finistère am dringendsten brauchen. Wir können die Männer bekommen; das haben mir die letzten Monate deutlich gezeigt, aber was nützen unbewaffnete Männer?“
„Weniger als gar nichts“, meinte sein Stellvertreter. „Dieses Dokument scheint daher ein echtes Geschenk des Himmels zu sein.“
„Ich werde mich auf jeden Fall unverzüglich mit Herr de Trélan in Verbindung setzen“, sagte der Marquis. „Darf ich dieses Pergament behalten, Abbé?“
„Ich hatte gehofft, dass Sie sich selbst um den Versand kümmern würden, Herr le Marquis“, antwortete der Priester, und Herr de Kersaint faltete es ohne weiteres zusammen und steckte es in seine Brusttasche.
„Mir scheint, de Kersaint“, sagte der Comte de Brencourt nachdenklich, während er mit den Karten spielte, die noch auf dem Tisch lagen, „dass wir unter Berücksichtigung aller Umstände, der außergewöhnlichen Lage, unserer dringenden Bedürfnisse und der Möglichkeit, dass es Ihnen vielleicht nie gelingen wird, mit dem Duc in Kontakt zu treten – wo auch immer er sich befinden mag –, kaum dafür kritisiert werden könnten, wenn wir das Gesetz in unsere eigenen Hände nähmen und nicht auf seine Genehmigung warteten. Schließlich wäre das Risiko unser.“
„Diese Lösung ist mir auch schon in den Sinn gekommen, das gebe ich zu“, sagte der Marquis mit einem Hauch von einem Lächeln, während MHerr de Céligny und de la Vergne den Vorschlag des Comte mit stummem Beifall begrüßten. „Aber die Angelegenheit ist in gewisser Weise die des Abbé und ihm anvertraut.“
„Ich bin ganz zufrieden, mich Ihrer Entscheidung zu fügen, Herr le Marquis“, antwortete der Priester gelassen.
„Aber, de Kersaint“, warf der Graf ein, offenbar von einer plötzlichen Idee erfasst, „haben Sie nicht selbst ein Anrecht auf den Schatz, wenn Sie mit Herr de Trélan verwandt sind? Würden wir Sie dann nicht letztendlich bestehlen?“
„Nein, dafür bin ich nicht nah genug mit dem Duc verwandt“, erwiderte der Marquis schnell. „Ich bin nur durch Heirat mit ihm verbunden – ein entfernter Verwandter.“
„Dann darf ich Ihnen vielleicht dazu gratulieren“, sagte Herr de Brencourt in düsterem Ton. „Ich selbst möchte nicht daran denken, dass ich eng mit einem Mann verwandt bin, der sich selbst in Sicherheit gebracht und seine Frau dem Tod überlassen hat!“
Diese Worte schienen sich wie ein elektrischer Schlag auf die beiden anderen Männer zu übertragen. Herr de Kersaints rechte Hand, die im Schein der Kerzen auf dem Tisch ruhte, ballte sich augenblicklich zur Faust. Im nächsten Moment stieß der Abbé mit einer plötzlichen, ungeschickten Bewegung die ihm am nächsten stehende Kerze zu Boden, wo sie mit einem lauten Knall sofort erlosch.