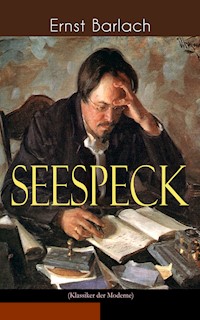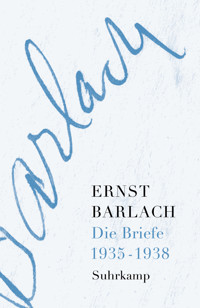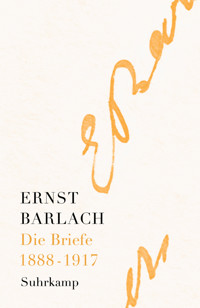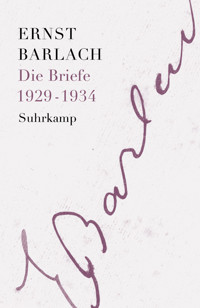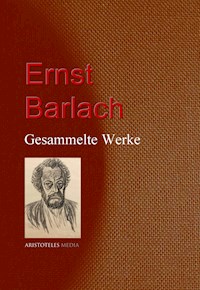Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Barlachs letztes bekanntes Werk ist dieses Romanfragment, in dem er seine Protagonisten den ewig währenden Kampf zwischen Gut und Böse austragen lässt. Der Roman gipfelt im scheinbaren Sieg des Bösen, das den guten Mond vom Himmel verschwinden lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der gestohlene Mond
Ernst Barlach
Inhalt:
Der gestohlene Mond
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Der gestohlene Mond, E. Barlach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849606268
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Der gestohlene Mond
Erstes Kapitel
Wenn man eine wichtige, sagen wir eine besondere Sache frisch erlebt, so tut man dies zunächst leicht in Unterschätzung ihrer Bedeutung. Man macht nicht immer ein langes Gesicht, vielleicht sieht man sie nur mit behäbigem Ernst an. Leute von gewisser Art machen sich ein Geschäft daraus, sie leichthin wie eine Nebensächlichkeit aufzunehmen, spüren am nächsten oder übernächsten Tage eine Abspannung und merken bald, daß die anscheinende Leichtigkeit eine Überspanntheit war, die sie einer Fedrigkeit ihres Gemüts verdankten, die aber einer längeren Prüfung nicht gewachsen ist, die sich abnutzt und versagt. Das Besondere nun, das in der genannten Art in Waus Gemüt empfangen und von Waus Gemüt ausgestanden und, kaum Lust oder Unlust zuführend, durchlebt wurde, war Wahls Feindschaft, und als das Ende dieser Feindschaft ergab sich das Lob der Feindschaft und des Feindseins, die bestanden und weiterbestehen sollten, aber mit dem Lob ihres Bestandes behaftet aus dem niederen Kreis der Feindschaft in den höheren der Notwendigkeit gehoben wurden.
Keine Uneinigkeit konnte verhindern, daß ihrer beider Einigkeit völlig war, und wenn es keine irdischen und menschlichen Leiden gab, die Wau von Wahl nicht erfuhr, so war es doch die urerschaffene Lauterkeit selbst, die alles zubereitete und vollzog und die der Geist der reinsten Wohlbeschaffenheit, am Grunde aller Dinge liegend, beschloß und erwog. Daß Feindschaft sich mit den gefälligsten Formen und Farben der Freundschaft schmücken kann, wer möchte darüber noch ein Wort verlieren. – Denn wohlverstanden, es ist von etwas Weitausholendem die Rede, und das derart Breitspurige waltet, hantiert und pfuscht nicht mit Beiläufigkeiten und allerorts üblichen Ungehörigkeiten, solchen Lappalien, wie die täglichen Auflagen der Zeitungen zur Befriedigung der Lüsternheit nach übelriechenden Tagtäglichkeiten ihren Lesern zuführen. Feindschaft wie die zwischen Wahl und Wau können viele nicht von echter Freundschaft unterscheiden. Man wird ja sehen, und man muß einstweilen nicht fragen, wie es zuging, daß Wau Wahls Freundschaft als Feindschaft erkannte, wobei es sich dann auch erweisen mußte, ob er zu den Leuten gehörte, die mit anscheinender Leichtfertigkeit zunächst das Schwere hinnehmen und deren Fedrigkeit des Gemüts erst nach und nach abnutzt und versagt.
Zweites Kapitel
Wahl pflegte Wau des öfteren an seine Bürgerlichkeit zu erinnern, und dieser, keineswegs erschüttert, konnte es doch niemals unterlassen, in seiner Antwort die Frage nach Wahls Bürgerlichkeit ausdrücklich offen zu lassen. Beide wünschten unbemakelt von einer Wesensart zu bleiben, bei deren Erwähnung keiner an etwas Bestimmtes dachte. An einem frostigen Abend warf sich Wau indessen mit Behagen in einen gut gefütterten und an den Schultern brav gepolsterten Mantel, und während er ihn vor dem Spiegel zuknöpfte, nachdem er noch ein weniges an seiner Krawatte gefingert hatte, lächelte er seinem Spiegelbild beifällig zu und würde, so seine Vorstellungen in diesem Augenblick auf der Zunge geprickelt hätten, gesagt haben: gut bürgerlich, freilich, aber er sitzt warm, und ich fühle mich mollig darin. So trat er auf die Straße, wo er wie manche andere Beamten, Lehrer und sonstige Würdenträger von Gericht oder Post oder Steuer wohnte. Sie war kahl, normal, wohlanständig, und es schien Wau in seinem bürgerlichen Mantel, daß die Kahlheit und Normalhaftigkeit die Kälte des Abends besonders schaurig fühlbar machten. So also machte er sich's in seinem Mantel recht behaglich, wippte mit den Achseln, stopfte die Hände in die Taschen und zog die Schultern in die Höhe. Wenn seine Straße sich an ihrer Kahlheit genug getan, lief sie zwar geradeaus weiter, hieß nach wie vor gleichen Namens, ließ sich aber einigen Bewuchs gefallen und endete als Lindenallee. Auf den ersten dieser Lindenbäume hatte sich eine Katze vor Hunden gerettet und sich, im Geäst höhersteigend, rettungslos verklettert, die Hunde hatten sich verlaufen, aber die Kletterkünste der Katze hatten bankerott gemacht. Sie saß im Frost des Abends oben und mußte sitzen bleiben, da sie nicht abwärts steigen konnte, und aus der Nachbarschaft hatte ihre Not die Teilnahme anderer Katzen beschworen, die nun aus dunkeln Winkeln und Ecken die Anteiligkeit ihrer Katzenseelen am Ungemach der einen aus feurigen Augen leuchten ließen. Wau in seinem an den Schultern stark gepolsterten warmen Mantel blieb stehen und las aus der Situation im Baum und aus der kalten Stille in den Winkeln hier und da den Verlauf der Vorgänge ab, wußte dem Tier oben in den kahlen Zweigen seinerseits auch kein Entkommen aus seiner üblen Lage nachzuweisen und setzte, da er von der Geselligkeit eines gemütlichen und zwanglosen Abends beim Bürgermeister erwartet wurde, seinen Weg fort.
Es gab zurzeit am Ort eine gute Schar Schöngeister, Dichterlinge und Dichter. Zu den letzten rechnete sich Assessor Bostelmann, wie auch viele seiner Bekannten taten, der im Verlauf des Abends einiges Papier entfaltete und etwas ganz Besonderes, wie er sagte, als Frucht seiner guten Stunden der letzten Tage zum besten gab. Schon die Überschrift überraschte und tat das, was Titel und Etiketten oft tun, sie versprach mehr, als sie hielt. Sie lautete: »Wo der Satan seine Abende verbringt.« Unter Abend verstand der Assessor Bostelmann nicht streng eine mehr oder weniger dämmerige Angelegenheit, sondern nur die Zeit der Erholung, der Ausspannung von Berufsgeschäften, und so hatte sich der Satan einst in der Verwandlung als Landstreicher das boshafte Vergnügen gemacht, bei Pastor Riefstahl am Markt gerade vor dem westlichen Turmeingang um eine milde Gabe zu bitten. Pastor Riefstahl ließ es nicht an milden Worten fehlen, aber bei einem bedauernden Hinweis auf seine vielen Kinder blieb es denn auch. Der Satan, schnurstracks, schrägelte quer über die Ecke zum Hause des Propstes Pomperin, der gerade am Fenster stand und, wie er, nichts Gutes ahnend, den Satan auf sein Haus zusteuern sah, hinter die Gardinen und in das Dunkel des pastörlichen Gemachs zurückwich. Als der Satan aber klopfte, sagte das dienende saubere Kind, der Herr Propst sei nicht anwesend. Nun, nicht faul, machte der Satan wieder kehrt, gerade auf die Kirchenpforte los, grabbelte dabei, als hätte er schon vorher etwas Satanisches im Schilde geführt, in seinen Taschen, fand das zur rechten Zeit sich einfindende Stück Kreide und schrieb, als täte er es so recht zum Spott dessen, dem das hohe Haus geweiht, ans spitzgewölbte Bogentor: Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn, Pastor Riefstahl wull mi nix geben, Pomperin, de lät mi gornich in. Der Herr Assessor schleckte beim Umschlagen seines Blattes an den letzten Worten wie an einem Bonbon und murmelte, als wäre seine Zunge von süßem Saft überlaufen, der zudem aus den Mundwinkeln sickerte, somit am genauen Artikulieren behindert, die Zwischenbemerkung: Eine wahre Geschichte, erst kürzlich vorgefallen, meine Herren, ich habe selbst die Inschrift gelesen und – er zog aus der Westentasche ein Stück Kreide – das Korpus delikti selbst aufgehoben. Aber weiter! Er las: »Der Satan hatte sich so zwar ein unterhaltendes Geschäft gemacht, aber es war immerhin ein verteufeltes Vergnügen gewesen, was, wenn er auf Abendunterhaltung ausging, nicht eigentlich seine Absicht war, kam sich somit als gewissermaßen aus der Rolle gefallen vor. Es war ihm hauptsächlich um leichte und arglose, ja gemütvoll-unschuldige Unterhaltung zu tun, er wollte mitten im Volke, in dem er seinem Handel und Wandel nachging, herz- und seelenbrüderlich seines Daseins genießen. Auf Erholung von berufsstrengem Tun und Treiben ging er aus, und so vollzog er einen flotten Wechsel vom Teuflischen ins Biedere, er warf nicht nur den Biedermann um sich, sondern wandelte sich in ihn hinein, nicht ohne Erstaunen über den glatten Verlauf dieser Umstellung, ja gewissermaßen betroffen von der Erkenntnis, wie leicht die Brücke zwischen zwei so abgrundtiefen Geschiedenheiten zu schlagen war. Sollte die Scheidung am Ende gar nur eine scheinbare, eine leichte Maskierung sein, dachte er noch, als er schon als frischgebackener Biedermann, durchdrungen von Herzenswärme, im Vollgefühl jeder gangbaren Vorzüglichkeit seinen Weg antrat. Er saß, Vertrauen schöpfend aus dem Born der Gutartigkeit aller Zugehörigen eines trauten Familienkreises, zudem wohlempfohlen als vorgeblicher Freund eines abwesenden Sohnes, in Reih und Glied um einen runden Familientisch. Die Frau des Hauses ließ sich mit Schicklichkeit ein bißchen wohltuende Aufmerksamkeit gefallen, die junge und jüngste Tochter nahmen eine oder andere, gut präparierte Entgleisung in zahmem Schwerenöterton geübt in geneigte Ohren, und der Herr Forstrat nahm mit Freude wahr, daß der Unbekannte mit zahllosen Geschichten völlig unbekannt geblieben, die er schon seit langen Jahren in seinem Busen verschlossen zu halten genötigt war, weil jedermann seines Bekannten- und Verwandtenkreises sie ebenso gut wie er hätte erzählen können, nur daß ihnen niemandes geneigte Ohren die Ehre einiger Aufmerksamkeit zuteil werden ließen. So war der Satan im biedersten Kreise warm gehegt und litt entsetzlich unter seiner eigenen und der anderen Biederkeit. Der alte Herr erzählte, und die Damen fanden in dieser Eigenschaft ihres Gastes als aufmerksamer Hinnehmer von abgeschmackten Delikatessen der aufgeschlossenen väterlichen Vorratskammer ein Haar, und der Satan, der es wohl empfand, daß er sich als bloßer Zuhörer unliebsam mache, räumte seiner Biederkeit das Recht ein, mit der Mahnung, es geschehe den Damen Unrecht, darauf zu dringen, daß ein Wechsel der Unterhaltung stattfände. In anscheinender und glaubhaft gespielter Zerstreutheit schenkte er den Damen Likör in die Gläschen und entschuldigte sich, des Unschicklichen seiner Handlung plötzlich und sichtlich gewahr werdend, so drollig, daß alles lachte. Er fühle sich hier in dieser bisher unbekannten Familie von so wohliger Treuherzigkeit umhegt, daß es ihm im Augenblick vorgekommen sei, als wäre er Gastgeber im eigenen Hause. Er bat, den Verstoß zu entschuldigen, und bat den Herrn Forstrat, der gerade im Begriff war, die zweite Hälfte einer durch eine andere Geschichte, die ihrerseits auch noch der Pointe bedurfte, unterbrochenen Erzählung wieder aufzunehmen, seinerseits mit einem aktuellen Vorkommnis herausrücken zu dürfen, ohne weiter darauf zu achten, daß dem erschreckten alten Herrn der Atem ein wenig verschlug. Wie mag das wohl zugegangen sein, sagte der Satan, und nippte am süßen starken Zeug wie sämtliche Damen: Ich hörte, bevor ich Ihr Haus betrat, daß der Mond gestohlen sei, unauffindbar am Himmel, obgleich er im Kalender steht und vor einer guten halben Stunde aufgegangen sein müßte. Er ist nicht aufgegangen – ist wohl ein Kalender zur Hand? Das jüngste Fräulein stürzte davon und fiel, übereilfertig zurückkommend, über eine Teppichfalte just vor Satans Füße, der sie aufhob und mit onkelhafter Zärtlichkeit zu ihrem Stuhle führte, einer Zärtlichkeit, die vor dem Familienurteil als solche, und eben rein onkelhaft ausgelegt werden mußte. Dann schlug Satan, er hatte sich als ein Herr Doktor eingeführt, den Kalender auf und bewies die Richtigkeit seiner Angaben. Es war knapp zehn Uhr, und seit einer halben Stunde sollte der noch halbvolle Mond am Himmel stehen. Es ging dabei alles mit rechten Dingen zu, nämlich solchen, die für den Satan gute und gerechte sind, da die seinigen zwar besondere sein mögen, aber immerhin von zweifelsfreier Vor-Rechtlichkeit. Ein bißchen Blendwerkerei gehört zu seinem Handwerk, und zwar zu den läßlichsten seiner Ermächtigungen, die er nun, da es mit den von der bloßen Biederkeit erhofften Erbauungen nichts werden wollte, zu Rate zog. Niemand sah den Mond, der für jedermann sonst mit klarem Schein stand, wohin er gehörte, wenn auch in Wirklichkeit nicht stehend, sondern sausend und stürmend, wovon durch ein Blendwerk aus anderer Ordnung der Dinge niemand etwas gewahrte. Er brauste sogar, wie der Doktor mit hochmusikalischen Ohren wahrnahm, über seine Bahn – die G-Saite des Brumbasses wird tüchtig strapaziert, dachte der Satan flüchtig, als er mit seinen Augen den gewaltigen Notenkopf am Himmel betrachtete. Aber als Biedermann war er ehrlich ratlos wie die ganze Familie auch. Der Herr Forstrat, der mehr an seine in der Luft hängenden Geschichten als an den in der weiten Welt nicht wahrnehmbaren Mond dachte, rüttelte ein Schock unzusammenhängender Worte durcheinander, die Damen zirpten und zwitscherten durcheinander, und niemand achtete darauf, daß der Herr Doktor, während sich alle ans Fenster drängten, seinen Arm um die zarten Rundungen des jüngsten Fräuleins legte, offenbar keiner anderen als onkelhaften Empfindungen bewußt, trotz eigener ehrlicher Ratlosigkeit bestrebt, der Erschütterung einer jugendlichen Seele mit kundiger Hand zur Fassung und Ablenkung zu verhelfen.«
Der Assessor stockte und blickte auf. Denn der Bürgermeister hatte Zeichen der Ungeduld und des Überdrusses schon zum vielfachen Male von sich gegeben. Soll ich aufhören, Herr Bürgermeister? fragte der Herr Assessor. Der Gefragte schob die Frage beiseite: . . . viel zu novellistisch, ganz und gar älteste Schule, schnaufte er und besorgte sodann dem Assessor eine kritische Heimsuchung. Dieser Forstrat, ach, du großer Gott, was für ein Altenteiler – hat er kein Telephon, ruft die Polizei nicht an und läßt den Faxenmacher von Satan nicht einsperren – –? Diese Biedermänner, wie Forsträte, Herr Assessor, kennen alle Schleichwege im Wald und auf der Heide und noch mehr in den Korridoren und Amtszimmern der Behörden – – kurz . . . so was von Familie in der Gartenlaube war noch nie da . . . Der Assessor faßte sich langsam und begehrte von dem Bürgermeister zu wissen, woran sein Forstrat denn wohl, die Voraussetzung des satanischen Blendwerks einmal hingenommen, die Tatsache der arglistigen Täuschung hätte als solche erkennen sollen. Gestohlener Mond, prustete der Bürgermeister, da haben sie indicia facti, Verehrtester – die Absurdheit, bewiesen durch sich selbst, schließt jede Täuschung aus. – Ja, aber, sagte nun leiser der Assessor, indem er seine Blätter zusammenlegte, kommt dergleichen nicht tatsächlich vor? Denken Sie einen Augenblick nach, was für Hereinfälle der Gutgläubigkeit, sagen wir der Biederkeit, auf Hochstapeleien jeder Art . . . und wenn Sie dann nur hätten bemerken wollen, worauf ich eigentlich hinaus wollte bei meiner . . . Novelle, Herr Bürgermeister! – Nun, Herr Assessor, Ihr Wohl, prosit, Herr Assessor, prosit die Herren, schließlich kann uns allen der Mond gestohlen werden – wenn schon! Er trank, und die anderen Gäste tranken, auch der Assessor, nur, daß er sich verschluckte und es nicht mit einem Räuspern zu vertuschen vermochte, er mußte, was er in den unrechten Schlund bekommen, auskeuchen, lief rot an, und Wau, der ihm zur Seite saß, verhalf ihm zu Luft, indem er ihm auf den Rücken klopfte. Als sich danach eine Art von Nachdenklichkeit mit allseitigem Stillschweigen peinlich auf den Kreis legte, faßte er, da es am Ende vor Räuspern und Hm-sagen nicht mehr auszuhalten war, ein Herz und erzählte von der im Lindengeäst verstiegenen Katze, hatte aber nur die Genugtuung, daß der einzige Rechnungsrat Studt halbwegs aufmerksam zuhörte. Als er zu Ende war, sagte jemand: Und?, worauf Wau, gekränkt und über die Teilnahmlosigkeit der geselligen Runde erbost, gegenfragte: Möchten Sie etwa bei der Kälte da oben hocken? Ich denke die ganze Zeit über alle Augenblicke an das hilflose Tier. – Ach, de Katt! sagte wegwerfend der Angeredete und wandte sich gleichzeitig an den Assessor Bostelmann mit der Frage, ob er nicht weiterlesen wolle. Dieser aber legte die Hand an seinen Hals und entschuldigte sich mit wirklich imposanter Kühle und Würde. Die gesamten Register sind verstimmt, sagte er, andeutungsweise hüstelnd, und es kommt mit der Sache selbst gewiß nicht besser als vorher – und obendrein, da der Vortrag des Redners Glück jetzt nicht mehr macht bescheide ich mich notgedrungen mit dem beglückenden Achtungserfolg – durch welche forsche Umkehrung der Dinge er einen Aufschwung vollzog, der ihm den erwähnten Achtungserfolg tatsächlich eintrug. Er wurde also dennoch der Löwe des Abends und ließ sein Manuskript gelegentlich in der Brusttasche knistern, als wollte er sagen – ihr ahnt es ja alle nicht, wie sehr ihr hereingefallen seid. Ja, Wau vernahm, wie dem Zaun seiner Zähne ein Murmelwort entsprang. Es klang wie: . . . geweckt, aber es entsprang verstohlen, wie es schien, und sollte nicht gehört und beachtet werden. Auf dem Heimweg bot Wau sein Leibliches dem Zustrom der feuchten Kälte dar, ließ die Mantelfalten wie zwei lose hängende Schwingen um die Beine schlagen, gab der Kühle um ihn ab, soviel sie von seiner Wärme verlangte. Sein Kopf war heiß, manches Glases Zugebrachtes hatte ihm gutgetan und den Ballon seiner Seele gebläht, und so einer Zugeknöpftheit doppelt ledig stand er bald wieder an der Stelle der Straße, wo die Linden begannen, oder vielmehr, da er nun in umgekehrter Richtung strebte, aufhörten. Er dachte noch immer an den gestohlenen Mond und welche Bewandtnis es mit des Assessors Aufrollung eines so besonderen Falles von Unwahrscheinlichkeit eigentlich gehabt haben könnte, als er unvermutet unter der bewußten Linde stand und durch ein Geräusch von oben her, gerade als knacke es in den gerüttelten Ästen über ihm, an die nun wohl halberfrorene Katze erinnert wurde, die er just in irgendeinem Winkel seiner Gedanken unbeachtet gelassen. Ein Lichtlein aus dem Bodenfenster des Kaufmanns Paap, von dessen Ladentür einige Meter entfernt der Baum stand, schlug seinen Schein in die zarten Säulen des ragenden Baums, eine Stange schob sich langsam aus dem Fenster und machte sich mit der Spitze heftig in den Zweigen zu tun, es fauchte und mauzte aus einem bescheidenen Organ da oben, ein Körperchen glitt oder stürzte, nur als Schatten bisher spürbar, schien zwischen zu engen Gabelästen einen Augenblick eingeklemmt bleiben zu wollen, gab ein wütiges Lüftlein Weh und Ach von sich, purzelte tiefer und tat einen fast unhörbaren Fall zu Waus Füßen, der nun dem erlösten Tierchen beigesprungen wäre, wenn es seiner Warmherzigkeit bedurft hätte. Es war aber ein auf nichts als Flucht bedachtes Stück matter Erhellung auf dem Pflaster, das sich durch schnellstes Verschmelzen mit der Dunkelheit jeder Weiterung der Vorgänge entzog. Paap zog seine Stange ins Dachfenster zurück und schlug die Scheiben zu. Er hatte das Katzenmiau vor seinem Hause nun endlich satt gehabt und mit einer Bohnenstange seine Nachtruhe erfochten. In Waus Magen grimmte etwas wie Katzenjammer. Er fand zudem wie schon sonst gelegentlich eine Ungehörigkeit unbestimmbarer Art im rechtmäßigen Bestand der Dinge allzusicher hausen. Der gestohlene Mond spukte noch in seinem doch wohl von alter Reserve und anderen besseren Feuchtigkeiten zu sehr durchdünsteten Kopfe, der Ballon seiner Seele hatte seine pralle Rundung verloren und verzog sich in Falten einer Mißlaune, die die Schuld an dem Versagen noch besserer Aufgeblähtheit dem Magen zuschob. Kurz, Wau ergrimmte über unbestimmbare Ungehörigkeiten und versetzte durch hartes Auftreten der nun doppelt erbärmlichen Normalität seiner Wohnstraße knallende Ohrfeigen. Er war allein im Nachtrevier des Viertels und hätte sich, wenn er gewollt hätte, noch besser austoben können, aber da er ein Mann von einiger Erfahrung war, so kannte er die Überflüssigkeit solcher Ausschweifungen und beschloß, dem Grimm seines Magens nicht länger zu widerstehen und die Zerteilung der Dünste seines Kopfes dem Walten der Nachtstunden zu überlassen.
Drittes Kapitel
Wau in der Würde eines Mannes von einiger Erfahrung Respekt zu verschaffen, würde nicht schwer fallen – er besaß Erfahrungen mancher Jahre, die ihm eine unheilbare Zerrüttung seiner Ehe zugeteilt hatte, und diese Erfahrung war der sicherste Besitz seiner jüngeren Jahre geworden. Er war zwar noch Ehemann, aber der Mann einer immer abwesenden Frau, die ihre Krankheit erträglich, ja fast unmerklich fand in dem Heim eines Arztes, der ihre reichen Gaben als Helferin und Vertraute für ihn vorteilhaft und für sie selbst segensreich ausbildete und so ihr Leben, in dem er den Anschein einer Heilung erzielte, sachte und klug dahin lenkte, wo es seiner Last ledig schien. Daß die Richtung dieses Heilweges immer weiter von dem ehelichen abwich, war freilich unvermeidlich, denn die wenigen Versuche, ihn bei günstigen Anlässen wieder in den ehelichen einmünden zu lassen, als träfen sich beide unvermutet zu gemeinsamem und dauerndem Verlauf, hatten immer nur die alten Unmöglichkeiten aufgedeckt. Wau hatte gelitten und erfahren, was durch Leiden zu erfahren ist, er hatte gelernt, da er mehr zum Geben als zum Erraffen angelegt war, gut sein zu lassen, was böse schien. Er verübelte dem Leben nichts und nahm es doch nicht leicht. Tröstungen, die ihm gefällig sein wollten, ließ er zwar nicht unbeachtet, doch dienten sie ihm lediglich als Balsam, mit dem sich eine gesunde Haut wohl einmal erfrischen läßt, ohne seiner zu bedürfen. – Ja, er befand sich in dem Zustand der Trostlosigkeit leidlich aufgehoben und ließ es sein Bewenden haben mit mancherlei Dingen, die all und jeder zum Guten und Nötigen rechnet, und das fehlende, »Glück« benannte Rätselvolle in seinem Versteck auszukundschaften, sich müde und mager danach zu laufen, trieb ihn keine zwickende Vorstellung von unbestimmten oder viel verheißenden Möglichkeiten. Man würde Wau nicht gerecht werden können, wollte man denken, es handele sich hier um sein auszupinselndes Charakterbild, sein Ganzes, als hieße es, ihn, aus diesen und noch weiteren raren oder wunderlichen und erratbaren oder auch nachweisbaren Teilen zusammengesintert, wie eine runde Summe, mit der sich hantieren läßt, in den Auf- und Abstieg der Vorgänge einzusetzen. Denn die Erforschung eines Charakters ist eine Aufgabe, die gar nicht gestellt wurde, wobei überhaupt unerklärlich scheint, was und wer ein Charakter ist, ob er im Laufe der Begebenheiten einer wurde, ob er fertig als solcher in die Begebenheiten hineinstolperte, schlecht und recht bestehend als derselbe, mit dem nachher nichts weiter war als vorher, so daß er zur Hintertür der Geschehnisse entlassen werden kann als entweder untadelig und von imposanter Unerschütterlichkeit oder als schillernd und mäßig achtbar, aber desto größere Gebiete, ja vielleicht das Ganze der menschlichen Eigenheiten fassend, also gleichsam einen Teil für das Ganze bildend – oder endlich, ob er verdarb und die Eigenschaft als Charakter überhaupt verlor und in die Grenzenlosigkeit einging, die alles umfaßt, enthält, gebiert, gestaltet, entläßt und gestaltlos empfängt, über nichts von allem Derartigen soll gehandelt werden, nichts, was zu einem guten und gerechten Bündel von Romankapiteln gehört, wird verheißen.
So kann auch ein anderer sonst wichtiger Umstand bei der Betrachtung eines Stück Lebens außer acht bleiben, die Erwähnung des Berufs, den sich Wau – schon stellt ein falsches Wort sich ein: erwählt. Nichts wäre unrichtiger, als von Waus Hingabe an die ihn einschließende Beamtenfachschaft zu sprechen, nichts von Berufung, Ehrgeiz und Strebsamkeit, nichts von Keuchen und Hasten auf der vorgeschriebenen Laufbahn! Es war ihm gegangen wie manchem Jüngling vor und mit ihm, dem eine Gelegenheit den Blick auf ein schmuckes und sauberen Anschein gebendes, Zuverlässigkeit und Treue voraussetzendes, nicht eben gar zu genau reglementiertes Vertun von Zeit und Weile gegönnt, wobei das Ausbrechendürfen aus den Hürden der Schule von Einflüsterungen einer Stimme angepriesen wurde, die den wächsernen Willen so manches Jünglings vor und mit ihm eingeschmolzen und geformt hat, wie sie es mit so manchem nach ihm nicht anders tun wird. Hätte man ihm damals eine geordnete Laufbahn als Pirat einigermaßen praktikabel und zugleich als respektabel angepriesen und seine Vorbildung für ausreichend erklärt, er wäre gewiß ins Piratengeschäft gegangen. So zog er einige Jahre in grünem, knappsitzendem Uniformrock durch die Normalstraßen der Stadt, hatte eine dünne Stange von Degen längs der Beine baumeln und befleißigte sich jeder sonstigen Sauberkeit und frischen Anstands. Jetzt bekleidete er längst ein Spezialamt, für das er erst versuchsweise verwandt und, schnell bewährt, als die einzige in der Gegend verwendbare Kraft erkannt oder doch erklärt worden war. Degen und Uniformrock waren nunmehr unverwendbar, und Herr Schneidermeister Altrog besorgte das Nötige für den äußeren Aufputz. Da alles dieses als unvorhanden und längst gewesen neben dem Langen und Breiten von Waus Gegenwärtigem gelten kann, so verdient es, wenn überhaupt wahrgenommen, gänzlich vergessen zu werden.
Vielleicht könnte man noch schnell einige rührende Züge von Waus Wirtschafterin anbringen. Aber der Verdacht entsteht, ob nicht gerade die rechte Auswahl verfehlt und die Aussage über besagte Person nicht als Preisgabe grotesker und lächerlicher Seiten empfunden würde. Auch die Chronik über Tun und Lassen von Fräulein Viereck würde ins Romanhafte ausarten, es genügt festzustellen, daß Wau auch in Hinsicht ihrer rührenden und gelegentlich seltsam beliebigen Pflichtäußerungen das Schicksal nichts entgelten ließ, was es ihm durch Fräulein Viereck angetan. Fräulein Viereck war unüberbietbar ehrlich und treu. An Essen und Trinken und Eifer in Förderung von Waus sonstiger leiblicher Pflege ließ sie es mit Absicht nicht fehlen; obgleich sie aber von Haus aus zu anderem bestimmt gewesen war, so rang sie doch in dieser Hinsicht mit manchem Fehlversuch nach dem ersten Grade, und gelegentlich glückte ihr auch, das Richtige oder wenigstens das Bessere zu treffen. Aber Wau verübelte es dem Schicksal und Fräulein Viereck gemeinsam ja nicht, daß es im ganzen bei Versuch und Streben blieb, und verzehrte manches Mittagsmahl stillschweigend, wo ein vorsichtiger Hinweis auf das wiederum verfehlte Bessere angebracht gewesen wäre. Nur ein- oder zweimal in längeren Jahren stellte er ein Mißlingen fest. Wenn er dann ein Gericht ungegessen ließ und die schlichte Angabe seiner Ungenießbarkeit achtungsvoll genug gemacht hatte, so sagte Fräulein Viereck wohl leichthin: Mir schmeckts – und ließ es sich weiter schmecken, woran dann auch Wau nicht wie an etwas Ungehörigem Anstoß nahm. Die Ungehörigkeiten, die im Bestand der Dinge allzusehr hausten, waren von einer Art, daß sie mit Fräulein Vierecks Sphäre des Häuslichen und des Tages Behagen oder Ungemächlichkeit nichts zu schaffen hatten. Wodurch sie aber in Waus Gemüt zu solchen wurden, von ihm wahrgenommen, und, einmal erkannt, nicht wieder von ihm wichen, sondern sich vom Sein aller Dinge sonst abhoben, am Himmel seiner Seele aufstiegen und immer schonungsloser über ihn walteten, ja wuchteten, daran trug die reine bloße und unabdingliche Ursachlosigkeit des Geschehens überhaupt die Schuld, das kam vom Sollen aus der ausgemachten Unergründlichkeit und verhaftete, verfugte sich in Waus Natur, daß sie sich an ihr wandelte. Mehr, als da zu sein, versuchte es erst und vollbrachte es dann so, daß Wau mit ihm, diesem ursachlosen Geschehen, verschmolz, an ihm und mit ihm anstatt seines eigenen Lebens gewann, sich an ihm steigerte und an ihm verdarb, was denn also Waus gutes und großes Schicksal genannt werden muß.
Viertes Kapitel
Jedermann war Wahls Freund, guter Bekannter, Mithelfer bei Zeitverderb, Abladeort für den Überfluß an Langerweile, die ihn gelegentlich befiel. Kurz, Wahl bediente sich jedermanns Gefälligkeit, womit es ihm nur selten mißlang. Alle kannten ihn, und er kannte alle. Daß Wau sich ihm verband, war ein Geschehen aus der schon einmal angeführten ausgemachten Unergründlichkeit. Zuerst kneipten sie miteinander in zufälliger Geselligkeit, dann ergaben sich Gelegenheiten, wo nicht der Trunk, sondern der unselige Zustand einer verbindenden Gegenseitigkeit in allerlei Not sie zusammenführte und der gemeinsame Trunk als allzu willkommene Abhilfe, als Tor ins Freie zu wechselseitiger Erleichterung versuchsweise vorgeschlagen wurde. Wau, sonst vertrauensselig, hatte aus Wahls Allbeliebtheit eine Mahnung zur Zurückhaltung für eine Person entnommen. Er war der fetten Festivität von Lebenshaltung ein wenig gram geworden und fühlte sich von den immer neu aufzischenden Raketen der Lust an den gangbaren Arten der üblichen Hochleberei leicht angewidert. Wahl, der überall mitmachte und unermüdlich alle Anlässe zu Schlamperei, ja Luderei fleißig nutzte und studierte, machte ihn besorgt für seine mit den Jahren in bescheidenen Maßen gediehene Zurückhaltung, ja ihm ward bänglich in seiner Nähe, wenn er spürte, daß Wahl es mit ihm anders als mit den meisten hielt. Er verschonte ihn sozusagen mit dem Anteilnehmen an ganz Grobem und Massivem seiner oft wüsten, manchmal bedenklichen, immer offenkundig über die Grenzen der Leidlichkeit hinausführenden Betriebsamkeit. Es schien Wau, als markierte er den im Grunde höherwertigen Menschen, wenn er mit ihm zusammentraf, und als mache es ihm nicht viel Mühe zu scheinen, was er letzthin nicht war, nämlich ein Jemand für sich, der dieses Sein im Eigenen als löblich anerkannt zu wissen wünscht. Diese Bänglichkeit Waus wich nur selten in langen Jahren, in denen er sich von Wahl umkreist wähnte. Kneipgeselligkeit verpflichtete zu nichts, und er ließ sich Wahls Gegenwart gefallen oder mied sie, wie es ihm beliebte, ja gelegentlich entartete seine Reserviertheit in offenkundige Ablehnung, die ihm dann selbst Kopfzerbrechen über Unklarheiten im eigenen Innern machte, indem er einen Vorwurf aus Wahls Wesen in sich eindringen und Stimme werden ließ, die scheinbar als seine eigene gegen sich selbst für Wahl laut wurde. Da sie beide mäßige Trinker waren, so gab es der Gelegenheiten zur Zwiesprache beim Pokulieren mehr, als wahrgenommen wurden, und so vergingen manche Jahre, ehe die Freundschaft als ausgemacht und gültig in ihrer beider Bewußtsein als Bau und Obdach für ihre Gemeinsamkeiten dastand.
Fünftes Kapitel
Wau hatte vielerlei durcheinander gelesen, behalten und vergessen. Nach welchem Richtpunkte nun aber das Behalten, nach welchem anderen das Vergessen geschah, blieb ihm verborgen, indem sich das Zurückbleibende der aufgenommenen Vorstellungen gleichsam ungefragt in ihm etablierte, das Entschwundene sich davonstahl, als müßte er es selbst wissen, wo seines Bleibens sein dürfe, aber gewiß nicht in Waus Wesen. Indessen mußte er wahrnehmen, daß manches Vergessene sich anscheinend nur darum ungegenwärtig gemacht hatte, weil ein Gleichwertiges in ihm es als unnötig und unerbeten verjagt oder ihm das Dasein und Bleiben sonstwie unbehaglich gemacht hatte. Der Platz war sozusagen schon besetzt, nur daß es, das Ding, das Wort oder Inbegriff von tausend Buchseiten geduldig im Bewußtlosen lag und den Verbleib in Unkenntlichkeit schlummernd und gleichmütig hatte geschehen lassen, bis ein Zeitpunkt sich erfüllt und ein Erwachen gekommen war. Dann, so schien es, hatte das Eingewachsene das Zugewachsene als überflüssig verscheucht. Das Zurückgebliebene, in Wau Wurzel Schlagende, in ihm wie in einem Treibhaus Wuchernde, was er hegte, pflegte und von dessen Gedeihen er gute Ernten erhoffte, dieser gern empfangene Wert begann zuzeiten und mit öfteren Malen immer stärker Waus Unbehagen auszumachen, denn womit, dachte er wohl, habe ich das alles verdient, wenn es gutes Gut ist, und was riskiere ich andererseits, wenn das Gut schlechten Wuchses ist, da ich schließlich nur durch Zufall gefunden und nach Belieben gewählt habe. Inwiefern ist es nun mein eigen, da ich es hingenommen habe, indem ich meinem geringen eigenen Gut ein höheres zuzufügen trachtete, ohne Wissen vom Grunde und der Beschaffenheit seiner besseren Art? Ist es in der Tat mein geworden, oder verbleibt es nur in meiner Obhut, gewissermaßen auf Abruf anvertraut? So wankte Wau zuzeiten zwischen Überzeugungen und Zweifel hin und her, ertappte sich dabei auf Versuchen der Scheidung zwischen dem Eigentum aus angeborener Zugehörigkeit und dem erworbenen Besitz. Da ergaben sich dann Augenblicke der Bestürztheit, denen er schlecht gewachsen war, weil er den Grund unten seinen Füßen schwanken spürte und im Ernst zweifelte, ob er – er oder, wenn schon kein anderer, so doch überhaupt Jemand sei. Denn was er von sich selbst wußte, war lückenhaft und in Zeiten besonderer Bereitschaft zur Prüfung seiner selbst gleich nichts. Ich bin doch und trotzdem, sagte er dann wohl böse, denn wo ich aufzuhören scheine, findet sich sogleich etwas, als das ich mich alsbald wieder erkenne, nicht eben als etwas erhebend zu Bezeichnendes, aber, besser als das, als etwas Unbedingtes und Wirkliches, denn darauf kommt es am Ende überhaupt an. So sagte er dann und wußte doch, daß, worauf es ankommt, auch nicht ausgemacht, sondern wiederum von seinem Wünschen und Belieben nach Bedarf des Augenblicks bestimmt war. Wahl machte es ihm, wenn sich das Gespräch auf dieses und ähnliches richtete, nicht leicht. Er spöttelte ja nicht, was am Ende Wau in seinen Gedankengängen nicht verwirrt haben würde, aber er tat etwas Schlimmeres, indem er die Fragen wohl hin und her wendete, abwog und Waus Meinung so oder so bewertete, je nach seiner Aufgelegtheit, wobei in Wau der Zweifel immer neu erstand, ob Wahl die Probleme, Waus wichtigste Angelegenheiten, überhaupt als Probleme oder nur als Gesprächsstoff ansah, mit dem man in Ermangelung eines andern nicht gerade Mißbrauch trieb, solange es dem geselligen Beieinander nicht Abbruch tat.
Sechstes Kapitel
Als Wau längere Jahre hindurch ziemlich regelmäßig seinen Nachmittagskaffee im »Café«, was sich schlechthin das Café nannte, im Gegensatz zu zwei oder drei anderen, worunter auch das erste am Ort, die man mit Namen der Besitzer unterschied, in diesem zum Verkriechen verbauten Hinterzimmer, eingenommen hatte, wußten diejenigen wenigen, die ihn suchten, ihn in der Verlorenheit, die er um diese Tageszeit geräuschvolleren Zuständen vorzog, zu finden und, wie es Wau manchmal auslegte, zu stellen. Kurze Zeit hindurch vertrieben ihn die Überfälle einer Sorte von unnützen Liebhabern des guten Getränks, die in dem Dunkel dieses Hinterhalts und seiner Sitzgelegenheiten eine Art Börse mit über schmalen Marmorplatten zusammengesteckten Köpfen abhielten und sich den Anschein von lichtscheuen Umtreibern in geheimnisvollen Geschäften gaben. Wau saß also einige Monate an der Rückwand des Cafés ersten Ranges am Markt, raschelte in Blättern, studierte im Wandspiegel gegenüber das Treiben auf dem Markt bis zum Ende der Büttentwiete hinauf, ließ das Stimmen der Instrumente als vorbereitendes Räuspern des pünktlich antretenden Orchesters mit Behagen im Raume raunen. Denn er meinte, aus diesem Girren von Klängen alles und zwar Besseres zu hören, als was diese Auslese von Musikanten in einem Cafékonzert ersten Ranges am Ort mit aller Gelassenheit ihrer Meisterschaft demnach leistete. Die ganze Musik – dachte Wau bei An- und Abklingen und dem schwirrenden Durcheinander der Töne – und die bloße Ahnung des Möglichen beglückte ihn. Wenn dann die ersten Streiche fielen und Bums und Sums, Schmalz und Gewalz mit den Flügeln um sich schlug, zahlte er und enteilte fluchtartig. Schließlich saß er unversehens doch wieder im Verlorenen des alten Absteigequartiers, wie das Café von den Lebensfreudigeren anzüglich und spöttisch zugleich genannt wurde. Hier traf sich nun aber auch der Assessor Bostelmann mit einer Verkäuferin des erstrangigen Kaufhauses am Ort, da Standesrücksichten ihm verboten, dem Kinde eine Tasse Kaffee und ein Gläschen zum Kuchen und Zigaretten bei besserer Beleuchtung anzubieten, was aber im Halbdunkel und an Tagen, wo schon mittags Lichter dürftig genug aushelfen, bestens anging. Wenn Fräulein Linde sich gütlich getan und ihren Posten im Warenhause wieder versah, nahmen die beiden weitläufig bekannten Herren wohl Notiz voneinander, grüßten im Vorübergehen oder ließen ein paar Worte fallen, wechselten abgelesene gegen frischere Zeitungen und schließlich auch einmal die Plätze, rückten in der Verborgenheit der Nische zusammen, legten die Blätter beiseite, was alles der Assessor in einer Art von Absichtlichkeit anregte, die er nicht einmal zu verbergen sich bemühte. Er ist schon betrunken, dachte Wau, aber er sah auch, daß, wenn es so war, der Assessor Herr seiner Wallung geblieben war und gedachte, es weiter zu bleiben. Das blasse, sonst von besserem als natürlichem Rot verpatzte Gesicht des Fräuleins hatte Waus Aufmerken schon angeregt. Er hatte flüchtigen Blicks das wie immer hochfarbige Gesicht des Fräuleins gestreift, nicht ohne den Schatten einer blassen Vorstellung haften zu fühlen, daß die Farbe wie verrutscht war und weniger von Natur als von mangelhafter Kunst erzeugt. Das Quartier war leer geworden, und die Wände hielten ihre Ohren offen. Der Assessor mußte der von Neugier heißhungrigen Luft des Raums – räucherig, verbraucht, parfümiert von gemischten Dünsten verschiedenster Aufgüsse und Brühen, Getränke und Gebäcke – zuteilen, wessen sie offenbar noch dringend bedürftig schien. Kurz, er offenbarte Wau ohne viel Vorbereitung das Geheimnis des großen Skandals um Fräulein Linde. – Ich weiß, ohne zu ahnen warum, sagte er, daß Sie verschwiegen sind, aber ich kann es heute nicht mit mir allein aushalten und – da sind Sie nun. Wau antwortete nicht, und der Assessor entnahm aus seinem Schweigen, daß er richtig vermutet und beansprucht hatte. Wau war verläßlich, auch ohne daß der Verlaß ausbedungen und bestätigt werden mußte. Er erfuhr also, daß – nun, eine gute Anzahl der besten Namen des Städtchens genannt werden konnten – und der Assessor nannte sie alle. Des Fräuleins Not mußte von allen gemeinsam gelindert werden. Keiner von allen verhehlte seine Mitschuld und Mitverpflichtung – und alle trugen die Last der Gefahr eines unerwarteten Ausgangs der Dinge oder des verräterischen Hauches aus verborgenem Hinterhalt. Dem Assessor war das Ehrenamt des Vollziehers gemeinsamer Pflichten zugefallen, da er mit den Finessen des heiklen Geschäfts am ehesten vertraut zu sein schien, ein Zutrauen, das ihm der jugendlich flotte Zuschnitt seiner Lebensführung eingetragen. Indessen ging das alles offenbar über seine Kräfte, und Erfahrungen besaß er für diesen Fall überhaupt keine. Er saß somit in Not und Bedrängnis und wünschte sich, wenn es irgend anginge, einen Umtausch dieser ganzen Weitläufigkeiten gegen ein oder beliebig viele Duelle, die er als klare Erledigungen lobte. Wau fragte schließlich, wodurch eigentlich der Assessor, da Hilfe oder Rat in der bewußten Angelegenheit von ihm nicht erwartet werde, bewogen sei, ihm das große Vertrauen, das er gebührend anerkannte, zu gewähren, auf welche Frage hin der Assessor sich in den Stuhl zurücklehnte und den Wandfries, eine Wirkerei in süßen Tönen, über Waus Sofasitz anstarrte. Der Fries lief von einer beiläufigen Begebenheit des Sitzens eines älteren und gemütvollen Herrn vor der Stadt, während der Postwagen nahte, von Frau und Kindern erwartet, und zugleich die stille rotdächerige Stadt sich einen halben Meter weiter dehnte, in dieselbe Begebenheit des Sitzens desselben älteren und gemütvollen Herrn vor der Stadt, während derselbe Postwagen ebenso wie der erste nahte. – Ja, sagte der Assessor, warum, Herr Wau? Seitdem ich erfahren durfte, daß Sie die Schnurre mit dem gestohlenen Mond so voll Verständnis aufgenommen, seitdem, fühle ich, kann ich Ihnen alles sagen und so auch dieses, wissen Sie. – Wau gedachte zunächst, der zunehmenden Betrunkenheit des Assessors die Schuld an dieser seltsamen Wendung des Gesprächs zuzuschieben, aber obgleich der Assessor fleißig und immer wieder den Inhalt der Flasche in die Gläschen fließen ließ und das scharfe Zeugs nicht schnell genug im Hals verschwinden lassen konnte, so blieb doch seine Hand sicher, sein Griff geschickt und sein Blick von überlegener Eindringlichkeit. Er forschte in Waus Mienen. Wau hatte wohl hin und wieder an den gestohlenen Mond gedacht, aber immer mit dem Wunsch, zu wissen, was denn wohl er, der Assessor, für Vorstellungen damit verbunden hätte, wobei ihm denn diese oder jene Vermutung aufgestoßen war, ohne daß er ihr mehr als kümmerliche Bedeutung zuschrieb.
Nun muß eingeschoben werden, daß Wau in dieser Zeit von der Fülle schwerer Vorstellungen befallen war, die ihn nun einmal von Knabenzeiten an heimsuchten. Ihm kam dann, nicht als Visionen, aber als Gegenwärtigkeiten, denen er gar nicht auszuweichen gesonnen war, die Reihe seiner toten Vorfahren und Familienglieder in den Sinn, soweit er an ihrem Leben teilgehabt, den Verlauf ihres Daseins verfolgt, ihren Ausgang miterlebt oder doch genauestens mit allen seinen Umständen erfahren hatte. Alle waren schwer gestorben. Der Tod war ihnen gleichsam ein wütiger, mindestens ein kalt-grausamer Vollstrecker eines unbarmherzigen Urteils aus lautlosem Richtermunde gewesen. Waus Ergriffenheit, wenn er dieses oder jenes Nahegestandenen Ende, des Vaters, der Mutter, der Brüder und anderer, vor der schauenden Erinnerung wiederum miterlebte, überdrang ihn tagelang, und da solche Perioden von Vergegenwärtigung unermeßlicher Schwere des Geschehens nicht häufiger, aber auch nicht seltener wurden, so war am Ende der Tod in all diesen unversöhnlichen Gestalten ein Begleiter seines Lebens geworden, und er hatte sich des Gedankens an die Möglichkeit lange entschlagen, daß sein eigenes Dahinfahren dereinst ein gelinderes Geschehen sein würde als das der Früheren. Die Periode dieser nun schon lange nicht mehr Furcht erweckenden Vorstellungen, die Vertrautgewordenheit mit den wohlbekannten Schrecken der überwundenen Auflehnung des Hinhängens in vorbereitender Ahnung war gerade in diesen Tagen wieder von Ferne in Nähe gerückt und machte, ohne daß er ein kleines von seinem Zustande weder Wahl noch sonst jemand offenbarte, den schwermütigen Zustand seiner Tage aus. Gewohnt, wie er dessen war, beanspruchte der Tod, der unablässig drohende, eine Art von Gastlichkeit in Waus Gemüt, das er erfüllte und innehielt, bis er vorläufig das Quartier räumte. Ein Gast, dessen Gegenwart Wau wie durchaus berechtigt hinnahm, dessen Kommen geschah und verging, ohne daß Wau dem Geschehen in seiner Schwere hätte entweichen, der Allgegenwart und Mitdazugehörigkeit des Todes gram werden wollen. Vielmehr war es an dem, daß er jedesmal wie tief versponnen, ja unweigerlich angezogen das Verhängnis hinnahm wie einen Vorgang von unvergleichlicher Wichtigkeit, ja als etwas alles andere Ausschließendes und das andere wert- und sinnlos Machendes.
Bei des Assessors Drängen, weniger einem durch Worte als durch Blicke, war das Ganze und Starke der Möglichkeiten mit einem Schlage aufgetan. Der Mond als Trabant, Mitläufer, Leibwächter, Begleiter der Erde in all und jedem Augenblick, der Nächste und Unabwendbarste, oft unsichtbar, wie unvorhanden und jeder Wahrnehmung entzogen, dann wieder aufdringlich und fast drohend mächtig durch seine Phasen wandelnd, immer in unfaßbarer Schnelle, immer der Erde auf den Fersen wie ihre zugeteilte Notwendigkeit, traumschön und wiederum am stürmenden Himmel hinter Wolken lauernd – wie der unvermeidliche Tod, so ging es durch Waus wie durch Sturz erschüttertes Wesen. Er sagte aber nichts, sondern nickte wie im Wohlverstand der Meinung des Assessors, als lohne es nicht, noch ein Wort über eine Selbstverständlichkeit zu verlieren. Der gestohlene Tod, der nicht mehr vorhandene, abhanden gekommene, einen Augenblick nur als Tatsache anerkannt – und nun dazu die forsträtliche Familiarität und ihr bißchen Hach und Ach, als ginge es so an, zwar merkwürdig, aber nicht aufregend – und der Bürgermeister sagte obendrein: er kann mir gestohlen werden, – wenn schon! – – Übrigens, beschloß er, werde ich bei anderer Gelegenheit den Assessor befragen, und wir werden ja sehen, was schließlich und endlich er selbst denn mit seiner Schnurre anrichten wollte. Heute hat er bessere Geschäfte, dachte er und drängte nach einer schicklichen Pause des Nachdenkens über des Assessors Eröffnungen auf Abbruch der Sitzung in diesem Absteigequartier mannigfacher Bedürfnisse zu Verborgenheit und Abgeschiedenheit von erstickender Üblichkeit des tagtäglichen Lebensablaufs.
Siebentes Kapitel
Wau war wohl ein glücklicher Mensch. Eine richtige Gläubigkeit als Durchsäuerung des ganzen Menschen machte ihn zum Gast des Seins, überall in Behagen und Vertrauen. Ob das Wesen seiner Gläubigkeit in Worte und Wortgestaltung übertragen werden könne, bekümmerte ihn wenig, ja er sah in der Freiheit von jeder Fesselung durch Worte und Begriffe die beglückende Bestätigung und den Prüfstein dieses einzigen, aber tausendfach teilbaren und jedem Vorfall und in jeder Lebenslage gewachsenen Verhaltens gegenüber der Undurchdringlichkeit und Weite dessen, was er wohl einmal den absoluten Vorfall nannte. Dieser »Vorfall« war eben ein solcher, neben dem es keinen anderen gab, und so war er der einzige und allein-mögliche, eben die Welt, beschaffen wie sie war. Wenn ihn dann einmal die Vorstellung überkam: gibt es keine andere Möglichkeit?, so beschwichtigte ihn seine Gläubigkeit mütterlich mit der Eröffnung, daß jene andere Möglichkeit zur Stelle wäre, wenn es ihr bequemen werde, in Wirklichkeit über- oder einzugehen; und wenn er dann gegen die Möglichkeit der Unterdrückung der sonstigen durch die gegenwärtige Möglichkeit aufbegehren wollte, so zähmte ihn seine Gläubigkeit, indem sie ihm einen oder anderen Augenblick schenkte, in dem er in die Unaufhellbarkeit und Nacht der Tiefe der Gegenwart sekundenlang untertauchte und so gestillt Fragen und Verlangen vergaß. Woher aber nun das Spüren von Ungehörigkeiten als allzu fest eingebaut in den Bestand der Dinge ihn zu beunruhigen gekommen, danach zu fragen blieb ihm erspart, denn was ihn beunruhigte, kam gewissermaßen aus einem Belieben seiner Gläubigkeit, die in sich das Bedürfnis nach Zweifeln und Prüfungen ihrer selbst trug. Sie bedurfte es, zeitweilig gänzlich in Frage gestellt zu werden, um sich auch dann als echt und recht bestätigt zu sehen. Gläubigkeit, sagte sich Wau, hat nichts mit Glauben zu tun, sondern ist das Wissen selbst, insofern es wortlos und der Gnade des Ungeschorenbleibens von Denkmathematik teilhaftig geworden ist. Dank dieser Gnade und im Besitz dieses erhobenen wortlosen Wissens bin ich allwissend oder doch nirgends einer Grenzsetzung und Einhürdung bewußt wie ein Fisch im Teiche, der wohl einmal mit der Nase ans Ufer stößt, aber immer erfahren darf, daß es nach hinten und allen Seiten weitergeht im scheinbar Unermeßlichen, der das Kehren, Wenden und Kreisen betreibt und lebt, wie sich der Fisch sein Leben im schrankenfreien Überall vorstellt.