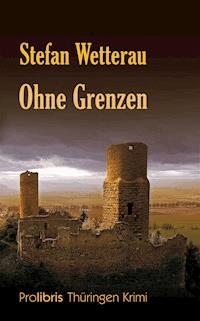8,99 €
Mehr erfahren.
Sommer 2034: Widerwillig lässt sich Simon zur Teilnahme an einem virtuellen Klassentreffen überreden. Nicht nur sind ihm seine ehemaligen Klassenkameraden fremd geworden, er misstraut der modernen Technik, die sie gemeinsam ins Florida der 1960er Jahre führt. Es dauert nicht lang, bis sich Simons Bedenken der Technologie gegenüber bestätigen: Zunächst seltsame, dann beängstigende Vorfälle häufen sich, die wie technische Fehler aussehen und Simon an den Rand des Wahnsinns führen. Und ihm dämmert, dass jemand sie alle in der Hand hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über den Autor
Stefan Wetterau wurde 1972 im nordosthessischen Herleshausen geboren. Er schreibt seit frühester Jugend, inspiriert von Romanen zahlreicher Autoren aus unterschiedlichsten Stilrichtungen. So lassen sich auch die Genres seiner bisherigen Veröffentlichungen selten in Schubladen sortieren, ihre Geschichten überschreiten diese Grenzen oft in überraschende Richtungen.
Hauptberuflich ist Stefan Wetterau – nach einer Lehre zum Landschaftsgärtner und einigen Jahren in diesem Beruf – selbständiger Programmierer und Webentwickler. Neben dem Schreiben widmet er sich dem Schlagzeug und der Gitarre. Er lebt mit seiner Frau seit der Jahrtausendwende in Sindelfingen.
Mehr unter https://www.stefanwetterau.de
Stefan Wetterau
DER GLANZ DES ROSENKÄFERS
Roman
© 2022 Stefan Wetterau
Coverdesign von: Doreen Wetterau
ISBN Softcover: 978-3-347-67812-5
ISBN Hardcover: 978-3-347-67818-7
ISBN E-Book: 978-3-347-67820-0
ISBN Großschrift: 978-3-347-67826-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
1. Auflage 2022
Sämtliche Handlungen und Personen im Roman sind frei erfunden und jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig
Für alle Menschen, die im Kleinen noch das Große sehen
Und umgekehrt
0
Ich hasse sie. Fast alle.
Auf diese schlichte Aussage muss ich meine Empfindungen kondensieren, um halbwegs die Motivation für diesen Plan darlegen zu können.
Hass ist ein derart simpler Begriff, so wenige Buchstaben, auch in anderen Sprachen – hate, haine, odio. Viel zu einfach, um ein Gefühl solcher Kraft und einzigartiger emotionaler Energie zu beschreiben.
Dabei könnte ich mich differenzierter erklären, so wie sich mein Fokus nicht auf alle Beteiligten gleichmäßig richtet.
Weshalb? Sie tragen nicht durchweg dieselbe Schuld, auch wenn sie sich schuldig gemacht haben, jeder und jede auf seine und ihre Weise. Sei es durch offen aggressives Verhalten bis hin zum tätlichen Angriff, durch Unterdrückung, verbale Attacken. Verharmlosung werfe ich ihnen vor, das Kleinreden, das Schulterzucken. Die Ignoranz und das bewusste Wegsehen. Und schwer wiegt die Schuld der Lüge, das Verdrehen von Fakten, Aussagen anderer und das eigene Tun betreffend. All dessen haben sie sich schuldig gemacht.
So wie ich.
1
Derart gerade Straßen hatte Simon noch nie gesehen. Die durchgehende Mittellinie spaltete das graue Asphaltband symmetrisch in zwei Hälften. Dass Amerika wegen der schieren Größe, der flachen Landschaften hier in Florida und der Distanz zwischen den einzelnen Orten solche effizienten Routen wie mit dem Lineal gezogen hatte, wusste er von den zahlreichen Erzählungen seiner Schwester.
Carola, die er wie alle ihre Freunde Carol nannten, hatte diesen Winkel Amerikas in den vergangenen Jahren oft aus beruflichen Gründen besucht. Der Stress, den ihr Job als Flugbegleiterin mit sich brachte, wurde durch regelmäßige kurze Auszeiten an den unterschiedlichsten Orten der Welt abgemildert. Mit Begeisterung hatte sie ihrem Zwillingsbruder oft von den weiten Landschaften des Sunshine-States berichtet, den endlosen Stränden, den pulsierenden Städten, Miami, Orlando. Neid empfand Simon nur zu Beginn, als seine Schwester neu in dem Job war und ihre Euphorie sich aus Restbeständen jugendlicher Energie speiste. Inzwischen war diese einer gewissen Ernüchterung und Routine gewichen, Carol agierte besonnener. Die Jet-Lags taten ihr Übriges.
Die Gelassenheit machte sich an ihrem Fahrstil bemerkbar. Früher wäre Simon nicht freiwillig zu ihr ins Auto gestiegen. Sie war damals ein unglaubliches Energiebündel gewesen, das sich unschwer durch alle möglichen Reize vom eigentlichen Tun ablenken ließ. Es grenzte an ein Wunder, dass sie nie mehr als den einen oder anderen Blechschaden verursacht hatte. Heute steuerte Carol das knallrote Cabrio lässig mit drei Fingern einer Hand. Die gegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen machten ihr hier nichts aus, dafür war sie viel zu entspannt.
Simons rechter Arm lag auf der Tür, hin und wieder hob er ihn an, ließ ihn vom warmen Fahrtwind tragen. So wie sie es als Kinder getan hatten. Ein zufriedenes Lächeln schlich sich hartnäckig in sein Gesicht. Warum auch nicht? Einmal mit dem Cabrio durch Amerika cruisen, den ganzen Scheiß mit der Arbeit im engen, grauen, spießigen Deutschland hinter sich lassen. Davon hatten Carol und er jahrelang geredet. Und jetzt taten sie es, und es war so einfach und so perfekt.
Die Sonne stand hoch im Süden und ließ den heißen Straßenbelag flimmern. Durch die dunklen Sonnenbrillen nahmen die beiden Zwanzigjährigen die Farben noch kräftiger wahr. Die Konturen von Bäumen, Gräsern und Cumuluswolken erschienen fast unerträglich scharf.
Aus dem Radio grummelte und schraddelte Muddy Waters‘ unerreichtes Mannish Boy, während sie ihren Blick über das schier endlose Marschland des Lake Okeechobee schweifen ließen, dessen Ufer sich zu ihrer Linken dahinzog. Die gleichnamige Stadt hatten sie vor einer halben Stunde hinter sich gelassen und fuhren nun auf der Florida State Road 78 am See entlang ins Herz des Glades County.
Ziel war LaBelle, »die Schöne«, wagte Simon eine freie Übersetzung. Ob der Name der Stadt Ehre machte, würde sich noch zeigen. Es roch hin und wieder nach Sumpfland und Morast, dann schlug ihnen der Geruch von kochendem Asphalt und Diesel entgegen, wenn Carol einen Sattelschlepper überholte. Der späte Junivormittag war extrem heiß, selbst für den siebenundzwanzigsten Breitengrad.
Beiläufig strich Simon über die beigefarbene Innenverkleidung der Beifahrertür der Corvette. Seit etlichen Kilometern hatten sie beide kein Wort gewechselt und fanden das Schweigen überhaupt nicht peinlich.
Wegen des ganzen Geschwätzes mit Fluggästen und Kunden machte es Carol und Simon nichts aus, wortlos in diesem Wagen zu sitzen und die schwüle Luft Floridas an sich vorbeibrausen zu lassen. Einmal musste Carol scharf bremsen, weil ein Gürteltier über den Asphalt watschelte. Kurz sah es sie träge an, dann verschwand es im trockenen hohen Gras neben der Straße.
Irgendwann brach Carol das Schweigen. »Du siehst gut aus, hatte ich das schon erwähnt?« Ein ironisches Lächeln umspielte ihre Lippen. »Wenn man das so sagen kann.« Sie warf ihrem Bruder kurz einen Seitenblick zu und richtete ihre Augen wieder auf die Straße.
Simon lachte auf. »Ja, ist schon klar. Wenn du wüsstest, wie ich wirklich aussehe! Ich habe monatelang Überstunden geschoben, mich mit nervigen Kunden rumgeschlagen und zu wenig geschlafen.«
Acht Monate Arbeit ohne einen einzigen Tag Urlaub hatte er hinter sich, und sie hatten Wochenendschichten geschoben, alles für die Kohle. First-Level-Support für einen Internetkonzern war mentaler Höchstleistungssport und moralisch fordernd, wenn man im Sinne der Firmenphilosophie handeln wollte, die den Kunden auf einen unantastbaren Sockel hievte. Mit welch ausgemachter Dummheit man sich dabei bisweilen konfrontiert sah, entbehrte für Außenstehende jeglicher Vorstellungskraft. Den ganzen Tag, Stunde um Stunde, genervtes Geplapper von überforderten Tech-Dilettanten, die den Fehler logischerweise beim Anbieter vermuteten. Und dabei zu blöd waren, einen Stecker in die richtige Buchse zu schieben oder ihren Chip in die Nähe eines Transponders zu bewegen. Hin und wieder taugte eine Konversation zur kollegialen Aufheiterung, wenn nicht sogar kollektivem Gelächter. Die Mehrzahl der verbalen Auseinandersetzungen zehrte dagegen gewaltig an der Arbeitsmoral aller Help-Desk-Mitarbeiter.
Entspannt lehnte sich Simon mit der Schulter gegen die Beifahrertür und betrachtete seine Schwester mit eindeutig übertriebenem Interesse.
»Was glotzt du so?«, blaffte sie ihn unsicher grinsend an, als sie es bemerkte. »Stimmt was nicht?«
»Das Kompliment gebe ich gern zurück«, erklärte Simon. »Den Sixties-Style hast du gut drauf, das muss ich zugeben.«
Mit der Cat-Eye-Sonnenbrille und dem wehenden weißen Schal war jedes Klischee erfüllt und hätte Grace Kelly vor Neid erblassen lassen. Das taillierte sonnengelbe Swingkleid ergänzte den Look perfekt.
Diese Gedanken behielt Simon für sich. Er liebte seine Schwester, vor allem, weil sie sich nicht oft sahen. Die räumliche Distanz ihrer Wohnorte, die sich berufs- und familienbedingt ergeben hatte, verhinderte regelmäßige Treffen in kurzen Zeitabständen. Einzig Besuche bei ihren Eltern, die inzwischen gemeinsam in einem Seniorenheim lebten, führten die Familie zwei- bis dreimal pro Jahr zusammen.
»Du weißt, dass das nur Fassade ist«, erwiderte sie trotzig. Simon sah das unterdrückte Lächeln. Sie seufzte. »Wer hat sich das Setting denn dieses Mal ausgedacht?«
Ihr Bruder zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Einer von den Wichtigs, vermute ich. Nina oder Yvonne. Die haben doch ein Faible für so ausgefallene Drehbücher. Weißt du noch, vor fünfzehn Jahren? Disco-Mania?«
»Hör bloß auf!«, schnauzte Carol ungehalten. »Die ganze Scheiß-Musik, Schlaghosen und Glitzer. Ich bekomme heute noch das Kotzen!«
»Ach, komm! Wieso? War doch lustig! WaaaaaayMCA!«
»Hör sofort auf! Den Song krieg ich für den Rest der Woche nicht mehr aus dem Kopf.«
»YMCAy – hey!«, fuhr Simon ungerührt fort und übertönte damit das Autoradio. Seinen Gesang begleitete er mit übertriebenen Disco-Moves. Er bemerkte Carols Reaktion. »Was grinst du so?«
»Ich frag mich gerade, welcher von den Village People du gewesen wärst.« Sie schenkte ihm ihr breitestes Zahnpasta-Lächeln.
»Schau auf die Straße, Schwester«, antwortete Simon, ein Grinsen vermochte er jedoch auch nicht zu unterdrücken. »Die waren doch alle schwul.«
»Na und?« Stirnrunzeln bei Carol.
Er dachte nach. In den Siebzigern war Homosexualität ein heikles Thema, und eigentlich vertrat er die Ansicht, die Gesellschaft wäre heute ein Stück weiter. Sie beide wussten es besser.
»Welche Rolle hätte ich da schon übernehmen können? Einen IT-Nerd gab es in der Band nicht.«
Carol schmunzelte. »In der Tat.«
»Ich frage mich, was wir in zehn Jahren veranstalten. Oder in zwanzig.«
»Das wäre dann 1944.«
»Party im Führerbunker. Garantiert eine Bombenstimmung!«
Seinen Sarkasmus teilte Carol in dem Fall nicht. »Da sollten sie sich was anderes ausdenken«, gab sie schmallippig zurück. »Wenn wir bis dahin den Zirkus überhaupt noch veranstalten. Wir werden ja auch nicht jünger.«
Simon rümpfte die Nase. »Da ist was Wahres dran«, gab er zu.
Carol ließ die Corvette ausrollen und brachte sie an einer Haltelinie zum Stehen. Die State Road 78 mündete hier in den Highway 27. Links, gen Osten, lag in zwei Meilen Entfernung Moore Haven, eine dieser nichtssagenden Südstaatenstädte, deren Straßenplanung ausschließlich Neunzig-Grad-Winkel kannte und beim Durchfahren in Erinnerung blieb wie der Geschmack von Wasser. Aus der Richtung näherte sich mit beträchtlichem Gepolter ein imposanter Truck. Die schwarze Zugmaschine war üppig mit Chrom verziert und blitzte in der hoch stehenden Mittagssonne wie ein Weihnachtsbaum. Die Plane des Aufliegers zeigte den mittels kursiver Schrift Dynamik suggerierenden Namen einer US-Firma, die Simon nicht kannte.
Irgendjemand aus der Abschlussklasse hatte bereits beim ersten Klassentreffen zum fünfjährigen Jubiläum des Mittelstufenabschlusses die Idee mit den Retro-Events präsentiert. Dieselbe Zeitspanne, die seit der mittleren Reife verstrichen war, wollten sie bei ihren Zusammentreffen in die Vergangenheit reisen und diese Zeiten aufleben lassen. Die ambivalente Ära der Popper und des Grunge zu Beginn der Neunziger war das erste Thema. Da hatten sie sich hervorragend einfühlen können. Nach der anfänglichen Zurückhaltung waren rasch alle Hemmungen gefallen, zumal nicht wenige aus der Klasse durch ihre Eltern und eigene Erinnerungen aus der Kindheit und beginnenden Pubertät Kontakt zu dieser Zeit herstellen konnten. Zu Paula Abdul und Nirvana gleichermaßen hatte die Tanzfläche gebrannt.
Gefolgt waren die Achtziger in stonewashed Jeans, Schulterpolstern und Leggins. Simon gruselte es beim Gedanken an die damalige Mode und die Musik. Der bevorstehende Exkurs in die frühen Sechziger lag ihm da näher, selbst wenn sie zu der Zeit noch nicht auf der Welt gewesen waren. Die Klamotten dieser Ära hatten ihre zigfach wiederholte Renaissance verdientermaßen erlebt, und auch die Songs aus der Zeit waren ihm näher. Passend dazu drang Sam Cooke’s Twistin the Night Away aus dem Radio.
Geduldig ließ Carol den Truck passieren. Sie bog rechts ab und folgte dem Gefährt in größer werdendem Abstand. Eile war nicht geboten. Es war gerade Mittag, und die Party startete erst am späten Nachmittag. Bis LaBelle waren es nur noch achtzig Meilen.
Die Hitze wurde allmählich unangenehm. Simon beugte sich vor und öffnete das Handschuhfach. Eine MacLite-Taschenlampe, verschiedene Straßenkarten mit umgeknickten Ecken und schlampig gefaltet, eine leere Bierdose und eine Baseballkappe mit dem Logo einer lokalen Brauerei. Er fischte sie heraus, klappte das Fach wieder zu und setzte die Cap auf. Erwartungsvoll sah er Carol an. »Und?«
Sie betrachtete ihn kurz und nickte anerkennend. »Du kannst alles tragen.«
Er nahm sie nie völlig ernst und verübelte ihr ihre verbalen Spitzen nur selten. Carol hatte sich in der Familie permanent gegen den übermächtigen Vater behaupten müssen, der es zu keiner Zeit aus seiner Haut geschafft hatte. Diese Haut war als hohes Tier eines Automobilkonzerns außergewöhnlich dick geworden, und das Alter, das manche Zeitgenossen milde stimmte, vermochte sie nicht wieder abzutragen. Ihre Mutter hatte sich in dieses Szenario gefügt. Katholisch erzogen und aus einer erzkonservativen Gegend, war der erfolgreiche Karrierist eine gute Partie, der man eigene Ambitionen zugunsten von Ansehen und Wohlstand gern unterordnete. Dagegen hatte Carol mit Ausdauer rebelliert und praktisch mit der Volljährigkeit ihren Ausweg in der Flucht gefunden. Darüber war die Verbindung zu den Eltern zunächst in eine Eiszeit verfallen. Die Gletscher schmolzen erst, als sie ihnen ihren ersten Enkel schenkte. Natürlich konnte sie in der Erziehung des kleinen Carl kaum etwas richtig machen, was Anlass zu verschiedenen Reibereien mit ihrem Vater war. Immerhin genügte der Erhalt der Erblinie für ein Wiederaufleben der familiären Bindungen.
Simon war heilfroh, dass seine Schwester ihn begleitete. Ohne sie hätte er schon vor Jahren die Teilnahme an den Treffen eingestellt. Die Hälfte seiner ehemaligen Klassenkameraden war ihm seit dem Schulabschluss fremd geworden. Abgesehen von den organisierten Events pflegten sie keinen nennenswerten Kontakt. Er war zwei Jahre nach dem Abschluss, dem anschließenden Zivildienst und der Ausbildung zum Systeminformatiker weggezogen. Hatte diverse Beziehungen durchlebt und eine davon zu guter Letzt geheiratet. Sechzehn Jahre führten sie eine vorbildhafte Partnerschaft, die zwei Kinder hervorbrachte.
Das Scheitern seiner Ehe stellte für die Eltern ebenso einen Affront dar wie Carols jugendliche Renitenz und ihr Bruch, den das trotzige Verlassen des Elternhauses mit sich brachte. Grundsolide Werte wie Familienzusammenhalt, Loyalität und Tradition standen bei den Hilgenbergs weit über individuellen Bedürfnissen wie Kreativität und Freiheit. Dass Simons Kinder, Sara und Emil, nach der Scheidung bei der Mutter wohnten und darüber hinaus deren Nachnamen trugen, war seinem Dad mehr als nur ein Dorn im Auge, schlimmer: ein Stachel im Fleisch.
Als ob sie seine Gedanken gelesen hätte, fragte Carol unvermittelt: »Wie geht es den Kids?«
»Ha, Kids ist gut«, stieß Simon belustigt aus. »Sara ist fünfundzwanzig und hat seit drei Jahren einen festen Freund. Ich warte täglich auf den Anruf mit der freudigen Verkündung, dass ich Großvater werde.«
»Opa Simon«, witzelte Carol. »Klingt doch gar nicht schlecht.«
»Ja, wenn es in einem Kitschroman steht oder eine sechsjährige Göre mit Zahnlücke in einem französischen Film säuselt. Ich assoziiere damit bloß den Begriff alt.«
»Für das Gefühl braucht es keine Enkel«, erklärte Carol nüchtern.
»Na, herzlichen Dank auch!«
Bevor Simon sich weiter in den Sumpf des Selbstmitleids hineinstrampelte, fuhr sie fort: »Ernsthaft. Ich bin seit fünf Jahren Oma. Da war ich Mitte vierzig, und mein Lieblings-Doc breitete vor mir das gesamte Potpourri der Menopause aus. Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Migräneschübe. Und ich so: Yeah, Bingo, mein Zettel hat gewonnen!«
»Sorry, war nicht so gemeint.«
»Kein Thema. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Was macht Sara?«
»Sie hat vor ein paar Monaten einen Unverpackt-Laden eröffnet. Und bevor du fragst: Ja, ich war auch skeptisch. Aber in dem Stadtviertel, wo sie wohnen, gab es wohl bisher keinen. Und die Leute scheinen darauf gewartet zu haben.«
»Hm, da drück ich mal die Daumen. Was ist mit Emil?«
»Immer noch im Studium, macht demnächst seinen Bachelor. Dann hängt er den Master noch dran.«
Carol schnalzte beeindruckt mit der Zunge. »Guter Junge. Umweltwissenschaften, oder? Sie werden sich um ihn reißen.«
»Wenn es nicht schon zu spät ist. Um etwas zu reißen, meine ich.«
»Dein Optimismus ist mir stets Vorbild und Motivation, Bruderherz!«
Simon schnaubte. »Ach, komm schon, vor zehn Jahren hatten sie es noch in der Hand, da hätte man echt was bewegen können. Und was ist passiert? Nichts!« Er zog die Kappe tiefer ins Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust. »Stattdessen machen sich die Reichen weiter die Taschen voll, und ein Viertel der Menschheit krepiert wegen Dürren oder Überschwemmungen.«
Dem hatte Carol nichts entgegenzusetzen. »Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dass deine Kids sich so engagieren, macht mir Mut.«
Simon besann sich wieder. Vielleicht teilte er manchmal zu hart aus, dachte er im Stillen. »Sorry, das Thema bringt mich auf die Palme. Dad mit seinem ewigen Gelaber von der ach so wichtigen Wirtschaft, der alles andere unterzuordnen sei, weißt du noch?«
Seine Schwester nickte. »Nur zu gut.«
Er mochte das nicht weiter vertiefen. Mit Carol ließ sich darüber vortrefflich diskutieren, ohne dass sie sich am Ende in die Haare gerieten. Mit seinem Vater dagegen hatte er zahllose hitzige Debatten geführt. Seinen Argumenten war der alte Herr nie zugänglich gewesen, zu kurzsichtig stellte er die Konzerninteressen über das Wohl nachfolgender Generationen. Einsicht zeigte er auch im Alter nicht, obwohl die Vorhersagen der Klimaforscher in den vergangenen zwanzig Jahren nicht nur eingetreten, sondern teils drastisch übertroffen worden waren.
»Du hast deinen Spirit an die Kids weitergegeben, darauf kannst du echt stolz sein.« Carol fügte das nicht bloß hinzu, um ihren Bruder zu besänftigen. Aus Ihren Worten sprach aufrichtige Anerkennung. Sie streckte sich und kreiste mit den Schultern.
»Soll ich den Rest fahren?«, fragte Simon.
»Lass gut sein. Da vorn kommt die Abzweigung auf die 29, von da ist es nicht mehr weit.«
2
Die Hitze war schon um halb zehn morgens unerträglich. Herr Köhler hatte es am Tag zuvor angedeutet: »Morgen kann es sein, dass es Hitzefrei gibt.« Das freudige Gejubel der 6a hatte er lächelnd zur Kenntnis genommen, sich kurz zurückgelehnt und die Klasse dann noch einmal zur Ruhe gemahnt. »Aber erst tretet ihr morgen früh an, dann wird entschieden. Verstanden?«
Auch ihm kam ein freier Tag bei Mittagstemperaturen über dreißig Grad gelegen. Nicht nur die Schüler waren bei dieser Hitze unleidlich und unkonzentriert. Er selbst neigte zu rasenden Kopfschmerzen und legte sich mittags gern in das Gästebett im Souterrain. Arbeiten konnte er abends immer noch, wenn die Sonne glühend hinter den Hügeln im Westen versunken war.
Malte, Tobi und David waren solche Pausen fremd. Mit ihren elf und zwölf Jahren steckten sie voller Energie und Tatendrang, verpulverten tagsüber ihre ganze Kraft, um abends selig ins Bett zu fallen und durchzuschlafen. Ob es da fünfunddreißig Grad im Schatten hatte oder klirrende Kälte, war ihnen einerlei. Zusammen mit ihren Klassenkameraden warteten sie ungeduldig auf die Durchsage aus dem Sekretariat.
Nachdem Rektor Gunkels Stimme über die schulweit hörbare Sprechanlage knarzend die Temperatur übermittelt hatte, war der Rest seiner arg bürokratisch formulierten Rede im euphorischen Jubel aller Klassen untergegangen. Sämtliche Schüler wussten über die Voraussetzungen für einen vorzeitigen hitzebedingten Schulschluss Bescheid. Sekunden später platzten die Eingangstüren des Schulkomplexes auf und spuckten Kolonnen von johlenden Schülerinnen und Schülern aus.
Die drei Jungs hatten sich am Vortag verabredet. Die Ranzen auf dem Rücken, schwangen sie sich auf ihre Räder und preschten vom Schulhof.
»Wer als Erster da ist!«, brüllte Malte und legte noch eine Schippe drauf. Er hatte zum Geburtstag vor einigen Wochen von seinen Großeltern ein neues knallrotes Rad mit einundzwanzig Gängen geschenkt bekommen. Da konnten die anderen beiden nicht mithalten, selbst als es kurz vor dem Ortsausgang ein gutes Stück bergab ging.
»Dieser Angeber«, rief David über seine Schulter Tobi zu. »Mit so einem Rad könnte ich das auch.«
»Ist doch egal«, gab der zurück, wie immer die Ruhe selbst. »Er muss nur aufpassen. Irgendwann nimmt ihn noch ein Trecker auf die Hörner.«
Wie aufs Kommando sahen sie Malte schlingernd eine Vollbremsung hinlegen, kurz bevor er das Ende der Ausfallstraße erreichte, die dort auf die Umgehungsstraße des Dorfes stieß. Ein Lkw mit Anhänger einer örtlichen Spedition bretterte vor ihm entlang. Der Fahrer machte seinem Unmut über den kleinen Kamikaze-Radler mit unwirschem Hupen Luft.
Mit dem roten Schopf, dem grellgrünen Batikshirt und den käsigen Beinen, die ihm im Sommer meist übel verbrannten und nie braun wurden, war Malte auch in zweihundert Metern Entfernung noch so gut zu sehen wie eine Leuchtboje auf hoher See.
»Uiuiui«, raunte er übertrieben und grinste, als seine Verfolger ihn erreichten. Der Schrecken stand ihm ins von unbändigen Locken umrahmte Gesicht geschrieben. Dabei strahlte er ein gewisses Maß an Stolz aus, als stellte die überstandene Gefahr eine ganz passable Leistung dar, der eine angemessene Bewunderung gebührte.
Tobi betrachtete kritisch die zwei Meter lange schwarze Bremsspur auf dem Asphalt. »Das hätte leicht schiefgehen können.«
»Isses aber nicht«, krähte Malte und stieg wieder in die Pedale.
»Der ist total gaga«, konstatierte David und sah Tobi ungläubig an. Der schüttelte stumm den Kopf und setzte sich wie sein Freund auf den Sattel, um Malte zu folgen.
Anderthalb Kilometer nach dem Ortsschild verließ der Rothaarige in einem waghalsigen Manöver links die Landstraße, was ihm abermals das hysterische Hupen eines entgegenkommenden Kleintransporters bescherte und seinen beiden Verfolgern für einen Moment den Atem raubte.
Auf einem sachte ansteigenden, ausgefahrenen Feldweg folgten sie ihrem Klassenkameraden. Beiderseits des Weges und in dessen Mitte wuchs sattes hohes Gras, trockene Ähren strichen über die Haut ihrer nackten Schienbeine. Hinter ihnen blieb die Landstraße mit dem Lärm einzelner vorbeifahrender Autos zurück, die wilden Zwetschgen und Apfelbäume links und rechts rückten näher heran. Schon bald war durch das Unterholz das Plätschern des Bachs zu hören.
Malte hatte sein Tempo gedrosselt und sich von Tobi und David einholen lassen. Sie stoppten, stiegen vom Rad und lauschten. Außer dem Rinnsal im Gebüsch, dem Zirpen einzelner Grillen und dem Summen eifriger Hummeln hörten sie nichts. Ein heißer Wind trug die letzten Gerüche der Rapsblüte das Tal herauf, mit ihnen feinen Staub von den trockenen Feldern und die Blütenblätter des Holunders.
Es war dieselbe Stelle wie vorgestern, am Sonntag, an der sie den Feldweg rechts verließen. Das niedergetrampelte Gras hatte sich wieder aufgerichtet, so dass ihr letzter Besuch vermutlich unbemerkt geblieben war.
Nach wenigen Metern erreichten sie die ersten niedrigen Zweige der Bäume und schoben mit eingezogenen Köpfen ihre Räder in den Schatten. Dort lehnten sie diese an verschiedene Stämme. Malte band sein neues Rad mit überzogenem Gehabe mithilfe einer dicken Kette und einem ähnlich soliden Schloss an einen Baum. David und Tobi verfolgten das stirnrunzelnd.
»Was denn?«, erwiderte Malte großspurig. »Man weiß ja nie, welches Gesocks sich hier so rumtreibt.« Damit sprang er ins tiefere Unterholz davon.
Die Stelle hatten Tobi und David in diesem Frühjahr entdeckt, auf einer ihrer ungeplanten Radtouren rund ums Dorf. Zehn Schritte ins Dickicht hinein wichen die dickeren Stämme zurück, und es eröffnete sich eine kleine ovale Lichtung, über die eine Handvoll ausladende Äste ragten. Hier lagen mehrere Findlinge in loser Anordnung im Kreis, auf denen es sich gut sitzen ließ. Während der Mittagshitze befanden sie sich größtenteils im lichten Schatten der größeren Apfelbäume am Rand. Ein wenig weiter wand sich der Bach an der Lichtung vorbei, bevor das Wasser wieder im Dunkel verschwand.
Wie so viele Generationen von Jungs vor ihnen trieb sie das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit in die Natur, wo sie unbeobachtet von Eltern, Großeltern und den anderen argwöhnischen Alten im Dorf tun und lassen konnten, was sie wollten. Trotz Konsole und Nintendo starb diese Spezies nicht aus. Das Betätigungsfeld dieser eingeschworenen Gemeinschaften auf Zeit reichte vom Feuermachen über das Bauen von Dämmen in Bachläufen bis hin zum Errichten von mehr oder weniger soliden Unterständen, dem sogenannten »Budenbauen«.
Der stets aktive und über die Maßen neugierige Malte – er hätte es »wissbegierig« genannt – hatte sich erst zwei Wochen zuvor eingeklinkt. Gewissermaßen hatte er sich den beiden anderen aufgedrängt. Zumindest war es ihnen nicht gelungen, ihr Tun außerhalb des Ortes vor ihm geheim zu halten. Auf dem Fahrradparkplatz hatte er sie so lange mit Fragen bombardiert, bis sie ihn zähneknirschend in ihr kleines Geheimnis eingeweiht und mitgenommen hatten. Natürlich nur unter der Auflage strengster Verschwiegenheit.
Ihren Aufenthaltsort hielten sie so geheim wie möglich. Es ließ sich nicht vermeiden, dass der Landwirt, der die Felder ein Stück weiter den Weg hinauf bewirtschaftete, die Jungs ein- oder zweimal dabei beobachtete, wie sie gerade von den Rädern sprangen und sich hastig zu verbergen suchten, als er mit dem Trecker vorbeikam. Das Dorf war allerdings klein, und der grummelige alte Mann kannte sie. Er machte sich nichts daraus, dass ein paar Halbstarke sich hier draußen vergnügten. Die Jungs vermuteten, dass er und seine Altersgenossen sich als Zwölfjährige auf ähnliche Weise außerhalb des Ortes die Zeit vertrieben hatten. Wann immer das gewesen sein mochte.
In der Schule mussten sie besonders umsichtig vorgehen. Zunächst waren es drei der Mädchen aus ihrer Schulklasse, denen auffiel, dass Tobi, David und Malte auf dem Pausenhof permanent zusammenstanden und eifrig tuschelten. Katarina, bekannt dafür, nicht auf den Mund gefallen zu sein, wagte es als Erste, die drei anzusprechen.
»Na, ihr? Was treibt ihr so?«, fragte sie unverhohlen offensiv.
Die Jungs wurden auffällig still und wechselten vielsagende Blicke. Katarina zählten sie nicht zu ihrem engeren Freundeskreis, zumal sie dicke mit Sabine war, die nicht weit weg bei Nina stand. Ihr Geheimnis wähnten sie bei ihr nicht in vertrauenswürdigen Händen.
»Äh, nix«, sagte Malte einigermaßen resolut, wie er fand. Er hoffte, die knappe Antwort kam beim Gegenüber unmissverständlich an. Seine Verunsicherung versuchte er zu verbergen. Katarina war nicht bloß neugierig, sondern im wörtlichen Sinne schlagfertig. Mit ihren kurzen braunen Haaren und dem kräftigen Körperbau war haarscharf ein Junge an ihr vorbeigegangen. Es war vorgekommen, dass selbst größere Kerle aus der Klasse von ihr Tritte und sogar Kinnhaken kassiert hatten.
Katarina verschränkte empört die Arme. »Aber ihr quatscht doch seit einer Viertelstunde.«
»Es geht darum, wo wir so mit unseren Eltern hinfahren in den Ferien«, erklärte Tobi trocken und wollte das so stehen lassen in der Hoffnung, dass Katarina das nicht interessierte. Doch die ließ nicht locker.
»Und, wo geht’s hin?«, fragte sie mit vorgerecktem Kinn in Tobis Richtung.
»Ferienlager im Sauerland«, antwortete der große Junge prompt und mit säuerlicher Miene. David war platt, wie überzeugend Tobi diese Lüge vorbrachte. Vielleicht stimmte das ja sogar.
Die Selbstsicherheit des Mädchens brachte das nicht ins Wanken, eher spornte es sie an. Forsch sah sie David an. »Und du? Wo geht es hin dieses Jahr?«
Der ganzen Klasse einschließlich der Lehrer war bekannt, dass Davids Familienverhältnisse von schwieriger Natur waren. Sein Vater Hans war vor sieben Jahren an einem Schlaganfall gestorben. David hatte ihn im Garten gefunden, ausgestreckt auf dem Rasen, daneben der fallengelassene Eimer mit Küchenresten, die er zum Komposthaufen hatte bringen wollen. Eine rauchende Zigarette lag neben ihm im Gras, der buchstäbliche Sargnagel nach einer jahrzehntelangen Karriere als Kettenraucher. Das Gesicht war eine graue Maske maßlosen Entsetzens und hatte sich in die Erinnerung des Jungen unauslöschlich eingebrannt.
Wie viele Minuten der Fünfjährige schweigend und völlig ausdruckslos auf dem Plattenweg gestanden und die hässliche Fratze des plötzlichen Todes betrachtet hatte, wusste später niemand zu sagen. Nachbarn behaupteten, der Tag hätte aus dem fröhlichen Jungen einen anderen gemacht, einen introvertierten, stillen Einzelgänger. Freundschaften hielten bei ihm nur so lange, wie es die Situation erforderte, sei es im Kindergarten oder kurze Zeit später in der Schule. David wuchs nicht so schnell wie seine Altersgenossen und maß mit dem Schulbeginn im Schnitt einen halben Kopf weniger als alle anderen. Hinter vorgehaltener Hand stellten manche Dorfbewohner Vergleiche mit Oskar Matzerath an, und schon bald bekamen Gleichaltrige das mit und verpassten ihm diesen Spitznamen, obwohl die wenigsten Die Blechtrommel gelesen hatten.
Damit nicht genug. Davids Mutter Marlies verlor mit dem Tod des Ehemannes jeglichen Halt. Er war es, der für den Unterhalt sorgte, sie hatte sich mit der Geburt des Sohnes der Rolle der Hausfrau ergeben. Die Witwenrente hätte vielleicht ausgereicht, um den Kredit für das erst kurz zuvor gebaute Haus weiterhin zahlen zu können, wäre da nicht der Alkohol gewesen. Eine latente Neigung zur Flasche hatte Marlies schon in der Jugend entwickelt, auf Partys und Familienfesten den einen oder anderen Totalabsturz zelebriert. Stolz war sie nicht darauf. Das geordnete Familienleben vermochte die Sucht eine ganze Weile zu unterdrücken. Hans‘ Verlust sprengte die dünne Schale täglicher Strukturen hinfort und setzte Marlies schutzlos dem allgegenwärtigen Bombardement der Versuchungen aus. Sie gab ihm nach.
Die Raten konnten bald nicht mehr bezahlt werden. Das Haus wurde verkauft, und Marlies zog mit David in eine Zweizimmerwohnung in einer Reihenhaussiedlung. Für ein paar Wochen fand sie eine Anstellung im örtlichen Supermarkt, in dem sie Regale einräumte. Ihre Abhängigkeit blieb den Vorgesetzten nicht verborgen oder war ihnen sogar bekannt. Man kannte sich im Ort. Eine Chance wollten sie ihr geben. Ihre Unpünktlichkeit und das mangelhafte Ergebnis ihrer Arbeit führten schlussendlich zu ihrer Entlassung während der Probezeit. Und öffneten die Schleusen vollends.
Diese ganze Geschichte kannten Davids Klassenkameraden. Einigen war das einerlei, den meisten tat ihr Mitschüler leid, und sie nahmen ihn in Schutz, vor allem in der Grundschule. Mit Beginn der Mittelstufe kam ein Dutzend weiterer Kinder von einer Schule aus dem Nachbarort hinzu, wo der Realschulzweig nicht angeboten wurde. Diese kannten Davids Vorgeschichte nicht und hatten seine Entwicklung in den Jahren seit dem Tod des Vaters nicht mitverfolgt. Darunter waren Kai und Arne, beide vom Typ Draufgänger und Großmaul, die sich um das emotionale Katastrophengebiet hinter Davids verletzlicher Fassade nicht scherten und hin und wieder gegen den Kleinen austeilten. Insgeheim zählte der Junge Katarina zu dieser Kategorie Menschen hinzu. Auch sie war erst seit knapp zwei Jahren eine Klassenkameradin.
Dass sie nun ihm diese bohrende Frage stellte, überraschte ihn also nicht im Geringsten, trotzdem trafen die Worte ihn unvorbereitet. Er setzte zu einer Antwort an, verlor sich aber in unartikuliertem Gestammel. Die Röte stieg ihm ins Gesicht. Zwischen seinen Sommersprossen fiel das keinem der anderen auf.
»Was, äh?«, ätzte Katarina. »Hast du’s schon wieder vergessen, wo ihr hinfahrt? Oder wird das nix mit dir und deiner Schnapsmama? Bestimmt findet man euch wieder den ganzen Sommer unten am Fluss auf der Bank.«
Verlegen senkte David den Kopf und wusste nichts zu erwidern. In seinem Innern schrie alles durcheinander, er sollte sich wehren, Katarina anbrüllen, ihr an die Gurgel springen. Stärker war dagegen die Lähmung, die bleierne Schwere. Sie klebte ihn am Boden fest und raubte ihm jeglichen Willen zu einer standhaften Reaktion. Was hätte er gegen das größere Mädchen auch ausrichten können? Er, der kleine Oskar?
Tobi wurde es in dem Moment zu viel. Aus seinem Gesicht sprach eine Mischung aus Verärgerung und Verachtung. Er schob sich halb vor David.
»Jetzt mach mal halblang. Was bildest du dir ein, hier so auf ihm rumzuhacken!«, tönte er ungewohnt voluminös im Bass eines frühen Stimmbruchs. »Du weißt genau, dass das alles nicht seine Schuld ist. Sei lieber froh, dass es dir und deiner Familie so gut geht. Und jetzt zieh ab zu deinen Freundinnen!«
Katarina war einen Schritt zurückgewichen. Derlei Wutausbrüche waren weder sie noch die beiden Jungs von Tobi gewöhnt. Sie wagte es nicht, weitere Worte an einen von ihnen zu richten. Stattdessen starrte sie den größeren Jungen zwei Sekunden lang an, machte eine unbestimmte wegwerfende Geste mit den Armen, drehte sich um und schritt grimmig von dannen.
»Respekt, Tobi!« Malte nickte anerkennend und nahm beiläufig wahr, dass einige andere, die in der Nähe standen und die Auseinandersetzung verfolgt hatten, erstaunt zu ihnen und insbesondere Tobi herüberschauten. »Der hast du aber einen eingeschenkt.«
»Ist doch wahr«, brummte Tobi und stopfte die Hände tief in die Hosentaschen. »Kann sich wohl alles erlauben.«
David war noch völlig geplättet und sah den Größeren ungläubig an. Es war lange her, dass sich jemand für ihn eingesetzt hatte. Sein Herz machte mehrere Sprünge vor Freude darüber, einen so großartigen Freund zu haben. Zaghaft drückte er Tobis Unterarm.
»Danke, Tobi, ich …«, flüsterte er.
Weiter kam er nicht. »Ach, lass«, grummelte Tobi und drehte sich weg. David verstand das nicht als Ablehnung, und seiner Freude tat es keinen Abbruch.
Ab dem Tag wagte es niemand mehr, David direkt anzugreifen, sei es verbal oder gar handgreiflich. Wenn sich Schüler aus ihrer Klasse zu ihnen gesellten, drehten sich ihre Gespräche ausschließlich um alles andere, nur nicht um ihre heimlichen Treffen. Stellte jemand die Frage, was sie nachmittags unternahmen, redeten sie sich mit Hausaufgaben, gemeinschaftlichem Lernen oder familiären Verpflichtungen heraus, für welche die anderen wenig Interesse aufbrachten. Sie gingen dazu über, nach der Schule zuerst nach Hause zu fahren und einzeln zu ihrem Außenposten zu radeln, wie sie die Lichtung in dem Dickicht schon bald nannten. Auf diese Weise sank die Wahrscheinlichkeit, dass ein allzu neugieriger Genosse auf das Trio aufmerksam wurde und die Verfolgung aufnahm.
Während der ersten gemeinsamen Wochen zu dritt hatten sie sich mit dem Bau eines bescheidenen Staudamms beschäftigt. Das Vorhaben folgte zunächst dem reinen Selbstzweck, nämlich sich möglichst mit Schlamm einzusauen und mit Freunden etwas Konstruktives auf die Beine zu stellen. Davids Mutter hatte ihm diverse Male Hausarrest angedroht, sollte er noch einmal derart schmutzig nach Hause kommen. In die Tat hatte sie die Ankündigung nicht umgesetzt. David vermutete insgeheim, dass sie die Worte im Suff geäußert und am Morgen darauf vergessen hatte.
Die Stabilität des Damms war von eher fragwürdiger Natur, und nicht selten war das Bauwerk am nächsten Tag schon wieder hinüber, beziehungsweise buchstäblich den Bach hinunter.
»Wollen wir uns nicht mal einen eigenen Pool bauen?«, fragte Malte an einem außergewöhnlich heißen Tag Mitte Juni.
»Wie meinst du das?«, wollte David wissen. »Wir haben doch keine Fliesen und so.«
»Nee, nicht so einen Pool«, entgegnete Malte lachend. »Fliesen sind was für Spießer. In der Natur baust du dir deinen Pool mit den Dingen, die du zur Verfügung hast. Stämme, Steine und so weiter.« Er wandte Tobi den Blick zu. »Was meinst du? Ist das machbar?«
Auf die Meinung des mit wenigen Monaten Älteren in der Runde schien Malte große Stücke zu halten, nicht erst seit dessen Auftreten gegenüber Katarina. Tobi machte stets einen überlegten Eindruck und neigte nicht dazu, überstürzt zu handeln. David fand das bewundernswert, zumal sein Freund mit diesen Stärken in der Schule einigen Erfolg hatte.
Der sah die beiden kurz nacheinander an, dabei drehte er einen Kiesel zwischen den Fingern. Sein hageres Gesicht verriet keinerlei Regung, ein paar Sekunden lang dachte er nach. »So machen es die Großen auch. Also Naturvölker, und so. Habe ich in einer Dokumentation gesehen.« Er zuckte mit den Achseln. »Das sollte schon auch hier funktionieren.«
Nach den ersten größeren Konstruktionen, die vom aufgestauten Wasser des gar nicht so schwach dahinplätschernden Bachs ebenso davongeschwemmt wurden wie ihre früheren Versuche, gingen die drei die Errichtung mit mehr Bedacht an. Sie schafften dickere Stämme herbei, schnitten diese auf geeignete Längen zu und spitzten sie am einen Ende an. Eine von Malte im Schuppen des Großvaters »geliehene« Säge und ein kleines schartiges Beil leisteten dabei nützliche Dienste. Mit anderen dicken Stämmen und größeren Steinen gelang es ihnen, an einer günstigen Stelle mehrere Pfähle in den Bachlauf einzuschlagen, die Zwischenräume mit weiteren Felsbrocken, Ästen und Reisig aufzufüllen und zum Schluss mit Lehmklumpen abzudichten. Am Ende sickerte nur an wenigen Stellen Wasser durch die Wand. Der Rest floss wie geplant seitlich über einen Kanal am Damm vorbei in den unteren Lauf.
So entstand ein annähernd kreisrundes Bassin von immerhin vier Metern Durchmesser, das an der aufgebauten Barriere achtzig Zentimeter tief war und den drei Jungs die Möglichkeit zu einem kühlen Bad und erfrischenden Raufereien bot. Dass das angestaute Wasser durch ihre Bewegungen aufgewühlt und schlammig wurde, kümmerte sie dabei absolut nicht. Genauso wenig scherten sie sich darum, sich geschützt vom Schatten der Bäume bis auf die Haut auszuziehen. Die eine oder andere naive Frotzelei über ihre Geschlechtsteile waren von harmloser Natur.
So verging der sommerliche Juni mit wenigen kühleren Episoden, die auf heftige Sommergewitter folgten. Der Juli war ebenso geprägt von langen, heißen Tagen.
Dann kamen die Sommerferien. Mit dem Ausbleiben der lästigen schulischen Pflichten dehnten sich die Stunden in ihrem kleinen Tal endlos. Immer wieder mussten sie mehr oder minder heftige und unterschiedlich ernst gemeinte Schimpftiraden ihrer Eltern über sich ergehen lassen, ausgelöst vom Zustand ihrer schlammverkrusteten Hosen oder dem späten Zeitpunkt ihrer Rückkehr.
Für David hätte der Sommer ewig weitergehen dürfen. Sie organisierten Limo und Eistee, wobei Tobi der Spendabelste war und in stiller Übereinkunft mit Malte davon absah, mehr Einsatz von David einzufordern, dessen prekäre finanzielle Verhältnisse das nicht zuließen. Der machte das mit verstärktem Eifer bei der Beschaffung von Baumaterial und Brennholz wett. Inzwischen schafften sie es, in einer Mulde zwischen den Findlingen hin und wieder ein Feuer zu entfachen. Für Grillwurst oder anderes Essen langte das Taschengeld von keinem. Außerdem wollten sie bei ihren Eltern nicht Alarm auslösen mit der Information, dass sie die Zubereitung auf einem Feuer im trockenen Unterholz in Angriff nehmen würden. Der Außenposten wäre schnell Geschichte gewesen.
Spät in den Sommerferien saßen sie wieder am Feuer beieinander. Dieses Mal erfüllte es seinen wärmenden Zweck, denn es war ein eher kühler Tag. Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Anzünden wärmten die Flammen die blanken Unterschenkel der Jungs.
»Ging ja gerade noch einmal gut«, murmelte Malte. Er war an dem Tag ungewohnt zurückhaltend. Der Qualm der zögerlich kokelnden Feuerstelle hatte ihm offenbar die Stimmung verhagelt, vermutete David.
»Brennt doch«, sagte er und rieb sich die Hände. »Alles gut.«
»Pst«, machte Tobi und reckte den Hals. Die anderen hielten den Atem an und lauschten ebenfalls.
Aus der Richtung, in welcher der Feldweg lag, den sie immer heraufkamen, drangen Stimmen. Das Knacken von Holz war zu hören.
»Scheiße«, stieß David aus.
»Wer ist das denn?«, wollte Tobi wissen und sah die beiden anderen abwechselnd an.
Die Geräusche kamen näher. Die Stimmen waren die von jungen Menschen. Das Krachen von Ästen erscholl, zusammen mit dem Pling einer Fahrradklingel, als das zugehörige Rad achtlos hingeworfen wurde. Dann traten zwei Jungs und zwei Mädchen aus dem Unterholz. Arne und Kai standen dort, hinter ihnen stolperten Katarina und Sabine zwischen den Ästen hervor.
»Oskar!«, rief Kai in gespielter Überraschung aus.
»Na, schau an«, sagte Arne süffisant und begleitete seine Aussage mit einem strahlenden Lächeln. »Was ist das denn für eine lustige Truppe?«
Katarina stemmte die Fäuste in die Hüften, ihre Augen funkelten. »Hab ich’s doch gewusst!«, presste sie hervor.
Tobi und David starrten die Neuankömmlinge ungläubig an. Dass Malte verlegen lächelte, bekamen sie nicht mit.
3
Simon sank ein wenig tiefer in den Sitz. Seine gelöste Laune hatte sich in Wohlgefallen aufgelöst. Das Familienthema trübte seine Stimmung, dieser ewige Zwist mit seinem starrsinnigen Vater, dem kein Mensch auf der Welt irgendetwas recht machen konnte, schon gar nicht seine eigenen Kinder. Er würde noch auf dem Sterbebett das Mantra von der Allmacht der regulierenden Ökonomie beten.
Das Treffen mit seinen früheren Klassenkameraden stand unmittelbar bevor. Die letzten beiden Jubiläen hatte Simon sausen lassen. Bis auf seine Schwester hatte er fast alle seine Mitstreiter fünfzehn Jahre lang nicht gesehen.
Etwas, das er in seinem Augenwinkel wahrnahm, riss ihn aus seinen Gedanken. Ein oder zwei Meilen abseits der Straße tauchte zwischen niedrigem Buschwerk immer wieder eine Farm auf, ein flaches Gebäude, umringt von mehreren lose angeordneten Scheunen und Ställen, deren mit Blech gedeckte Dächer in der Sonne schimmerten. Die reflektierten Sonnenstrahlen blitzten nicht in allen Lücken zwischen den Bäumen und Sträuchern auf: Jedes zweite oder dritte Mal, wenn die weit verstreuten Pflanzen den Blick auf die Gebäude freigaben, waren die Dächer mit roten Ziegeln gedeckt, und sie schienen nicht so groß und dafür höher zu sein.
Simon blinzelte, schob kurz die Sonnenbrille hoch und kniff sich mit Daumen und Zeigefinger in die Augenwinkel. Als er den Blick wieder nach rechts wandte, sah er das erwartete Szenario der ausgedehnten Südstaatenfarm. Keine roten Dächer mehr.
Carol blieb sein Stimmungsumschwung nicht verborgen. Seine Zwillingsschwester hatte einen angeborenen Sinn für seine Gefühlslage. »Was ist los? Alles in Ordnung?«
»Passt schon«, war seine knappe Antwort.
»Los, sag. Ich merk doch, dass was nicht stimmt.«
»Ich hab schon Halluzinationen«, bekannte er mürrisch. »Wahrscheinlich schlecht geschlafen wegen dem ganzen Tamtam um dieses Klassentreffen.«
»Was hast du gesehen?«, wollte Carol stirnrunzelnd wissen.
Er beschrieb ihr grob die wechselnde Form und Farbe der Dächer der Farm.
»Das sind nur die Nebenwirkungen des Eingriffs«, versuchte sie ihn zu beruhigen. »Völlig normal in den ersten Monaten. Ist bei dir ja noch nicht so lange her.«
Simon griff sich hinter das linke Ohr und befühlte die Haut unter dem Haaransatz. Sie war glatt und ohne Makel. »Drei Wochen«, sagte er gedankenverloren.
»Und Stress fördert die Nebenwirkungen zusätzlich«, ergänzte Carol. »Du hast den Kopf ja auch voller Zeugs. Ist wirklich alles ok?« Sie sah ihn besorgt an.
Seufzend setzte sich Simon aufrechter hin und strich sich mit der Handfläche über den Dreitagebart. »Mir sind die anderen so fremd geworden. Ich hab doch mit denen gar nichts mehr zu tun. In all den Jahren tauschen wir uns nur noch aus, um das nächste Treffen zu organisieren.«
»Man muss ja nicht mit jedem ständig in Kontakt bleiben«, entgegnete Carol schulterzuckend und nahm den Fuß vom Gaspedal. »Außerdem kommen sowieso nicht mehr alle. Es ist nur noch der harte Kern von damals. Also die, die besonders dicke miteinander waren.«
Sie ließ den Wagen bis an die Haltelinie rollen, neben der ein verbeultes Stop-Schild stand, und hielt dann vollständig.
»Und die das nötige Pfund Extrovertiertheit oder Leidensfähigkeit mitbringen, um sich dieses Event zu geben«, murrte Simon.
Weit und breit war kein anderes Fahrzeug zu sehen, geschweige denn eine Highway Patrol. Scherereien mit den lokalen Behörden wollten sie sich ersparen, daher hielt sich Carol an die Verkehrsregeln. Zur Genüge hatten sie Stories gehört von Bekannten, die Stunden, wenn nicht Nächte auf Polizeirevieren verbracht hatten, weil sie den Blinker falsch gesetzt hatten. Kein Filmklischee.
»Langsam bedaure ich, dass ich dich zum Mitkommen überredet habe«, beschwerte sich Carol ohne viel Nachdruck. »Ich kann es ja zum Teil nachvollziehen. Einige der Figuren brauche ich auch nicht. Aber wer weiß, wie viele Treffen es noch gibt.«
»Hast ja recht«, gab Simon zu. »Ich reiß mich schon zusammen. Gute Miene zum bösen Spiel und so weiter. Sind ja nur die paar Stunden.«
Seine Schwester lächelte und tätschelte ihm den Kopf. »Braver Junge.«
»Lass das«, maulte Simon mit kindisch verstellter Stimme und duckte sich weg.
Nachdem sie links Richtung Südwesten abgebogen waren und wieder Fahrt aufnahmen, glich die Szenerie zu beiden Seiten des Asphalts den Landschaften auf den vergangenen zweihundert Meilen bis auf wenige Details. Plattes Buschland mit endlosen Weideflächen, von Zäunen unterbrochen, rustikal wirkende hölzerne Telegrafen- und Strommasten mit Keramikisolatoren. Hier und da ein Caravan-Park, da eine Farm.
Nach einer Handvoll weiterer Meilen erreichten sie LaBelle, was sich lediglich durch ein eher unauffälliges Ortsschild und eine höhere Dichte an Bauwerken bemerkbar machte.
Carol drosselte das Tempo und ließ die Gebäude vorüberziehen, meist weiße, einstöckige Bauten aus Holz. Simon stellte sich unweigerlich die Frage, weshalb die von Hurrikans und Tornados geplagten Amerikaner nicht doch mal auf die Idee kamen, anstelle von Brettern und Nägeln einmal Steine und Mörtel zu verwenden.
Auf den Straßen war wenig los, wofür die Hitze des Nachmittags verantwortlich sein mochte. Vor einigen Häusern saßen Einheimische unter schattigen Vordächern bei kalten Getränken auf Bänken und beäugten müde und manches Mal argwöhnisch die Vorbeifahrenden. Touristen war man hier vermutlich nicht gewöhnt.
So etwas wie einen Stadtkern gab es in LaBelle nicht, das ähnlich uninspiriert mit dem Geodreieck geplant worden war wie die meisten anderen Städte im ländlichen Florida. Nicht einmal einen Kirchturm vermochte Simon auszumachen.
Nach einigen weiteren Abbiegemanövern verkündete Carol: »Wir sind da.«
Mit einem Kopfnicken deutete sie ein Stück die Straße hinab auf einen Diner auf der rechten Seite. Es handelte sich auch hier um ein einstöckiges Gebäude, das aus der Masse der anderen Bauten allein durch die auffällige Leuchtreklame herausstach. Die komplette Front war verglast, darüber prangte auf einem das ganze Haus umspannenden orangeroten Streifen in neongelben Lettern, umrahmt von unzähligen Glühbirnen, der Schriftzug »Donnie’s Diner & Motel«. Wem das immer noch nicht auffiel, brauchte nur den Blick zu heben, um an einem Masten, von jeder Seite bestens sichtbar, dasselbe Logo in doppelter Größe zu erblicken. Donnie hatte marketingtechnisch alles gegeben.
Carol bog von der Straße ab und lenkte die Corvette durch eine ausreichend breite Einfahrt am Diner vorbei zu einem Parkplatz auf der Rückseite. Dort stellte sie den Motor aus und ließ sich in den Sitz sinken. Hier waren verschiedene Fahrzeuge abgestellt worden, darunter ein weißer Ford Mustang und ein türkisfarbener Chevrolet Impala.
An den Diner schloss sich das fünfzig Meter lange, zweistöckige Motel an. Auf den beiden Etagen gab es jeweils zwölf gleichartige Fenster mit Türen daneben. Im Erdgeschoss waren diese ebenerdig vom Parkplatz zu erreichen. Das erste Geschoss mit dem durchgehenden Balkon erreichte man über eine stählerne Außentreppe, die in der Ecke zwischen Diner und Motel montiert war. Vor dem Trakt waren kreisrunde Löcher im Asphalt mit niedrigen Betonmauern eingefasst, aus denen recht traurig wirkende Palmen wuchsen.
Ein Schrei riss Carol und Simon aus ihren Betrachtungen der Oldtimer, die hier alle einen über die Maßen gepflegten Eindruck vermittelten. Der Diner war auch auf der Rückseite mit großflächigen Fenstern versehen und besaß eine zweiflügelige Tür. Darin stand eine dralle Frau undefinierbaren Alters in einem pinkfarbenen Petticoat mit weißen Polka-Dots, die wasserstoffblonden Haare hochgesteckt, und breitete einladend und mit strahlendem Lächeln die Arme aus. Selbst auf die Entfernung von knapp dreißig Metern war ein Übermaß an Schminke zu erkennen.
»Was zur Hölle ist das?«, fragte Simon konsterniert und zwang sich zu einem Lächeln, für den Fall, dass sein Gegenüber das sah und es dem reibungslosen Verlauf des Abends dienlich war.
Carol ging es ähnlich. Sie legte nachdenklich den Kopf schräg. »Ich vermute, das ist Nina.«
»Sie steht auf diesen Zirkus, oder?«
»So was von.«
In der Einfahrt heulte ein voluminöser Motor auf, bevor ein dazu passender schwarzer Dodge D-100 auf den Parkplatz preschte und dabei einen ähnlich monströsen Eindruck machte wie wenige Stunden zuvor der Truck auf dem Highway. Split und Staub spritzten auf, und das Ungetüm wurde einige Meter neben Carol und Simon zum Stehen gebracht.
Nina hatte plötzlich vor allem Augen für die Insassen des Pickup-Trucks und ließ abermals einen hochfrequenten Schrei der Begeisterung vernehmen, bevor sie die Stufen vom Eingang heruntereilte.
»Und das?«, versetzte Simon knapp und beobachtete, wie drei Männer dem Monstrum entstiegen. Was ihr Outfit anging, hatten sie sich wohl abgesprochen. Sie trugen rot-weiße College-Jacken, Jeans und hatten ihre Frisuren zu Tollen gegelt. Der Fahrer war größer und kräftiger gebaut als seine beiden Begleiter, sein Haar war schwarz. Lässig setzte er die Pilotenbrille ab und stieß beiläufig die Tür des Wagens zu. Der Beifahrer war drahtig und agil, der andere eher von durchschnittlicher Statur. Wie die Mitglieder einer Retro-Boy-Band warfen sie sich in die Brust und blickten sich mit übertriebener Arroganz um.
»Lass mich raten«, setzte Simon hinzu. »Das Trio Infernale: Arne, Malte und Kai.«
»Erster Preis für dich, Bruder!«, verkündete Carol mit ihrer vollkommensten Flugbegleiterinnen-Stimme.
Simon seufzte. »Und du wunderst dich, dass ich keine Lust auf dieses Kasperletheater habe.«
4
Bereits Mitte der 2000er Jahre gab es die ersten Einsätze von RFID-Chips in Form von Implantaten beim Menschen. Zunächst nutzten Tech-Begeisterte die unter die Haut gespritzten, winzigen Chips als genauso hippes wie nützliches Instrument, um bequem Haustüren zu öffnen. Dabei stammte die Technik ursprünglich aus den 1960er Jahren, als Waren mit eingesetzten Chips gegen Diebstahl gesichert wurden. Im folgenden Jahrzehnt kennzeichnete man in der Landwirtschaft Nutztiere mit den kleinen Bauteilen.
Weiterentwicklungen der Basistechnologie folgten in immer kürzeren Zeitabständen und brachten weitere Einsatzzwecke hervor wie das bargeldlose Zahlen per Handauflegen oder den Ersatz des Personalausweises.
Es wundert nicht, dass die auf den Chips gespeicherten Daten – persönliche Daten, Informationen zum Gesundheitszustand und durchgeführten Behandlungen, Bankdaten und Bonität – rasch Begehrlichkeiten bei Verbrechern weckten. Datendiebstahl per drahtloser Übertragung war innerhalb kurzer Zeit ein weit verbreitetes Problem und damit verbunden der Kontrollverlust über das eigene Konto. Entwickler und Kriminelle lieferten sich von Beginn an einen eifrigen Schlagabtausch.
Trotz dieser Probleme und aller Bedenken hielt der Erfolg der RFID-Chips an und bereitete den Boden für die nächsten gewaltigen Meilensteine im informations- und kommunikationstechnischen Fortschritt.
Boris Walker: Chipped – Siegeszug der Vernetzung, Einleitung
5
Carol stand neben dem Wagen und arrangierte ihren Schal, während Simon die langgezogene Beifahrertür aufstieß und sich aus dem Sitz schälte. Sie hatten nur eine einzige Pause eingelegt, und das war bereits zweieinhalb Stunden her. Trotz der bequemen Polsterung waren seine Gelenke ein wenig eingerostet. Er streckte sich.
»Na, dann los«, murmelte er und trottete neben seiner Schwester hinüber zum Diner.
Nina wurde von den drei anderen Neuankömmlingen umringt und klimperte dabei kokett mit den verlängerten Wimpern. Die Männer hatten sie der Reihe nach zur Begrüßung umarmt und waren in den zu erwartenden Austausch erster Nettigkeiten vertieft.
»Gut siehst du aus«, wagte Kai ein Kompliment. »Mit dem Outfit hast du voll ins Schwarze getroffen.«
»Umwerfend«, setzte Arne die Lobeshymne fort. »Absolut umwerfend.«
»Ach, kommt, Jungs«, wehrte Nina ab. »Ihr wisst doch, das ist alles Fassade.« In gespielter Verlegenheit senkte sie den Blick.
Fishing for compliments schoss es Simon durch den Kopf, als sie zu der kleinen Gruppe traten. In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich nichts geändert. Bestimmte Charakterzüge legte man nie ab.
»Na, hallo, wen haben wir denn hier?«, rief Arne aus, ehrliche Wiedersehensfreude im Gesicht. »Die Hilgenberg-Twins geben sich die Ehre.«
Die nächste Willkommensrunde stand an, doppeltes Küsschen für die Damen und Fist-Bumps für die Herren. Carol erntete einen üppigen Strauß überschwänglicher Komplimente für ihr Outfit.
»Du warst ein paarmal nicht dabei, oder Simon?«, stellte Malte fest. »Wie lange ist das her?«
Verlegen machte das Simon nicht, er zögerte allerdings, weil er tatsächlich nachrechnen musste. War es wirklich das Abba-Event gewesen?
»Fünfzehn Jahre, denke ich. Kurz bevor es mit Covid-19 losging.«
Sie nickten beifällig. »Ja, damals ging es los«, bestätigte Malte. Betretenes Schweigen breitete sich aus.
»Aber davon wollen wir uns heute nicht die Stimmung vermiesen lassen, oder?«, zwitscherte Nina und strahlte in die Runde.
Nein, vor allem du nicht, dachte Simon. Sofern du was zu saufen hast und genügend Typen um dich herum, die dich anhimmeln oder dir zumindest das Gefühl geben, hübsch und begehrenswert zu sein, kann neben dir die Apokalypse ihr Abendprogramm starten. Hauptsache, die Frisur sitzt. Er bemühte sich, seine Gedanken nicht in einer mürrischen Miene zur Schau zu stellen.
Carol stand wie üblich über solchen Dingen. Sicher ging ihr Ähnliches durch den Kopf, wusste Simon. Sie wischte das souverän beiseite. »Können wir reingehen, oder wenigstens in den Schatten?«, fragte sie und fächerte sich demonstrativ mit dem Ende ihres Schals Luft ins Gesicht. »Wir werden ja gebraten hier draußen.«
Sie einigten sich auf die überdachte Außenterrasse, weil im Innenraum Rauchverbot herrschte. Die Lufttemperatur war unter dem Vordach, das sich um das halbe Gebäude zog, um einiges erträglicher als in der sengenden Sonne auf dem glühenden Beton des Parkplatzes. Schweißflecken an dafür prädestinierten Stellen ließen sich nicht vermeiden, und glücklicherweise trug eine leichte Brise allzu aufdringliche Körpergerüche davon.
»Ist sonst schon jemand da?«, wollte Kai wissen. »Oder sind wir die Ersten?«
»Lydia, Kerstin, Maria und Tobi sind drin und besprechen noch ein paar Dinge mit dem Inhaber.« Nina deutete mit dem Daumen über ihre Schulter ins Innere des Diners. »Wir sind ja nicht die Einzigen hier, und sie wollen ein bisschen Schönwetter machen, falls wir heute Abend … äh, ein wenig aus dem Rahmen fallen.« Sie lachte auf. Die anderen lächelten vielsagend.
Arne und Malte boten unterschiedliche Zigarettensorten an. Carol zog die Marke von Arne vor, Simon lehnte ab, ebenso Nina.
»Ich hab es mir vor der ersten Schwangerschaft abgewöhnt«, erklärte sie.
Simon verbuchte das als Plus auf ihrer Pro- und Contraliste. Die Minusseite war derzeit länger; mal sehen, wo das am Abend hinführte.
Malte nickte anerkennend. »Respekt, Nina. Ich qualme, seit ich denken kann.«
»Dann ist das ja noch nicht so lang«, lachte Kai und kassierte einen nett gemeinten Boxhieb in die Seite.
»Und, Carol, du warst nicht ganz so erfolgreich wie Nina, wie ich sehe«. Arne nahm einen kräftigen Zug aus seiner Kippe und atmete durch die Nase aus. »Keine Kinder?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und hielt ihre Zigarette lässig in der Linken erhoben. Mit ihrem Outfit, dem schlichten gelben Swingkleid, dem Schal und der ins Haar geschobenen Sonnenbrille ging sie als Stilikone der Sechziger durch. Simon fragte sich, ob Nina nicht innerlich kochte angesichts Carols natürlicher Attraktivität.
»Ich bin inzwischen Großmutter«, erklärte sie voller Überzeugung und ließ die anderen sprachlos glotzen. »Ich habe auch aufgehört, als ich schwanger wurde. Und als meine Tochter ihren Scheißer ankündigte, hab ich prompt wieder angefangen zu quarzen. So here we are.« Und inhalierte einen ordentlichen Zug.
»Das glaub ich jetzt nicht«, erwiderte Arne, trat einen Schritt zurück und musterte Carol eingehend von Kopf bis Fuß.
»Ich kann’s bestätigen«, sagte Simon. »Der Kleine ist eine Plage.« Seine Schwester hob zustimmend den Daumen und grinste.
»Wir müssen das nächste Mal ein ganz normales Treffen organisieren«, meinte Kai. »Alle ohne Verkleidung und völlig ungeschminkt.«
»Och nee, ich weiß nicht.« Nina lächelte unsicher.
Bevor darauf jemand eingehen konnte oder der unselige Staffelstab der gegenseitigen Status-Quo-Abfrage an Simon weitergereicht wurde, fuhr ein weißer VW Käfer rasselnd auf den Parkplatz. Als die Fahrerin die Gruppe auf der Veranda erblickte, erscholl ein vieltöniges Hupen. Wie ein junger Welpe vollführte das Gefährt zwei freudige Runden auf der größtenteils freien Fläche und hielt schließlich diagonal am Rand, hingeschwemmt wie Treibholz. Die Türen flogen auf, und drei Frauen stiegen aus, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können.