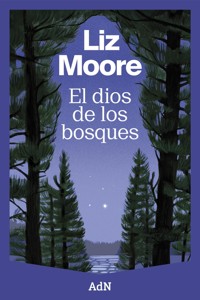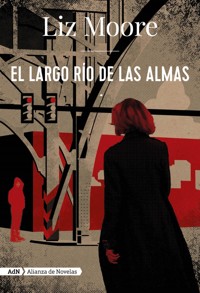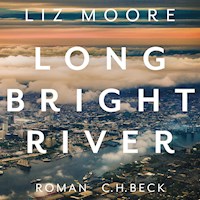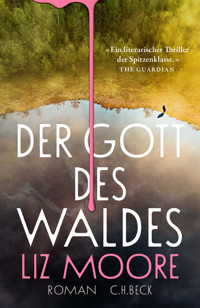
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag C.H. Beck oHG - LSW Publikumsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manche sagen, es sei tragisch, was den Van Laars widerfahren ist. Manche sagen, die Familie habe es verdient. Sie hätten sich nicht einmal bei den Suchern bedankt, die fünf Nächte lang im einskalten Wind ausharrten, um ihren vermissten Sohn zu finden. Manche sagen, es habe einen Grund gegeben, warum die Familie so lange brauchte, um Hilfe zu rufen. Dass sie wussten, was mit dem Jungen geschehen war. Jetzt, vierzehn Jahre später, ist die Tochter der Van Laars in derselben Wildnis wir ihr Bruder verschwunden. Manche sagen, es gebe keine Verbindung zwischen den beiden Fällten. Manche sagen, so etwas könne kein Zufall sein. Es ist August 1975, ein Sommer, der das Leben vieler Menschen in den Adirondack Mountains für immer verändern wird. Als Barbara eines Morgens nicht wie sonst in ihrer Koje im Sommercamp liegt, beginnt eine panische und groß angelegte Suche nach der 13-Jährigen. Das Verschwinden einer Jugendlichen im Naturreservat ist unter allen Umständen eine Katastrophe, aber Barbara ist keine gewöhnliche Camperin: Sie ist die Tochter der reichen Familie Van Laar, der das Camp und das umliegende Land in den Wäldern gehören. Und sie ist die Schwester von Bear, dem Jungen, der seit 14 Jahren vermisst wird. Kann das Zufall sein? Was wissen die anderen Kinder im Camp über Barbaras Verschwinden, und was verheimlichen die Angestellten, die im Schatten der Van Laars ihr Dasein fristen? Was hat der aus dem Gefängnis entflohene «Schlitzer» mit all dem zu tun und welche Geheimnisse hütet die Familie selbst? Mit scharfem Blick führt Liz Moore in ihrem neuen packenden Roman an die Abgründe von sozialer Ungleichheit, Wohlstandsverwahrlosung und Machtmissbrauch, lässt aber auch den Kampf um weibliche Selbstbestimmung und den großen Wert von Freundschaft hochleben. Mit «Der Gott des Waldes» hat sie nicht nur einen brillanten Thriller, sondern auch einen fulminanten Gesellschaftsroman geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Liz Moore
Der Gott des Waldes
Roman
Aus dem Englischen von Cornelius Hartz
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
Karte
I: Barbara
Louise – August 1975
Tracy – Zwei Monate zuvor Juni 1975
Alice – Juni 1975
Tracy – Juni 1975
Louise – Juni 1975
Louise – Zwei Monate später August 1975
Tracy – Juni 1975
Louise – Zwei Monate später August 1975
Alice – August 1975
Alice – Zwei Monate früher Juni 1975
Tracy – Juni 1975
Jacob – Juni 1975
II: Bear
Alice –
1950er
| 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice –
1950er
| 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice –
1950er
| 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
III: Wenn du dich verläufst
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 |
Juli 1975
| August 1975
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 |
Juli 1975
| August 1975
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 |
August 1975
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Jacob – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Alice – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Alice – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
IV: Besucher
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Carl – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice – 1950er |
1962
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice – 1950er |
1962
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice – 1950er |
1962
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
V: Gefunden
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Alice – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 |
August 1975
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Louise – 1950er | 1961 |
Winter 1973
| Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Louise – 1950er | 1961 |
Winter 1973
| Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
VI: Überleben
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag zwei
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 |
Juli 1975
| August 1975
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 |
Juli 1975
| August 1975
Alice – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag zwei
Alice – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag zwei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag zwei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag zwei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 |
August 1975
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 |
August 1975
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Jacob – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
VII:
Self-Reliance
Alice – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag drei
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Alice – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag vier
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag fünf
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag fünf
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Nacht fünf
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Nacht fünf
Victor – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Victor – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Victor – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Victor – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Victor – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Alice – 1950er |
1961
| Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag sechs
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag sechs
Louise – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag sechs
Tracy – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag sechs
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975 |
September 1975
Barbara – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975:
Tag eins
Judyta – 1950er | 1961 | Winter 1973 | Juni 1975 | Juli 1975 | August 1975 |
September 1975
Danksagung
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Für meine Schwester Rebecca, die die Wälder dort ebenfalls kennt
Karte
So mancher Wanderer, der jene Wälder betritt, mag nicht wahrhaben, welche Gefahr ihm dräut, wenn er sich auf den Weg macht, um sich dort ganz allein seiner liebsten Zerstreuung hinzugeben. Er sollte sich darüber im Klaren sein, dass das Risiko, das er eingeht, durchaus ernst zu nehmen ist – das Risiko nämlich, sich im Walde zu verlaufen. Es ist das Einzige, wovor man sich in den Wäldern der Adirondacks fürchten muss!
– «Lost in the Adirondacks: Warning to Visitors to the North Woods; What Not to Do When You Lose Your Way and How Not to Lose It», New York Times, 16. März 1890
Wie schnell Gefahr und Schönheit einander in der Wildnis doch abwechseln, dachte ich bei mir, und die eine ist stets Teil der anderen.
– Anne LaBastille, Woodswoman
I
Barbara
Louise
August 1975
Das Bett ist leer.
Die Betreuerin Louise – dreiundzwanzig, kurze Beine, raue Stimme, heiteres Gemüt – steht barfuß auf den warmen, rauen Bodenbrettern der Hütte, die den Namen «Haus Balsam» trägt, und stellt fest, dass die untere Etage des Stockbetts neben der Tür leer ist. Später wird sie die zehn Sekunden, die zwischen dieser Wahrnehmung und ihrer daraus resultierenden Schlussfolgerung liegen, als Beweis dafür werten, dass Zeit ein menschliches Konstrukt ist und je nach Gefühlslage – sprich: Chemikalien im Blut – entweder schneller oder langsamer vergeht.
Das Bett ist leer.
Die einzige Taschenlampe in der Hütte, deren Fehlen auch bei Tag anzeigt, dass eines von den Mädchen zum Toilettenhaus gegangen ist, liegt an ihrem angestammten Platz auf einem Bord neben der Tür.
Louise dreht sich langsam um die eigene Achse und ruft sich die Namen der Mädchen, die sie sieht, ins Gedächtnis.
Melissa. Melissa. Jennifer. Michelle. Amy. Caroline. Tracy. Kim.
Acht Ferienkinder. Neun Betten. Sie zählt, und dann zählt sie noch einmal.
Schließlich, als sie es nicht mehr verhindern kann, lässt sie es zu, dass sich ein weiterer Name den Weg an die Oberfläche ihres Bewusstseins bahnt: Barbara.
Das leere Bett ist das von Barbara.
Sie schließt die Augen und stellt sich vor, dass sie für den Rest ihres Lebens immer wieder an diesen Ort und an diesen Moment zurückdenken wird: eine einsame Zeitreisende, ein Geist, der im Haus Balsam herumspukt und sich wünscht, dass ein Körper erscheint, wo keiner ist. Der sich wünscht, dass Barbara durch die Tür kommt. Sagt, sie sei nur zur Toilette gegangen und habe vergessen, dass man dazu immer die Taschenlampe mitnehmen soll. Dass sie sich auf so entwaffnende Art und Weise entschuldigt, wie sie es öfter tut.
Aber Louise weiß genau, dass Barbara nichts von alldem tun wird. Aus Gründen, die sie nicht genau benennen kann, spürt sie, dass Barbara fort ist. Verschwunden.
Ausgerechnet Barbara, denkt Louise. Von allen Ferienkindern, die verschwinden könnten.
Um 6:25 Uhr betritt Louise durch einen Vorhang den Raum, den sie sich mit Annabel teilt, einer Betreuerin, die sich noch in der Ausbildung befindet. Sie ist siebzehn, kommt aus Chevy Chase, Maryland, und tanzt Ballett. Annabel Southworth ist altersmäßig näher an den Ferienkindern als an Louise, aber sie kann sich behaupten, ihre Worte haben stets einen ironischen Unterton, und sie lässt ganz allgemein keinen Zweifel daran, dass es eine klare Grenze zwischen dreizehn und siebzehn Jahren gibt – eine Grenze, die auch durch die Sperrholzwand markiert wird, die den Hauptteil der Hütte von der Ecke trennt, in der die Betreuerinnen schlafen.
Louise rüttelt sie wach. Annabel blinzelt. Hält sich theatralisch eine Armbeuge vor die Augen. Schlummert wieder ein.
Louise fällt etwas auf: der Geruch von verstoffwechseltem Bier. Erst hatte sie angenommen, er käme von ihrem eigenen Körper – von ihrer Haut und aus ihrem Mund. Sie hat letzte Nacht definitiv so viel getrunken, dass sie heute Morgen die Folgen davon spüren kann. Aber als sie sich nun über Annabel beugt, fragt sie sich, ob der Geruch nicht eher von Annabels Seite des Raumes kommt.
Was ihr durchaus Sorgen bereitet.
«Annabel», flüstert Louise. Plötzlich erkennt sie in ihrem Tonfall den Klang der Stimme ihrer Mutter. Und wenn sie die junge Frau da vor sich betrachtet, fühlt sie sich in gewisser Hinsicht auch wie ihre Mutter. Ihre verantwortungslose Rabenmutter.
Annabel öffnet die Augen. Sie setzt sich auf und zuckt sofort zusammen. Als sie Louises Blick begegnet, macht sie große Augen und wird blass.
«Ich muss brechen», sagt sie – zu laut.
Louise macht Pst! und schnappt sich das einzige Gefäß in Reichweite, eine leere Kartoffelchipstüte, die auf dem Fußboden liegt.
Annabel nimmt ihr die Tüte ab. Sie übergibt sich. Dann hebt sie den Kopf, keucht und stöhnt leise.
«Annabel», sagt Louise. «Hast du etwa einen Kater?»
Annabel schüttelt den Kopf. Sie sieht aus, als hätte sie Angst.
«Ich glaube, ich», sagt sie – wieder macht Louise Pst!, und diesmal setzt sie sich zu der jungen Frau auf die Bettkante und zählt in Gedanken bis fünf, wie sie es schon als kleines Kind getan hat. So hat sie sich beigebracht, nicht vorschnell zu reagieren.
Annabels Kinn zittert. «Ich glaube, ich habe etwas Falsches gegessen», flüstert sie.
«Warst du gestern Abend noch weg?», fragt Louise. «Annabel?»
Annabel schaut sie an. Überlegt.
«Das ist wichtig», sagt Louise.
Normalerweise hat sie jede Menge Geduld mit ihren Auszubildenden und hat auch Übung darin, sie durch ihren ersten Kater zu begleiten. Sie findet es nicht schlimm, wenn sie sich an ihrem freien Abend ein wenig vergnügen. In diesem Jahr ist Louise die leitende Betreuerin, aber wenn sich jemand auf eine Weise danebenbenimmt, die sie für unbedenklich hält, drückt sie meist ein Auge zu. Sie macht sogar selbst mit, falls es ihr angebracht scheint. Aber im Großen und Ganzen führt sie ein strenges Regiment; in diesem Sommer hat sie dem ersten Betreuer, der nach einer durchzechten Nacht verschlafen hat, zur Strafe verboten, an den nächsten Partys teilzunehmen, und hat damit ein Exempel statuiert. Seitdem hat keiner mehr verschlafen.
Bis jetzt. Denn gestern Abend ist Louise ausgegangen, und Annabel hatte Dienst. Und das scheint Annabel nicht gut bekommen zu sein.
Louise schließt die Augen. Sie geht noch einmal die Ereignisse des letzten Abends durch.
Im Gemeinschaftsraum fand eine Tanzparty statt: das Abschlussfest, eine Pflichtveranstaltung für alle Ferienkinder, Betreuer und Auszubildenden. Sie erinnert sich, dass Annabel irgendwann nicht mehr da war – zumindest, dass sie sie nicht mehr gesehen hat –, aber Louise ist sich sicher, dass sie am Ende der Party wieder da war.
Denn um 23 Uhr, als Louise kurz durchzählte, war Annabel dabei, und neun Ferienkinder – jawohl, neun – waren bei ihr und winkten Louise freundlich zu, als sie einander gute Nacht sagten. Sie hat noch genau vor Augen, wie sie ihnen hinterherschaute, als sie in kleinen Grüppchen Richtung Haus Balsam gingen.
Es war das letzte Mal, dass sie die Mädchen sah. Louise war überzeugt, dass Annabel alles unter Kontrolle hatte, und zog alleine los.
Als Nächstes versucht sie, sich an die Betten der Ferienkinder zu erinnern, als sie selbst mitten in der Nacht, weit nach Bettruhe, in die Hütte schlich. Um wie viel Uhr war das – um 2? Um 3? Die Bilder kehren bruchstückhaft zu ihr zurück: der offene Mund von Melissa R., Amys Arm, der über die Bettkante auf den Boden hängt. Nur an Barbara kann sie sich nicht erinnern. Andererseits aber auch nicht daran, dass Barbaras Bett leer gewesen wäre.
Stattdessen taucht eine andere Erinnerung auf: John Paul auf der Lichtung, wie er mit den Armen rudert, zuerst in ihre Richtung und dann in die von Lee Towson. John Paul, der die Fäuste schwingt, als beträte er einen Boxring, so wie es Jungs aus reichem Hause immer tun. Lee dagegen stürmisch und rauflustig, noch in seiner Schürze vom Abendessen. Er hat kurzen Prozess mit John Paul gemacht, hat ihn am Boden liegen lassen und geistesabwesend hoch zu den Ästen geblinzelt.
Heute gibt es Ärger. Den gibt es immer, wenn John Paul glaubt, dass sie mit jemand anderem rummacht.
Nur um das klarzustellen: Das hat sie nicht. Dieses Mal nicht.
Annabel schnappt nach Luft. Sie legt sich eine Hand auf die Augen.
«Weißt du, wo Barbara ist?», fragt Louise. Sie kommt direkt zur Sache. Ihr bleibt nicht viel Zeit: Bald werden die Mädchen nebenan aufwachen.
Annabel sieht verwirrt aus.
«Van Laar», sagt Louise, und dann sagt sie es noch einmal, diesmal etwas leiser. «Eines unserer Ferienkinder.»
«Nein», sagt Annabel und lässt sich wieder rücklings aufs Bett sinken.
In diesem Moment ertönt aus den Lautsprechern, die überall auf dem Gelände des Ferienlagers an den Bäumen angebracht sind, die Reveille, das traditionelle Hornsignal, das beim Militär als Weckruf dient. Somit werden gleich auf der anderen Seite der Sperrholzwand acht zwölf- und dreizehnjährige Mädchen widerwillig aufwachen, ihre leisen Geräusche machen, ausatmen und seufzen und sich auf die Ellbogen stützen.
Louise geht auf und ab.
Annabel, immer noch in der Horizontalen, beobachtet sie dabei, offenbar dämmert ihr langsam, was das Problem ist.
«Annabel», sagt Louise. «Du musst mir jetzt bitte die Wahrheit sagen. Warst du letzte Nacht noch einmal unterwegs? Als die Mädchen schon im Bett waren?»
Annabel scheint den Atem anzuhalten. Dann atmet sie aus. Sie nickt. Louise sieht, dass ihre Augen feucht werden.
«Ja, war ich», sagt sie. In ihrer Stimme liegt ein kindliches Zittern. Sie hat sich in ihrem bisherigen Leben nur selten Ärger eingehandelt, da ist sich Louise sicher. Sie ist ein Mensch, dem man von Geburt an vermittelt hat, welchen Wert er in dieser Welt hat. Die Art und Weise, wie sie andere mit ihrer guten Laune ansteckt. Jetzt weint sie ganz ungehemmt, und Louise gibt sich alle Mühe, nicht mit den Augen zu rollen. Was glaubt Annabel denn, wovor sie Angst haben muss? Für sie steht nichts auf dem Spiel. Sie ist siebzehn Jahre alt. Das Schlimmste, was Annabel passieren kann, ist, dass man sie wieder nach Hause schickt, zu ihren reichen Eltern, die mit den Besitzern des Ferienlagers befreundet sind. Und die just in diesem Moment in deren Haus auf dem Gelände zu Gast sind. Dagegen ist das Schlimmste, was Louise passieren kann – einer Erwachsenen, denkt sie, um sich zu kasteien –, also, das Schlimmste, das ihr passieren kann, ist … nun ja. Mach dir nicht zu viele unnötige Gedanken, sagt sie sich. Konzentrier dich aufs Hier und Jetzt.
Louise geht zum Vorhang. Zieht ihn ein Stück beiseite. Sie sieht, wie die stille Tracy, die sich mit Barbara ein Etagenbett teilt, die Leiter hinabsteigt und offenbar sofort bemerkt, was nicht stimmt.
Louise lässt den Vorhang zurückfallen.
«Ist sie verschwunden?», fragt Annabel.
Wieder macht Louise: Pst! «Sag nicht verschwunden», zischt Louise. «Sag lieber, sie ist nicht in ihrem Bett.»
Louise durchsucht ihren kleinen Raum nach Indizien dafür, was sie letzte Nacht angestellt haben. Alles, was sie findet, steckt sie in eine braune Papiertüte: eine leere Bierflasche, die sie auf dem Rückweg von der Lichtung leergetrunken hat; den Stummel eines Joints, den sie irgendwann zwischendurch geraucht hat; die Chipstüte mit Erbrochenem darin, die sie mit spitzen Fingern hochhebt.
«Hast du noch irgendetwas, von dem du nicht willst, dass es jemand findet?», fragt sie Annabel, doch die schüttelt den Kopf.
Louise schließt die Papiertüte und faltet sie zusammen.
«Hör mir gut zu», sagt sie. «Vielleicht musst du heute Vormittag die Aufsicht über die Ferienkinder übernehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wenn ja, dann musst du das hier dringend loswerden. Wirf es einfach auf dem Weg zum Frühstück in den Müllcontainer. Es muss verschwinden. Schaffst du das?»
Annabel nickt, sie ist immer noch ganz grün im Gesicht.
«Aber jetzt bleibst du erst einmal hier», sagt sie zu Annabel. «Zeig dich eine Weile besser nicht. Und außerdem …» Sie zögert und sucht nach passenden Worten, es soll ernsthaft klingen, aber nicht so, als hätte sie selbst irgendetwas falsch gemacht. Immerhin ist Annabel quasi noch ein Kind. «Sag noch niemandem etwas von letzter Nacht. Ich will mir erst ein paar Gedanken machen.»
Annabel bleibt stumm.
«Okay?», fragt Louise.
«Okay.»
Sie wird sofort einknicken, denkt Louise. Jeder x-beliebigen Autoritätsperson wird sie, ohne zu zögern, alles, was passiert ist, und alles, was sie weiß, auf die Nase binden. Sie wird sich bei ihrer Mutter und ihrem Vater ausheulen, die wahrscheinlich nicht einmal wissen, worum es in dem Gedicht von Poe, nach dem sie ihre Tochter benannt haben, eigentlich geht. Sie wird sich von ihnen trösten lassen und wieder zum Ballett gehen, und nächstes Jahr wird ihre Prep School sie nach Vassar oder Radcliffe oder Wellesley schicken, und sie wird einen jungen Mann heiraten, den ihre Eltern ihr aussuchen – sie haben schon eine Idee, wer das sein könnte, wie sie Louise verraten hat –, und sie wird nie wieder an Louise Donnadieu denken oder an das Schicksal, das Louise ereilen wird, oder daran, wie schwer Louise es für den Rest ihres Lebens haben wird, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden, ihre Mutter zu unterstützen, die seit sieben Jahren nicht mehr arbeiten kann oder will. Ihren kleinen Bruder zu unterstützen, der mit seinen elf Jahren noch nichts dafür getan hat, das Leben zu verdienen, das man ihm geschenkt hat.
Vor ihr würgt Annabel. Beruhigt sich wieder.
Louise stützt die Hände in die Hüften. Atmet. Nur die Ruhe, ermahnt sie sich.
Sie lässt die Schultern hängen. Zieht den Vorhang zurück. Macht sich bereit, so zu tun, als wisse sie von nichts. Gleich wird sie vor dieser Schar Mädchen die Überraschte spielen, diesen Mädchen, die – wie eine Pille schluckt sie ihre Scham herunter – zu ihr aufschauen, sie bewundern, sie immer wieder um Rat bitten, bei ihr Schutz suchen.
Sie betritt den Schlafsaal. Tut so, als würde sie aufmerksam die Betten betrachten, eines nach dem anderen. Sie runzelt die Stirn, gibt sich verwirrt.
«Wo ist denn Barbara?», fragt sie betont fröhlich.
Tracy
Zwei Monate zuvor Juni 1975
Drei Regeln hatte man den Ferienkindern direkt bei der Ankunft eingebläut.
Die erste betraf Nahrungsmittel in den Hütten, und wie man sie zu verzehren und zu lagern hatte (ohne zu krümeln oder zu kleckern; in verschließbaren Behältern).
Die zweite betraf das Badengehen: Dies durfte man unter keinen Umständen allein tun.
Die dritte (und wichtigste, was man daran erkennen konnte, dass sie in Großbuchstaben auf mehreren Schildern stand, die an gemeinschaftlich benutzten Orten angebracht waren) lautete: WENN DU DICH VERLÄUFST: SETZ DICH HIN UND SCHREI.
Tracy kam diese Aufforderung unfreiwillig komisch vor. Später an jenem Abend, beim Begrüßungs-Lagerfeuer, wurde ihnen erklärt, welche Logik dahintersteckte. Aber so, wie einer der Betreuer, ein hochgewachsener Mann, es in jenem Moment sagte, ohne Satzzeichen oder Betonung, musste sie den Blick abwenden und sich ein nervöses Lachen verkneifen. WENN DU DICH VERLÄUFST: SETZ DICH HIN UND SCHREI. Sie versuchte, sich vorzustellen, wie das wäre: sich irgendwo einfach so hinzusetzen, den Mund zu öffnen und loszuschreien. Was für einen Laut würde man dabei wohl machen? Was für Wörter würde man rufen? Hilfe? Helft mir? Oder, Gott bewahre: Bitte sucht nach mir? Das war zu peinlich, um weiter darüber nachzudenken.
Ihr Vater hatte ihr Geld dafür gegeben, dass sie hierhergekommen war.
Eine Woche lang hatten sie miteinander verhandelt und sich am Ende das ganze Wochenende lang in Tracys Zimmer angegiftet. Das Resultat: hundert Dollar, eine Hälfte bar auf die Hand, die andere zahlbar bei ihrer Rückkehr.
Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte sie den Sommer ganz anders verbracht: Sie hätte jeden Tag im Wohnzimmer des viktorianischen Hauses in Saratoga Springs herumgehangen, das ihre Eltern zehn Jahre lang immer für die Rennsaison gemietet hatten. Die Jalousien halb heruntergelassen, die Fenster einen Spalt geöffnet, alle Ventilatoren im Haus in ihre Richtung gedreht, hätte sie auf dem Sofa gelegen und wäre nur aufgestanden, um sich ein paar raffinierte Snacks zu machen. Und vor allem hätte sie: gelesen.
Das hatte sie fünf Sommer in Folge getan. Sie hatte gehofft, dass es im Sommer 1975 genauso sein würde.
Stattdessen hatte sich ihr Vater, der seit einem knappen Jahr von ihrer Mutter geschieden war, in rascher Folge eine Freundin angeschafft, ein schickeres Ferienhaus gemietet und sich überlegt, dass es nicht gut für Tracy wäre, den ganzen Sommer lang untätig herumzuliegen. Das hatte er ihr gesagt, als sie Mitte Juni vom Haus ihrer Mutter auf Long Island aus nach Saratoga gefahren waren. (Ihr war nicht verborgen geblieben, dass er gewartet hatte, bis sie mehr als die Hälfte der Strecke nach Saratoga zurückgelegt hatten, bevor er ihr mitteilte, was er sich überlegt hatte.) Sie war überzeugt, dass der wahre Grund war, dass er sie für zwei Monate los war. Damit er und besagte Freundin das Haus für sich hatten, ohne dass eine schmollende Zwölfjährige auf dem Sofa herumlag. Warum, fragte sich Tracy, hatte er bloß so sehr darum gekämpft, den ganzen Sommer über das Sorgerecht für sie zu haben, wenn er sie jetzt einfach in ein Ferienlager abschob?
Er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, sie selbst nach Camp Emerson zu bringen. Diese Aufgabe hatte er an Donna Romano delegiert, seine neue Freundin, die für Tracy immer noch Vor- und Nachname war.
«Heute ist Rennen», sagte ihr Vater, als Tracy sich ihm im Flur in den Weg stellte und ihn anbettelte, wenigstens mitzukommen. «Ich muss nach Belmont. Um zwei läuft Second Thought.»
Ihr Vater war der Sohn eines Jockeys, der zu sehr in die Höhe geschossen war, um in dessen Fußstapfen zu treten. Stattdessen war er Bereiter, dann Trainer und schließlich Rennpferdbesitzer geworden, und mit jedem Job hatten sich ihre Lebensumstände verbessert. Nachdem Tracy zur Welt gekommen war, hatten sie zu dritt in einem Wohnwagen in der Einfahrt ihrer Mutter gehaust. Jetzt wohnten sie in einem neuen, großen Haus mit einem silberbeschlagenen Tor an der Einfahrt in Hempstead, New York. Zumindest Tracy und ihre Mutter.
«Worüber sollen wir uns überhaupt unterhalten?», fragte sie, aber er schüttelte nur den Kopf und legte ihr flehend seine Hände auf die Schultern. Mit einem Mal wurde ihr klar, dass sie mit ihrem eigenen Vater auf Augenhöhe war. Ihr letzter Wachstumsschub hatte sie auf fast 1,80 Meter gebracht, was zur Folge hatte, dass sie, wenn sie nicht in Bewegung war, einen krummen Rücken machte.
«Da soll es todschick sein. Ich meine, so richtig etepetete», sagte ihr Vater – dieselben zwei peinlichen Adjektive, die er benutzt hatte, als er ihr erstmals von seinen Plänen berichtet hatte. «Ich wette, am Ende findest du es richtig dufte.»
Sie wandte sich zum Fenster. Draußen sah sie, wie Donna Romano in der Autoscheibe ihr Spiegelbild betrachtete und ihren BH zurechtrückte. Es war ein nagelneuer Stutz Blackhawk, eine Nobelkarosse mit plüschiger Auslegeware im Fußraum. Das Röhren des Motors erinnerte Tracy immer an die Stimme ihres Vaters. «Das Beste vom Besten», hatte er gesagt, als er sie in Hempstead abgeholt hatte. Tracy fiel auf, dass plötzlich alles im Leben ihres Vaters neu war. Wohnung, Freundin, Pekinesenwelpe, Auto. Tracy war das einzig Alte in seinem Leben; kein Wunder, dass er sie aus dem Haus haben wollte.
Wie sich herausstellte, war Donna Romano Kettenraucherin. Zwischen den Zügen stellte sie Tracy Fragen über ihr Leben, die sie offensichtlich für diese Autofahrt gesammelt hatte. Wenn sie nicht damit beschäftigt war, Donna Romanos Fragen zu beantworten, betrachtete Tracy die Frau verstohlen. Sie war sehr hübsch. Normalerweise hätte Tracy das gefallen. Sie hatte etwas übrig für hübsche Frauen. Sie bewunderte die beliebteren Mädchen an ihrer Schule – wobei das nicht ganz stimmte, denn wenn sie ehrlich war, verachtete sie sie im Grunde ihres Herzens. Trotzdem war sie von ihnen fasziniert, vielleicht weil sie rein körperlich das genaue Gegenteil von ihr waren und ihr daher wie Präparate vorkamen, die sie am liebsten unter dem Mikroskop studiert hätte. Die meisten ihrer Mitschülerinnen trugen langes, glattes Haar mit Mittelscheitel – Tracy hatte einen roten Wuschelkopf. Einige ihrer Mitschülerinnen hatten ein paar wenige, zarte Sommersprossen im Gesicht – Tracys Sommersprossen waren so ausgeprägt, dass einige Jungs aus der Sechsten ihr den Spitznamen «Dotty» verpasst hatten. Eigentlich war sie Brillenträgerin. Sie hatte auch eine Brille, aber die setzte sie nie auf, weswegen sie dauernd die Augen zusammenkniff, um scharf sehen zu können. Ihr Vater hatte ihr einmal beiläufig gesagt, sie sähe aus wie eine Pflaume auf Zahnstochern, und dieser Satz war so grausam und poetisch zugleich, dass er irgendwie schon wieder passte.
Die Straßen wurden immer schlechter, auf Asphalt folgten Schotterpisten, auf Schotterpisten folgten Feldwege. Alle paar Minuten tauchten verfallene Häuser auf, deren Vorgärten in Friedhöfe für verrostete Autos umfunktioniert worden waren. Er war unheimlich, dieser Kontrast zwischen der Schönheit der Natur und menschengemachtem Verfall, und Tracy fragte sich, ob sie nicht irgendwo falsch abgebogen waren.
Dann endlich kam ein Schild in Sicht, auf dem Naturreservat Van Laar stand.
In den Anweisungen, die man ihnen mitgeschickt hatte, stand, dass sie diesem Schild folgen sollten.
«Komisch, dass sie nicht den Namen des Ferienlagers auf das Schild geschrieben haben», sinnierte Donna Romano.
Vielleicht, damit Perverse es nicht finden, dachte Tracy. Sie wusste: Genau das hätte ihr Vater jetzt gesagt. Ständig hörte sie seine Stimme, wie einen Erzähler, der ihr Leben kommentierte, auch wenn sie das gar nicht wollte. Sie waren noch nie so lange voneinander getrennt gewesen wie in diesem Jahr, dem ersten nach der Scheidung.
Als kleines Kind war sie so etwas wie sein Schatten gewesen, hatte ihn bedingungslos lieb gehabt, war ihm auf Schritt und Tritt gefolgt und hatte seinen Lieblingspferden mit der flachen Hand Karotten in die samtenen Mäuler gesteckt. Auch wenn sie es nie im Leben zugegeben hätte, hatte Tracy ihn von ganzem Herzen vermisst, und den größten Teil des letzten Schuljahres hatte sie damit zugebracht, sich auf den Sommer mit ihm zu freuen.
Der Feldweg gabelte sich. Ein Schild mit einem Pfeil nach rechts wies ihnen nun doch den Weg zum Ferienlager und verhieß: Camp Emerson – Wo sich Freunde fürs Leben finden. Dann öffneten sich die Bäume, und sie kamen auf eine Wiese, auf der in Reih und Glied mehrere rustikale Holzhäuser standen. Davor stand ein Klapptisch, an dem ein klammes Pappschild mit der wenig überzeugenden Aufschrift Herzlich willkommen befestigt war, und hinter dem Tisch saß ein Betreuer.
Der Betreuer kam mit einer Mappe auf den Blackhawk zu und reichte sie Donna durchs Fenster. Dann verkündete er feierlich wie ein mittelalterlicher Herold die «drei Regeln von Camp Emerson». Die dritte, die wichtigste, sollte Tracy noch tagelang, wochenlang im Kopf herumspuken. Sogar für den Rest ihres Lebens.
Wenn du dich verläufst: Setz dich hin und schrei!
Tracy konnte sich schwerlich vorstellen, wie sehr sie sich verlaufen musste, bevor sie das täte. Ihre Stimme, so kam es ihr vor, war seit ihrer Geburt immer leiser geworden, und jetzt mit zwölf war sie kaum noch zu hören.
Sie würde sich komplett und unwiederbringlich im tiefsten Wald verlaufen müssen, beschloss sie.
«Du kommst nach Haus Balsam», unterbrach der junge Mann Tracys Gedankengang. Er streckte einen langen Arm aus und wies nach rechts. Donna Romano trat aufs Gas, und der Blackhawk rollte weiter.
Alice
Juni 1975
Die letzten Eltern fuhren ab.
Vom Wintergarten des Hauses oben auf dem Hügel aus beobachtete Alice, wie unten die Autos vorbeifuhren, eine langsame Parade mit eingeschalteten Scheibenwischern.
Camp Emerson war eine halbe Meile entfernt, aber hier, vom Haupthaus des Naturreservats aus, das den Namen Self-Reliance trug, konnte sie die ganze Umgebung sehen: im Osten den Lake Joan, im Westen die lange Zufahrt zur Hauptstraße, die in die Stadt führte, im Süden Camp Emerson und im Norden die Wildnis. Den Hunt Mountain und seine Ausläufer.
Seit zwei Stunden stand sie schon hier. Einundneunzig Autos waren bisher vorbeigefahren. In jedem saßen eines oder mehrere Elternteile, die eines oder mehrere Kinder hergebracht hatten.
Seit dreiundzwanzig Jahren war sie mit Peter Van Laar verheiratet, und seit dreiundzwanzig Jahren war das hier Alice’ Ritual: Seit ihrem achtzehnten Lebensjahr stand sie jedes Mal an dem Tag, wenn das Ferienlager losging, hinter den hohen Fensterscheiben des Wintergartens von Haus Self-Reliance und schaute der Autokarawane zu, manchmal mit einem Kind auf dem Arm, manchmal allein. Sie stellte sich gerne die Familien vor, die in den Autos saßen, malte sich aus, wie sie hießen und welche Probleme sie hatten.
Der letzte Wagen verschwand aus ihrem Blickfeld. Alice richtete sich auf. Sie sah auf die Wanduhr hinter sich: 16:45 Uhr. Ihr täglicher Countdown lief, um fünf durfte sie eine der Tabletten nehmen, die Dr. Lewis ihr für ihre Nerven verschrieben hatte. Empfohlen war eine – aber «an besonders schlechten Tagen» würden ihr auch zwei nicht schaden. Damit meinte Dr. Lewis Tage, an denen sie zu häufig an Bear dachte.
Also heute zwei.
Ein dumpfes Wummern im Flur: Der eiserne Türklopfer schlug gegen die Haustür. Das war T. J.
Heute Morgen hatte Alice im Büro der Campleiterin angerufen und um ein Treffen gebeten.
Jetzt fischte Alice das Glasfläschchen aus ihrer Tasche. Sie zerkaute ihre zwei Tabletten, eine Viertelstunde zu früh.
Dann schloss sie die Augen und wiederholte in Gedanken die Worte, die sie sich zurechtgelegt hatte.
Es geht um Barbara, würde sie sagen. Sie würde gerne mit ins Ferienlager.
Vor fünf Jahren hatte T. J. Hewitt die Leitung von Camp Emerson übernommen. Zunächst hatte sie sich gesträubt; ihr Vater Vic, so hatte sie betont, sei durchaus in der Lage, den Job, den er seit Jahrzehnten wunderbar erledigte, auch weiterhin auszuüben.
Doch Vic hatte immer mehr abgebaut, erst körperlich, dann geistig. Im Sommer 1970 war dann allen schlagartig klar geworden, dass sich etwas ändern musste, als er gleich am ersten Tag der Saison mehreren Ferienkindern sinnlose Laute entgegengebrüllt und sie damit in Angst und Schrecken versetzt hatte. Und das vor den Augen der Eltern! Wütend waren die Eltern zum Haupthaus gestürmt, um sich zu beschweren. Peter hatte Vic an Ort und Stelle seines Amtes enthoben und den Eltern versichert, dass er persönlich die Aufsicht über das Ferienlager übernehmen würde, bis sich ein geeigneter Ersatz gefunden hätte.
Doch nachdem sich auf die Schnelle kein Ersatz auftreiben ließ, hatte Peter vorgeschlagen, T. J. könne doch für ihren Vater einspringen. Alice war dagegen gewesen. T. J. war so jung und noch dazu eine Frau. Wer hatte je davon gehört, dass eine Frau ein Naturreservat beaufsichtigte? Aber Peter hatte darauf bestanden. Irgendwann würden sie schon noch jemand Besseren finden, hatte er gesagt.
Doch bislang war niemand Besseres aufgetaucht, jedenfalls in Peters Augen. Also erledigte T. J. weiterhin die beiden Aufgaben ihres Vaters: Im Herbst, Winter und Frühjahr fungierte sie als Aufseherin über das Naturreservat, im Sommer als Leiterin des Ferienlagers. Sie wohnte nach wie vor in dem Haus, in dem sie aufgewachsen war und das im Sommer als Büro der Leiterin des Ferienlagers diente und das ganze Jahr über als Vic Hewitts Genesungsheim.
Jetzt stand T. J. in der Tür zum Wintergarten und räusperte sich. Sie sah aus, als sei ihr nicht ganz wohl in ihrer Haut – wobei sie eigentlich immer so aussah, wenn sie sich im Inneren eines Gebäudes aufhielt. Ihr Revier war der Wald.
«Hallo, T. J.», sagte Alice, und T. J. nickte, um zu vermeiden, Alice anreden zu müssen. Solange Alice sie kannte, hatte T. J. sie nie mit Namen angesprochen. Sie strahlte eine gewisse Hochnäsigkeit aus, die Alice immer irritiert hatte. Mit Peter ging sie anders um, fand Alice – Peter gegenüber war sie schon fast unterwürfig.
«Setzen Sie sich», sagte Alice und sah zu, wie sich T. J. einmal um die eigene Achse drehte und offenbar nach einer Sitzgelegenheit Ausschau hielt, mit der sie Alice das Gefühl geben konnte, sie wolle es sich möglichst wenig bequem machen. Schließlich nahm sie auf einem gepolsterten Hocker Platz, setzte sich ganz an die Kante. Stützte die Ellbogen auf die Knie, den Kopf auf die Hände.
Seit einer Weile trug sie ihr Haar kurz, eine Art Pilzkopf, aber so schief und krumm, dass Alice davon ausging, dass sich T. J. die Haare selbst schnitt. Alice hatte Mühe einzusehen, dass die Frau, die vor ihr saß, derselbe Mensch war wie das Mädchen, das vor dreiundzwanzig Jahren mit seinem Vater hergekommen war. T. J. war drei Jahre alt gewesen und immer in Bewegung, war ihrem Vater nachgelaufen wie ein Gänseküken. Damals hatte sie noch Tessie Jo geheißen, ein ausgefallener Name, wie für eine Puppe, eine Kuh oder eine Akrobatin vielleicht, aber zu einem solch stoischen Kind wollte er nicht so recht passen. Mit sechzehn hatte sie sich das androgyne T. J. zugelegt, aber ihr Haar trug sie anschließend noch zehn Jahre lang zu einem dicken Zopf gebunden. Bis jetzt.
«Wie geht es Ihnen?», fragte Alice. Sie nahm ein Pfefferminzbonbon aus der Schale neben sich, die das Personal immer wieder auffüllte. Die rosa Bonbons waren die besten.
«Ganz okay», sagte T. J. in ihrem breiten Dialekt. Dieser Dialekt! Alice lebte seit mehr als zwanzig Jahren hier und hatte immer noch Probleme damit.
«Und wie geht es Ihrem Vater?»
«Geht schon.»
«Gibt es dieses Jahr Probleme mit den Sanitäranlagen?»
«Nee», sagte T. J. Sie zupfte an etwas Unsichtbarem in ihrem Nacken. Musterte ihre Hand.
«Ich will gleich zum Thema kommen», sagte Alice. «Ich nehme an, Mr Van Laar hat schon mit Ihnen gesprochen?» Sie wartete auf T. J.s Antwort, denn ehrlich gesagt hatte sie keine Ahnung, ob Peter mit ihr gesprochen hatte. Seit er Donnerstag nach Albany gefahren war, hatte sie nichts mehr von ihm gehört. Sie wusste nur, dass Barbara noch zu Hause war.
T. J. schüttelte den Kopf. Also nicht.
Alice atmete aus. Das war ja klar, dachte sie. Wenn sie sich auf irgendetwas verlassen konnte, dann darauf, dass er sich vor seinen Pflichten drückte; dass er sie – und Barbara – immer wieder im Stich ließ; dass er sich einfach so verdünnisierte, wenn es ernst wurde. Das war auch der Grund, warum er in letzter Zeit – seit Barbara sich so verhielt – ständig verschwand, meistens ohne ihr Bescheid zu sagen. Und dann still und heimlich zurückkam.
T. J. wand sich, drückte den Rücken durch.
«Nun», sagte Alice zu T. J. und zwang sich, möglichst aufgeräumt zu klingen. «Dann wissen Sie ja noch gar nichts davon. Wir haben beschlossen … nein, Barbara hat beschlossen, dass sie dieses Jahr am Ferienlager teilnehmen möchte.»
Sie lächelte verhalten, als wäre das eine gute Nachricht.
Sie wusste, dass das T. J. gar nicht gefiel. Schon deshalb hatte sie es immer wieder aufgeschoben. Seit Generationen gab es eine strikte Trennung zwischen den Van Laars – durchaus naturverbundenen, aber doch recht gesetzten Bankiers aus Albany – und dem Ferienlager, das zwar technisch gesehen ihr Eigentum war, aber schon immer die Domäne der Hewitts gewesen war. Zuerst Vics Domäne. Jetzt die seiner Tochter. Außerdem mochte T. J. es, wenn die Dinge auf eine bestimmte Art und Weise erledigt wurden. Wenn man sich an bestimmte Rangfolgen hielt. Alice nahm an, dass sie sich darüber ärgern würde, dass sie sie erst so spät informierte.
Für einen kurzen Moment huschte eine Regung über T. J.s Gesicht, die Alice nicht einordnen konnte. Bestürzung? Wut? Sie sah Alice nicht in die Augen. Seit sie das Zimmer betreten hatte, starrte sie unentwegt die rechte Seite von Alice’ Kopf an.
T. J. schüttelte ein zweites Mal den Kopf.
«Tut mir leid», sagte T. J. «Das geht nicht.»
Alice starrte sie an.
In T. J. Hewitts Stimme lag so viel Selbstbewusstsein, so viel Entschlossenheit. Als hätte sie bei alldem ein Wörtchen mitzureden, dachte Alice. Als wäre sie ihre Arbeitgeberin und nicht umgekehrt.
Alice atmete ein. Das Pfefferminzbonbon in ihrem Mund hatte sich komplett aufgelöst.
Sie nahm noch eines aus der Schale und zerbiss es, bevor sie antwortete.
«Es würde uns viel bedeuten», sagte sie. «Ich weiß, dass Sie Barbara nahestehen. Ihnen ist sicher aufgefallen, dass sie … Schwierigkeiten hat. Sie benimmt sich daneben. Wir sind der Meinung, dass es ihr nicht schaden würde, ein paar neue Freunde zu finden.»
Zumindest war Alice der Meinung. Peter nicht unbedingt. Aber es gab mehrere Gründe, sie ins Ferienlager zu schicken – nicht zuletzt, weil sie dann zum Fest aus dem Haus wäre. Ihrem ersten Fest seit vierzehn Jahren. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Naturreservats hatten sie für eine Woche im August zwei Dutzend Freunde und Verwandte eingeladen. Das letzte Mal, als sie in Albany Gäste zum Abendessen dagehabt hatten, war Barbara nur einmal aus ihrem Zimmer gekommen. Sie hatte eine Art … nun ja, Halloweenkostüm getragen, ihr Haar hatte sie in irgendeiner undefinierbaren Farbe gefärbt, ihre Augen waren schwarz umrandet. Peters Cousin Garland war in Gelächter ausgebrochen, und Barbara war wieder verschwunden und hatte ihre Zimmertür zugeknallt. Obwohl Alice sie ein ums andere Mal dafür gerügt hatte, trug sie die Haarfarbe und den Lidstrich immer noch.
Diesmal würde sie sich wegen so etwas keine Sorgen machen müssen – falls sie Barbara los wären.
T. J. sah zu Boden.
«Haben Sie es ihr schon gesagt?», fragte sie.
«Dass sie ins Ferienlager soll?», sagte Alice. «Sie hat mich selbst gefragt, ob sie hin darf.»
«Nein», sagte T. J. «Ich meine, was im Herbst passiert.»
Alice stutzte. Sie schüttelte den Kopf.
«Das erzähle ich ihr am Ende des Sommers.»
Dann kam ihr ein Gedanke, und sie fügte hinzu: «Beziehungsweise am Ende der Ferienlagersaison.»
«Die Saison läuft ja schon», sagte T. J. auf die ihr eigene Art.
«Aber doch gerade erst.»
«Die Hütten sind alle voll.»
Langsam stieg in Alice’ Brust das Gefühl auf, dass T. J. sie anflunkerte, und doch spürte sie, dass sie irgendetwas davon abhielt, ihre innersten Reserven an Wut abzurufen, wie ihr das bei Peter immer gelang, wenn sie sich Gehör verschaffen wollte.
Die Tabletten, fiel ihr ein. Die Tabletten hatten sich in ihrem Inneren festgekrallt, lösten die Verspannung in ihren Schultern, schickten eine Welle der Erleichterung über ihre Stirn und ihren Rücken hinab, einen Wasserfall aus Wärme und Ruhe. Konzentrier dich, befahl sie sich.
Sie betrachtete die Gegenstände im Zimmer um sich herum, ein Trick, den Dr. Lewis ihr beigebracht hatte. Wanduhr. Üppig wachsende Pflanzen. Steinfliesen auf dem Boden vom Wintergarten.
Ihre Zunge war ein dicker Klumpen. Trotzdem redete sie weiter, darauf bedacht, die Worte korrekt auszusprechen.
«Sie kennen Barbara so gut wie kaum jemand sonst», sagte Alice. Zumindest besser als ich, dachte sie unwillkürlich. «Sie wissen, wie gut ihr das tun würde.»
T. J. stand plötzlich auf, als wollte sie gehen. Hätte sie einen Hut gehabt, dann hätte sie ihn jetzt aufgesetzt.
Ein ganzer Sommer, dachte Alice. Ein ganzer Sommer ohne Barbara, ohne ihre Wutanfälle, ohne dass sie stundenlang laut weinte und das Personal nervte. Alle waren immer höflich, taten so, als hörten sie es nicht. Aber sie hörten es, alle hörten es, und Alice hörte es auch. Wie schön wäre es, die Sommermonate einmal ganz für sich zu haben. Ihre Tochter wäre ja trotzdem in der Nähe, nur ein Stück den Hügel hinunter. Behütet. Beschäftigt. Zufrieden.
«Ich muss mal wieder», sagte T. J.
Alice lächelte. Die Tabletten nahmen ihr den Filter. In ihrem Mund befanden sich Worte, die sie normalerweise mit den Zähnen abfangen würde. Das tat sie schon fast ihr ganzes Leben lang, mit Peter, mit allen anderen. Normalerweise gelang es ihr wunderbar, den Mund zu halten.
Heute nicht.
«Das ist ohnehin nicht Ihre Entscheidung», sagte Alice. «Kümmern Sie sich einfach darum, dass es klappt.»
«Oder … was?», fragte T. J. unvermittelt.
Zu laut, dachte Alice. Warum mussten die Menschen immer so laut reden?
Stille – das war alles, was sie wollte.
Alice öffnete den Mund. Kein Wort kam heraus.
Eine Minute verging, vielleicht auch fünf. Sie spürte, wie der Schlaf kam. Sie wusste, dass sie sich für ihre Haltung schämen sollte, dafür, wie sie den Kopf zur Seite neigte – aber auch auf dieses Gefühl konnte sie nicht zugreifen, es war abstrakt, etwas, von dem sie wusste, dass es existierte, das sie aber nicht spüren konnte.
«Das war die Idee von Mr Van Laar», sagte Alice schließlich. «Er will es so.»
Das war der letzte Ausweg. Sie schämte sich, auf diese Finte zurückgreifen zu müssen. Wie peinlich, dachte sie, dass ihre eigenen Worte in diesem Haus keinerlei Bedeutung hatten.
T. J. sah sie an. Offenbar überlegte sie, ob sie Alice glauben sollte oder nicht. Dann veränderte sich ihr Gesichtsausdruck, und sie schaute resigniert drein.
«Na gut», sagte T. J. «Stellen wir halt bei Haus Balsam noch ein Stockbett rein. Sie kann morgen kommen.»
Ohne weitere Fragen zu stellen, verließ T. J. das Zimmer. Das Haus.
Wenn Bear hier wäre …
Alice hielt inne. Dr. Lewis hatte ihr verboten, sich diesen Fantasien hinzugeben. Jedes Mal, wenn ihre Gedanken dahin abschweiften, solle sie sich in die Realität zurückholen, hatte er gesagt. Doch die Vorstellung drängte sich ihr mit aller Macht auf: Wenn Bear hier wäre, würde er T. J. zur Tür hinaus folgen. Sie schloss die Augen und erlaubte sich – nur für einen Moment –, an ihren Sohn zu denken, sich vorzustellen, wie er T. J. Hewitt über das ganze Gelände folgte. Tessie, Tessie. Seine hohe, sanfte Stimme, genau auf der anderen Seite des dünnen Vorhangs, der ihre Welt von seiner trennte. Sie konnte sie hören, ohne Probleme.
Auf der Couch drehte Alice den Kopf und schaute durch die Scheiben des Wintergartens. T. J. blieb auf dem Rasen stehen, zog etwas aus der Tasche und steckte es sich in den Mund. Spuckte aus. Priem nannten die Männer das. Eine ekelhafte Angewohnheit.
Alice sah T. J. Hewitt hinterher, bis sie außer Sichtweite war. Sie war groß, schlank und anmutig, und nicht zum ersten Mal dachte Alice, dass sie eigentlich hübsch sein könnte.
Wie T. J. ihr Aussehen ruiniert hatte, war für Alice eine wahre Sünde.
Schritte drangen an ihr Ohr. Schwere, stampfende Schritte: Barbara. Sie war auf dem Weg in die Küche. In letzter Zeit ihr Lieblingsort. Alice verzog das Gesicht. Gestern hatte Alice die neue Köchin (sie konnte sich den Namen partout nicht merken) gebeten, Barbara nicht mehr ständig etwas zu essen zu machen. Nach Ausflüchten zu suchen, falls nötig. Aber Alice wusste, dass Barbara sehr manipulativ sein konnte, und sie traute der Köchin nicht zu, dass sie dagegen ankam.
Sie ging zur Küche und blieb in der Tür stehen, versuchte, ganz leise zu sein.
Es war tatsächlich Barbara, die ihr den Rücken zuwandte und den Inhalt der Speisekammer inspizierte. Sie trug Shorts und ein T-Shirt, und mit einem Anflug von Ekel bemerkte Alice, dass ihr einst undefinierter Hintern jetzt rund war und ihre Beine die einer Frau. Neben Barbara stand die Köchin. Sie sah Alice an und hob hilflos die Hände.
Alice bereitete es keine Freude, den Körper ihrer Tochter so zu beurteilen. Sie wusste, dass es lieblos war. Dennoch war sie zugleich überzeugt, dass es zu den Pflichten einer Mutter gehörte, die erste und gnadenloseste Kritikerin ihrer Tochter zu sein; sie schon als kleines Mädchen zu wappnen, damit sie später als Frau alle Übergriffe und alle Beleidigungen, die auf sie einprasseln würden, voller Anmut aushalten konnte. Diese Methode hatte ihre eigene Mutter bei ihr angewandt. Damals hatte sie das ganz schrecklich gefunden, aber heute war ihr klar, dass das richtig gewesen war.
«Barbara», sagte Alice, und ihre Tochter zuckte zusammen. Einen Laib Brot unter den Arm geklemmt, drehte sie sich um. Einen Moment lang überkam Alice ein zärtliches Gefühl. Sie war schon immer schreckhaft gewesen, schon als kleines Kind – das einzige Baby auf der Welt, das nicht gern Kuckuck oder Verstecken spielte und das sofort weinte, wenn man es erschreckte, selbst wenn es nur aus Spaß war.
«Um halb acht gibt es Abendessen», sagte Alice.
Barbara legte das Brot auf die Arbeitsplatte und schnitt sich eine Scheibe ab.
«Hast du mich gehört?», fragte Alice.
Barbara nickte. Griff nach der Butter. Schmierte sie auf das Brot. Hielt den Kopf gesenkt. Ein Zentimeter Blond war am Haaransatz zu sehen, der Rest ihres Schopfes war immer noch in diesem schrecklichen stumpfen Schwarz. Wenigstens ihr Gesicht war hübsch. Daran konnten alle billigen Haarfärbemittel nichts ändern.
Die Köchin sah tatenlos zu. Sie war ein winziges Persönchen, vielleicht fünfundzwanzig, dem schlichten Ring an ihrem Finger nach zu urteilen verheiratet.
Alice seufzte. Es hatte keinen Sinn, zu schimpfen – nicht heute. Nicht, wenn Barbara für den Rest des Sommers fort sein würde. Was konnte es schon schaden, ihr ein letztes Mal die Freude einer Scheibe Brot mit Butter und Konfitüre zu gönnen?
«Ich habe gerade mit T. J. gesprochen», sagte Alice, und endlich blickte das Mädchen auf. Da war sie, die Barbara, die sie lieb hatte. Endlich kam Leben in ihr Gesicht und in ihre Augen.
«Und?», fragte Barbara.
«Sie meint, du darfst morgen ins Camp.»
Triumph. Barbara senkte schnell den Blick, aber Alice blieb nicht verborgen, dass sie die Lippen zusammenpresste, um ein Lächeln zu unterdrücken.
«Ich schicke jemanden, der für dich packt», sagte Alice.
Das war gut, fand Alice. Eine gute Idee. Eine kleine Pause voneinander. Dann würde alles besser werden.
Tracy
Juni 1975
Das, erfuhr Tracy, war Camp Emerson:
Drei Gebäude bildeten den nördlichen Rand, schräg unterhalb vom Haupthaus auf dem Hügel. Eines war die Kantine, in der man die Mahlzeiten einnahm; das Gebäude daneben hieß «Großer Saal», darin befanden sich das Zimmer der Krankenschwester, zwei kleinere Räume für Aktivitäten an Regentagen und ein großer Gemeinschaftsraum, der hauptsächlich für Tanzpartys genutzt wurde und für Aufführungen, für die man eine Bühne benötigte. Das dritte Gebäude war das Haus der Campleiterin. Die einzigen Ferienkinder, die es jemals von innen gesehen hatten, hatten sich zuvor auf irgendeine Weise Ärger eingehandelt.
Südlich von diesen Gebäuden lag der Rest des Ferienlagers. Am östlichen Rand war der See, am Ufer gab es einen kleinen Strand und ein Bootshaus. Am südlichen Rand des Geländes befand sich ein längliches Gebäude, das als Personalquartier bezeichnet wurde – hier waren die Leute, die in der Küche arbeiteten, und andere Saisonkräfte untergebracht. Nördlich davon standen in zwei Reihen vierzehn Hütten – sieben für Jungen, sieben für Mädchen. Zwischen den Hütten für die Jungen und den Hütten für die Mädchen verlief ein Bach, den man hier und da mithilfe einer kleinen Brücke überqueren konnte. Jede Hütte war nach einem Baum oder einer Blume benannt, die in den Adirondacks wuchsen.
Tracys Hütte hieß Haus Balsam und wurde innen von gelben Glühbirnen erleuchtet, die nackt von der Decke hingen. Nachts zog das warme Licht Heerscharen von Insekten an, die durch die kaputten Fliegengitter an den Fenstern eindrangen.
Die Hütte war mit acht Stockbetten ausgestattet, vier an der einen und vier an der anderen Seite. Am Fußende jedes Bettes standen kleine Holztruhen. Die Wände der Hütte waren aus unbearbeitetem Holz, genau wie die Decke, in beides hatten Generationen von Ferienkindern Namen, Daten und Anspielungen auf weiß der Himmel was geritzt.
Erstaunlicherweise befand sich an einer Wand der Hütte ein Holzofen. Später im Sommer erfuhr Tracy, dass die Hütten früher das ganze Jahr über von Bekannten der Van Laars für deren Jagdausflüge genutzt worden waren; aber seit der Gründung von Camp Emerson wurden die Öfen nicht mehr benutzt, außer von Fledermäusen, die sich gelegentlich in den Schornsteinen ansiedelten und dann umgesiedelt werden mussten.
Nachdem die Mütter – und Donna Romano – verschwunden waren, setzten sich die Betreuerin und ihre Auszubildende mit den Ferienkindern in einem Kreis auf den Boden. Sie hatten sich ein paar Übungen ausgedacht, um das Eis zu brechen.
Während der Übungen stellte Tracy fest, dass sich alle anderen Mädchen in ihrer Hütte schon seit Jahren kannten. Sie warfen sich Phrasen und Gesten zu, als würden sie Pingpong spielen, und ab und zu brachen sie aus Gründen, die sie nicht nachvollziehen konnte, in Gelächter aus. Insider-Witze, dachte Tracy – der Begriff machte ihr Angst, schließlich war jeder, der diese Witze nicht verstand, automatisch ein Außenseiter.
Eine weitere Erkenntnis aus dem Sitzkreis war, dass es unter den Mädchen in Tracys Hütte eine eindeutige Hierarchie gab.
An der Spitze der Hackordnung standen natürlich Louise und Annabel, die Betreuerin und die Auszubildende. Beide waren auf unterschiedliche Weise hübsch: Louise war mit ihren dreiundzwanzig Jahren schon eine richtige Frau. Sie war klein, viel kleiner als Tracy, hatte langes dunkles Haar und dunkle Augenbrauen, und man sah ihr an, dass sie Sport trieb. Außerdem war sie – ein Wort, das Tracy erst in jenem Jahr gelernt hatte – vollbusig. Annabel war siebzehn, groß, gertenschlank, blond, eine Ballerina, die so anmutig und selbstbewusst durch die Gegend schwebte, wie es nur jemand tut, dessen Eltern sich noch nie Gedanken darum hatten machen müssen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollten. Tracy war in beide von der ersten Sekunde an vernarrt. Sie spürte das seltsame Verlangen, sie zu verkleinern, in die Hand zu nehmen und mit ihnen zu spielen, als wären sie Puppen.
Als Nächstes kamen die Ferienkinder, die in Haus Balsam untergebracht waren, von den beiden Melissas – drahtigen blonden Turnerinnen von der Upper East Side in Manhattan, die ganz eindeutig den Ton angaben – bis hinunter zu einem Mädchen namens Kim, das die Angewohnheit hatte, ausführlich über Themen zu reden, die sonst offenbar keinen interessierten.
Dann kam nur noch Tracy, die bereits durch ihre Körpergröße die Blicke der anderen auf sich zog, wie sie glaubte. Als sie sich vorstellen sollte, versagte ihr plötzlich die Stimme. Langsam wurde ihr klar, wie ihr Sommer aussehen würde. Sie würde sich zurückziehen. Sie würde mit niemandem sprechen. Sie würde unbemerkt bleiben und sich, wann immer möglich, hinter Büchern verstecken. Sie würde sich aus allem heraushalten. Bloß nicht auffallen.
Sie packte ihre letzten Sachen aus. Aus ihrem Kulturbeutel nahm sie die neue Brille, die sie in jenem Jahr bekommen hatte, und legte sie ganz hinten in die ihr zugewiesene Schublade. Sie fand, wenn sie in diesem Sommer nicht einmal allzu deutlich sehen konnte, wäre das nicht weiter schlimm.
Plötzlich musste sie heftig blinzeln. Wenn sie jetzt weinen müsste, wäre das eine Katastrophe – doch die Enttäuschung lastete schwer auf ihren Schultern. Denn auch wenn sie aufgrund der vielen Enttäuschungen, die sie über die Jahre erlebt hatte, genau wusste, wo sie in der sozialen Hierarchie stand, hatte sie doch irgendwie gehofft, dass es diesmal anders sein würde. Dass ein zierlicher Junge oder ein anmutiges Mädchen geduldig und scharfsinnig genug wäre, Tracy aus der Masse herauszupicken und eine der positiven Eigenschaften zu bemerken, die aufzuzählen sie sich nur selten gestattete: ihren Sinn für Humor, ihr zeichnerisches Talent, ihre schöne Singstimme oder ihre Loyalität und Hingabe gegenüber jedem, der sich auch nur ein wenig für sie interessierte.
Tracy zog ihr schlecht sitzendes Uniformhemd über ihre schlecht sitzenden Uniformshorts. Sie atmete aus, und damit verabschiedete sie sich von allen Hoffnungen, die sie für diesen Sommer gehabt hatte.
Gleich am ersten Abend fand in einem natürlichen Amphitheater am Fuße eines kleinen Hügels, der zu einem graslosen Stück Land hinunterführte, ein Lagerfeuer statt. Auf dem Hügel waren große, gespaltene Baumstämme als Bänke aufgestellt, mit einem Gang in der Mitte. Der dunkle See war gerade noch zu sehen. Hier am Lagerfeuer wurde Tracy Zeugin einer Reihe merkwürdiger Gesänge und Rituale.
Eine seltsame Energie lag in der Luft, die Energie von Teenagerhormonen, von verstohlenen Blicken, um festzustellen, wer sich seit dem letzten Jahr auf welche Weise verändert hatte. Letzteres galt nicht nur für die Ferienkinder, sondern auch für die Betreuer. Sie schlichen umeinander, flüsterten sich gegenseitig etwas ins Ohr und machten Gesten, die Tracy nicht verstand. Sie stellte fest, dass jede der Aufsichtspersonen auf ihre eigene Weise so etwas wie eine Berühmtheit war; die Ferienkinder versuchten eifrig, möglichst viel über sie herauszufinden, über ihr Privatleben, darüber, wen sie anhimmelten und wer ihnen das Herz gebrochen hatte, und diese Fakten wurden dann im Dunkeln weitergeflüstert.
Vor ihnen gingen die Präsentationen weiter. Mehrere Betreuer führten ein Ritual vor, bei dem unter anderem ein Baumstamm zerhackt wurde. Es folgten Bekanntmachungen über neue Regeln, Einrichtungen, Veranstaltungen.
Dann wurden Sketche aufgeführt. Einer der Sketche sollte die Regel illustrieren, über die Tracy zuvor so gestaunt hatte: Ein hochgewachsener Betreuer tat so, als wäre er ein kleines Kind, und lief immer wieder um das Lagerfeuer herum, als hätte er sich verlaufen.
«Ich dachte, ich weiß, wo ich bin», erhob der Betreuer souverän seine Stimme, «aber jetzt merke ich: Das stimmt nicht!»
Dann trat eine Betreuerin vor das Publikum.
In gespieltem Entsetzen legte sie sich die Hände an die Wangen und fragte: «Was sollte Calvin tun?»
«Wenn du dich verläufst», riefen alle im Chor, «setz dich hin und schrei!»
«Hilfe!», schrie Calvin. «Ich brauche Hilfe!» Er sah auf eine unsichtbare Armbanduhr. «Eine Minute ist vergangen», verkündete er, «jetzt sollte ich wieder schreien!»
Der Grund dafür lag auf der Hand: Jeder Versuch, auf eigene Faust aus dem Wald herauszufinden, konnte dazu führen, dass man die Orientierung verlor. Selbst ein erfahrener Ranger konnte sich in den Adirondacks verlaufen. Wenn man im dichten Unterholz zwischen den Bäumen den Weg aus den Augen verlor, sah alles gleich aus.
«Fünfundsechzig Prozent der Menschen», sagte Calvin, «sind keine zehn Schritte vom Waldweg entfernt, wenn sie die Orientierung verlieren.»
Tracy hörte fasziniert zu. Sie stellte sich vor, wie der Wald sie magisch anzog, mit seinem kühlen, schattigen Geruch, dem samtigen Moos auf den Steinen – und wie ihr dann nach und nach klar wurde, dass sie die Orientierung verloren hatte. Wie sie allmählich das Grauen packte.
Zwischen den Sketchen frotzelten die männlichen Betreuer miteinander und mit ihren Schützlingen herum. Riefen zu den Mädchen auf der anderen Seite des Halbkreises hinüber. Kevin findet dich hü-übsch!
Dann baute sich eine große, schlanke Frau vor ihnen auf. Sie stand vor dem Feuer und sah fast so aus, wie Tracy sich immer Ichabod Crane aus der Legende von Sleepy Hollow vorgestellt hatte.
Alle verstummten.
«Herzlich willkommen», sagte die Frau. Sie stellte sich den Neuankömmlingen vor: Sie leite das Ferienlager und heiße T. J., und so dürften alle sie anreden.
Es war schwer zu sagen, wie alt sie war. Sie sah jung aus, vielleicht Anfang zwanzig, aber ihre Stimme war rau und strahlte eine Autorität aus, die Tracy von Frauen ihres Alters nicht gewohnt war. Alle blieben stehen und hörten ihr zu, sogar die lauten männlichen Betreuer, die jetzt zum ersten Mal die Klappe hielten.