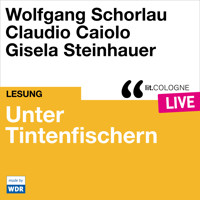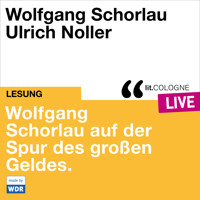9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Spur des großen Geldes – Dengler deckt die Machenschaften der »Euro-Retter« auf. Georg Dengler droht an seinem bisher größten Fall, dem neunten in Wolfgang Schorlaus Bestseller-Krimiserie, zu scheitern: Wer hat die EU-Beamtin Anna Hartmann entführt? Was hatte sie mit der sogenannten Griechenlandrettung zu tun? Und vor allem: Wo sind die Milliarden europäischer Steuergelder wirklich gelandet? Endlich, die mageren Jahre sind vorbei! So jedenfalls scheint es dem Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler. Zum ersten Mal ergattert er einen wirklich gut bezahlten Auftrag: Das Berliner Auswärtige Amt will, dass er nach der Mitarbeiterin Anna Hartmann sucht. Ein Handyvideo legt nahe, dass sie entführt wurde. Mithilfe seiner technisch versierten Freundin Olga gelingt es Dengler, vier verdächtige Männer zu identifizieren. Bevor er sie befragen kann, werden sie allesamt ermordet. Gibt es einen Verräter im Auswärtigen Amt? Oder gibt Denglers neue Mitarbeiterin Petra Wolff Informationen an die Killer weiter? Denglers Ermittlungen enden in einer Sackgasse. Die Entführte war als Beamtin an die Troika ausgeliehen worden, die Griechenland die Bedingungen der Eurogruppe diktiert hat. Liegt hier der Schlüssel für den Fall? Dengler nimmt einen neuen Anlauf und stößt auf das größte Geheimnis der sogenannten Griechenlandrettung: Auf welchen Konten sind die vielen Milliarden europäischer Steuergelder letztlich gelandet? Als Dengler die Namen der Personen und Institutionen ermittelt, die diese gewaltigen Summen kassiert haben, gerät er selbst ins Visier ... Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg BluesDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Der große Plan
Denglers neunter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Prolog: Gero von Mahnke
1. Teil
1. Der Auftrag
2. Freunde
3. Müsli
4. Bewerbungen
5. Rechnung
6. Wittig
7. Gero von Mahnke: Lektionen
8. Stenzel
9. Eltern
10. Schwester
11. Teambesprechung 1
12. Gero von Mahnke: Im Krieg
13. Stiftung
14. Krausenstraße
15. Jakob
16. Teambesprechung 2
17. Föhrenbach
18. Zürich
19. Gero von Mahnke: Heimat
20. Teambesprechung 3
21. Basta
22. Testosteron
23. Kolonnenstraße
24. CarWash
25. CarWash 2
26. Gero von Mahnke: Im Hospital
27. Teambesprechung 4
28. Solarium
29. Solarium 2
30. Gero von Mahnke: Ostmark
31. Fehrbelliner Straße
32. Teambesprechung 5
33. Gero von Mahnke: Athen
34. Prügel
35. Observation
36. Gero von Mahnke: Flucht, Oktober 1944
37. Boxclub
38. Vernehmung
39. Teambesprechung 6
2. Teil
40. Katzenjammer
41. Medi Transfer
42. Facebook
43. Otto Hartmann: Frankfurt
44. Wittig
45. Petra Wolff
46. Teambesprechung 7
47. Athen
48. Tinos
49. Knien
50. Kirche
51. Petros
52. Teambesprechung 8
53. Wohnung
54. Stick
55. Mario
56. Otto Hartmann: In der Bank
57. Aufgaben
58. Bergenfeld
59. Verstärkung
60. Geld
61. Illegitim
62. Schuldenberg
63. Ouzo
64. Otto Hartmann: London
65. Zwischenermittlung
66. Presse
67. Nachfrage
68. Swaps
69. Griechenland
70. Anita
71. Petros
72. Teambesprechung 9
73. Otto Hartmann: Das weitere Leben
74. Razzia
75. Kontakt
76. Vorbereitung
77. Glienicker Brücke
78. Abtransport
79. Wunden
80. Anfrage
81. Ad Kalendas Graecas
82. Teambesprechung 10
3. Teil
83. Geheimnis
84. Eltern
85. Anna Hartmann
86. Stiftung
87. Anna Hartmann: Erster Verdacht
88. Storage Room
89. Anna Hartmann: Das Foto
90. Gero von Mahnke: Der Schuss
91. Zürich
92. Anna Hartmann: Großvaters Tod
93. Anna Hartmann: Im Lagerhaus
94. Manifest
Epilog
Anhang
Manifest zur Neuausrichtung der Otto-Hartmann-Stiftung
Finden und Erfinden – ein Nachwort
Inhaltsverzeichnis
»Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen.«
William Faulkner
»Die größte Tragödie der Menschheit ist, dass wir so lange leiden müssen, bis es endlich zu dem Kompromiss kommt, von dem alle wussten, dass er unausweichlich ist.«
Nelson Mandela
Inhaltsverzeichnis
Für Joju und I.
In Erinnerung an meine Mutter
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Gero von Mahnke
Gero von Mahnke sah auf seine Armbanduhr. Dann hob er die Tasse und trank den letzten Schluck Kaffee. Wohlwollend betrachtete er das durchsichtige Porzellan und stellte die Tasse behutsam auf den Unterteller. Er schob abrupt den Stuhl zurück, stand auf und streckte sich. Erst spät in der Nacht war er aus Livadia zurückgekommen, und die Müdigkeit steckte ihm noch in den Knochen. Er griff prüfend an die Seitentasche seiner Hose und überzeugte sich, dass sein Lieblingsbuch darin steckte. Als er durch den Flur zur Eingangshalle schritt, sah er hinter den Gardinen der hohen Fenster die ausgemergelten Gestalten, die heute wie jeden Morgen die Mülltonnen hinter dem Hotel Grande Bretagne nach Resten des Frühstücks der Gäste durchwühlten. Mittlerweile blickten sie kaum mehr auf, wenn er aus dem Nebeneingang trat, dort stehen blieb, die Augen für einen Augenblick schloss und die Luft Athens in sich einsog. Noch war sie mild, geradezu würzig; die Hitze des Tages stand erst bevor.
Dieses gleißende Licht! Er kannte keinen Ort, an dem die Sonne morgens so heiter, verlockend, so verspielt, ja, man konnte sagen: so unschuldig schien. In wenigen Stunden würde sie diese Unschuld verloren haben und auf die Stadt herabbrennen, als wolle sie alles und jeden darin verzehren. Doch jetzt war die Stunde der Götter. Ihm fiel ein Gedicht von Hölderlin ein, das er als Schüler auswendig gelernt hatte:
Ihr wandelt droben im Licht
Auf weichem Boden, selige Genien!
Glänzende Götterlüfte
Rühren euch leicht,
Wie die Finger der Künstlerin
Heilige Saiten.
Gero von Mahnke atmete tief ein. Götterlüfte. Der gestrige Tag war hart gewesen. Bevor er in die Bank ging, wollte er noch einmal die Akropolis sehen, den Sitz von Athene und ihren Gefährten, deren Geschichte und Geschichten er seit Kindertagen liebte.
Auf dem Syntagma-Platz folgte ihm eine Gruppe bettelnder Kinder, vier Buben und ein Mädchen, alle barfuß und verdreckt, die Augen verklebt, die Hände zu ihm ausgestreckt, trotzdem wach und vorsichtig, immer einen Meter Abstand einhaltend. Für einen Augenblick befürchtete er, schwach zu werden und ihnen ein paar Münzen in die Hände zu drücken. In diesen Zeiten halfen keine milden Gaben. Nur die großen, die energischen Schritte würden Griechenland retten. Das Neue Europa konnte nicht mit Almosen errichtet werden. Es verlangte Opfer von allen. Niemand wusste dies besser als er.
Er drehte sich um und ging mit schnellen Schritten zum Ausgang des Platzes. Die hungrigen Kinder folgten ihm schweigend und ließen ihn dabei keine Sekunde aus den Augen. Gero von Mahnke schüttelte energisch den Kopf: Von ihm war nichts zu erwarten. Er zog den Hyperion aus der Tasche, schlug eine Seite auf und las:.
Wie haß ich dagegen alle die Barbaren, die sich einbilden, sie seien weise, weil sie kein Herz mehr haben, alle die rohen Unholde, die tausendfältig die jugendliche Schönheit töten und zerstören mit ihrer kleinen unvernünftigen Mannszucht!
Von jugendlicher Schönheit konnte bei den Kindern wahrlich keine Rede sein. Dazu waren sie zu dünn und zu dreckig. Ihre Haltung wirkte weder edel noch aufrecht, sondern lauernd, hinterhältig und ständig bereit zu plötzlicher Flucht. Mit den heroischen griechischen Skulpturen, die er in Winkelmanns Büchern bewunderte, hatten diese Straßenkinder nicht einmal eine entfernte Ähnlichkeit. Sie umringten ihn schweigend und sahen zu, wie er das Buch wieder zurück in die Seitentasche steckte. Dann zog er mit der Rechten einige Münzen hervor und warf sie in hohem Bogen, so weit er konnte. Einen Augenblick lang blickte er den rennenden und sich balgenden Kindern nach und ging weiter.
Er war jemand, der ein Herz hatte, das war nun bewiesen.
In dem Gebüsch auf der anderen Seite des Platzes erhoben sich einige Gestalten und schlurften eilig auf die andere Straßenseite. Es gab so viele Flüchtlinge in Athen. Niemand kannte ihre genaue Zahl; sie kamen aus dem Norden und dem Osten, die Verwaltung hatte es aufgegeben, sie zu zählen und sie zu ernähren.
In langen Schritten ging er bergab an der Kathedrale Mariä Verkündigung vorbei. Die meisten der kleinen Geschäfte hatten die Türen und Fenster verrammelt. Die Eigentümer fanden schon lange keine Kunden mehr in Zeiten wie diesen. Viele hatten schon in den letzten Jahren die Türen endgültig geschlossen und waren zu Verwandten auf die Inseln oder aufs Land gezogen, wo sie ihnen gegen Kost und Logis in der Landwirtschaft oder beim Fischfang halfen.
Doch das Licht! Wo gab es ein solch gleißendes Licht? Es übertraf jede Beschreibung im Baedeker. Warm und klar, einzig dazu geschaffen, die Akropolis zu bestrahlen. Gero von Mahnke blieb stehen und sah zu ihr hinauf. Er war nur ein kleines Rad in der Geschichte, eine Geschichte, die schon so viele Tausend Jahre andauerte, und wenn Athen nun eine Phase der Prüfung durchlitt, würde die Stadt später, wenn alles überstanden war, strahlender denn je auferstehen.
Er mochte die Plaka, die Altstadt mit ihren Gassen und Tavernen, dem Geruch von gegrilltem Fleisch und Gemüse, er mochte die Zitronen und Apfelsinen, das Lammfleisch und das gebratene Zicklein. Er mochte sogar die Griechen.
Gero von Mahnke reckte sich. Er sprach Alt- und mittlerweile dank des Unterrichts, den er bei Sophia nahm, ganz passabel Neugriechisch. Er verstand die Lockrufe der Türsteher vor den Restaurants, doch die meisten von ihnen sprachen ihn ohnehin auf Deutsch an.
Er wandte sich nach links auf den Schotter der Panathenaia-Straße und atmete noch einmal tief den jetzt nach Kiefer riechenden Duft der Agora ein. Hier, auf dem alten Marktplatz des klassischen Griechenlands, fühlte er sich dem Land so nahe wie sonst nirgends. Die Vorstellung, dass Aristoteles vor mehr als 2000 Jahren genau hier, auf demselben Platz, gestanden haben könnte, beschleunigte seinen Puls und ließ ihn die Schultern straffen und das Kreuz durchdrücken. Er sah auf den staubigen Weg, als könne er den Fußabdruck des großen Philosophen entdecken. Schnell zog er noch einmal seinen zerfledderten Hölderlin aus der Tasche und fuhr mit einem Finger zwischen die Seiten:
Wer hält das aus, wen reißt die schröckende Herrlichkeit des Altertums nicht um, wie ein Orkan die jungen Wälder umreißt, wenn sie ihn ergreift, wie mich, und wenn, wie mir, das Element ihm fehlt, worin er sich stärkend Selbstgefühl erbeuten könnte?
Er trug sein stärkend Selbstgefühl sichtbar durch die Stadt. Er ging aufrecht in einer makellosen Uniform, die SS-Runen am Kragenspiegel verschafften ihm Abstand und Respekt.
Den Griechen fehlte es noch am stärkend Selbstgefühl. Gestern hatte er es wieder erlebt.
Er dachte an den Beginn des Balkanfeldzugs. Die Italiener hatten Griechenland angegriffen. Doch zunächst wehrten die Griechen den Angriff der an Feuerkraft weit überlegenen Italiener durch Mut und Tapferkeit ab und hätten sie fast wieder aus dem Land verjagt. Im letzten Augenblick befahl der Führer, dem Duce zu Hilfe zu eilen. Die Wehrmacht überwältigte die erschöpfte griechische Armee, und nach wenigen Tagen unterschrieben ihre Generale die Kapitulation. Doch der Führer reichte ihnen in einer wahrhaft ritterlichen Geste die Hand zur Versöhnung. Obwohl sie in einem Blitzkrieg besiegt worden waren, lobte er ihren Kampfgeist. Auf ausdrücklichen Befehl Hitlers verzichtete die Wehrmacht darauf, griechische Gefangene nach Deutschland zu deportieren, sondern ließ sie frei. Von Mahnke fand diese Geste des Führers edel und eines wahren Feldherrn würdig. Man hatte den geschlagenen General als neuen Regierungschef installiert, ihm für seine neuen Aufgaben detaillierte Befehle erteilt und ihm genügend Verbindungsoffiziere zur Seite gestellt, die dafür sorgten, dass diese Befehle auch eingehalten wurden. Ein Anfall von Sentimentalität trieb von Mahnke einige Tränen in die Augen. Das ist das wahre nordische Deutschtum, getränkt von Edelmut und Großherzigkeit gegenüber einem Volk mit solch erhabener Geschichte.
Doch man durfte sich nichts vormachen. Dankbarkeit war nicht die Sache der Griechen. Vielleicht waren sie dazu zu sehr Südländer, schon zu sehr gemischt mit allerlei Orientalischem und dem minderwertigen Völkerdurcheinander des Mittelmeeres. Gero von Mahnke hatte an die gesamte Gefolgschaft der griechischen Nationalbank das Buch In Griechenland. Ein Buch aus dem Kriege von Erhart Kästner verteilen lassen, des Touristen in Uniform. Kästner hatte darin den interessanten Gedanken entwickelt, die deutschen Soldaten seien die eigentlichen und würdigen Nachfahren der alten Griechen: »… ihre Haare weißblond. Da waren sie, die ›blonden Achaier‹ Homers, die Helden der Ilias. Wie jene stammten sie aus dem Norden, wie jene waren sie groß, hell, jung, ein Geschlecht, strahlend in der Pracht seiner Glieder.«
Von Mahnkes Gesicht verdunkelte sich. Undankbar! Die Griechen sind unfähig zu erkennen, wie vorteilhaft sie bisher behandelt wurden. Immer wieder müssen sie bestraft werden. Es fällt uns nicht leicht! Plötzlich tat es ihm leid um die Drachmen, die er den Kindern auf dem Syntagma-Platz zugeworfen hatte.
Er dachte an den gestrigen Tag und ihm wurde kalt, obwohl die Sonne nun hoch über der Akropolis stand.
Inhaltsverzeichnis
1. Teil
1.Der Auftrag
Schneeböen tanzen über die spiegelglatte Fahrbahn.
Orangefarbenes Licht zuckt über die Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes, geworfen von unruhigen Straßenlaternen, die zwischen den kahlen Bäumen die Fahrbahn säumen.
Breite Straße, breite Bürgersteige.
Berlin.
Nur wenige Autos sind in den Parkbuchten am Straßenrand abgestellt. Frischer Schnee auf Dächern und Kühlerhauben. Ein Wagen ist ohne Schnee: ein dunkler Van, neues Modell. An seinem glänzenden schwarzen Lack finden die Schneeflocken, die die nervösen Windstöße immer wieder hochwirbeln, keinen Halt.
Als einziges Fahrzeug parkt der Van mit der Breitseite am Bürgersteig. Alle anderen Wagen stehen mit Heck oder Front in Hausrichtung in den markierten Buchten.
Eiskristalle auf der Fahrbahn, Schnee auf dem Bürgersteig, gefrorener brauner Matsch auf den Parkflächen. Die Straße ist menschenleer.
Der Eingang des mehrstöckigen Hauses ist hell erleuchtet. Die schmale Toreinfahrt daneben ist geschlossen. Alle Fenster, auch die vergitterten viergeteilten Scheiben im Erdgeschoss, sind dunkel.
Die Szenerie schwankt kurz, für einen Sekundenbruchteil herrscht Dunkelheit. Dann wieder Eis und Schnee, Matsch und orangefarbenes Licht.
Jetzt stapft ein Mann von links ins Bild. Grüne Cargohose, braune, knöchelhohe Stiefel, dunkle Steppjacke. Er geht einige Schritte, dreht sich um und winkt. Er lacht. Ovales Gesicht, rötliches, kurz geschnittenes Haar. Alter Mitte oder Ende zwanzig. Seine Gesten und Bewegungen wirken verzögert und fahrig. Mit unsicheren Schritten überquert er die glatte Straße, betritt den Bürgersteig und geht auf den beleuchteten Eingang zu. Er scheint eine Klingel zu drücken. Wendet sich noch einmal um, lacht wieder und hebt die rechte Faust mit erhobenem Daumen. Dann beugt er Kopf und Rumpf und spricht in die Sprechanlage. Dabei macht er einen Ausfallschritt, um das Gleichgewicht zu wahren, und stützt sich mit der rechten Hand an der Mauer ab. Er hält inne, spricht erneut in die Gegensprechanlage, dann hebt er den Kopf und zuckt mit den Schultern.
Er betätigt wieder die Klingel und wartet lauschend. Schließlich wendet der Mann sich ab und geht zur Fahrbahnmitte zurück, gerät ins Rutschen und bleibt sofort mit ausgebreiteten Armen stehen, kann das Gleichgewicht halten, zögert, lässt den rechten Arm sinken, zieht ein Tuch aus der Tasche und schnäuzt sich. Und lacht.
Jetzt taucht im Hintergrund von rechts eine Frau auf. Sie geht mit schnellen Schritten den Bürgersteig entlang. Ihr Pferdeschwanz fliegt hin und her: rechts, links, rechts, links. Zwei parkende Autos verdecken ihren Körper, doch die Schultern und der Kopf mit dem pendelnden Pferdeschwanz sind gut zu erkennen: rechts, links, rechts, links. Für einen Augenblick wird zwischen den Parklücken ihre ganze Gestalt sichtbar. Jeans, Stiefel, ein dunkler Parka mit pelzgefasster Kapuze, um den Hals ein Wollschal gewickelt. Die hellen Lampen am Eingang des mehrstöckigen Gebäudes beleuchten Kopf und Gesicht: Anfang dreißig, vielleicht Mitte dreißig. Sie trägt eine Umhängetasche, vermutlich aus Leder, die sie mit der rechten Hand fest an sich drückt.
Der Mann in der Mitte der Straße dreht sich mit einem Ruck um, schwankt, ruft der Frau etwas zu, rutscht auf dem Eis aus, rudert mit den Armen und stürzt.
Ein Audi versperrt den Blick auf Beine und Oberkörper der Frau, die zielstrebig auf dem Bürgersteig weitergeht. Sie blickt geradeaus, als habe sie den Betrunkenen nicht gesehen. Eine Straßenlampe überblendet für einen kurzen Augenblick und wirft gleißendes Licht auf sie. Der blonde Pferdeschwanz schwingt in energischer Bewegung weiter hin und her. Die Frau geht an einem weißen Mercedes vorbei, dann verschwindet sie hinter dem dunklen Van.
Zwei Sekunden.
Drei Sekunden.
Sie taucht auf der anderen Seite nicht wieder auf.
Vier.
Fünf Sekunden.
Nichts.
Die Frau bleibt verschwunden.
Der Betrunkene hat sich aufgerappelt, blickt sich um nach der Frau, zuckt mit den Achseln, klopft sich den Schnee von der Hose, winkt wieder, kommt lachend näher und verschwindet auf der rechten Seite aus dem Bild. Plötzlich scheint die ganze Szenerie nach oben zu kippen, der Bildschirm wird dunkel, kurz flackert das orangefarbene Licht noch einmal auf und erlischt sofort wieder, dann erscheint ein blauer Screen mit Programmsymbolen.
»Das ist alles, was wir haben.«
Der blaue Anzug neben ihm stand auf. Dengler fiel der Name nicht mehr ein. Er berührte seine Schläfe mit den Fingern und ärgerte sich, dass er sich nicht an den Namen des Mannes erinnern konnte, mit dem er immerhin seit fast einer Stunde in diesem Besprechungszimmer saß.
Ließ ihn sein Gedächtnis im Stich, oder lag es daran, dass ihm dieser Mensch vom ersten Augenblick an unsympathisch war?
Er nutzte das Halbdunkel des Raumes, um die Visitenkarte zu betrachten, die er neben sein kleines schwarzes Notizbuch gelegt hatte.
Hans-Martin Schuster
Persönlicher Referent des Ministers
Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland
Werderscher Markt 1, Berlin
Natürlich. Schuster. Hans-Martin Schuster.
Schuster ließ die Rollos hochfahren. Er trat an die Konsole mit dem Receiver, löste ein Kabel vom Laptop und klappte das Gerät zusammen. Er hob die Fernbedienung und schaltete den großen Bildschirm an der Wand aus und trat ans Fenster. Mit dem Rücken lehnte er sich gegen die große Panoramascheibe.
»Das ist das letzte Lebenszeichen unserer Mitarbeiterin. Seither hat sie niemand mehr gesehen.«
»Außer ihren Entführern.«
Schuster runzelte verärgert die Stirn. »Niemand aus dem Außenministerium hat sie seither gesehen. Ihre Eltern nicht, ihr Verlobter nicht, niemand.«
Dengler betrachtete den Mann. Schuster hatte eine Stirnglatze, die in der Mitte seines Schädels endete und deren Grenze sich akkurat vom rechten bis zum linken Ohrläppchen zog. Auf dem Hinterkopf wucherte kurz geschnittenes, dichtes braunes Haar, das an den Seiten in längere Koteletten und schließlich in einem kurz geschnittenen Kinnbart mündete. Durch die Halbglatze wirkte die Stirn hoch, doch wurde das Gesicht nach unten breiter, das Kinn war wuchtig und sonderbar groß in dem ansonsten schmalen Gesicht. Schusters Lippen, gerahmt von dem braunen Bart, waren voll und rot, als hätte er Lippenstift aufgetragen. Seine Augen hinter den dicken Gläsern einer massiven altmodischen Brille wirkten starr.
»Wer ist der Mann auf dem Video?«, fragte Dengler.
»Ein Ire.«
»Ein Ire?«
»Das Gebäude, das Sie in dem Video gesehen haben, ist die irische Botschaft. Der Mann heißt Ken McKinley. Er ist mit einem Kumpel für ein Saufwochenende von Dublin nach Berlin geflogen. Wollten nach Kreuzberg und haben in der Jägerstraße haltgemacht. Der Kumpel saß in einem Mietwagen auf der anderen Straßenseite und filmte das Ganze mit seinem Handy. McKinley ging zum Eingang der Botschaft und fragte den Pförtner nach je einem Guinness für sich und seinen Freund. Scheint öfter vorzukommen in der irischen Botschaft, hat der Pförtner ausgesagt.«
»Haben die beiden etwas mit dem Verschwinden Ihrer Mitarbeiterin zu tun?«
Schuster schüttelte den Kopf. »Das Bundeskriminalamt und die irische Polizei haben die beiden überprüft. Sie sind harmlos. Irische Jungs, die mit einem Billigflieger nach Berlin gekommen sind und sich hier zwei oder drei Tage die Kante gegeben haben.«
»Was erwarten Sie von mir?«
Schuster rückte mit beiden Händen die Krawatte zurecht.
»Ich erwarte gar nichts«, sagte er. »Der Minister erwartet. Er braucht jemanden, der einen unabhängigen Blick auf die Ermittlungen der Polizei wirft. Sie, Herr Dengler, sollen die Ermittlungen kritisch begleiten. Das Auswärtige Amt braucht einen eigenen Standpunkt, damit das Innenministerium und das BKA uns nicht an der Nase herumführen. Sie sollen uns helfen, diesen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Wir wollen die richtigen Fragen stellen, dafür will der Minister Sie.«
Er verzog sein Gesicht zu einer Grimasse, als wolle er Dengler klarmachen, dass dies nicht seine Idee gewesen war.
»Bekomme ich Zugang zu den Ermittlungsakten?«
»Sie bekommen alle Unterlagen, die wir auch haben.«
»Ich brauche einen Ausweis, der mich als Mitarbeiter des Auswärtigen Amts ausweist.«
»Auf keinen Fall!« Schuster schnappte nach Luft.
»Dann erklären Sie mir bitte, wie ich Befragungen durchführen soll. Ich benötige einen Ausweis, damit die Leute mit mir reden.«
Schuster bewegte seine rechte Hand abwehrend hin und her und starrte Georg Dengler mit seinen vergrößerten Augen an: »Nein, nein! So etwas steht nur Mitarbeitern zu. Das regeln die Vorschriften ganz eindeutig. Haben wir uns verstanden?«
Georg Dengler stand auf. »Es ist immer wieder schön, in Berlin zu sein«, sagte er. Er dachte an den chronischen Minusbetrag auf seinem Konto bei der BW Bank. »Schade«, sagte er, »unter diesen Umständen … Sie müssen sich einen anderen suchen.«
Schusters Starre wich einem höhnischen Grinsen. »Dann ist das ja auch geklärt. Wir erstatten Ihnen selbstverständlich die Fahrtkosten von Stuttgart nach Berlin und zurück; in der Höhe eines Bahntickets, zweite Klasse selbstverständlich.«
Stille.
Was für ein Arschloch.
Dengler stand auf.
In diesem Augenblick klopfte es einmal kurz an die Tür, die sofort aufging, und der Außenminister trat ein. Er beachtete Schuster nicht, ging auf Dengler zu, beide Hände ausgestreckt. Er zog Denglers rechte Hand zu sich und drückte sie fest, als habe er endlich einen lang vermissten Freund wiedergefunden.
»Ich bin so froh, dass Sie uns helfen wollen.«
Der Außenminister sah Dengler direkt in die Augen. Der Mann lächelte. Ein warmes Lächeln, das nicht nur die Mundwinkel verzog, sondern auch die Augenpartie in freundliche Falten legte. Der Mann gab ihm das Gefühl, als sei die Begegnung mit ihm, dem kleinen, unbedeutenden Privatermittler aus Stuttgart, der Höhepunkt seiner Außenministerkarriere.
»Bitte setzen Sie sich doch!«
Er berührte Dengler kurz am Arm, ein herzlicher, kurzer Druck nur, als würden sie sich seit vielen Jahren kennen. Dann setzte er sich Dengler gegenüber und sah ihm offen ins Gesicht, immer noch mit diesem gewinnenden Lächeln.
»Geht es Ihnen gut? Hat man Ihnen einen Kaffee angeboten?«
Er blickte auf das Ensemble unbenutzter Tassen in der Mitte des Besprechungstischs.
»Offenbar nicht. Wie mögen Sie ihn am liebsten?«
»Ein doppelter Espresso wäre jetzt genau richtig. Wenn ich dazu ein wenig Milch extra …«
Ein kurzer Blick zu Schuster, der sich an seinem Platz vor dem Fenster nicht gerührt hatte und in eine Art Schockstarre verfallen war. Jetzt schien er daraus zu erwachen, denn er fuhr sich mit einer schnellen Bewegung durchs Gesicht. »Natürlich, sofort«, sagte er und hastete zur Tür.
Georg Dengler war überrascht. Der Außenminister war kleiner, als er im Fernsehen wirkte, stämmiger, untersetzter. Das weiße Haar, sorgfältig gescheitelt, dominierte das Gesicht, und die große dunkle Brille unterstrich den Eindruck von Ernsthaftigkeit und Seriosität. Er trug wie Schuster einen dunkelblauen Anzug, nur teurer und besser sitzend, dazu ein weißes Hemd mit roter Krawatte.
»Ich bin wirklich froh, dass Sie für uns arbeiten werden«, sagte er.
Dengler registrierte die angenehme, tiefe Stimme, die ohne erkennbare Anstrengung den Raum füllte. Dieser Mann war gewohnt, dass man ihm zuhört. Er hatte es nicht nötig, lauter zu sprechen, um seine Autorität zu beweisen, oder giftig zu werden wie Schuster.
»Personen. Verschwundene Personen. Darauf bin ich spezialisiert.«
»Das ist gut. Wir sind in großer Sorge um Frau Hartmann. Wir möchten sie schnell und vor allem wohlbehalten wieder bei uns haben. Dabei sollen Sie uns helfen.«
Die Tür öffnete sich, und Schuster betrat wieder den Raum.
Dengler sagte: »Wenn ich Befragungen durchführe, wäre es hilfreich, wenn ich einen Ausweis des Auswärtigen Amtes hätte. Dann reden die ermittelnden Beamten mit mir. Sonst …« Er hob den rechten Unterarm leicht an und ließ ihn wieder auf den Tisch sinken.
»Selbstverständlich.« Der Minister wandte den Kopf zu Schuster. »Bitte kümmern Sie sich darum.«
»Kein Problem«, sagte Schuster, der jetzt in straffer Haltung neben dem Minister stand. Er setzte sich an den Tisch, zog eine kleine Schreibkladde aus der Innentasche seines Jacketts und notierte etwas.
»Es ist wichtig, dass wir wissen, was bei den Ermittlungsbehörden vor sich geht. Bitte scheuen Sie keinen Aufwand.«
Er wandte sich an Schuster: »Sie halten mich auf dem Laufenden. Sie berichten mir persönlich.«
Schuster nickte heftig.
Der Minister wandte sich wieder zu Dengler. »Sie kommen aus Stuttgart, nicht wahr?«
Dengler nickte.
»Gut«, sagte er, »Sie haben sicher ein Büro in Berlin. Halten Sie darüber engen Kontakt zu Herrn Schuster.«
Er blickte auf seine Armbanduhr.
»Und schicken Sie Ihre Rechnungen und Auslagen direkt an Herrn Schuster. Er wird dafür sorgen, dass alles umgehend beglichen wird. Es gibt hier manchmal einen etwas bürokratischen Umgang mit diesen Dingen.«
»Selbstverständlich«, sagte Schuster und kritzelte etwas in seine Kladde.
Der Außenminister stand auf. Er gab Dengler die Hand, nickte Schuster zu und verließ den Konferenzraum.
Stille.
Es klopfte, ein junger Mann erschien und stellte ein kleines Tablett mit einem doppelten Espresso und einem Milchkännchen vor Dengler auf den Besprechungstisch. Georg Dengler goss Milch ein, nippte an dem Kaffee und blickte Schuster an. »Wann kann ich mit dem Ausweis rechnen?«
»Ich werde noch heute alles Notwendige in die Wege leiten.«
»Die Akten brauche ich so schnell wie möglich.«
»Das ist nicht üblich. Aber wenn der Minister … Nun gut, ausnahmsweise, wir machen Kopien. In ein paar Tagen gehen sie an Ihr Berliner Büro.«
»Schicken Sie sie bitte nach Stuttgart.«
»Der Außenminister sagte, ich soll sie an Ihr Berliner Büro schicken.«
Wieder schrieb Schuster etwas auf, dann sah er Dengler an: »Sie bringen mir Glück, Dengler, wissen Sie das?«
»Das war nicht meine Absicht.«
»Sie haben doch gehört, was der Minister gesagt hat.« Schuster streckte seine Schultern. »›Sie halten mich auf dem Laufenden. Sie berichten mir persönlich‹ – das hat er gesagt.«
»Na, dann herzlichen Glückwunsch.«
»Wie Sie sicher wissen, ist er ja nicht mehr lange Außenminister. Er wird unser nächster Bundespräsident. Vielleicht nimmt er mich mit in seinen neuen Job. Es ist wirklich wichtig, dass Sie die Kollegin Hartmann bald finden.«
Dengler stand auf. »Dann schicken Sie mir möglichst bald den verdammten Ausweis und die bisherigen Ermittlungsunterlagen.«
»Und Sie geben mir die Adresse Ihres Berliner Büros.«
2.Freunde
»Bin ich froh – heute Abend sind hier keine Gäste, sondern nur Freunde«, sagte Mario und entkorkte eine Flasche Barolo. »Glaubt mir: Ich habe eine harte Zeit hinter mir.«
Zu fünft saßen sie um Marios Wohnzimmertisch. Dengler und Olga saßen auf der rechten Seite des Tisches, Martin Klein und Leopold Harder auf der linken, Mario thronte am Kopfende. Normalerweise aßen an diesem Tisch zahlende Gäste. Marios Wohnzimmer war unter dem Namen Einzimmertafel St. Amour in Stuttgart ein heiß begehrter Treff. Künstler und Geschäftsleute mieteten sich mit ihren Freunden oder ihren Familien bei ihm für einen Abend ein, und dann kochte Mario. Dengler fand, das Essen an diesem Tisch schmeckte so gut wie in den besten Restaurants der Stadt.
Seit mehr als zehn Jahren war er nun selbstständiger Privatermittler und mit der Ausnahme seines letzten Falles, der ihm für einige Monate etwas Geld auf das Konto gespült hatte, war er in dieser Zeit mehr oder weniger – und eigentlich immer – pleite, und sein Konto kam aus dem Minus ebenso wenig heraus wie der Hamburger SV aus der Abstiegszone.
Doch an Marios Tisch verflogen Denglers Sorgen. Immerhin war die schönste Frau, der er je begegnet war, in dieser Zeit seine Freundin geworden. Von seinen Freunden hatte keiner eine Freundin. Sonja hatte Mario vor einem Jahr verlassen, und seit dieser Zeit hatte sich nur hin und wieder ein weibliches Wesen in sein Bett verirrt, aber keine blieb länger als zwei, drei Nächte. Martin Klein mied weibliche Bekanntschaften, seit der schrecklichen Enttäuschung, die er während ihrer Ermittlungen rund um das Attentat auf das Münchner Oktoberfest erlebt hatte. Und Leopold Harder war, was Liebesbeziehungen anging, ein ganz großes Rätsel. Er sprach nie darüber, und alle Nachfragen in diese Richtung wehrte Harder immer äußerst geschickt ab.
Wie auch immer: Dies war seine Familie. In diesem Kreis fühlte er sich aufgehoben und verstanden. In Marios Wohnzimmer fühlte er sich zu Hause.
Mario schenkte ihnen ein, stellte die Flasche zurück und verkündete feierlich: »Georg wird jetzt reich.«
»Er hat den Berliner Auftrag bekommen«, sagte Martin Klein.
»Er arbeitet jetzt für die höchsten Stellen«, sagte Leopold Harder.
»Darauf sollten wir trinken«, sagte Mario und hob das Glas. »Wir trinken auf Georgs ruhmreiche Zukunft.«
»Auf den Durchbruch des Privatermittlers Georg Dengler«, sagte Martin Klein.
»Auf den künftigen Spender vieler Flaschen Barolo«, sagte Leopold Harder.
»Freunde, daraus wird nichts«, sagte Georg Dengler.
Olga drehte sich zu ihm hin. »Daraus wird nichts?«, fragte sie.
»Nein«, sagte Georg Dengler. »Ich muss den Auftrag ablehnen.« Er sah in die erstaunten Gesichter seiner Freunde. »Es ist so«, Georg blickte auf einen imaginären Punkt vor sich auf dem Tisch, »der Außenminister denkt, ich hätte ein Büro in Berlin, das den Kontakt zu dieser Hofschranze im Ministerium hält. Aber ich habe kein Berliner Büro. Ich bin eine Einmannband. Kein Berliner Büro, kein Berliner Auftrag.«
»Mensch, sei doch nicht blöd«, sagte Mario. »Dann miete doch etwas in Berlin. Die müssen doch nicht wissen, dass das Büro ganz neu ist.«
»Okay, Freunde, ich muss deutlicher werden: kein Geld, kein Geld für ein Berliner Büro, kein Berliner Auftrag. So ist die Lage.«
»Das ist doch Unsinn«, sagte Leo Harder.
»Großer Mist«, sagte Martin Klein.
»Damit kannst du dich doch nicht abfinden«, sagte Mario.
»Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen«, sagte Olga.
»Wir legen alle zusammen!«, rief Leo Harder.
»Es reicht ja eine Mansarde«, sagte Mario.
»Muss ja nicht in der Friedrichstraße sein«, sagte Martin Klein.
»Olga, was meinst du damit: ›Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen‹?«, fragte Georg Dengler.
Sie warf ihm eine Kusshand zu. »Später«, sagte sie leise.
»Ich habe ein paar Ersparnisse. Ich könnte dir zwei Monatsgehälter leihen«, sagte Leopold Harder.
Mario: »Ich hab auch ein bisschen was auf die Seite gelegt. Du kannst darüber verfügen. Aber es sind nicht mehr als 3.000 Euro. Und du, Martin, was kannst du in die Mitte werfen?«
Martin Klein sah in die Runde. »Nichts«, sagte er.
»Seit wie vielen Jahrhunderten veröffentlichst du deine Horoskope? Du hast doch bestimmt einen dicken Sparstrumpf«, sagte Mario.
»Den rückst du jetzt raus«, sagte Leopold Harder.
»Es gibt keinen Sparstrumpf«, sagte Martin Klein. »Ihr wisst doch, vor Kurzem wurde die Stuttgarter Sonntagszeitung eingestellt.«
»Genau«, sagte Mario, »wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wovon lebst du denn jetzt?«
»Das, meine lieben Freunde, ist exakt das Problem, das mich am meisten beschäftigt«, sagte Martin Klein. »Seit fünfzehn Jahren schreibe ich für die Sonntagszeitung das Wochenhoroskop – und von einem Tag auf den anderen …« Er hob beide Hände und ließ sie in den Schoß fallen. »Schluss, einfach Schluss.«
»Und wie sieht es mit den Frauenzeitschriften aus?«, fragte Georg Dengler. »Du hast doch auch immer Horoskope in der Cosmopolitan, in der Elle, in der Vogue und wie die Blätter nicht alle heißen, geschrieben.«
»Weil du so ein Frauenversteher bist, wie wir alle wissen«, sagte Leopold Harder.
Mario hob das Glas und sang: »Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen …«
Olga sagte: »Leute, das ist nicht lustig … Ihm ist nicht zum Lachen zumute.«
»Absolut nicht«, sagte Martin Klein. »Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Für die Frauenmagazine schreibe ich nur einmal im Jahr. Die Jahreshoroskope, ihr wisst schon. Aber diese Honorare retten mich auf Dauer nicht vor dem Verhungern.«
»Kein Geld«, sagte Mario.
»Noch nicht einmal ein Sparstrumpf«, sagte Leo Harder.
Olga legte Martin Klein eine Hand auf den Arm.
»Wir lassen dich nicht hängen«, sagte Georg Dengler.
Mario tippte und wischte auf seinem Handy herum.
Leo Harder sagte: »Wir sammeln nicht für Georg, sondern für dich.«
»Auf jeden Fall«, sagte Mario, »lassen wir dich nicht verhungern. Ein Gläschen guten Weines gibt es für dich hier immer und eine Suppe auch.« Er griff erneut nach seinem Handy.
Klein lachte und hob sein Glas. »Auf die Freundschaft«, sagte er.
»Auf die Freundschaft!«, sagten die anderen im Chor. In diesem Augenblick klingelte es.
Mario sprang auf. »Das wird Anita sein. Ich habe morgen zwanzig Gäste, und sie wird die Speisen auftragen. Ich muss ihr kurz zeigen, wo alles ist – das Besteck, die Teller, die Gläser.«
Kurz darauf kam er mit einer blonden Frau zurück. »Darf ich euch vorstellen: die beste Bedienung auf diesem Planeten.« Dann überprüfte er erneut sein Handy.
Dengler blickte auf und beobachtete Anita, wie sie ihren langen, breiten Wollschal ablegte. Schulterlange, krause Haare. Unter dem blauen, dicken Wintermantel trug sie ein luftiges schwarzes Kleid mit Blumenmotiven, eine schwarze Strumpfhose und klobige Schuhe, die Dengler an Bergstiefel erinnerten. Sie hob die Hand und winkte ihnen zu: »Hallo, ich bin Anita.«
»Setz dich zu uns«, sagte Leo Harder und stand auf. »Du erhöhst die Frauenquote um hundert Prozent.«
Anita zog einen Stuhl heran und setzte sich neben Mario. »Ich freue mich sehr, endlich mal Marios Freunde kennenzulernen. Er erzählt immer von euch. Wer ist denn der Detektiv in der Runde?«
Dengler hob die Hand.
Anita sah kurz zu ihm hin und schien enttäuscht. »Ich dachte, du seist es«, sagte sie zu Leo Harder, der geschmeichelt lächelte.
Mario tippte eine Nachricht in sein Handy.
»Du, Mario«, sagte Anita, »das ist extrem unhöflich. Die ganze Zeit beschäftigst du dich mit deinem Handy, während deine Freunde da sind.«
»Da sind wir von ihm durchaus Schlimmeres gewohnt«, sagte Martin Klein.
»Das ist ja noch ganz harmlos«, sagte Georg Dengler.
»Was tippst du denn die ganze Zeit?«, fragte Anita.
»Ah, ich guck gerade, ob eine neue Nachricht von Parship da ist.«
Anita prustete los. »Du?! Du bist bei einem Partnerschaftsportal? Ich glaub’s ja nicht.«
»Doch, das glaube ich sofort …«, murmelte Martin Klein.
»Nee, sag mal echt: Wieso bist du denn bei Parship?«, fragte Anita.
»Wie soll ich denn sonst jemand kennenlernen?«, fragte Mario. »Frühmorgens gehe ich in den Großmarkt und kaufe ein, nachmittags koche ich, und abends sind die Gäste da.«
»Und wenn die Gäste gehen, ist er zu erschöpft für die Liebe«, sagte Martin Klein.
»Keine Libido mehr«, sagte Olga.
Dengler setzte zu einer Äußerung an, doch dann schwieg er.
»Das glaub ich nicht«, sagte Anita. »Dem Mario laufen doch die Frauen hinterher.«
»Das seht ihr völlig falsch!«, sagte Mario. »Ihr habt keine Ahnung. So, wie ich arbeite, lerne ich wirklich niemanden kennen.«
»Aber du kennst doch mich. Mich hast du doch auch kennengelernt«, sagte Anita.
»Ja, was für ein Glück«, sagte Martin Klein.
Olga zog eine Augenbraue hoch und sah ihn streng an.
»Ach, Anita«, sagte Mario, »dich hab ich kennengelernt, weil ich eine Servicekraft für meine Gäste brauchte. Bei Parship suche ich jemand …« Er stockte.
»… für die ganz große Liebe!«, sagte Martin Klein.
»… und vor allem fürs Bett!«, sagte Leopold Harder.
»Ich sag’s mal so«, sagte Mario, »ich stehe jeden Abend am Herd und ich bräuchte mal wieder eine Frau.«
»Wieso suchst du noch? Neben dir sitzt doch eine.«
»Würdest du mit mir ins Bett gehen?«, fragte Mario.
»Ja, klar!«
»Echt?«
Mario stand auf. Am Tisch herrschte perplexes Schweigen.
Dengler und Olga gingen zu Fuß nach Hause. Es war kalt. Auf der Reinsburgstraße fuhren nur wenige Autos. Sie kamen am hell erleuchteten Kaufhaus Gerber vorbei und marschierten, immer noch schweigend, die Tübinger Straße entlang. Vor dem Kino blieben sie stehen und betrachteten die Plakate von »Nicht ohne uns«, dem neu angelaufenen Film.
»So kann’s gehen«, sagte Dengler, »die Liebe ist ein seltsames Spiel.«
Olga sagte nichts. Erst später, als sie in ihrem großen Bett lagen und Dengler schon die Augen geschlossen hatte, drehte sie sich noch einmal zu ihm um. »Sag mal, Georg«, sagte sie, »warum schläfst du nicht mehr mit mir?«
3.Müsli
Dengler stocherte lustlos in der Schale Müsli, die die blonde junge Frau, die ein energisches Regiment über das bis auf den letzten Platz gefüllte Lokal führte, mit einem Knall vor ihn auf den Tisch gestellt hatte. Olga saß neben ihm und blätterte im Stuttgarter Blatt.
Ihre Bemerkung von letzter Nacht rumorte in seinem Kopf. Sie hatte recht, kein Zweifel. Irgendetwas stimmte nicht. Wann hatten sie das letzte Mal miteinander geschlafen? Es war Wochen her. Nein, dachte Dengler, sei ehrlich, es handelt sich um Monate. Er erinnerte sich, Oktober war es gewesen, und die Initiative war von Olga ausgegangen. Es war ein Sonntagmorgen gewesen, er war noch in der Zwischenwelt zwischen Schlaf und Wachwerden, als ihre Hände zu ihm herüberwanderten. Sie kannte ihn, sie wusste, was zu tun war, aber Dengler fühlte, jetzt, da er daran zurückdachte, noch genau den Moment des inneren Widerstands, den er damals empfunden hatte, bevor er ihren erkundenden und auffordernden Händen nachgab. Es wurde wunderschön. Dengler lächelte in der Erinnerung daran. Sie gingen anschließend spazieren, Hand in Hand den Blauen Weg entlang, und sie sahen die Stadt zu ihren Füßen liegen, sie suchten Muster und Figuren in den Nebelschwaden, die aus den Wäldern an den Hängen gegenüber aufstiegen, und waren glücklich wie zwei Kinder.
Und jetzt? Dengler schob mit der Gabel einige Apfelstücke auf die Seite. Er hatte keinen Hunger. Irgendeine Macht hatte in seinem Inneren sein Begehren ausgeschaltet, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Er verstand es nicht. Liebte er Olga nicht mehr? Er sah sie an. Eine Welle inniglicher Zuneigung durchflutete ihn. Eindeutig: Er liebte sie. Mehr als alles andere auf der Welt. Er würde alles für sie tun. Er konnte sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Wenn sie ihn verlassen würde … Ein größeres Unglück konnte es nicht geben.
Doch begehrte er sie? Er horchte in sich hinein und da war … nichts. War er impotent geworden? Oder war sein Hormonspiegel ins Bodenlose gefallen? War ihm etwas Unbekanntes widerfahren, etwas Medizinisches, das er mit blauen Pillen beheben musste?
»Hast du keinen Hunger?«, fragte Olga.
Dengler zermanschte die Haferflocken. »Nein, irgendwie nicht«, sagte er.
»Ich habe nachgedacht«, sagte Olga, und Dengler schaute sie erschrocken an. Hatte sie genug von ihm und seiner Lustlosigkeit? Was kam jetzt? Der Abschied? Er atmete tief ein und wappnete sich.
»Du solltest diesen Auftrag unbedingt annehmen«, sagte sie. »Er ist eine große Chance.«
Dengler seufzte. »Ich weiß«, sagte er, »aber das kann ich alles nicht finanzieren. Ein Büro in Berlin, jemand, der dort das Telefon hütet und den Kontakt zum Auswärtigen Amt hält. Ich bin ein Einmannbetrieb und muss Einmannbetriebsaufträge annehmen. So ist die Lage.«
»Ja, so ist die Lage. Aber ich sehe eine Möglichkeit, genau diese Lage zu ändern. Du kannst nicht dein ganzes Leben lang untreuen Ehefrauen hinterherspionieren. Dafür bist du zu schade.«
Dann fügte sie hinzu: »Das ist nicht gut.«
Dengler dachte an die letzte Nacht, und er war sich nicht sicher, ob Olga nicht ebenfalls daran dachte.
»Ich kann dir das Geld vorstrecken«, sagte sie. »Sobald der Minister deine Rechnung bezahlt hat, gibst du es mir zurück.«
»Olga, ich weiß, wie du dein Geld verdienst. Wir reden nicht darüber, aber ich will nicht, dass du dich meinetwegen in Gefahr begibst.«
»Unsinn«, sagte sie. »Ich leihe es dir von meinen Ersparnissen. Wir suchen im Internet nach einem passenden Büro, und wir rufen jetzt gleich beim Arbeitsamt an, sie sollen Bewerberinnen schicken.«
Sie hielt einen imaginären Telefonhörer ans Ohr. »Detektei Dengler, Büro Berlin, was kann ich für Sie tun?«
Dengler schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall«, sagte er. »Ich nehme kein Geld von dir.«
4.Bewerbungen
Die erste Bewerberin klingelte pünktlich um neun Uhr. Sie hieß Elisabeth Feldinger, eine hochgewachsene Frau mit rötlichen Haaren und blassem Teint. Sie trug ein dunkelgrünes Tweed-Jackett und den passenden Rock dazu, braune Strümpfe und Schuhe mit halbhohem Blockabsatz. Mit wenigen raschen Schritten trat sie in sein Büro und sah sich um. Dengler bot ihr den Stuhl vor seinem Schreibtisch an, sie stellte eine braune Aktentasche auf ihren Schoß, öffnete sie und zog eine Bewerbungsmappe heraus. Mit einer schnellen Bewegung legte sie sie vor Dengler auf den Tisch.
»Tja«, sagte Dengler, »also ich bin Privatdetektiv, die Geschäfte laufen jetzt besser, und ich brauche jemanden, der mir bei dem ganzen Bürokram hilft.«
Die Frau sah sich noch einmal in dem kleinen Büro um. »Wo soll denn mein Schreibtisch stehen?«, fragte sie.
Verdammt, daran hatte er nicht gedacht. »Nun ja, den müssen wir noch kaufen, und den schieben wir dann an meinen mit ran. Außerdem suche ich jemanden, der meine Berliner Niederlassung managt. Sie werden einen Teil Ihrer Arbeitszeit in der Hauptstadt verbringen.«
»Ja, das wurde mir auf dem Arbeitsamt gesagt«, sagte die Frau. »Wo genau ist denn Ihre Niederlassung in Berlin?«
»Na ja«, sagte Dengler, »eine Ihrer ersten Aufgaben wird sein, diese Räumlichkeiten anzumieten.«
»Und die weiteren Aufgaben?«
»Wenn jemand anruft, müssen Sie am Telefon einen professionellen Eindruck machen und das Gespräch dann zu mir weiterschalten.«
»Und weiter? Sie wissen, ich bin eine ausgebildete Office-Managerin. Wenn Sie mal einen Blick in meine Bewerbungsunterlagen …«
»Ja, gute Sache«, sagte Dengler, »Office-Managerin. Das ist … gut. Das ist wahrscheinlich genau das, was ich brauche.«
»Ich kann Ihre Termine professionell verwalten, buche Ihre Flüge und Zugfahrten, sorge dafür, dass Sie pünktlich zu Ihren Besprechungen kommen. Daneben führe ich die Ablage, beantworte Ihre E-Mails, sofern sie nicht im Kompetenzbereich A liegen. Ich übernehme alle organisatorischen und administrativen Tätigkeiten zur Unterstützung der Geschäftsführung, gleichzeitig bin ich die Schnittstelle zu allen Abteilungen und Stabsstellen Ihres Unternehmens. Zu meinen Aufgabengebieten gehören die Postbearbeitung, ich korrespondiere in Deutsch und Englisch, aber selbstverständlich erstelle ich auch Excel-Listen und -Tabellen, wie Sie sie wünschen, PowerPoint ist mir geläufig …«
»PowerPoint? Oh, das ist gut …. ja, sehr gut«, sagte Dengler.
»Ich übernehme die Vorbereitung und Organisation von Meetings und Events. Bei Ihren internen Besprechungen führe ich selbstverständlich Protokoll. Das Vorkontieren übernehme ich. Ich vermute ja, Sie verbuchen Ihre Rechnungen nicht selbst, sondern überlassen das einem Steuerberater? Auch hier kommuniziere ich im Interesse der Firma, unserer Firma …«
»Ich bin Privatdetektiv«, sagte Dengler. »Ich bin eine kleine Nummer, bis jetzt hat meine Firma noch keinen Gewinn gemacht. Aber das wird sich ändern. Wir sind auf einem guten Weg.«
»Das Reisemanagement sowie die Reisekosten- und Spesenabrechnung werde ich ebenfalls übernehmen. Ich habe sogar Erfahrung beim Projektcontrolling und …«
»Das ist wirklich eine ganze Menge«, sagte Dengler. Er blätterte in ihren Bewerbungsunterlagen. Frau Feldinger hatte das Vorzimmer des Geschäftsführers eines Automobilzulieferers gemanagt. Vierzehn Jahre lang. Tadellose Zeugnisse. »Außergewöhnlich leistungsbereit«, las er, »hoch motiviert, umsichtig.« Er sah ihr ins Gesicht. Die Kieferknochen waren angespannt und gaben ihr einen harten Zug um den Mund. Die Augenbrauen waren hochgezogen und die Augen standen erstaunlich weit offen. Frau Feldinger zeigte alle Symptome von Angst. Aber warum? Warum hatte die Frau Angst? Sie befand sich nicht in Gefahr. Dengler sah ihr noch einmal ins Gesicht.
»Warum arbeiten Sie nicht mehr bei Ihrem früheren Arbeitgeber?«
Zu dem harten Zug um ihren Mund trat ein bitterer hinzu. »Der neue Chef wollte wohl etwas Jüngeres«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Und jetzt muss ich mir etwas Neues suchen.«
Sie zuckte mit den Schultern und ließ den Blick durch Denglers Büro schweifen, und er wusste genau, was sie dachte: Und jetzt muss ich mich in so einer Bruchbude bewerben.
»Mit Ihrer Qualifikation wird das sicher klappen.«
Sie schwieg.
»Wovor haben Sie Angst?«
Sie sah ihn wütend an. »Ich arbeite seit meinem siebzehnten Lebensjahr. Seit zwölf Jahren bin ich Chefsekretärin mit wenig Freizeit, aber einem guten Gehalt. Und nun – nun bekomme ich nur ein Jahr lang Arbeitslosengeld, dann geht’s ab nach Hartz IV.«
Sie sah Dengler an, als trage dieser die Schuld dafür.
»Mein Freund sagt, das haben uns die Linken eingebrockt, die SPD und die Grünen, Agenda 2010. Ich hätte nie geglaubt, dass ich einmal …« Sie schluckte. Dann sagte sie leise: »Ich hab nur noch drei Monate Zeit.«
Jetzt wusste Dengler, woher die Angst kam.
Sie warf die Haare zurück und sah ihm direkt ins Gesicht.
»Ich habe immer gearbeitet. Sie haben mir im Jobcenter gesagt, ich müsse meine Wohnung verkaufen, bevor ich auch nur einen Cent von ihnen bekomme. Und den Flüchtlingen wirft man das Geld hinterher. Mein Freund sagt …«
Dengler unterbrach sie: »Sie hören von mir. Ich behalte Ihre Unterlagen solange hier.«
Eine Dreiviertelstunde später erschien Luise Merkle, eine kleine untersetzte Frau, die sich mit einem großen Taschentuch den Schweiß von der Stirn tupfte. Dengler schätzte sie auf Mitte vierzig. Erschöpft ließ sie sich in den Stuhl vor ihm fallen.
»Boah«, sagte sie, »das sind ja viele Treppenstufen zu Ihnen hoch!«
»Mein Büro ist im ersten Stock«, sagte Dengler.
»Trotzdem. Viel zu viele Stufen …«
Sie wischte sich erneut über das schweißnasse Gesicht.
Dengler betrachtete sie. Ihr Blick wanderte hin und her. Unsicherheit, dachte er. Sie weiß nicht, ob sie der Aufgabe gewachsen ist.
»Möchten Sie sich vielleicht etwas frisch machen?«, fragte Dengler. Ich muss eine freundliche Atmosphäre schaffen. Wie bei einem Verhör, erst einmal die Angst nehmen.
»Ah, das ist eine gute Idee«, sagte sie. »Ich schwitze immer so vom Treppensteigen.«
»Ich zeige Ihnen das Bad«, sagte Dengler und stand auf. Die Frau folgte ihm. Sie gingen durch die Küche, und Frau Merkle sah sich um. »Vielleicht brauchen Sie eher jemand für den Haushalt?«, fragte sie.
Dengler öffnete stirnrunzelnd die Tür zum Badezimmer. »Dort unten finden Sie Handtücher«, sagte er und zeigte auf einen der Unterschränke.
»Was ist das denn für ein Bad?«, fragte sie.
»Wie meinen Sie das? Das ist mein Bad«, sagte Dengler.
»Also das geht ja gar nicht! Glauben Sie, ich will in Ihren Intimbereich eindringen, wenn ich hier arbeite?« Empört drehte sie sich um. »Also das ist mir noch nie passiert. Die können mich vom Arbeitsamt doch nicht in jeden Puff schicken.«
»Wie bitte?«
»Eine Zumutung ist das!« Ihre Stimme war jetzt laut.
Dengler sah sie wieder an, und es schien ihm, als läge hinter dem empörten Gesichtsausdruck auch eine Spur von Erleichterung.
»Entschuldigung«, sagte Dengler, »so sieht es hier nun mal aus.«
Als die Frau gegangen war, rief er Olga an. »Süße«, sagte er, »ich glaube, wir haben ein Problem mit der Personalbeschaffung. Es funktioniert nicht.«
»Hast du denn schon alle drei Bewerberinnen gesehen?«
»Nein, eine kommt noch, aber ich glaube, ich rufe sie an und sage ihr ab.«
»Warte, ich komm runter zu dir«, sagte sie.
Es klingelte. »Dann schau dir mal der Tragödie dritter Teil an«, sagte Dengler und öffnete die Tür.
Eine junge Frau trat ein. »Guten Tag. Mein Name ist Petra Wolff«, sagte sie. »Auf dem Arbeitsamt haben sie mir gesagt, ein Privatdetektiv brauche Unterstützung im Büro. Wobei benötigen Sie denn genau Unterstützung? Was soll ich tun?«
»Na ja«, sagte Dengler, »das hier ist ein kleiner Laden. Ein Einmannbetrieb. Für einen Auftrag brauche ich jemand, der in Berlin sitzt, und eigentlich brauche ich ihn nur dafür, falls dort jemand mal anruft.«
»Ich soll in Berlin sitzen und auf Anrufe warten?«
»Im Grunde genommen ist das exakt Ihre Arbeitsbeschreibung.«
Dengler sah ihr ins Gesicht und suchte nach Angst, Empörung oder irgendeinem anderen Anzeichen von Ablehnung. Doch sie schien einfach nur nachzudenken.
»Ich habe eine bessere Idee!«, sagte sie.
»So?«
»Ja, in Berlin reicht doch dann ein einfaches Telefon mit einer Anrufweiterschaltung hierher. Und wenn ich sehe: Aha, ein weitergeleiteter Anruf aus Berlin, dann melde ich mich ›Detektei Dengler, Büro Berlin, guten Tag. Was kann ich für Sie tun?‹; und in der Zwischenzeit kann ich Ihnen andere Arbeiten abnehmen.«
»Na ja«, sagte Dengler, »wir brauchen trotzdem ein Büro in Berlin, wo dieses Telefon steht.«
»Ach Quatsch«, sagte die Frau. »Ich habe eine Freundin in Berlin. Ob da ein oder zwei Telefone im Flur stehen, das macht der gar nichts aus. Sie zahlen ihr eine kleine monatliche Gebühr und die Sache ist erledigt.«
Olga lächelte die Frau an. »Wir haben uns noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin Olga.«
»Ich heiße Petra Wolff und ich würde wahnsinnig gern für einen Privatdetektiv arbeiten.«
»Warum?«, fragte Dengler.
»Polizeiarbeit macht mir Spaß«, sagte sie. »Ich habe mehrere Jahre beim Landeskriminalamt in Bad Cannstatt als Sekretärin gearbeitet.«
»Und warum sind Sie nicht mehr dort?«
»Ach«, sie verzog das Gesicht, »dort muss man in der richtigen Kirche sein, um vorwärtszukommen, und immer freundlich nach oben lächeln, auch wenn’s einem nicht danach zumute ist.«
»Ja, wissen Sie, hier ist es ziemlich beengt. Wir können einen Schreibtisch für Sie hereinzwängen, aber Bad und Toilette sind praktisch drüben in meiner Privatwohnung. Also nah, aber …«
»Das macht mir nichts aus! Was für Fälle bearbeiten Sie denn zurzeit?«
»Wir suchen eine verschwundene Mitarbeiterin des Außenministeriums.«
»Wow, das klingt spannend! Da würde ich gerne mitmachen! Außerdem habe ich noch einigermaßen gute Connections ins LKA. Vielleicht können diese uns ja nützlich werden …«
Olga lächelte. »Georg«, sagte sie, »wir haben die richtige Frau für dich gefunden.«
5.Rechnung
Am Nachmittag brachte der Kurier ein Paket. Vier Aktenordner mit Ermittlungsunterlagen. Die vermisste Person hieß Anna Hartmann, geboren am 3. November 1980 in München. Der Vater hieß Jürgen Hartmann und war Jurist, angestellt beim Deutschen Patentamt. Die Mutter hieß Kalliope Hartmann, geb. Timiliotis, Hausfrau, geboren in Athen. Die Tochter sprach neben Griechisch und Deutsch noch Englisch, Französisch und Spanisch, sie hatte Jura und Volkswirtschaft in München und London studiert. Prädikatsexamen. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst bei der Europäischen Kommission in Brüssel, bevor sie dann ins Auswärtige Amt in die Abteilung Südeuropa wechselte. Zuletzt war sie vom Außenministerium als Beraterin an die Troika ausgeliehen worden, das Dreigespann aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Kommission. Verlobt mit Benjamin Stenzel, der bei einer Unternehmensberatung in München arbeitete.
Das Landeskriminalamt Berlin führte die Ermittlungen. Dengler suchte den Namen des ermittelnden Kollegen. Hauptkommissar Johannes Wittig. Er runzelte die Stirn. Der Name kam ihm bekannt vor, doch ihm fiel dazu kein Gesicht ein.
Das Video war in der Nacht vom 27. Dezember aufgenommen worden. Am nächsten Tag erschien Anna Hartmann nicht zu zwei wichtigen Besprechungen im Auswärtigen Amt. Da Anna Hartmann sich nicht krankmeldete, auch nicht an ihr Telefon in der Berliner Wohnung ging und dieses Verhalten völlig untypisch für ihre pflichtbewusste Chefin war, machte sich ihre Sekretärin Sorgen. Sie rief erst den Verlobten an, der auch nichts gehört hatte, und fuhr dann zu der Wohnung. Als dort niemand öffnete, alarmierte sie den Sicherheitsdienst, der sofort das Landeskriminalamt einschaltete.
Wittig hatte die Eltern und den Verlobten befragt und versucht, mögliche Motive für eine Entführung zu ermitteln. Doch die Eltern konnten sich keinen Grund für eine solche Tat vorstellen. »Wir sind nicht reich«, hatte der Vater ausgesagt. »Meine Frau und ich haben ein gemeinsames Konto, dort liegen 185.000 Euro. Bei uns hat sich kein Entführer gemeldet. Aber ich würde dieses Geld sofort für meine Tochter hergeben.« Das Münchner Landeskriminalamt hatte das Telefon verwanzt, aber es meldete sich niemand; die Tochter nicht und auch keine Entführer.
Über eine Meldung des Pförtners der irischen Botschaft und die Auswertung der Sicherheitskameras ermittelte Wittig die beiden irischen Trunkenbolde. Auf ihrem Handy befand sich der Film, den Dengler im Auswärtigen Amt gesehen hatte.
In einem weiteren Vermerk spielte Wittig mögliche Szenarien durch. Möglicherweise war Anna Hartmann von einer osteuropäischen Bande verschleppt und nach Asien oder in den Nahen Osten in ein Bordell verkauft worden – blonde Frauen waren dort begehrt. Aber eine selbstbewusste und kluge Frau wie Anna Hartmann würde eine Gelegenheit finden, ein Signal an die Eltern oder an die Polizei zu schicken. Wittig schätzte diesen Tathergang nicht als wahrscheinlich ein. In einem weiteren Vermerk notierte er: »Das Amateurvideo der beiden irischen Zeugen lässt nicht unbedingt auf eine Entführung schließen. Es ist sehr wohl möglich, dass Anna Hartmann hinter dem schwarzen Mercedes-Kastenwagen gestürzt war und erst wieder in Erscheinung trat, als der Ire seine Videoaufzeichnung längst beendet hatte.« Wittigs Notizen lauteten weiter: »Es ist durchaus möglich, dass Anna Hartmann freiwillig verschwunden ist. Sie hatte um 2.14 Uhr auf ihrem Handy einen Anruf von einem unbekannten Teilnehmer erhalten und muss kurz danach ihre Wohnung verlassen haben.«
Dengler blätterte weiter in Wittigs Aufzeichnungen, aber es gab aus ihrem Umfeld keinen Hinweis darauf, dass Anna Hartmann ein Motiv gehabt hätte unterzutauchen. Aber das kannten Angehörige von Verschwundenen ohnehin meist nicht.
Dengler legte die Füße auf den Schreibtisch. Es war also keineswegs sicher, dass es sich bei diesem Fall um ein Verbrechen handelte. Dagegen sprach, dass sich Entführer weder bei den Eltern noch bei dem Verlobten gemeldet hatten. Wenn es so war – und die Berliner Polizei schien zunehmend davon auszugehen –, dass sie freiwillig gegangen war, dann würden die polizeilichen Ermittlungen eingestellt werden. Anna Hartmann war volljährig, und es gab eine Menge volljährige Menschen, die jedes Jahr ihren Koffer packten und anderswo ein besseres Leben suchten. Nicht alle informierten ihre nächsten Verwandten von ihren Plänen.
Allerdings hatte die Verschwundene keinen Koffer gepackt. Sie wohnte in der Jägerstraße. Die Polizei hatte ihre Wohnung durchsucht und versiegelt. Dengler betrachtete die Fotos in der Ermittlungsakte. Eine Zahnbürste lag auf einer Ablagefläche im Bad, daneben ein Zahnputzbecher mit Mickymaus-Motiv. In der Küche standen zwei benutzte Kaffeetassen, ein Messer lag im Spülbecken. Ein Brett mit Brotkrümeln fand sich neben einem ungemachten Bett im Schlafzimmer. Nichts deutete auf eine geplante Abreise hin. Wenn Menschen überstürzt abreisen, fliehen sie oft vor einer großen, lebensbedrohlichen Gefahr. Für eine solche Bedrohung gab es jedoch keinen Hinweis. Dengler las noch einmal die Vernehmungen der Eltern, des Verlobten und ihres Vorgesetzten im Auswärtigen Amt. Keiner konnte sich eine solche Bedrohung vorstellen.
Also doch eine Entführung?
Wittig hatte eine Funkzellenabfrage durchgeführt. Sie ergab keine besonderen Ergebnisse. Das Handy von Anna Hartmann war den ganzen Tag eingeschaltet und in der Funkzelle in der Jägerstraße eingeloggt gewesen. Sie hatte den Funkzellenbereich auch nicht gewechselt. Um 2.47 Uhr wurde ihr Handy ausgeschaltet, und seither hatte sich das Gerät auch nicht wieder in irgendeiner Zelle eingeloggt.
Anna Hartmann besaß zwei Konten. Eines bei der Berliner Sparkasse und eines bei der Deutschlandbank. Über das Sparkassenkonto bezahlte sie die Miete, die Kranken- und einige andere Versicherungen.
Dengler stieß einen überraschten Pfiff aus. Das Konto bei der Deutschlandbank war ein Festgeldkonto, auf dem 375.000 Euro lagen. Für das Sparkassenkonto besaß sie eine EC-Karte sowie eine Kreditkarte. Seit dem Tag ihres Verschwindens war weder eine Abhebung noch eine Überweisung erfolgt. Wittig hatte gründliche Arbeit geleistet und ihre Kontobewegungen der letzten beiden Jahre überprüft. Er fand keine Anhaltspunkte, dass Anna Hartmann heimlich Barbeträge abgehoben hatte, um ihr Verschwinden zu finanzieren.
Dengler überlegte. Anna Hartmann musste essen, musste schlafen. Sie brauchte Lebensmittel und eine Unterkunft. Beides kostete Geld. Wenn sie freiwillig verschwunden war, musste es jemand anderen geben, der ihr beides zur Verfügung stellte. Wittig hatte einige Kollegen aus dem Auswärtigen Amt befragt sowie zwei Schulfreunde; aber aus diesen Protokollen konnte Dengler keinen Hinweis entnehmen, dass irgendjemand aus ihrem Umfeld mit ihrem Verschwinden etwas zu tun gehabt hätte.
Jeder Mensch hinterlässt Spuren. Es gibt keine menschliche Bewegung ohne Spuren. Wenn das Video eine Entführung zeigte, dann hatten die Entführer Spuren hinterlassen.
Er musste diese Spuren finden.
Das Telefon klingelte. Dengler nahm ab.
»Also, das klappt schon mal«, sagte eine Frauenstimme.
»Was klappt?«, fragte Dengler. »Und wer spricht dort?«
»Petra ist hier. Petra Wolff, Ihre neue Mitarbeiterin. Das klappt mit dem Telefon in Berlin.«
»Wie meinen Sie das?«
»Meine Freundin hat gerade einen zweiten Apparat in den Flur gestellt, der die Gespräche direkt an unser Büro in Stuttgart weiterleitet. Sie möchte dafür zweimal im Jahr zum Abendessen ausgeführt werden, aber nicht gerade in eine Dönerbude. Ich kümmere mich um den Papierkram. Sie müssen nur noch unterschreiben.«
»Äh … großartig! Danke.«
»Wann ist bei Ihnen eigentlich Arbeitsbeginn?«
»Äh … Arbeitsbeginn?«
»Also gut, ich bin um neun Uhr da. Mein erster Arbeitstag! Ich freu mich.«
»Also ich weiß gar nicht, was Sie morgen machen könnten.«
»Ich schon. Wir müssen die Rechnung für die Bonzen in Berlin schreiben.«
»Wovon reden Sie? Welche Bonzen?«
»Na, Ihren Außenminister.«
»Das hat noch Zeit.«
»Hat es nicht. Schließlich müssen Sie mich am Monatsende bezahlen. Und ich hab schon kapiert: Ich muss mich selbst drum kümmern, dass es bei Ihnen in der Kasse klingelt.«
»Mach doch mal dein Handy aus. Es ist erst sieben Uhr«, sagte Olga schlaftrunken.
»Oh Gott, ich muss aufstehen …«, sagte Dengler. »Meine neue Assistentin erscheint in zwei Stunden, und ich will im Büro noch ein bisschen aufräumen. Außerdem muss ich den Küchentisch ins Büro stellen, damit Frau Wolff einen Arbeitsplatz hat.«
»Das fängt ja gut an«, sagte Olga und drehte sich noch einmal um.
»Wir wollen die Rechnung für das Außenministerium fertig machen, und dann lad ich Petra zum zweiten Frühstück ein.«
»Oha! Jetzt ist sie schon ›Petra‹.«
»Reine Fürsorgepflicht«, sagte Dengler. »Ich bin jetzt Arbeitgeber, da muss man sich ums Betriebsklima kümmern.«
»Ich komme mit«, sagte Olga und schlug die Bettdecke zurück. »Das will ich mir nicht entgehen lassen, wenn du das Betriebsklima verbesserst.«
Petra Wolff saß an Denglers Küchentisch, den er an seinen Schreibtisch geschoben hatte. Sie nahm ein Blatt Papier aus dem Druckerschacht und legte es über die beiden eingetrockneten Rotweinringe auf dem Tisch. Dengler saß ihr gegenüber an seinem Schreibtisch. Olga lehnte an der Fensterbank.
»Wie hoch ist denn Ihr Stundensatz?«, fragte Petra Wolff und sah Dengler an.
Dengler lehnte sich in seinem Stuhl zurück und dachte nach. »80 Euro«, sagte er. »Da kommen noch Spesen dazu, also Unterbringung, Fahrtkosten und diese Dinge.«
»Und wie viele Stunden sollen wir vorab dem Außenminister berechnen?«
»Zehn Stunden, würde ich mal sagen.«
»Das kommt nicht infrage«, sagte Petra Wolff.
»Wieso nicht?«
»Wieso nicht?! Überlegen Sie doch: Zehn mal 80 sind gerade mal 800 Euro. Wie wollen Sie mich da bezahlen?«
Sie kritzelte einige Zahlen auf das Papier. Dann sah sie ihn an. »Wie hoch ist Ihre Miete?«
»780 Euro.«
»Okay«, sagte Petra Wolff. »5.000 plus 780, plus Bürokosten, plus Strom, Heizung, Wasser – sagen wir mal 350 Euro –, ergibt …«, sie zog einen schwungvollen Strich unter die Tabelle, »6.130 Euro im Monat.«
»Die 5.000«, fragte Dengler, »wo kommen die her?«
Petra Wolff bedachte ihn mit einem langen Augenaufschlag. »Das«, sagte sie, »sind Kosten und Nebenkosten für Ihre neue Assistentin.«
Dengler sah zu Olga hinüber. »Wir haben noch gar nicht über Ihr Gehalt gesprochen.«
»Doch, gerade eben. Aber machen Sie sich keine Sorgen, in diesem Betrag sind Krankenkasse und Sozialversicherung und Steuern bereits drin. Wir müssen also Ihren Stundensatz erhöhen.«
»Vermutlich ziemlich drastisch«, sagte Olga.
Petra Wolff kritzelte erneut etwas aufs Papier.
»Was rechnen Sie denn da?«, fragte Dengler.
»Wenn wir annehmen, Ihre Unkosten, also Steuer und Versicherung, dazu der Gewinn, betragen im Monat 6.000 Euro – und die Kosten für Ihre Assistentin und Bürokosten von 6.130 Euro dazuzählen, kommen wir auf einen Mindestumsatz von 12.130 Euro im Monat. Und das ist ja nicht viel.«
Dengler lachte. »Nicht viel, sagen Sie.«
»Nein, das ist das Minimum. Darunter können Sie Ihren Laden zumachen. Wenn wir die Rechnung für die ersten drei Monate ausstellen, muss der Rechnungsbetrag mindestens 36.390 Euro betragen.«
»Das zahlt kein Mensch«, entfuhr es Dengler.
»Wir sind aber ein aufstrebendes Unternehmen mit einem Filialbetrieb in Berlin und einer ausgezeichneten Verwaltung. Deshalb erhöhen wir diese Summe um den Faktor zwei. Die Rechnung wird also 72.780 Euro betragen.«
Olga lachte.
»Sie sind verrückt«, sagte Dengler.
»Das ist die Wahrheit der Zahlen«, sagte Petra Wolff. »Sie sollten sie nicht länger ignorieren.«
»Was halten Sie von einem Frühstück im Café KönigX?«, fragte Dengler. »Wir haben einige Zeugenbefragungen zu planen.«
6.Wittig
Hauptkommissar Wittig holte Dengler und Petra Wolff am Eingang Keithstraße ab. Er schüttelte ihnen die Hand. »Wir gehen in ein Besprechungszimmer«, sagte er. Dengler schätzte Wittig auf Mitte vierzig, etwa 1,85 Meter groß; er hatte graue kurze Haare, braune Augen und eine kräftige Figur. Unter seinem karierten Hemd zeichnete sich ein Bauchansatz ab. Biertrinker. Der Gang war leicht vornübergebeugt, wie es bei gestressten Menschen oft der Fall ist. Vermutlich viele Fälle, viele Überstunden. Wittigs Gesicht war blass, er trug einen grauen Schnauzbart. Im Gegensatz zu seiner recht müden Erscheinung waren seine Augen wach und interessiert.
Das Besprechungszimmer war klein. Graue Resopalstühle, grauer Resopaltisch. An der Wand hingen zwei Bilder: einander verschlingende Kreise. In dem Bild an der Fensterwand waren die Kreise rot. Im Bild gegenüber grün. Es wirkte auf Dengler, als hätte jemand versucht, aus Einschusslöchern Kunst zu machen. Polizeikunst.
Mit einer knappen Handbewegung forderte Wittig Dengler und Petra Wolff auf, Platz zu nehmen.
»Ich freue mich, dass das Auswärtige Amt sich um seine Mitarbeiter kümmert. Wir sind kurz davor, den Fall abzugeben an die Vermisstenabteilung«, sagte er, als er Denglers fragenden Gesichtsausdruck sah. »Im Augenblick ist der Fall Anna Hartmann noch im Dezernat 11, Delikte am Menschen, aber wenn es nach mir geht, wandert er demnächst zu den Kollegen ins Dezernat 2, Vermisstensachen und Identifizierungsmaßnahmen. Ich gebe es offen zu: Die Sache ist uns ein Rätsel.«
»Eine Entführung?«, fragte Dengler.
»Es gibt keine Lösegeldforderung. Bislang hat sich kein Entführer gemeldet.«
Dengler sagte: »Aber in diesem Video, dem Amateurvideo, ist zu sehen, wie Frau Hartmann hinter diesem schwarzen Van verschwindet.«
Wittig lehnte sich im Stuhl zurück. Er schloss die Augen. »Ja sicher. Aber was sagt dieses Video schon groß aus? Es sagt aus: Die Person verschwindet hinter dem Fahrzeug und kommt länger als fünf oder sechs Sekunden nicht wieder dahinter hervor. Mehr nicht. Vielleicht kommt sie erst in der siebten Sekunde oder in der achten oder neunten. Wir wissen es nicht, und wir können über mögliche Gründe nur spekulieren. Es kann gut sein, dass Anna Hartmann hinter dem Wagen auf dem Eis ausgerutscht und hingeschlagen ist. Dann ist sie wieder aufgestanden, hat sich den Schnee von den Knien geklopft und ist weitermarschiert. Dieses Szenario hätte länger als sechs Sekunden gedauert.«
»Oder jemand hat sie in den Van gezerrt«, sagte Petra Wolff.
Langsam bewegte sich Wittig mit dem Stuhl nach vorne und öffnete die Augen. Er blickte Petra Wolff an, als würde er sie jetzt zum ersten Mal wahrnehmen.
»Auch das ist möglich«, sagte er. »Um ehrlich zu sein: Ich befürchte, irgendwann findet ein Spaziergänger irgendwo in einem Waldstück um Berlin ihre Leiche. Dann hätten wir wenigstens einen Tatort. Wenn es ein Sexualdelikt war, wird es schwierig, sie zu finden. Wir durchleuchten im Augenblick alle einschlägig Vorbestraften, die für so eine Tat infrage kommen. Wir haben ihr Umfeld gecheckt: Kollegen, Nachbarn, den Verlobten, die Eltern und weitere Verwandtschaft. Wir haben dort kein Motiv für eine Straftat gefunden.«
»Sie gehen also von einem Sexualdelikt aus?«, fragte Dengler.
»Entweder davon«, sagte Wittig, »oder von einer ganz anderen Möglichkeit.«