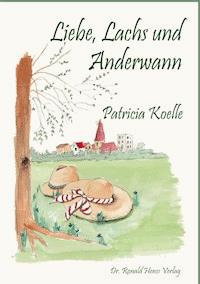8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Hoffnung und Licht: ein Winter auf Amrum Ein wunderschöner Roman zum Fest der SPIEGEL-Bestsellerautorin von »Das Meer in deinem Namen« und »Wenn die Wellen leuchten« Amrum, Heiligabend 1944. Kalt schlägt die Brandung an den Strand der Insel. Aber in Birkes Haus leuchtet ein Licht. Eng gedrängt sitzen die Bewohner um einen kleinen Weihnachtsbaum. Mit Brennstoff muss gespart werden, das Essen zum Fest ist äußerst karg. Während alle auf die Kerzen blicken, beginnt Birke zu erzählen: davon, wie im Herbst alles anfing. Als sie in den Dünen zwei Fremde traf, die von ihr jedoch keine Hilfe annehmen wollten. Eine Begegnung, die sie einfach nicht mehr loslässt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Patricia Koelle
Der Himmel zu unseren Füßen
Weihnachtsroman
Über dieses Buch
Heiligabend 1944. Auf Amrum herrscht ein eisiger Winter. Über die Insel fliegen die Jagdbomber hinweg. In Birkes Haus sitzen alle um einen behelfsmäßigen Weihnachtsbaum. Mit Brennstoff muss gespart werden, und das Essen ist ein wenig karg. Jeder fragt sich, wie die Zukunft aussieht. Keiner wagt auszusprechen, worauf sie alle am meisten hoffen. Ob es bald Frieden wird und ob Falk, Benedikts Vater, doch noch zurückkommen wird? Es ist, als ob alle Hoffnung davon abhängt. Was soll ohne ihn aus Benedikt werden? Um die Kinder und alle anderen aufzuheitern, sagt Birke, wenn die letzte Kerze abgebrannt ist, darf sich jeder insgeheim etwas wünschen. Das ginge dann in Erfüllung. Und danach werde sie allen eine Geschichte erzählen.
Während sie auf die Kerzen blicken, erinntert sich Birke zurück, wie im Herbst alles anfing… Als sie in den Dünen zwei Fremde traf, die von ihr jedoch keine Hilfe annehmen wollten. Eine Begegnung, die sie einfach nicht mehr loslässt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Amrum
1 Birkes Baum
2 Skeewacht Hüs
Föhr
3 Ein nasses Bewerbungsgespräch
4 Dr. Kilians Auftrag
5 Alte Musik
6 Zwei Wirklichkeiten
1944. Kapitel
7 Die Reisetasche
8 Schwarz auf weiß
9 Zerbrechliche Tage
10 Sommerhimbeeren
11 Der Dampfer Föhr–Amrum
12 Pinswins Spiel
13 Die Stimme im Wald
14 Frostige Beziehung
15 Eine wärmende Flamme
16 Jondris
17 Bis zum glücklichen Ende der Welt
18 Zuckerguss
Rezept für Marie Jäckischs Weihnachtsausstecher
19 Ein Los
20 Engel im Sturm
21 Überraschungen
22 Heiligabend
23 Der Weihnachtsstern
Danksagung
Für meinen Mann
Peter
und für alle, die in unseren Herzen und unserer Erinnerunglebendig bleiben
Amrum
Dezember 1944
1Birkes Baum
»Birke, der Leuchtturm sieht aus wie eine riesige Weihnachtskerze. Bloß die Farbe stimmt nicht. Er ist zu dunkel«, sagte Leni. »Das ist nicht fröhlich genug.«
Birke Rossmonith blickte hinunter in das Kindergesicht, das ebenso ernst war wie der Anstrich des Leuchtturms.
Dann sah sie über die Dünen hin zu ihrem alten Freund, dem Turm. Ja, sein finsteres Dunkelrot wirkte sehr streng vor dem Winterhimmel, aufrecht wie ein mahnend erhobener Zeigefinger. Doch das passte. Er hatte Grund genug zu mahnen. Sollten aber die Zeiten jemals besser werden, wäre es schön, wenn man ihn neu streichen würde, fand Birke. In einem warmen, hellen Rot wie Weihnachtskerzen. Heiter, wie Leni es sich wünschte, vielleicht mit weißen Ringen.
Dies war Lenis erstes Weihnachten auf Amrum. Ihr zuliebe würde Birke den Leuchtturm sogar eigenhändig streichen, wenn es nur möglich wäre, denn die neunjährige Leni hatte im Frühjahr ihre gesamte Familie verloren. Zum Glück war sie auf der Insel bei Birkes Tante untergekommen, die auch Lenis Patentante war.
Birke nahm Lenis kleine kalte Hand fest in ihre. »Dafür werden wir übermorgen fröhliche rote Kerzen auf unserem ganz besonderen Weihnachtsbaum haben«, sagte sie.
Denn auch in diesem Jahr würde es wider Erwarten einen Weihnachtsbaum bei Tante Ida geben. Birke konnte die Welt nicht ändern, aber der Welt einen Weihnachtsbaum abtrotzen, das musste möglich sein.
Sie hatte es jemandem fest versprochen.
Heute früh hatte Tante Ida beim Abwasch kopfschüttelnd einen Abschnitt aus der Zeitung vorgelesen:
Es war in diesem Jahre bekanntlich nicht möglich, die Bevölkerung unserer Insel ausreichend mit Weihnachtsbäumen zu versorgen. So bedauerlich es ist, dass dieses Symbol der deutschen Weihnacht in manchen Familien fehlt, so wenig kann es gebilligt werden, dass manche Volksgenossen zur Selbsthilfe schritten, auf gut Deutsch: einen Baum stahlen. Man kann den Heiligen Abend nicht unter einem gestohlenen Tannenbaum feiern! Das hätten die Leute, die aus dem Wald und anderswo sich Weihnachtsbäume besorgten, bedenken sollen. Unsere Vorväter hatten niemals richtige Tannenbäume und feierten dennoch Weihnachten, also sollten auch wir einmal darauf verzichten können, wenn es notwendig ist.
Föhrer Zeitung 1944, Amrumer Lokalblatt
Für Birke aber kam nicht in Frage, Weihnachten ohne einen Weihnachtsbaum zu feiern, ganz gleich, was ihre Vorväter gemacht hatten. Nicht, wenn hier so viele Menschen Trost und Hoffnung benötigten. Und außerdem war da das Versprechen, das sie gegeben hatte! Sie stellte die letzte Tasse in den Schrank und warf das Geschirrtuch hin. Dies war endlich etwas, das sie gegen ihr wachsendes Gefühl von Hilflosigkeit tun konnte.
»Hilfst du mir, Leni?«, fragte sie.
Zusammen liefen sie den halben Tag kreuz und quer durch den Wald und am Strand entlang. Sie suchten an Ästen zusammen, was sie finden konnten. Das war schwierig, weil es allen auf der Insel an Feuerholz mangelte. Birke jedoch dachte nicht daran, aufzugeben, und holte sich weitere Unterstützung. Wozu hatte sie eine Nichte und einen Neffen, die Zwillinge Pinswin und Filine? Sie waren genauso alt wie Leni, aber anders als Leni waren sie hier aufgewachsen und kannten alle Ecken.
Birke und Leni klingelten also bei Birkes Halbschwester Beeke Jessen, die ihnen die lebhaften Zwillinge nur allzu gern mit auf den Ausflug gab. Beide waren sofort mit Begeisterung dabei. Pinswin kletterte auf die Bäume und brach tote Zweige heraus. Außerdem kannten Filine und er sich im Watt aus wie niemand sonst und wussten, wo Treibholz angeschwemmt wurde.
So konnte Birke ihre Idee mit Hilfe der Kinder schließlich doch umsetzen.
»Wir machen es so ähnlich wie einen Kenkenbuum, nur viel größer natürlich«, hatte sie erklärt.
Bei dem üblichen Kenkenbuum, der woanders Friesenbaum genannt wurde, handelte es sich um ein kleines, baumähnliches Holzgestell, das, mit traditionellem Salzgebäck und einem Bogen aus Efeu oder anderem Grünzeug geschmückt, meist ins Fenster gestellt wurde. Wie ein Adventskranz trug er häufig auch Kerzen, die an den Adventssonntagen angezündet wurden. In diesem Jahr hatten sie die kostbaren Kerzen jedoch gespart. »Die heben wir für Weihnachten auf«, sagte Tante Ida.
Birke bohrte, hämmerte und flocht nun, bis sie am Ende des Tages aus dem gesammelten Holz ein Gestell geschaffen hatte, das einem Tannenbaum nicht nur ähnlich sah, sondern auch größer war als sie selbst. Dazu gehörte nicht viel. Doch das Werk überragte sogar Tante Ida.
Jetzt musste der kahle Baum nur noch grün werden.
Zu diesem Zweck nahm Birke Leni am nächsten Morgen mit zum Friedhof der Namenlosen. Auf den Gräbern der unbekannten Toten, die über die Jahre angeschwemmt und hier bestattet worden waren, standen die Holzkreuze ganz von Efeu überwachsen. Birke schnitt sie behutsam frei, so dass man die Daten darauf wieder lesen konnte. Die grünen Ranken nahm sie mit und ließ dafür eine der kostbaren Kerzen dort, die sie in einem Glas für die verlorenen Seelen anzündete.
In diesem Augenblick fing im Kirchturm von St. Clemens die Glocke an zu läuten. Birke lauschte beglückt, und auch Leni legte andächtig den Kopf schief.
Die Glocke hatte Birke in dieser verrückten, verzweifelten, hoffnungsvollen und merkwürdigen Zeit immer und immer wieder Trost und Kraft gegeben.
Schon früher, als Birke klein war, hatte sie die Glocke geliebt. Damals hatte sie diese »Inna« getauft. So hörte sich der Nachklang an, wenn die allerletzten Töne noch in der Luft lagen. Was eine Stimme hat, braucht einen Namen, fand Birke. Inna wurde ihr eine Freundin.
Dass Inna auch jetzt noch läuten konnte, da Birke ihren tröstlichen Klang so sehr brauchte wie nie zuvor, war ein Glücksfall. Denn Inna war jünger als das Jahrhundert, und die meisten dieser jungen Glocken waren zu Rüstungszwecken eingeschmolzen worden. Die Glocke von St. Clemens draußen auf der kleinen Insel in der Nordsee aber hatte man wohl vergessen.
Ein Graupelschauer hatte in der Nacht weiße Spuren auf den Dünen hinterlassen, in die der Wind Muster malte. Auf dem Sand sah das aus wie Marmorkuchen.
»Da ist Pinswin!«, sagte Leni und zeigte auf den Strand, wo drei ferne Figuren am Flutsaum spielten.
Pinswin hatte sie schon entdeckt und rannte zu ihnen hoch, gefolgt von Filine. Beeke ging ihnen gemächlich hinterher.
»Hallo, Birke! Was hast du im Rucksack?« Pinswin zeigte neugierig auf den ausgebeulten Sack.
»Du siehst damit aus wie der Weihnachtsmann«, fand Filine und spähte hinein.
»Das ist das Grün für unseren Baum«, erklärte Leni.
»Aber nur Efeu! Das ist doch langweilig. Ich weiß, wo Moos ist«, sagte Filine. »Und Heidekraut!«
»Und ich, wo ich Misteln vom Baum holen kann.« Auch Pinswin wollte etwas beisteuern.
»Hagebutten wären schön. Hallo, Birke.« Beeke umarmte ihre Schwester.
»Wunderbar. Immer her damit.« Birke freute sich. Die Kinder stoben eifrig in verschiedene Richtungen davon.
»Ihr feiert doch morgen Abend mit uns?«, fragte Birke. »Das ist jetzt unser aller Baum, da müsst ihr dabei sein.«
Beeke sah erleichtert aus. »Bist du sicher, dass Ida nichts dagegen hat?«
»Ida? Du kennst sie doch. Nichts würde sie mehr freuen.«
Und du freust dich auch, dachte Birke, als sie in Beekes müdes Gesicht sah. Beekes Mann war mit einem Holzbein aus dem Krieg gekommen, und nun war er wieder einberufen worden, im Lazarett mitzuhelfen. In der alten Pension, die Beeke führte, gab es in diesen Kriegszeiten keine Feriengäste mehr. Das zugige Haus war leer und kalt. Wie sollte da Weihnachtsstimmung aufkommen?
»Dann kommen wir sehr gerne«, sagte Beeke.
Gemeinsam banden sie die Efeuranken um die nackten Hölzer, zusammen mit all dem anderen Grün.
»Der ist viel schöner als ein ganz normaler Tannenbaum«, fand Filine. »So einen hat niemand außer uns.«
Tatsächlich sah der Baum durch den Wechsel von Efeu, Heide, Misteln, Hagebutten, Moos und Sanddorn sehr festlich und beinahe unverschämt fröhlich aus. Genau richtig, dachte Birke und stieg in den Keller, um die Kiste mit dem alten Weihnachtsschmuck heraufzuholen. Als die silbernen Pferdchen, die goldenen Kugeln und die Sterne aus Stroh an den ungewöhnlichen Zweigen hingen, war an diesem Notweihnachtsbaum wahrhaftig nichts mehr auszusetzen.
»Das werden doch noch richtige Weihnachten«, stellte Pinswin zufrieden fest.
Ida und Birke wechselten einen Blick.
Bis auf diejenigen, die nicht unter dem Baum sitzen werden, sagte dieser stumme Austausch.
Am vierundzwanzigsten Dezember wurde es kälter. Jedenfalls kam es Birke so vor. Am späten Nachmittag suchte sich der Wind einen Weg durch die alte Eichentür, in deren Holz die letzten hundert Jahre zahlreiche Sorgenfalten gerissen hatten. Auf dem Weg in die Stube nahm er den Frost mit, der die Straße mit Glätte überzogen hatte.
Birke zog die Schulterblätter hoch. Wo blieben die anderen nur? Vielleicht kam die Kälte daher, dass der Platz neben ihr so leer war.
Ein Wunder brauchen wir, dachte sie. Warum nicht jetzt, wie damals vor fast zweitausend Jahren?
2Skeewacht Hüs
Der Wind hatte sich sicherlich schon in vielen Weihnachtsnächten den Weg in das alte Haus im Kimangwai gebahnt. Doch Birke fragte sich, ob er dort schon jemals so viele Menschen vorgefunden hatte, die unter diesem Dach Zuflucht gesucht hatten.
Da Idas Mann, der Bauer Siegfried Prenderney, in den Krieg gemusst hatte, war Birke hier eingezogen, um Tante Ida zu unterstützen. Diese musste sich nun nicht nur allein um ihren Sohn Tede, den Hof und das Vieh kümmern, sondern dazu noch um Leni. Und der alte Opa Prenderney musste auch gepflegt werden.
Tede heckte selbst in diesen angstvollen Zeiten ständig Unsinn aus. Opa Prenderney nannte ihn einen Snootbalig, was so viel wie Rotzlöffel bedeutete. Aber Birke war dankbar, dass Tede das Lachen lebendig hielt, koste es, was es wolle, selbst dann, wenn alle anderen kaum noch wussten, wofür sie morgens aufstehen sollten. Tede war mit seinen fünfzehn nur sieben Jahre jünger als sie selbst, aber Birke fühlte sich neben ihm manchmal uralt. Das lag nicht nur daran, dass ihr rechtes Knie bei diesem Wetter noch immer bei jeder Bewegung schmerzte und sie an den vergangenen Sommer erinnerte, den sie zu gern aus ihrer Erinnerung gelöscht hätte.
Dann war da noch Emil. Emil war fast so alt wie Opa Prenderney. Jedenfalls nahm man das an. Woher Emil gekommen war, wusste niemand. Er war bei Ebbe von der Nachbarinsel Föhr herübergelaufen, aber keiner hatte ihn dort vermisst. Er konnte sich selbst nicht erinnern, woher er kam. Wer auch immer ihm die schlecht verheilte Wunde an seiner Stirn zugefügt hatte, mochte die Ursache dafür sein. Die Narbe sah aus wie ein Fragezeichen.
Der Krieg hatte ihn hier angespült wie so manches Treibgut, und weil man nicht wusste, wohin mit ihm, schlug Ida vor, dass er eine gute Gesellschaft für Opa Prenderney sein könnte. Der alte Hof hatte so viele Stuben, dass für den Emil auch noch eine übrig war. Je mehr Menschen auf dem Hof, desto besser, fand Ida. Zum einen fiel Leni dann weniger auf. Sie war jüdisch, und keiner durfte es wissen. Zum anderen half es gegen die schmerzliche Stille, die das Fehlen von Idas Siegfried hinterlassen hatte.
»Warum soll das Skeewacht Hüs nicht eine Art Arche Noah für uns alle sein?«, fragte Tante Ida, und nicht einmal Opa widersprach.
Das Skeewacht Hüs hieß so, weil über dem Tor eine Waage mit zwei herunterhängenden Schalen eingemeißelt war. Die Schalen hingen auf gleicher Höhe. In Öömrang, dem friesischen Dialekt der Insel, war Skeewacht das Wort für eine solche Waage. Für Tante Ida bedeutete das die Aufgabe, in das Leben aller Anwesenden trotz des Krieges so etwas wie ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn nicht hier, auf dem sturmerprobten Hof auf einer Insel im Wattenmeer, wo dann?
Ida fand, die vielen Menschen und Stimmen wirkten auch gegen die Angst und die Ungewissheit, die sich in diesem Jahr ausbreiteten wie Nebel im November.
Tante Ida hat recht, dachte Birke, es hilft. Sie lauschte auf die Kinderstimmen in der Küche.
»Filine, wenn du so viel Plätzchen isst, sind keine mehr für den bunten Teller übrig!«, hörte Birke Pinswins Stimme.
»Aber sie schmecken so gut, und ich habe Hunger«, verteidigte sich Filine.
»Leni möchte aber auch mal probieren«, widersprach Pinswin.
»Es sind genug Plätzchen für alle da. Ausnahmsweise. Deswegen haben wir sie ja für heute aufgehoben«, schritt Beeke ein.
Birke lächelte. Ihre ältere Halbschwester verlor nie die Ruhe. Sie selbst wurde immer ungeduldiger. Dabei ging es ihnen hier noch besser als den meisten Menschen. Sie hatten den Hof und dadurch wenigstens gerade genug zu essen für alle.
Der Wind schien genauso unruhig zu sein wie sie, denn er rüttelte nun am Fenster, das laut klapperte. Unwirsch riss Birke ein Stück aus der herumliegenden Zeitung, um es hinter den losen Fensterladen zu klemmen.
Nun, da für einen Augenblick Stille in der Stube lag, bevor sich bald alle um den Baum versammeln würden, stand Birke andächtig davor. Gleich würden die anderen hereinkommen, und dann war es Zeit, die kostbaren Kerzen anzuzünden.
Die Pendeluhr, die so alt war wie der Hof, tickte seelenruhig vor sich hin. Weder hatte der Erste Weltkrieg sie erschüttert noch der Zweite – bisher jedenfalls. Sie war der Herzschlag dieses Hauses und tat Birke wohl. Das Ticken bedeutete, dass etwas vorwärtsging, egal, was geschah. Die Uhr bewältigte die Augenblicke einen nach dem anderen, und Birke fand den Gedanken beruhigend, dass dieses Jahr nicht mehr viele Tage hatte.
Von nebenan drang das Radio aus Opa Prenderneys Zimmer, wo er mit Emil saß.
Diese sechste Kriegsweihnacht steht mehr als alle vorhergehenden unter dem Ernst des kriegerischen Geschehens, schnarrte die blecherne Stimme. Im Vordergrund aller Gedanken stehen die Ereignisse an den Fronten. In der Ruhe der Feiertage geht ein Strom von Segenswünschen zu unseren tapferen Soldaten, die in stürmischem Vorwärtsdringen oder in zäher Verteidigung ihre Aufgabe, die Heimat zu schützen, mit letzter Hingabe erfüllen. Am Heiligen Abend ist die Mehrzahl aller Volksgenossen um die Lautsprecher versammelt, um die von hohem Ernst erfüllten Worte zu hören, die Dr. Goebbels an die Nation richtet. In den Weihnachtstagen werden in vielen Familien Soldaten zu Gast sein. In den Werkstuben der Frauenschaft sind für die Kinder gefallener Kameraden Spielzeuge gefertigt worden, und manche anderen Beweise der Fürsorge, der Hilfsbereitschaft und der Kameradschaft zeugen davon, dass wir in dem Schicksalskampf, den wir austragen müssen, immer näher aneinanderrücken und immer mehr zu einer großen Familie werden. Auch die Alten wurden in diesem Jahr nicht vergessen. An fast hundert betagte Männer und Frauen, an Alleinstehende und durch den feindlichen Luftterror aus ihrer Heimat vertriebene Volksgenossen sind Einladungen ergangen. Im Festraum des Parteihauses finden sie sich unter dem Tannenbaum zusammen, wo es nicht an Kuchen und einer guten Zigarre fehlt. Musikalische und deklaratorische Darbietungen sorgen für die Unterhaltung. Der Ortsbeauftragte des Kriegs-Winterhilfswerkes begrüßte die Erschienenen in längerer Rede …
»Eine Zigarre von Goebbels. So weit kommt’s noch!« Opa Prenderney schnaubte verächtlich.
»Der Krieg ist bald zu Ende«, sagte Emil.
Er stellte seine Worte so fest in den Raum, als gäbe es keinerlei Zweifel daran.
»Woher willst du das wissen?«
Birke fror wieder. Opa Prenderneys Stimme hatte selten so hoffnungslos geklungen.
»Ich weiß es einfach.«
»Du weißt doch sonst nichts mehr.«
Emil war unerschütterlich. »Eben. Darum habe ich in meinem Kopf viel Platz für die Dinge, die ich eben doch weiß.«
»Das wäre schön«, sagte Opa Prenderney. »Ich möchte nicht, dass Tede auch noch eingezogen wird.«
»Tede wird leben!«, sagte Emil.
Das Ausrufezeichen hinter dieser Aussage stand so fest und aufrecht wie der Leuchtturm draußen in den Dünen.
Wenn das für Tede gilt, dann erst recht für Pinswin und die anderen, dachte Birke. Sie wollte Emil nur zu gerne glauben. Opa Prenderney aber würde nicht auf eine Zigarre verzichten müssen. Sie lag mit den anderen Geschenken unter dem Baum. Während eines Besuchs bei ihrer Mutter in Bremen hatte Birke schon vor längerer Zeit gründlich auf dem Schwarzmarkt eingekauft. Vor einigen Jahren war auf Amrum eine Kiste mit Rasierklingen angespült worden. Da die meisten Männer im Krieg waren oder Bart trugen, hatte man auf der Insel nicht allzu viel Verwendung dafür. Auf dem Schwarzmarkt hingegen erwiesen sie sich als erstaunlich einträglich.
Manche der Amrumer Männer allerdings gingen dazu über, sich ordentlich zu rasieren, da die Klingen nun einmal da waren und nichts gekostet hatten. Sie waren ein Hauch von Luxus in diesen Tagen. Außerdem, sagte Opa Prenderney, konnte es nicht schaden, wenn man dem Schicksal wenigstens frisch rasiert gegenübertrat.
Die Männer hatten es gut, dachte Birke. Sie wusste sich selbst keinen so einfachen Rat, wie sie sich gegen das Schicksal wappnen sollte.
Auf dem Schwarzmarkt war es Birke auch gelungen, zwei Kinderbücher zu ergattern, die nun in buntbemaltem Zeitungspapier verpackt mit den anderen Geschenken unter dem Baum warteten.
Kinder, denen man nicht nur die Eltern, sondern auch die Heimat genommen hatte, sollten wenigstens für kurze Zeit alles vergessen können, während sie ein Abenteuerbuch lasen.
Leni würde bei Ida immer ein Zuhause haben. Aber als Birke das zweite Buch einwickelte, hätte sie am liebsten eine ganze Zukunft mit eingepackt.
Schließlich hing von dieser Zukunft auch ihre eigene ab. Denn das, was Birke selbst sich so brennend wünschte, das konnte ihr niemand unter den Baum legen.
Behutsam rückte sie die Päckchen noch einmal zurecht, als die angelehnte Tür zum Flur aufflog. Mit der Ruhe war es jetzt vorbei. Stolz trug Filine mit beiden Händen den bunten Teller in die Stube.
»Lass ihn bloß nicht fallen!«, mahnte Pinswin. Erst als Filine den Teller sorgfältig auf dem Tisch abgestellt hatte, ließ er sie aus den Augen. »Leni, wo bleibst du denn?« Er sah sich um. Leni war auf dem Flur stehen geblieben und sah mit großen Augen in die Stube. Der hohe, ungewöhnliche Weihnachtsbaum mit den Päckchen darunter in der dunklen Bauernstube schien ihr Respekt einzuflößen. Pinswin nahm sie bei der Hand und zog sie sanft herein.
Vielleicht war es auch die Kälte, die Leni zögern ließ, und das lag nicht nur am Wind. Zwar brannte heute im Ofen ein ordentliches Feuer, das die Schatten tanzen ließ und die Seele wärmte, doch in letzter Zeit musste man damit sehr sparsam umgehen. In den alten Wänden hatte sich der Winter gründlich eingenistet.
Gleich würden die anderen mit neuem Feuerholz zurück sein, und dann konnte der Weihnachtsabend endlich beginnen. Birke sah zur Tür. War davor nicht ein Poltern zu hören? Ihr Blick fiel auf schlammige Fußabdrücke. Dabei hatte sie den Boden heute Morgen erst zur Feier des Tages blankgewischt.
»Wer von euch hat wieder nicht seine Schuhe saubergemacht?«, fragte sie mit gespielter Strenge. Eigentlich war sie in diesen Tagen froh über jedes Zeichen normalen Lebens, aber das mussten die Kleinen nicht wissen. Das Einzige, was man ihnen im Augenblick wirklich schenken konnte, war Erziehung.
Leni schüttelte stumm den Kopf.
»Ich war’s nicht«, sagte Pinswin. »Meine Füße sind schon viel größer.«
»Meine auch«, erklärte Filine. »Sogar noch größer.«
Natürlich. Birke starrte auf den kleinen Abdruck einer schmutzigen Sohle.
Bene.
Benedikt, das Kind, das sie vor einigen Wochen noch nicht einmal gekannt hatte. Und nun hing ihr eigenes Glück davon ab, wie Benes Leben weitergehen würde.
»Ist jetzt Bescherung, Birke?«, fragte Pinswin.
»Und können wir die Kerzen anzünden?«, wollte Filine wissen.
Beeke kam nun auch aus der Küche herein. »Gleich, Kinder. Ich hole noch den Opa und Emil. Wo bleiben die anderen, Birke?«
»Ich sehe mal nach.« Birke öffnete die Haustür einen Spalt und schlüpfte rasch hinaus, damit nicht noch mehr Kälte eindrang.
Draußen blinzelten Sterne zwischen mondsilbernen Wolken. Alle sieben Sekunden huschte der Lichtstrahl des Leuchtturms über die Insel und nahm der Dunkelheit das Gewicht.
Hinter dem Haus hörte sie Schritte in gefrorenen Pfützen knirschen und dann die helle Stimme Benes, der etwas rief. Sie dachte daran zurück, wie sie diese Stimme das erste Mal gehört hatte und was alles daraus folgte.
Während sie da unter dem Mond stand, begann die Kirchenglocke zu läuten. Der Wind trug den Klang heran wie Wellen. Mal schien er ganz nahe, dann wieder sanft wie aus weiter Ferne.
In dieser Weihnachtsnacht hörte sich Inna, wie sie die Glocke noch immer nannte, besonders schön an. Birke atmete tief ein, verlor sich in den Tönen und vergaß die Zeit. Sie vergaß sogar, dass sie auf die anderen wartete und die Kinder drinnen auf die karge Bescherung. Die schmerzliche Anspannung in ihr ließ nach.
Der klare Geruch nach Frost versetzte sie zurück in den letzten Winter, als Birke dachte, dass sie noch lange für Frau Dr. Kilian arbeiten würde, geborgen in deren chaotischem Dachzimmer und den Träumen, die Birke für sie festhielt.
Föhr
Mai 1943
3Ein nasses Bewerbungsgespräch
Die Arbeit bei Frau Dr. Kilian war eine der wenigen guten Ideen von Birkes Mutter gewesen.
Dabei hatte Birke nur widerwillig nachgegeben, als diese damals am Telefon weinerlich gebeten hatte, Birke solle wieder zu ihr nach Bremen kommen und bei ihr wohnen. Es war das Letzte, worauf Birke Lust hatte. Nur weil sich die meisten Männer an der Front befanden und ihre Mutter sich daher ausnahmsweise einsam fühlte, war das noch lange kein Grund, bei ihr einzuziehen!
Nach ihrem Notabitur war Birke zu ihrem Pflichtjahr beim Reichsarbeitsdienst einberufen worden. Das Jahr auf dem Bauernhof in Bayern lag nun hinter ihr. Es war schwere Arbeit gewesen, aber eine Arbeit, die sie mochte. Auch die Kameradschaft mit den anderen Mädchen und das abendliche Singen am Lagerfeuer hatten ihr gefallen. Doch jetzt wusste sie nicht, wohin mit sich. Sie hatte kein Geld für eine eigene Wohnung, wenn sie überhaupt eine gefunden hätte. Also beschloss sie, der Bitte ihrer Mutter doch erst einmal zu folgen. Sie würde Weihnachten mit ihr verbringen und dann herausfinden, wie es weitergehen sollte.
Zu ihrer Überraschung hatte ihre Mutter, die sich sonst um Birkes Leben wenig kümmerte, einen Vorschlag.
»Die Tochter von Leutnant Greski, ein ganz reizender Mensch übrigens, also die Gertrud, die lernt ab Januar Stenographie und Schreibmaschine. Da gibt es so eine Ausbildung. Da sind noch Plätze frei. Das wäre doch etwas für dich, etwas Vernünftiges.« Birke war verblüfft. Vernunft und Gisa Rossmonith passten erfahrungsgemäß nicht zusammen. »Wieso glaubst du das?«
»Na ja.« Ihre Mutter wich ihrem Blick aus. »Es könnte ja sein, dass wir diesen Krieg nicht gewinnen. Dann wäre es danach sicher gut für dich, wenn du so was kannst. In Englisch bist du ja auch so schlau. Vielleicht kannst du irgendwann dolmetschen oder dich sonst wie nützlich machen.« Ihr Tonfall war ungewohnt nüchtern. Birke wunderte sich. Als sie Gisa vor einem Jahr das letzte Mal gesehen hatte, war ihre Mutter noch voller Begeisterung für die Sache des Führers gewesen.
Nachdem sie länger darüber nachgedacht hatte, fand sie diesen Vorschlag tatsächlich vernünftig. Je eher sie Geld verdiente und aus dieser Wohnung herauskam, desto besser. Irgendwann würde Gisa wieder einen Mann kennenlernen. Und noch bevor das geschah, würden Birke und Gisa sich unweigerlich streiten.
Also meldete sie sich an.
Mit Gertrud Greski wurde sie nie richtig warm, aber immerhin halfen sie sich gegenseitig mit den Aufgaben und hielten sich bei der Stange, wenn ihnen der Kasernenton der Ausbilderin zu viel wurde. So gelang es beiden, die Lehre erfolgreich zu beenden.
Als Birke mit der Urkunde nach Hause kam, warf Gisa einen Blick darauf, nickte flüchtig und stellte Birke einen Mann in Uniform vor, der sich höflich vom Sofa erhob. »Das ist Rittmeister Winkelmann«, sagte Gisa stolz. »Er hat mich zum Tanz in den Mai eingeladen, stell dir vor.«
Erstaunlicherweise erwies sich der Rittmeister als nützlich, denn als Gisa am nächsten Vormittag nach der Tanzveranstaltung verschlafen auftauchte, reichte sie Birke eine Karte. »Ich habe Otto erzählt, was du alles kannst und dass du eine Verdienstmöglichkeit suchst. Er kennt eine Frau Dr. Kilian, die eine englischsprachige Sekretärin sucht. Sie wohnt allerdings auf Föhr. Ich habe ihm versprochen, dass du dich bei ihr melden wirst.«
Gisa wollte die Wohnung also wieder für sich allein haben. Sie war nun nicht mehr einsam. Doch Birke war der Vorschlag so willkommen, dass sie sich ausnahmsweise nicht darüber ärgerte, dass ihre Mutter in ihrem Namen irgendwelche Versprechen abgegeben hatte. Föhr! Etwas Besseres konnte ihr gar nicht passieren. Die Insel Föhr war nahe bei Amrum, wo ihre geliebte Tante Ida wohnte. Bei Tante Ida hatte sich Birke immer zu Hause gefühlt. Wenn sie diese Stelle nun bloß auch bekam!
Frau Dr. Kilian war eine imposante Erscheinung. Etwa sechzig, hochgewachsen und elegant, mit silbernen Haaren und warmen braunen Augen.
»Guten Tag, ich bin Birke Rossmonith. Ich sollte mich hier vorstellen.«
»Ich habe Sie erwartet. Es freut mich, dass Sie so pünktlich sind. Haben Sie einen Badeanzug da drin?« Frau Dr. Kilian wies auf Birkes Reisetasche.
»Äh – ja, schon.« Dies gehörte nicht zu den Fragen, auf die Birke sich vorbereitet hatte.
»Gut. Kommen Sie herein, Sie können sich dort umziehen. Wir gehen an den Strand.« Frau Dr. Kilian ließ sie in den engen Flur der Dachwohnung und wies auf eine kleine Tür, die wohl in das Badezimmer führte. »Oder ist Ihnen das Wasser noch zu kalt zum Schwimmen?«
»Das weiß ich nicht«, sagte Birke wahrheitsgemäß. Früher, ja, als sie zehn oder zwölf war und mit den anderen bei Tante Ida auf Amrum herumgetobt war, mit Gunne und Enno und Nadja und Line, da hatten sie sich auch manchmal im Mai schon in die kalten Wellen geworfen. Aber das war sehr lange her.
Frau Dr. Kilian lachte. Es war ein Lachen, bei dem Birke an Sommerwärme über reifen Kornfeldern denken musste. »Diese Antwort gefällt mir. Kommen Sie, lassen Sie es uns herausfinden.«
Der Strand war nicht weit. Es war ein ruhiger Tag mit einem launigen Frühlingswind, der die Wellen abwechselnd weckte und wieder einschlafen ließ. Die Flut war noch nicht auf dem Höhepunkt. Sie mussten ein ganzes Stück hineinwaten, bis das Wasser tief genug zum Schwimmen war. Birke hielt sich tapfer, bis die Kälte ihren Bauchnabel traf, dann entfuhr ihr ein kindliches Quietschen. Unentschlossen blieb sie stehen. Frau Dr. Kilian lächelte ihr zu und ließ sich ohne Zögern ins Wasser fallen.
»Zwölf Grad sind eine Herausforderung. Aber wenn Sie es nicht ausprobieren, werden Sie es nie wissen«, sagte sie.
Es gab kein Zurück. Birke schloss die Augen und warf sich in die Wellen, die um sie herum aufschäumten, als wollten sie sie auslachen. Erst blieb ihr die Luft weg. Das Wasser war so kalt, dass es auf ihrer Haut wie Feuer brannte. Dann prickelte ihr ganzer Körper. Birke stellte fest, dass sie wieder atmen konnte. Tatsächlich hatte sie nicht gewusst, dass so viel von der klaren, salzigen Luft in ihre Lungen passte. Auf einmal war ihr Atem weit wie der Himmel. Sie fühlte sich leicht. Die Nordsee schmeckte vertraut und geheimnisvoll zugleich auf ihrer Zunge, nach Kindheit, Tang, Sommer und Sorglosigkeit.
Birke schwamm auf den Horizont zu, mit glücklich ausholenden Bewegungen.
»Sehen Sie?«, sagte Frau Dr. Kilian neben ihr, die mühelos mithielt. »Die Kälte brennt alles Dunkle aus Ihnen heraus und macht Sie frei. Es ist, wie neu geboren zu werden, jedes Mal wieder. Jetzt müssten Sie Ihr Gesicht sehen können, es ist völlig anders als vorhin. Das wollte ich sehen. Und genauso müssen Sie es mit Ihrem Geist machen und Ihrer Phantasie. Geben Sie ihnen den Raum, den das Meer dafür bereithält. Und die Frische und die Bewegung.«
Über diese Worte würde Birke später nachdenken. Jetzt wollte sie nur immer weiterschwimmen. Lange hatte sie sich nicht mehr so gut gefühlt. Sie drehte sich auf den Rücken. Oben zogen weiche Federwolken über den Himmel, und darunter flog eine verspätete Formation von Wildgänsen nach Norden. Sie waren so exakt ausgerichtet, dass sie wie ein rätselhafter Buchstabe wirkten.
»Die Vögel setzen Zeichen«, sagte Frau Dr. Kilian, die nicht nur Birkes Blick gefolgt war, sondern merkwürdigerweise anscheinend auch ihren Gedanken. »Sie sagen, dass Ihnen etwas Gutes widerfahren wird, das Ihr ganzes Leben ändern kann. Und zwar dann, wenn die Vögel wieder zurückkehren.«
Birke war verwirrt. »Im Herbst?«
»Sicher nicht in diesem. Vielleicht im nächsten.«
Diese Frau Doktor war offensichtlich wunderlicher, als sie aussah. Anscheinend hielt sie sich für eine Hellseherin. Doch Birke wusste genau, dass sie unbedingt für diese Frau arbeiten wollte.
»Jetzt aber rasch zurück und raus aus dem Wasser, sonst wird es gefährlich«, mahnte Frau Dr. Kilian. »Can you tell me something about your life and why you speak English so well?«, fragte sie dann unvermittelt.
Als Birke sich dieses Bewerbungsgespräch vorgestellt hatte, hatte sie nicht damit gerechnet, dass sie es bis zum Hals im Wasser führen würde. Und nun sollte sie auch noch auf Englisch über ihr Leben erzählen und warum sie Englisch beherrschte! Nun gut. Sie wollte diese Stelle, also würde sie sich anstrengen.
Zu ihrer Überraschung stellte sie fest, dass es ihr unter diesen Umständen leichter fiel, als es auf einem unbequemen Stuhl in einem engen Raum gewesen wäre. Während das scharfe Prickeln langsam nachließ und sich in Wärme verwandelte, das Wasser sie zurück zum Strand trug und die Gischt weiße Muster auf die Oberfläche malte, kamen ihr immer mehr englische Worte wieder in den Sinn. Sie erzählte von ihrer Kindheit auf Amrum, die jäh zu Ende war, als ihr Vater Alrik Rossmonith starb. Birke war damals zehn Jahre alt gewesen.
Tante Ida hatte ihr einmal erzählt, wie Birkes Eltern sich kennengelernt hatten. Es war auf Idas Hochzeit mit Siegfried Prenderney gewesen. Natürlich hatte Ida ihre Schwester Gisa eingeladen. Aber sie hatte nicht damit gerechnet, dass Gisa sich ausgerechnet in den als schwierig bekannten Witwer Alrik verlieben würde, der auch noch viel älter war als sie.
Doch Gisa ließ nicht locker. Und nicht nur Ida war später überzeugt, dass Alrik Rossmonith der einzige Mann war, den Gisa jemals wirklich liebte. Zu jedermanns Überraschung funktionierte diese merkwürdige Ehe hervorragend, bis Alrik an einem Herzinfarkt starb.
Birke hatte keine sehr innige Beziehung zu ihrem Vater, der nicht viel mit Kindern anzufangen wusste. Und auch Gisa war nicht wirklich zur Mutter geboren. Doch es gab ja Tante Ida, auf deren Hof sich Birke am liebsten aufhielt und wo sie jederzeit willkommen war. Außerdem tobte sie ohnehin die meiste Zeit mit ihren Freunden durch die Wälder und die Heide, in den Dünen, am Strand und im Meer.
Gisa aber war ein Stadtmensch, und nach Alriks Beerdigung zog sie mit Birke nach Bremen. Alrik hatte gut vorgesorgt, so dass sie ein anständiges Auskommen hatten. Gisa verarbeitete ihre Trauer, indem sie fast jeden Abend tanzen ging. Birke blieb allein in der Wohnung und fürchtete sich. Bis sie den Mann aus der Nachbarwohnung kennenlernte: Alan Joyner.
Alan war ein Engländer, der schon länger in Bremen in einem Handelskontor arbeitete. Er war Mitte fünfzig und strahlte genau das Väterliche aus, das Birke nie kennengelernt hatte. Birke hatte gegen ihre Angst die Wohnungstür geöffnet und stand ratlos und unglücklich im Treppenhaus, als er ihr das erste Mal begegnete. »Du siehst so traurig aus, liebes Kind, verrätst du mir warum?«
»Ich bin so alleine.«
»Weißt du was? Ich auch. Wir könnten etwas zusammen spielen oder lesen, aber das geht natürlich nicht, weil du mich ja nicht kennst, nicht wahr?«
Birke nickte stumm. Das war eine der wenigen Regeln, die ihre Mutter ihr eingeschärft hatte: nicht mit Fremden zu reden oder gar mit ihnen in die Wohnung zu gehen.
»Aber das können wir ändern«, sagte der Fremde. »Wenn deine Mutter wieder da ist, werde ich mit ihr sprechen. Möchtest du das?«
Er hielt Wort, stellte sich bei Gisa vor und bot ihr an, abends manchmal auf Birke aufzupassen und ihr bei den Hausaufgaben zu helfen. Gisa war überaus dankbar für dieses Angebot und bedankte sich mit einem strahlenden Lächeln und ihrem gewohnheitsmäßigen Augenaufschlag, der Alan wenig zu interessieren schien.
Von da an gab es wieder Geborgenheit in Birkes Leben. Unter der gemütlichen Lampe an Alans wackeligem Wohnzimmertisch aß sie angebrannte Kartoffelpuffer mit Apfelmus, übte, Aufsätze zu schreiben, verlor die Angst vor Mathematikaufgaben, und – das Wichtigste – sie lernte Englisch. Denn Alan las ihr spannende Geschichten auf Englisch vor, Märchen, Sagen und Abenteuer, und oft auch wissenschaftliche Artikel aus einem reichbebilderten Magazin. Und er bestand darauf, dass sie sich in Englisch darüber unterhielten. So lernte Birke nicht nur Vokabeln, ohne es zu bemerken, sie lernte auch die Musik dieser Sprache zu lieben. Englisch wurde für sie die Sprache einer anderen aufregenden Welt, einer sagenhaften Welt, die es tatsächlich gab, die irgendwo da draußen Wirklichkeit war. Auf Englisch sprach sie schließlich mit Alan über ihre kleinen und großen Sorgen und über ihre Träume.
Zeitlebens würde ein Geruch nach Pfeifentabak, alten Büchern oder einem regenfeuchten Tweedjackett ihr Alan Joyners Gegenwart so deutlich heraufbeschwören, als säße er neben ihr und berühre gerade tröstend ihre Schulter.
Kurz vor ihrem Abitur bat Alan sie herein, und sie sah sofort in seinem Gesicht, dass jetzt etwas Trauriges kommen würde.
»Ich muss gehen, liebe Birke«, sagte er. »In diesem Land kann ich nicht mehr bleiben. Ich muss zurück in meines. Die Zeiten haben sich geändert. Doch du wirst etwas Gutes aus deinem Leben machen. Ich weiß es, und ich bin sehr stolz auf dich.«
»Wirst du wiederkommen?« Eigentlich war Birke viel zu alt, um zu weinen, aber vor Alan schämte sie sich nicht.