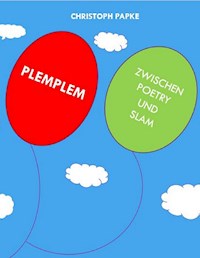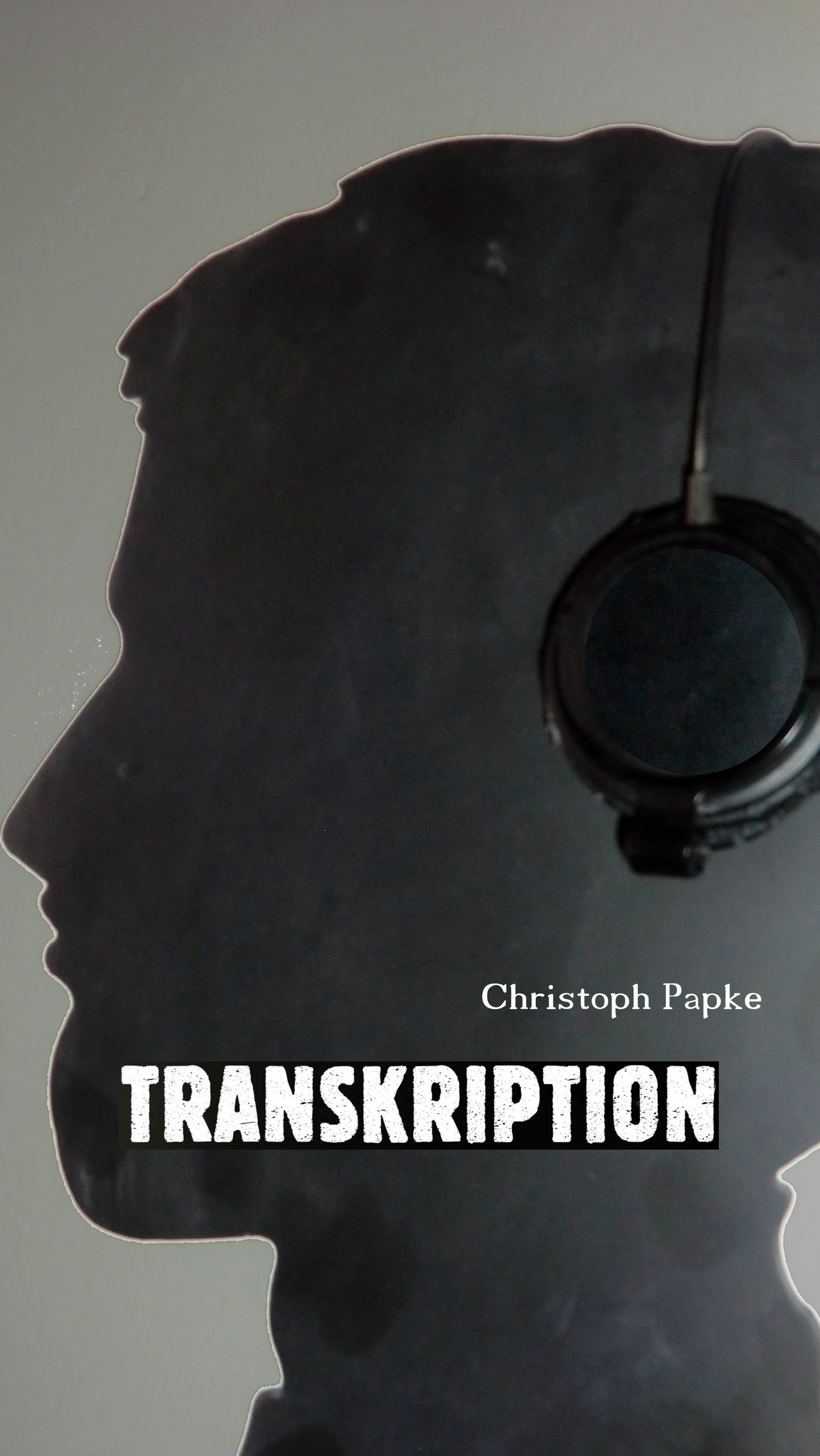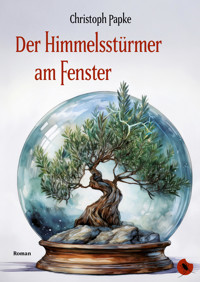
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Periplaneta
- Sprache: Deutsch
Nach einem Zusammenbruch wird der ausgebrannte Sozialarbeiter Martin Mann in die Psychiatrie eingeliefert. Dort trifft er auf den stummen Kurt Muleac, einen Dauerpatienten mit schwerer psychischer Diagnose. Doch der alte Herr beginnt plötzlich zu sprechen – ausgerechnet mit dem Neuankömmling. Kurt behauptet, ein außerirdisches Wesen zu sein, das seit Jahrtausenden im Dienste der Menschheit unterwegs sei.
Während die Ärzte vor Kurts Wahnvorstellungen warnen, erscheinen Martin dessen Geschichten und philosophischen Diskurse zunehmend plausibel. Zwischen Klinikalltag, Therapie und bizarren Enthüllungen gerät er in einen Strudel aus Wahrheit, Wahn und Wirklichkeit.
Ein faszinierender Roman über die fragilen Grenzen zwischen Krankheit und Erkenntnis – und über die Frage, ob unsere genormte Realität wirklich die einzige ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
periplaneta
Sicherheitshinweise: Lesen kann triggern, also an Dinge erinnern, die man vergessen hat und vielleicht gar nicht wissen will. Lesen bildet. Es kann die Sicht auf die Welt verändern, den Horizont erweitern und Dummheit, Einfalt und Leichtgläubigkeit stark beeinträchtigen.
CHRISTOPH PAPKE: „Der Himmelsstürmer am Fenster “
1. Auflage, Juli 2025, Periplaneta Berlin, Edition Periplaneta
© 2025 Periplaneta – Verlag und Medien
Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlin
periplaneta.com – [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Lektorat & Cover: Marion A. Müller
Satz & Layout: Thomas Manegold
Cover made with Adobe Firefly (AI)
Made in EU
print ISBN: 978-3-95996-302-2
epub ISBN: 978-3-95996-303-9
Christoph Papke
Der Himmelsstürmer am Fenster
Roman
periplaneta
Kapitel 1
Die meisten waren nett. Natürlich gibt es auch in der Psychiatrie Ärzte, Therapeuten, Pfleger und Patienten, die weniger angenehm sind – schließlich ist eine Nervenklinik ein ganz normaler Ort.
Ich erinnere mich nur noch schemenhaft an den ersten Tag meines Psychiatrieaufenthalts, oder nein, eigentlich war es spät am Abend, als ich ankam. Die Feuerwehr war so freundlich gewesen, mich einzuliefern. Ich hatte mit einer Rasierklinge in meine Haut geschnitten, in mein Fleisch, an den Armen und Beinen, links und rechts, mehrmals hintereinander. – Ob ich mir die Verletzungen zugefügt hatte, weil ich sterben wollte? Nein, glaube ich nicht. Ich wollte nur sehen … oder besser gesagt fühlen, ob ich noch lebe, ob ich mich selbst noch spüre … ob ich noch bin.
Die Feuerwehr hatte ich selbst gerufen. Zwar verspürte ich trotz der vielen Wunden überhaupt keinen Schmerz, aber das Blut … es floss in Strömen. Es rann Arme und Beine hinunter, tropfte auf meinen Teppich und bildete schnell eine Pfütze. Eigentlich war mir das alles egal, aber der übriggebliebene Rest meines Verstandes sagte mir: Blut gehört nicht auf den Teppich, das ist … irgendwie nicht in Ordnung.
Mit letzter Kraft hatte ich die 112 gewählt.
Der Aufnahmeraum in der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik ähnelte den mir gut bekannten Erste-Hilfe-Behandlungszimmern der vielen Krankenhäuser, die ich wegen vermeintlicher Herzinfarkte und lebensbedrohlicher Schwindelanfälle in den letzten vier, fünf Jahren aufgesucht hatte; ohne abschließenden Befund, mithin ergebnislos.
Ich schaute mich im Behandlungszimmer der KBoN, wie die Klinik im Fachjargon abgekürzt wurde, um. Vor einer der in neutralem Weiß gehaltenen Wände stand eine mit grünem Kunststoff bezogene Liege. An einer anderen hing eine laminierte Anweisung, wie man sich bei Gefahr oder Notfällen verhalten sollte, welche Notrufnummern gewählt werden mussten und welche Maßnahmen einzuleiten wären. Sie richtete sich nicht an die Patienten, sondern an das Personal. Hinten im Raum stand der ärztliche Schreibtisch, er hatte schon bessere Tage gesehen. Auf ihm, etwas seitlich gestellt, der zum Computer gehörende Monitor samt einer vergilbten Tastatur. Der abgewetzte, unbequeme Arztstuhl und der für den Patienten unterschieden sich nicht. Sichtbare Hierarchien sollten hier wohl deutlich vermieden werden. Hinter dem Schreibtisch und links neben der Tür standen Apothekenschränke mit etlichen Schubfächern, in einer Ecke zwei Ständer für Infusions-Tröpfe. Mattes Neonlicht strahlte aus einer alten Röhrenlampe von der Decke herunter.
Als der diensthabende Arzt mit geöffnetem weißen Kittel in das Aufnahmezimmer hereinrauschte, saß ich auf der Behandlungsliege. Man hatte mich vorher gebeten, in Unterwäsche dort Platz zu nehmen.
„Mein Name ist Müller“, stellte sich der etwa 45-jährige Herr Doktor Wichtig in forschem Ton vor, „ich bin heute Nacht der zuständige Aufnahmearzt.“ Auf seinem Schildchen am Revers stand unter seinem Namen Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
„Ja“, antwortete ich, weil mir nichts anderes einfiel.
Durch die Wand des Aufnahmeraums klangen die Schreie eines Mannes.
„Das ist normal“, sagte Doktor Müller, „kommt in jeder Schicht vor. Da ist gerade jemand mit der Polizei hergebracht worden.“
„Dann kümmern Sie sich doch lieber zunächst um den Schreihals“, schlug ich vor. Mir war sowieso alles ziemlich egal, ich hatte nichts weiter vor.
„Der kann warten“, entgegnete Doktor Wichtig beruhigend. „Sie waren zuerst da und bei uns geht normalerweise alles nach der Reihe.“
Normalerweise – ineiner psychiatrischen Klinik? Und: nach der Reihe?
„Außerdem“, fuhr Doktor Müller fort, „drückt sich unsere Wertschätzung gegenüber unseren Patienten auch dadurch aus, dass wir niemanden vorziehen und niemanden zurückstellen. Wir wollen doch alle gleichbehandeln.“ Dann schaute er auf sein Klemmbrett. „So, Sie sind also der Herr Mann. Martin Mann – richtig?“
Ich nickte.
Doktor Müller fuhr mit seiner Bestandsaufnahme in einem monotonen Singsang fort, während sein Blick weiter auf den Papierbogen des Klemmbretts blieb: „Sie haben sich Selbstverletzungen zugefügt … insgesamt 20 Schnitte in die Haut. Je vier am rechten und am linken Unterarm und jeweils sechs auf dem rechten und auf dem linken Oberschenkel.“
Das war korrekt. Doktor med. Müller entfernte den Wundverband und nahm die Schnitte in Augenschein.
„Gute Arbeit“, beurteilte der Psychiater die Arbeit meiner Retter. „Falls Sie sich dazu in der Lage fühlen, würde ich das Gespräch mit Ihnen gern am Schreibtisch fortführen. Dann kann ich alles gleich in den Computer eingeben.“
Ich zuckte mit den Achseln. „Wenn Sie wollen …“
Der Stuhl vor dem Arztschreibtisch war kalt.
„Geht’s?“, fragte der Arzt.
Es ging. In meiner Unterwäsche fror ich ein bisschen, aber was bedeutete denn schon Wärme oder Kälte? – Oder Hosen, Hemden, Pullover? Schuhe?
„Haben Sie irgendwelche Schmerzen? Tut Ihnen akut etwas weh?“
„Nein“, antwortete ich, „die Notfallleute haben mir eine Beruhigungsspritze und Schmerzmittel gegeben.“
„Stimmt“, sagte Doktor Müller, während er abwechselnd auf das Klemmbrett schaute und in den Computer schrieb. „Wie geht’s Ihnen jetzt?“
Tja, wie ging’s mir? – Scheiße, wenn ich ehrlich war. „Nicht gut“, antwortete ich.
„Können Sie das näher beschreiben?“
Wie sollte man nicht gut oder scheiße näher beschreiben? Ausgebrannt? Leer? Unendlich leer? Nutzlos? Überflüssig? Ich schaute Doktor Müller müde an und zuckte mit den Schultern.
Meine Antwort schien dem Mediziner wohl zu unergiebig. Seine linke Hand massierte nachdenklich das Kinn; er schien zu überlegen. „Hatten Sie schon mal Selbstmordgedanken? Oder hatten Sie heute Abend welche?“
Was für eine Frage?! Hatte nicht jeder schon mal den Gedanken, dass irgendetwas oder gar alles zu viel sei? Und wie es wäre, einfach alles hinzuwerfen, aus dem Leben zu scheiden und endlich wieder Ruhe zu haben? „Gute Frage“, antwortete ich nachdenklich.
Meine Antwort schien dem Aufnahmearzt diesmal wohl ausreichend. „Ich lese, Sie sind Sozialarbeiter von Beruf. Wo arbeiten Sie, was machen Sie?“
Ich hatte nicht die geringste Lust, über meinen Beruf zu reden. Warum auch?! Schon seit Jahren verspürte ich kein Bedürfnis mehr, über meine „wichtige“ Arbeit im Jugendamt zu sprechen, oder, wie ganz am Anfang meiner Berufstätigkeit, voller Enthusiasmus über meine interessantesten Fälle zu berichten. Was hatte mir die Arbeit denn gebracht? Im Endeffekt nichts als puren Ärger. Sie hatte mich meine Ehe gekostet und dafür gesorgt, dass sie kinderlos blieb. Jahrelang war ich nur für andere da gewesen, kümmerte mich um sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und im Leben zu kurz gekommene, vernachlässigte und verwahrloste Familien. Tagein, tagaus, morgens, mittags, abends und wenn es nicht anders ging, auch nachts. Wie oft hatte mich meine Ex vor unserer Scheidung um ein klein wenig mehr Zeit für sie, für uns gebeten? Stattdessen war ich schleichend und weitestgehend unbemerkt in eine sich selbstverliebt verleugnende Mühle aus Helfersyndrom, Pflichterfüllung und falsch verstandener Empathie für die Bedürfnisse meiner Klientel hineingerutscht. Obgleich mich meine Frau irgendwann vor die Wahl gestellt hatte: sie oder wenigstens die Reduzierung meiner Arbeitsstunden, nahm ich so gut wie täglich weiter für meine Klienten an abendlichen Besprechungen in den Wohnungen teil, an Elternversammlungen im Kindergarten oder in der Schule, an grundsätzlich nach 18 Uhr angesetzten Mieterversammlungen oder an unaufschiebbaren Krisensitzungen, die meist bis tief in die Nacht dauerten oder da erst begannen.
„Ich arbeite im Regionalen Sozialpädagogischen Dienst des Jugendamtes Reinickendorf, bin aber seit drei Monaten krankgeschrieben.“ Das sollte als Antwort vorläufig genügen, schließlich war ich zu müde, zu ausgelaugt und zu fertig und nicht in der Stimmung. „Hören Sie, ich bin müde, können Sie mir nicht irgendein Bett anbieten, in dem ich mich einfach erst einmal ausschlafen kann?“
Doktor Müller schaute mich kurz an. „Genau das wollte ich Sie auch fragen. Wären Sie damit einverstanden, heute Nacht bei uns zu bleiben? Morgen können wir dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht.“ Er machte eine kleine Pause. „Es scheint mir nicht hinreichend begründet, Sie wegen einer akuten Suizidgefährdung hierzubehalten. Ich würde das aber gern morgen früh noch einmal mit meinen Kolleginnen und Kollegen besprechen … und anschließend mit Ihnen abstimmen, wie es weitergeht.“ Während er sprach, tippte er das Gesagte in meine Patientenakte. „Nur eine Frage noch: Mit welcher Diagnose sind Sie zurzeit krankgeschrieben?“
„Keine Ahnung“, murmelte ich. „Vielleicht Burnout?“
Tatsächlich hatte der Arzt, den ich seinerzeit auf Empfehlung eines Kollegen aufgesucht hatte, so etwas gemurmelt wie: Ich nehme Sie erstmal aus der Schusslinie, nachdem ich über meine andauernde Überarbeitung und die permanente Überforderung geklagt hatte. Die Diagnose interessierte mich nicht. Hauptsache, zu Hause bleiben können, dachte ich damals.
„Gut“, sagte der Psychiater, „wir verbinden Sie gleich wieder, messen noch mal Ihren Blutdruck, legen vorsorglich einen Venenzugang und bringen Sie auf die Station 5, da haben wir noch freie Betten.“
„Station 5?“
„Ja, das ist eine von drei Stationen der Allgemeinpsychiatrie.“
„Guten Morgen!“, riss mich eine gereizte Stimme aus dem Schlaf. Sie gehörte einer rundlichen, dunkelhaarigen Frau um die Fünfzig. Ich schaute auf meine Uhr, es war kurz vor sechs. Zwei böse Augen schauten mich an.
„Also, ich komme jetzt noch mal rein. Dann will ich gefälligst ein freundliches Guten Morgen hören, verstanden?!“ Kaum hatte sie ihre Anweisung formuliert, verließ die Frau wieder das Zimmer, schloss die Tür hinter sich, um sie erneut zu öffnen.
„Guten Morgen“, fauchte sie und stellte sich mit drohender Miene vor mein Bett.
Ich fragte mich, was das Ganze sollte. Meine erste Nacht in der Nervenklinik war zu kurz für solcherlei Scherze. Die notwendigen Untersuchungen hatten bis 2 Uhr gedauert, es waren also gerade mal vier knappe Stunden vergangen. Das Pöbelmonster vor mir trug weiße Kluft und hielt in der einen Hand einen Eimer, in der anderen einen Wischmopp. Ich rang mir ein „Guten Morgen“ ab und wunderte mich, dass die Frau zwar mich anfauchte, nicht aber meinen Zimmergenossen, der noch immer mit dem Gesicht zu Wand schlief.
„Beim nächsten Mal freundlicher!“, giftete die Zicke. Schwungvoll führte sie den Mopp unter den Tisch am Fenster, riss die zwei Stühle zur Seite, die am Tisch standen, fuhr danach unter die beiden Betten im Zimmer, wischte an den zwei Einbauschränken vorbei, umkreiste anschließend die beiden an den Kopfenden der Krankenbetten stehenden Nachttische und zog endlich mit dem Mopp Schlangenlinien bis zur Tür unseres Zimmers.
„Was gibts da zu gucken?!“, echauffierte sie sich. „Bin ich Kino?“
Ich glotzte trotzdem weiter. Sollte sie nur meckern, es kratzte mich nicht die Bohne.
„Passen Sie ja auf!“, waren die letzten Worte, bevor sie endlich verschwand.
Ein Blick durch das Zimmer verriet mir, dass ich mich ganz im Gegenteil zu landläufigen Vorstellungen von Klapsmühlen in einem stinknormalen Krankenhaus befand. Keine Gitter an den Fenstern, keine Riemen oder Gurte zum Festschnallen am Bett, keine Kameras, die uns überwachten, keine Scheiben in der Zimmertür oder in der Wand, um uns zu beobachten.
Jetzt war ich also da. Angekommen in einer stationären psychiatrischen Einrichtung. Was nun, was jetzt? Ich versuchte zu ergründen, wie ich mich fühlte. Die starken Schmerz- und Beruhigungsmittel hatten offensichtlich ihre Wirkung wunschgemäß entfaltet. Wunschgemäß? Aus wessen Sicht, fragte ich mich. Aus meiner oder aus Sicht meiner Helfer und Retter? Oder aus beider Sicht? Wer war ich? Fühlte ich mich gut oder schlecht? Besser als gestern Abend? Ich zuckte mit den Achseln. Vermutlich ja.
Ich schaute zu meinem Bettnachbarn hinüber. Schlief er noch oder war er wach? Jedenfalls zeigte er mir immer noch nicht mehr als seine Rückseite. Ich hielt kurz den Atem an, um zu lauschen, ob er schnarchte oder wenigstens etwas lauter atmete. Nichts dergleichen. War der Mann etwa tot?!
Während ich weiter vor mich hin und auf das gegenüberliegende Bett starrte, öffnete sich die Tür. Herein kam ein gutgelaunter Mann. Er trat an mein Bett, öffnete die oberste Schublade meines Nachttisches, zog ein in Folie eingeschweißtes Informationsblatt heraus und reichte mir die Hand.
„Ich bin Robert und hier die leitende Pflegefachkraft. Und Sie sind der Herr Mann. Guten Tag und herzlich willkommen!“
Ich nickte und überlegte, ob ich Robert darüber informieren sollte, dass mein Bettnachbar kein Lebenszeichen von sich gab. Aber, was ging es mich an.
„Hier stehen die wichtigsten Informationen zum Tagesablauf drauf“, reichte Robert mir die Folie. „Wann gefrühstückt wird, wann es Mittagsessen gibt und Abendbrot, wann die Tabletten ausgeteilt werden … welche Therapien es gibt und wann und wo sie stattfinden.“ Dann wies er mit dem Finger auf eine Zeile. „Sehen Sie, 7 Uhr morgens Frühstück. Sie können das Frühstück hier im Zimmer einnehmen oder im Gruppenraum, ganz wie Sie wünschen.“
Ich wünschte gar nichts, verspürte keinen Hunger, brauchte kein Frühstück. „Muss ich mich jetzt entscheiden?“, fragte ich matt.
Robert ging kurz in die Nasszelle, die zu dem Krankenzimmer gehörte, und kam mit einem Blutdruckmessgerät zurück. „Nein, müssen Sie nicht. Vielleicht nehmen Sie Ihr erstes Frühstück erstmal in Ihrem Zimmer ein und besprechen das Weitere mit dem Doktor.“ Dann legte er mir fachgerecht die Blutdruckmanschette an. „Ich messe jetzt Ihren Blutdruck.“ Während er die Manschette aufpumpte, fiel sein Blick auf meinen Venenzugang. „Sprechen Sie nachher mal mit Doktor Clausewitz, ob der Schmetterling tatsächlich noch benötigt wird oder raus kann!“
„Schmetterling?“, fragte ich.
„Ja, die Flügelkanüle hier an Ihrem Unterarm. Die behindert doch nur, wenn sie nicht gebraucht wird … wenn Sie keine intravenös verabreichten Medikamente benötigen.“
Normalerweise hätte ich gefragt, wann und wo denn genau dieses Gespräch mit diesem Doktor Clausewitz stattfinden sollte und was der Zweck jener Unterhaltung sein würde, aber ich verspürte so früh am Morgen und dazu noch völlig unausgeschlafen kein Interesse für derlei Einzelheiten. Folglich ließ ich Robert seine Arbeit an meinem Blutdruck, die er mit „Alles okay“ quittierte, beenden und ihn auch noch das kleine, Pulsoximeter genannte Gerät zum Messen meines Pulses und Sauerstoffs auf den Zeigefinger meiner rechten Hand schieben.
„96 Prozent Sauerstoff, 68er Puls, alles im grünen Bereich“, zählte Robert laut für mich und für ihn auf. „So, brauchen Sie noch etwas? Kann ich noch etwas für Sie tun? Haben Sie noch Fragen?“
„Nein“, schüttelte ich den Kopf. Ich hatte den letzten Abend und die Nacht überlebt. Wozu das gut war, wusste ich zwar nicht, die gestrig erlebte Leere jedoch war – wahrscheinlich den mir verabreichten Medikamenten geschuldet – einer etwas erträglicheren Leck-mich-am-Arsch-Stimmung gewichen.
„Gut“, sagte Robert, „dann schaue ich mir kurz noch mal Ihre Wunden an und gehe dann zu Ihrem Mitbewohner, Herrn Überall.“ Ein Blick auf meine Pflaster und Verbände reichte. „Alles okay, soweit sieht alles gut aus.“
Dann begab er sich zu meinem Zimmergenossen. Am Bett angekommen, schaukelte der Pfleger vorsichtig die Schultern des Vielleicht-Toten. „Guten Morgen, Raimund! Ich bin’s, Robert. Langsam aufwachen, gleich gibt’s Frühstück!“
Eine sich allmählich streckende Bewegung und tiefes Ausatmen verrieten, dass mein vielleicht toter Bettnachbar aus seinem Tiefschlaf erwachte.
Wir speisten beide am Tisch unseres gemeinsamen Zimmers. Schweigend. Mein Bettnachbar schien sich ebenso wenig für mich zu interessieren wie ich mich für ihn. Immer noch müde sah ich gleichgültig seinem Treiben zu, zwei kleine Spielzeugautos hin und her zu schieben, während er aß und trank. Es schien im wichtig, die gleiche Zeit zum Bewegen der Autos aufzuwenden wie zum Essen. Irgendein scheiß Ritual, dachte ich – und aß stumm weiter.
„Guten Morgen, mein Name ist Clausewitz, ich bin der verantwortliche Arzt dieser Station! Wie geht’s Ihnen heute Morgen, Herr Mann?“
Ich fixierte mein Gegenüber mit den Augen. Ein Mann im Pullover und ohne weißen Kittel hatte mich in seinem Sprechzimmer begrüßt. Ein kleines Schild über seiner rechten Brust ließ erkennen, dass er der Stationsarzt der Station 5 war. Vor mir stand ein ganz normaler Typ zwischen 35 und 40 – ein Typ, der auch Angestellter in einem Start-up-Unternehmen hätte sein können oder Verkaufsberater in einem hippen Küchenstudio.
„So lala“, antwortete ich. Und das stimmte. Es ging mir nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es ging mir eben … keine Ahnung.
„Setzen Sie sich doch“, bot mir der Arzt an.
Ich nahm vor seinem Schreibtisch Platz und sah zu, wie er sich schwungvoll und dynamisch in seinen Bürostuhl gleiten ließ.
Er schaute auf seinen Monitor. „So. Sie sind gestern Abend mit dem Rettungsdienst zu uns gekommen … weil Sie sich geritzt haben. Zwanzig Schnitte, gerecht verteilt auf Arme und Beine …“ Doktor Clausewitz blickte vom Bildschirm weg und mich an. „Mein Kollege vom Nachtdienst hat Ihren Fall heute Morgen in der Übergabe vorgestellt und erläutert. Es scheint noch nicht klar, welche Ursachen sich hinter Ihren selbstverletzenden Handlungen verbergen. Herr Doktor Müller schwankte noch – und in aller Vorsicht – zwischen den Verdachtsdiagnosen Depression und Schizophrenie, wobei ich persönlich überhaupt keine validen Anhaltspunkte für eine Schizophrenie sehe. Ich wüsste nicht, was an Ihrem Verhalten schizo sein sollte.“
Ich zuckte die Achseln.
„Um es kurz zu machen“, fuhr der Arzt fort, „hätte ich nichts dagegen, wenn Sie heute wieder die Klinik verlassen würden. Ihre Wunden sind gut versorgt und nicht lebensbedrohlich, Ihr Hausarzt könnte die weitere Wundversorgung übernehmen. Sie sind ja aktuell krankgeschrieben, wissen Sie zufällig, mit welcher Diagnose?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir uns bei Ihrem behandelnden Arzt erkundigten, Ihr Einverständnis natürlich vorausgesetzt?“
Ich zuckte mit den Achseln. „Von mir aus.“
Doktor Clausewitz schaute mich freundlich an. „Eine akute Suizidgefahr kann ich nicht erkennen, ebenfalls keine Fremdgefährdung. – Wir könnten uns also jetzt die Hand reichen und uns voneinander verabschieden. Wenn Sie aber meinen ärztlichen Rat wünschten, würde ich Ihnen raten, noch zu bleiben. Um sich auszuruhen, sich zu erholen und um gründlich abklären zu lassen, warum es Ihnen so schlecht ging oder geht.“ Der Arzt schien eine Antwort zu erwarten.
„Ich weiß nicht … wenn Sie meinen …“
„Bekommen Sie bitte keinen Schreck. Ich würde dann als vorläufige Diagnose“, fuhr der Psychiater fort, „um Ihren Aufenthalt gegenüber Ihrer Krankenkasse zu begründen, eine schwere Depression angeben. Nur die schweren Depressionen im Sinne einer akuten, hochgradig affektiven Störung rechtfertigen einen Klinikaufenthalt. Verstehen Sie, was ich meine?“
Ich verstand. Entweder zurück nach Hause … in die Öde meiner Wohnung, in den tristen Alltag, in mein scheiß Leben – oder mit einer schwerwiegenden Diagnose in der Klinik bleiben.
„Na gut, dann bleibe ich“, hörte ich mich sagen. „Was ist mit dem Schmetterling oder wie das Ding heißt?“, wies ich auf den Venenkatheter.
„Kann raus. Robert wird sich gleich nach unserem Gespräch darum kümmern“, antwortete Doktor Clausewitz. „Lassen Sie uns noch klären, wie es vorläufig weitergeht. Unser Informationsblatt wurde Ihnen ausgehändigt?“
„Ja.“
„Also, wir haben einen festen Tagesplan: Um 9 Uhr morgens treffen sich alle Patienten Ihrer Station zur Tagesbesprechung im Gruppenraum. In dieser Sitzung werden Probleme besprochen, anstehende Aktivitäten und so weiter. Von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr haben Sie dann entweder Einzel- oder Gruppentherapie respektive ganz nach Ihren Wünschen Sport- oder Ergo- oder Musiktherapie, danach Pause. Um 12 Uhr gibt es dann Mittagessen und um 13 Uhr geht es weiter. Sie können aus der Vielzahl der therapeutischen Angebote selbst wählen, welche Ihnen am besten passen. Um 15.30 Uhr trifft sich Ihre Gruppe noch einmal zur Reflexion. Anschließend steht Ihnen die restliche Zeit zur freien Verfügung. Um 18 Uhr ist Abendessen und danach wieder Freizeit. Sie sehen, wir legen Wert auf einen strukturierten Tagesablauf. Nicht etwa, weil es unsere Arbeit erleichtert, sondern vielmehr, weil ein strukturierter Ablauf allen Patienten im Therapieverlauf äußerst dienlich ist. Das ist eine mittlerweile gesicherte Erkenntnis in der psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung. Ich rate Ihnen zudem, sich nicht zu isolieren. Am besten, Sie gehen in den Gruppenraum, sobald sie sich dazu befähigt fühlen. Soziale Kontakte sind gut für Depressive.“
„Und wie oft sehen wir uns?“, fragte ich den Arzt, den ich nicht unsympathisch fand.
„Im regelmäßigen Behandlungssetting zweimal pro Woche, ansonsten immer, wenn Sie etwas Dringendes auf dem Herzen haben. “
Ich bleib also. Immerhin brauchte ich mich hier nicht um den täglichen Einkauf zu kümmern, um die Wäsche, das Putzen oder die Zubereitung meines Essens – Tätigkeiten, die mir in der vergangenen Zeit immer schwerer gefallen waren, die ich ehrlicherweise seit Wochen nicht mehr zu erledigen in der Lage war. Abgesehen davon bewahrte mich der Krankenhausaufenthalt auch vor meinen Arbeitspflichten im Amt. Sollten sie sich dort doch das Maul zerreißen über mich, den Kollegen Mann, den Oberinspektor des Jugendamtes, der in der Klapper gelandet war, in der Klapse oder – wie die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik von den Berlinern genannt wurde – in Bonnies Ranch.
Doktor Clausewitz’ Rat folgend, schaute ich versuchsweise im Gruppenraum vorbei.
Der Gruppenraum war ziemlich groß, vielleicht 20 Meter lang, dazu erstaunlich breit. An den Wänden und Fenstern, teilweise auch in der Mitte standen Tische, an denen Menschen zu zweit oder in Gruppen saßen und quatschten. Andere standen oder liefen scheinbar ziellos umher. An der Stirnseite des Raums war ein Stuhlkreis zu erkennen, daneben eine zweite, ebenfalls weit geöffnete Tür. Außer meinem Zimmergenossen, der auf dem Fußboden saß und ohne Unterlass zwei kleine Spielzeuglaster hin und her schob, befanden sich wohl an die 20 weitere Personen im Käfig – wie der Gruppenraum auf Station genannt wurde. DerKäfig war sozusagen theplace to be dieser kleinen Welt, der Marktplatz, der Ort allen öffentlichen Geschehens, das Klatschzentrum und gleichzeitig der ultimative Treffpunkt für alle möglichen Verabredungen und Aktivitäten.
Endlich sah ich auch den Schreihals. Er lag in einem hereingeschobenen Krankenbett mit Gittern an den Seiten, hatte sich offensichtlich sein „Engelhemdchen“ vom Leibe gerissen, da es zusammengeknüllt auf der Matratze ruhte, und schrie vollends nackt in Minutenabständen aus ganzem Hals: „Heil Hitler!“ Obgleich das Geschrei so ähnlich klang, als würde jedes Mal ein Schwein abgestochen werden, störte sich niemand daran. Ich auch nicht. Es war mir wie alles egal.
Weiter hinten entdeckte ich auch meine morgendliche Peinigerin. Sie putze die Tische mit einem nassen Tuch, das sie zwischendurch immer wieder in einen Eimer tunkte und auswrang, während sie dabei kräftig vor sich hin fluchte.
Was sollte ich hier?! Was brachten mir diese Menschen? Welche therapeutische Wirkung sollte von ihnen auf mich ausstrahlen? Etwa ihr Gebrabbel? Ihr kindliches Spiel mit kleinen Autos auf dem Fußboden? Ihre Schwatzereien? Diese Leute störte ja noch nicht einmal ein nackter Mann, der „Heil Hitler!“ schrie. Warum wurde der Schreihals eigentlich nicht heiser? Und warum griffen die drei anwesenden Pfleger nicht ein? Vielleicht waren sie so abgestumpft wie ich. Einfach abgegessen vom öden Arbeitsalltag. Irgendwann hört man das Leid anderer Menschen eben nicht mehr. Nimmt es einfach nicht mehr wahr. Zum Kotzen. Hatten sich die Pfleger Ohrstöpsel in ihre Gehörgänge gestopft?
Soziale Kontakte sind gut für Depressive, hatte ich die Worte des Stationsarztes noch im Gedächtnis. Soziale Kontakte … schöner Witz für einen Sozialarbeiter, der wegen seiner überbordenden Kontaktdichte so gut wie alles verloren hatte – seine Frau, einen erheblichen Teil seines Freundeskreises, seine Unbekümmertheit, seine Arbeitsfreude, überhaupt seine Freude am Leben.
So stand ich also neben der Tür … wie bestellt und nicht abgeholt. Hätte mich nicht irgendeiner der Pfleger am Eingang abholen und den anderen vorstellen können? Na ja, is’ eben so, dachte ich mir. Die Pfleger machen eben auch nur ihren Job und versuchen, so gut wie möglich über die Runden zu kommen. Warum auch sollten sie jedes neue Gesicht dem versammelten Patientenkollegium vorstellen? Eine Klinik ist wie ein Hotel, dachte ich weiter, da herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Würden Hotelangestellte jeden neuen Gast vorstellen? Und wer war ich schon, um anderen vorgestellt zu werden?
Der Nackte schrie wieder. Wie am Spieß. An sich war der Zeitpunkt gekommen, das Experiment abzubrechen und sich zurück ins Zimmer zu begeben. Dort stand mein Bett. Ich hätte mich hineinlegen, die Decke über den Kopf ziehen und schlafen können, einfach schlafen.
Gerade wollte ich mich umdrehen und gehen, als ein letzter Blick durch den Aufenthaltsraum auf das Profil eines Manns fiel, der mit seinem Stuhl allein am Fenster saß und gedankenversunken hinaus starrte. Klein von Wuchs, etwa Anfang bis Mitte 70 und mit Halbglatze, schien der Mann sich keine Bohne für das Geschehen um ihn herum zu interessieren. Die kleinen, runden Augen des einsamen Fensterguckers gehörten zu einem pausbackigen, gut durchbluteten Gesicht. Die hellbraune, abgetragene Cordhose und ein alter Pullover, aus dem ein abgewetzter karierter Hemdkragen herauslugte, weckten im mir Assoziationen zu einem Lehrer, der noch immer die gleiche Kluft trug, wie damals, als er noch regelmäßig zur Arbeit ging und irgendwann daran verzweifeln musste, dass Kinder anderes im Kopf haben, als stundenlang frontal konditioniert zu werden.
War ich nun einmal da, konnte ich auch den Mann ansprechen, und sei es nur, um Herrn Doktor Clausewitz von meiner Mitwirkungsbereitschaft berichten zu können.
Als Sozialarbeiter war ich gewohnt, andere anzusprechen und das Eis zu brechen. Fremden, schwierigen, verschlossenen oder auch aggressiven und im Verhalten unkontrollierten Menschen sollten wir vorurteilsfrei entgegentreten – und uns immer wieder selbst dabei beobachten.
„Wie lautet Ihre Diagnose?“, begann ich mit geheuchelter Neugier das Gespräch und kam mir vor wie in einem psychodramatisierten Rollenspiel.
Der Befragte wandte langsam seinen Blick weg vom Fenster und mir zu. „Falsche Frage“, antwortete er, bevor er sich wieder umdrehte und mich keines weiteren Blickes würdigte.
Okay, dachte ich mir, damit wäre Doktor Clausewitz’ Auftrag erfüllt. Ich wendete mich ebenfalls ab und ging in mein Zimmer. Ich musste schlafen.
Um 18 Uhr raffte ich mich zum Abendessen auf. Ich verspürte einfach keine Lust mehr, meinem Mitbewohner beim monotonen Schieben kleiner Autos auf unserem gemeinsamen Tisch zuzusehen.
Kaum im Käfig angekommen, hielt ich unwillkürlich Ausschau nach dem kleinen, untersetzen Mann vom Fenster. War das die Neugier eines enttäuschten Neupatienten, dessen erster unschuldiger Versuch der vorsichtigen Kontaktaufnahme fehlgeschlagen war? Oder war es gar meine Faszination für einen so selbstverständlich rigorosen Menschen? Ich wusste es nicht. Was mir aber auffiel, war, dass ich nach langer Zeit wieder Interesse an etwas fand. Und so betrachtete ich weiter das bunte Treiben mit seinem Schmatzen und Quatschen, dem Geklimper von Besteck und Porzellan, dem Gemurmel und Getuschel, dem Rülpsen und dem Verrücken der Stühle beim Hinsetzen oder Aufstehen.
Und dann sah ich ihn. Er saß inmitten einer recht agilen, sich angeregt unterhaltenden Tischgesellschaft. Schweigend aß er seine Suppe und schaute nicht nach links oder rechts.
Ich beschloss, mir einen Platz zu suchen, von dem aus ich ihn unauffällig beobachten konnte. Dann nahm ich mir einen Teller, legte ein paar Scheiben Brot, Wurst und Käse darauf, dazu ein Stückchen Butter sowie ein Messer und setzte mich. Obwohl ich keinen Appetit hatte, schaffte ich zwei ganze Scheiben und nahm mir sogar Tee nach.
Der Fenstergucker wechselte kein einziges Wort mit seinen potentiellen Gesprächspartnern, schaute kein einziges Mal auf. Es dauerte eine Weile, bis auch der letzte von seinem Tisch aufgestanden war und er allein zurückblieb.
Nein, ich wollte nicht hingehen. Mir war die Gefahr zu groß, ein weiteres Mal abgewiesen zu werden. Außerdem war ich nicht im Dienst, musste mich nicht um Außenseiter kümmern. Aber waren wir nicht alle irgendwie Außenseiter? Die mit meinem Helfersyndrom verbundenen Synapsen fragten zwar ganz kurz leise weinend nach, ob es vielleicht auch unter Außenseitern Außenseiter geben könnte – Menschen, die mit keinem redeten, Menschen, mit denen keiner redete? Es war mir allerdings zu anstrengend, darüber nachzudenken.
So schlich ich zurück in mein Zimmer und starrte die Wand an. Wie könnte wohl die richtige Frage an den Fenstergucker heißen? Vielleicht sollte ich mich ihm beim nächsten Mal vorstellen und einfach fragen: „Und wer bist du?“
Vielleicht könnte man auch so beginnen: „Scheiß Laden hier, scheiß Zeiten …“, oder: „Ich bin neu hier – macht bei Ihnen auch so eine fiese, widerliche Alte sauber, die wie eine Gebirgsziege meckert und sich aufführt wie ein Feldwebel auf Droge?“
Ein mir unbekannter Pfleger riss mich aus meinen Überlegungen. Er roch nach Alkohol und stellte sich als Pfleger Billig vor. Dann reichte er dem Spielzeugautonarren und mir unsere Medikamente.
Ich schluckte meine Antidepressiva und die Schmerztablette und schaute dem leicht Torkelnden bei der Versorgung meiner Schnittverletzungen zu.
„Sieht ja richtig gut aus“, sagte er. „Ich meine nicht die exakt ausgeführten Schnitte, sondern den Heilungsprozess. – Rasierklinge, ’ne?“
Ich nickte. „Ja, Rasierklinge.“
„Dann war es wenigstens ’ne Gillette oder Wilkinson …“, konnte er sich die ebenso überflüssige wie unangebrachte Witzelei nicht verkneifen.
Kapitel 2
„Haben Sie vielleicht jemanden, der Ihnen ein bisschen Wäsche, eine Zahnbürste und Duschzeug bringen könnte?“, fragte mich Robert, der Frühdienst hatte.
„Ja, hab ich“, antwortete ich missmutig.
Meine Übellaunigkeit verdankte ich der Furie mit dem Wischmopp. Sie hatte mich mit ihrem bösartigen Geschimpfe wieder kurz nach 6 Uhr aus dem Schlaf gerissen. Keifend hatte sie an meinem Bett gestanden und mich davor gewarnt, irgendetwas auf den Boden zu werfen – Papier, Pflaster, Taschentücher oder Obstschalen. Sie mache das nicht weg. Ich solle mir nicht einbilden, dass sie da wäre, um mir den Müll hinterherzuräumen. Als sie mit dem Putzen fertig war, knallte sie die Tür zu. So laut sie konnte. Sie war ein Giftzwerg. Ein Ekelpaket. Eine Gewitterziege.
„Sagen Sie, Robert, die Reinigungskraft …“
„Ach, Sie meinen sicher Josephine, unsere Stationshilfe. Was ist mit ihr?“
„Ist sie immer so schlechtgelaunt?“
„Josephine? Schlechtgelaunt?“
„Aber sie ist keine Patientin, oder?“, fragte ich.
„Josephine? Nein, warum?“
„Ach, schon gut“, beendete ich den Small Talk und schaute zu, wie mein Stationspfleger den kindlichen Autonarren weckte.
„Heute begrüßen wir einen neuen Patienten in unserer Mitte“, hörte ich Robert im Stuhlkreis sagen. „Er heißt Martin Mann.“ Dann wandte er sich an mich: „Herr Mann, wollen Sie sich kurz vorstellen?“
Ich stand auf. „Martin Mann, Depression, wahrscheinlich Erschöpfungsdepression, so die vorläufige Eingangsdiagnose.“ Dann setzte ich mich wieder hin. Das sollte als Vorstellung reichen.
Ich schaute mich um. Wir saßen zu zwanzigst im Kreis, 19 Patientinnen und Patienten sowie der diensthabende Stationspfleger. Während sich einer nach dem anderen vorstellte, fiel mein Blick auf den kleinen, rundlichen Fenstergucker mit seiner Halbglatze und dem pausbäckigen Gesicht. Er war noch lange nicht an der Reihe, aber er würde Farbe bekennen müssen am heutigen Morgen.
Natürlich konnte ich mir nicht alles merken, was meine Mitpatienten über sich erzählten. Einige blieben mir dennoch sofort in Erinnerung.
Da war zum Beispiel Arnulf, ein endlos monologisierender Zwangsgestörter. Arnulf wurde von den Mitpatienten Pfiffig genannt, weil er über aber auch alles und jedes zu referieren wusste. Er schien die Inkarnation eines wandelnden Lexikons zu sein, eine Mischung aus Almanach, Atlas und weltumspannender Enzyklopädie.
Bei seiner Vorstellung unterrichtete er uns aus dem Stegreif über seine Diagnosen: „…, die sich gemäß der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme – ICD abgekürzt, was so viel heißt wie International Statistical Classification of Diseases and Relate Heath Problems – folgendermaßen einordnen lassen: Erstens ein Verfolgungswahn mit dem ICD-Schlüssel 10 F42.1, der sich differentialdiagnostisch aber nicht deutlich abgrenzen lässt von – zweitens – der Diagnose mit dem Kürzel ICD 10 F60.5, einer anankastischen, also zwanghaften Verhaltens- und Persönlichkeitsstörung, welche sich wahrscheinlich in der Kindheit, vielleicht auch erst in der Adoleszenz, also in der Phase des Übergangs vom Kind zum Erwachsenen, als persönliche und soziale Beeinträchtigung manifestiert hat –“ Viel weiter kam Pfiffig nicht mit seinem Vortragsmarathon.
Carla unterbrach ihn rüde: „Mann, kann der Kerl nich einmal was normal erzählen? Muss diese verfickte Nappsülze immer alles so erzählen, dass kein Mensch versteht, was er überhaupt meint?“ Offensichtlich schien auch sie erst in Fahrt zu kommen. „Ick könnte dem Kerl in die Fresse hauen – und dit mit wachsender Begeisterung! Immer und immer wieder! … Richtig rin in seine Schnauze … Dieses Ausgekotze immer … als ob die Weltgeschichte neu erfunden werden muss!“
„Carla“, sagte Robert ruhig, „du weißt doch, was du tun musst, um deine Gewaltbereitschaft unter Kontrolle zu halten?!“
„Ja, ich weiß. Gaaaanz langsam bis 20 zählen, bevor ick affektiv aggressiv reagiere. Aber, janz ehrlich, ick könnte dieser Schmachtfresse ohne Ende in die Eier treten … Dieses Aufgesetzte, wenn ick dit schon höre … Eins, zwei, drei, vier … man ey, diese verwichste Ratte …“
Pfiffig wollte diesen Angriff nicht auf sich sitzenlassen. „Selber verwichste Ratte. Blöde Kuh!“
„So“, klärte Robert die Fronten, „nachdem das jetzt ausdiskutiert wäre, – Carla, du zählst schön weiter! – können wir hoffentlich fortfahren mit unserer Vorstellungsrunde.“
Pfiffig schlug wieder sein Notizbuch auf, das er stets bei sich trug, um alles zu notieren, was ihm wichtig erschien.
Der Nächste, der nun aufstand, war sich offensichtlich seiner Schönheit und seiner Ausstrahlung auf andere Menschen bewusst. Peter sehe sich in der Psychiatrie am völlig falschen Platze und hielt seine attestierte Psychopathie für eine komplette Fehldiagnose. Dann setzte er sich wieder.
„Peter hat Frauen und Männer betrogen und um ihr ganzes Geld gebracht“, ergänzte Pfiffig ungefragt. „Er leidet unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung mit antisozialen Verhaltensweisen. Ungefähr drei bis sieben Prozent aller Männer und ein bis zwei Prozent der Frauen verfügen über einen dissozialen Charakter. Angehörige dieser Spezies werden gern als soziale Raubtiere bezeichnet, als verachtenswerte Existenzen, die sich mit ihrem antrainierten Charme, ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihren perfiden Manipulationstechniken skrupellos auf Kosten anderer Menschen bereichern, sie emotional und materiell aussaugen wie Vampire und dann am Boden zerstört zurücklassen, um sich neuen Opfern zu widmen. Mitgefühl, Reue und Gewissen sind ihnen fremd und für sie bedeutungslos.“
„Ich glaube, das genügt jetzt“, unterbrach der Stationspfleger Pfiffigs Ausführungen, obgleich dieser wahrscheinlich noch lange nicht am Ende war.
Etwas weiter neben mir hörte ich Carla leise mit den Zähnen knirschen: „Mann … ick könnte den Kerl …“
Dann endlich war mein Fenstergucker an der Reihe. Er schaute sich kurz in der Runde um und erhob sich langsam. „Mein Name ist Muleac. Kurt Muleac.“
Das war’s. Er setzte sich wieder. Niemand, nicht einmal Pfiffig, hatte etwas zu ergänzen.
Raimund spielte außerhalb des Stuhlkreises für sich allein mit einem gelben Spielzeugbus auf dem Boden. Seine Vorstellung übernahm der Stationspfleger. „Ich glaube, Raimund brauche ich Herrn Mann nicht mehr vorzustellen, sie bewohnen ja dasselbe Zimmer.“
Seltsam, dachte ich, bis vor kurzem noch und fast mein ganzes Leben lang bewohnte ich meine eigene Wohnung – und nun? Nun bewohnte ich ein Zweibett-Krankenzimmer in einer Nervenheilanstalt. Zusammen mit einem erwachsenen Mann, der nichts anderes tat, als Spielzeugautos hin und her zu schieben.
„Darf ich Raimund vorstellen?“, fragte Pfiffig.
Carla schnaufte vor Wut, riss sich aber zusammen.
„Das musst du schon Raimund selbst fragen“, antwortete Robert.
Flugs stand Pfiffig auf, machte ein paar Schritte und bückte sich zum Spielenden hinunter. „Darf ich dich Herrn Mann vorstellen?“
Raimund ließ sich nicht ablenken. „Ja“, war seine einzige Reaktion.
Pfiffig kehrte in den Kreis zurück. „Raimund ist schon sieben Jahre Patient hier. Seine Erkrankung nennt sich Autismus. Bis vor kurzem unterschied die Medizin noch den frühkindlichen Autismus, in der ICD 10-Klassifizierung unter F84.0 zu finden, den atypischen Autismus, F84.1, das Asperger Syndrom, Genaueres dazu unter F84.5, und schließlich noch die weiteren tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, die im Komplex F84.9 zu finden sind. Dabei handelt es sich beim letzten Punkt um eine klassifizierte Gruppe psychischer Störungen, die vor allem gekennzeichnet sind durch eine Beeinträchtigung der Kommunikation, der sozialen Beziehungen und der interpersonalen Interaktionen.“
Bevor Pfiffig fortfahren konnte, zischte Carla, den Kopf gesenkt, sichtlich gereizt: „Das reicht jetzt!“
„Ich glaube auch, dass du uns Raimund gründlich genug vorgestellt hast. Vielen Dank!“, wirkte Robert auf das Geschehen ein.
„Nein“, wehrte sich Pfiffig, „etwas fehlt noch. Etwas sehr Wichtiges.“
„Und was ist das?“, wollte Carla – mittlerweile puterrot im Gesicht – wissen.
„Na ja, dass Raimund nicht vorrangig wegen seiner Autismus-Störung hier ist, sondern wegen seiner mittlelgradigen Intelligenzminderung, und wir heutzutage nicht mehr zwischen dem frühkindlichen und dem atypischen Autismus unterscheiden oder dem Asperger Syndrom und so weiter, sondern die autistischen Störungen nunmehr generalisiert als Autismus Spektrum Störung, abgekürzt ASS, zusammenfassen. Darf ich, wenn es gestattet ist, noch weitere interessante Ausführungen zu Neuroentwicklungsstörungen und deren Therapiemöglichkeiten unter Einbeziehung des Falls Raimund machen?“
„Darfst du nicht!“, drohte Carla, hörbar um Contenance bemüht. „Und wenn du dich jetzt nicht hinsetzt, ramme ick dir deine scheiß Stiftzähne ins Gehirn!“
Das saß. Pfiffig huschte auf seinen Platz – wurde sogleich aber nochmals von unserem Stationspfleger in die Pflicht genommen. Es wäre nett, wenn er kurz, aber wirklich nur kurz, die Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als psychiatrische Einrichtung des Berliner Gesundheitswesens vorstellen könne.
Dazu ließ Pfiffig sich nicht zweimal bitten. Wie tausendfach geübt, ratterte er die Fakten herunter. Ich erfuhr, dass die KBoN früher einmal über 1.200 Betten verfügte, aktuell aber nur noch 800 belege. Es gäbe insgesamt drei Stationen der Abteilung für Allgemeinpsychiatrie und Allgemeinpsychotherapie. Des Weiteren beherberge die KBoN eine Gerontopsychiatrische Abteilung für Menschen, die im Alter psychisch erkrankt seien, dann eine Abteilung für Suchtmedizin und Abhängigkeitserkrankungen, weiterhin eine Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie eine geschlossene Station mit stark intelligenzgeminderten Patienten – das seien Menschen, deren Intelligenzquotient unter 34 liege und die früher im Allgemeinen als Oligophrene oder Schwachsinnige bezeichnet wurden. Außerdem gebe es noch eine weitere, streng geschlossene Station, nämlich die für gerichtlich untergebrachte Personen – die Forensik. Dort würden psychisch kranke Straftäter und Straftäterinnen behandelt und auf Dauer weggesperrt, um die Gesellschaft vor ihnen zu schützen. Ja, und nicht zu vergessen verfüge die KBoN noch über eine Institutsambulanz mit diagnostischen und therapeutischen Angeboten für Menschen, die nicht stationär untergebracht seien.
„Darf ich noch etwas zum aktuellen Stand der Psychiatrie-Enquete sagen?“, wandte sich Pfiffig aufgeregt an unseren Stationspfleger.
„Danke, Arnulf, vielleicht bei nächster Gelegenheit“, schlug dieser mit freundlicher Stimme seine Bitte ab – was den redseligen Referenten aber nicht davon abbrachte, den begonnenen Vortrag mit seinem Notizbuch unter dem Arm fortzusetzen, während er dabei ziellos durch den Käfig schlenderte.
Es traf sich gut, dass Pfiffig auch am Terrain-Training teilnahm. Während des zügigen Spaziergangs im Klinikpark gesellte ich mich unauffällig zu ihm und fragte, ob er mir vielleicht Näheres über Kurt Muleac mitteilen könne.
Offensichtlich erfreute es den Gefragten, dass ich seine Dienste in Anspruch nehmen wollte. Aus dem Gedächtnis öffnete er sogleich ein schier endloses Dossier über den Fenstergucker, das er herunterbetete wie ein vom Glauben beseelter Priester das morgendliche Vaterunser. Unmerklich verlangsamte ich meine Schritte, sodass Pfiffig und ich bis ans Ende der Wanderprozession zurückfielen und wir von unseren Mitsportlern, zu denen auch das allein vor sich hin stapfende Objekt meiner Neugier zählte, nicht mehr gehört werden konnten.
Ich erfuhr, dass der Fenstergucker ein notorischer Einzelgänger sei, jegliche verbale oder nonverbale Kommunikation vermeide und sich bei absolut unumgänglichen Gesprächen nur auf das Allerallerallernotwendigste beschränke.
Bei Herrn Muleac sei eine paranoide Schizophrenie in Verbindung mit assoziativen respektive dissoziativen, zugleich aber auch schizoaffektiven Störungen diagnostiziert worden.
„Zu einem dissoziativen Störungsbild“, wusste mein Begleiter gewichtig zu erklären, „zählen insbesondere Trauma bezogene Reaktionen – wahlweise akut und/oder posttraumatisch –, die sich medizinisch betrachtet als Amnesie, Flashbacks, Abgestumpftheit, Depersonalisierung und/oder Derealisation äußern. Unter einer Derealisation versteht die medizinische Nomenklatur eine verfremdete Wahrnehmung von Personen, Gegenständen oder gleich der gesamten Umgebung.
Im Verhältnis dazu bezeichnet die Depersonalisierung die Entfremdung zum eigenen Körper und zur eigenen Persönlichkeit, was zu einer Veränderung des Ich-Empfindens führt. Das eigene Leben wird quasi wie ein Film empfunden, den man von außen betrachtet. Die auch schon erwähnte schizoaffektive Störung ist eine Kopplung von relevanten Symptomen aus den Krankheitsbildern der Schizophrenie und bipolarer affektiver Störungen. Bezeichnend für diese Diagnose sind Wahn, Manie, Halluzinationen und depressive Episoden.“
Als Pfiffig mir auch noch den Unterschied zwischen einer Schizomanie und einer Schizophrenie erklären wollte, musste ich ihn unterbrechen. Ich hatte genug erfahren und wollte das Gehörte erstmal sacken lassen. So bedankte ich mich höflich für seine aufschlussreichen Hinweise, rannte nach vorn und ließ ihn weiter vor sich hinreden.
Während der Mittagspause lag ich auf meinem Bett und dachte nach. Der kleine Mann vom Fenster hatte also eine paranoide Schizophrenie. Damit konnte ich etwas anfangen. Mit den anderen Informationen konnte ich mich später noch beschäftigen. Falls ich mich überhaupt damit beschäftigen wollte.
Seltsam, dachte ich, da war es dem schweigsamen Fenstergucker doch tatsächlich gelungen, mich auf andere Gedanken kommenzulassen, mich in so kurzer Zeit ein kleinwenig aus meiner langen, tiefdunklen Depression zu holen.
Mir fiel mir ein, dass ich unbedingt noch meinen Kollegen Roland anrufen und ihn darum bitten wollte, meinen Ersatzschlüssel von der Nachbarin zu holen und aus meiner Wohnung ein paar Klamotten, den Rasierapparat und Waschzeug herzubringen.
Meine erste psychotherapeutische Einzelsitzung bei Herrn Gutzeit stand an. Zugegebenermaßen war ich trotz der eingenommenen Tranquilizer etwas besorgt. Psychotherapien waren mir zwar aus meiner beruflichen Praxis bekannt. Nun aber ging es nicht einem Klienten an den Kragen, sondern mir. Ich würde in wenigen Momenten als Patient einem Therapeuten gegenüberstehen, jemandem, der mich intensiv beobachtete, durchleuchtete, analysierte und studierte. Scheiß was drauf, dachte ich mir, was soll schon passieren? Ob mich der Therapeut nun für verrückt erklären würde oder mir verspräche, das Moor gemeinsam mit mir schon trocken zu legen, war im Prinzip ohnehin nicht wichtig.
„Herr Mann, wie geht es Ihnen?“
„Nicht gut.“
„Ich habe Ihrer Patientenakte entnommen, dass Sie Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert haben, da sind wir gar nicht so weit auseinander, ich bin Psychologe.“
„So?“, stellte ich nur mäßig interessiert fest. Zwischen meinem Studiengang und seinem lag für mich eine ganze Menge. Ich hatte das Fach Psychologie in meiner Ausbildung, er mit Sicherheit weder die Soziale Arbeit noch die Sozialpädagogik. Vermeintlich hatte er mit seiner Andeutung nur nach einem Eisbrecher gesucht, nach einer Gemeinsamkeit, die eine positive Gesprächsebene herstellte.
„Nun, dann fange ich einfach mal an und stelle mich vor.“ Herr Gutzeit war 40 Jahre alt und arbeitete seit sieben Jahren in der KBoN. Seine primäre Aufgabe sehe er darin, den Patienten zu helfen, den Grund ihrer Störung zu finden, die Ursachen zu erkennen und vor allem das Leiden zu mildern, im besten Fall sogar zu heilen.
„Wie schön für Sie“, kommentierte ich, weil mir keine anderen Worte einfielen.
„Wollen Sie mir auch etwas erzählen? – Vielleicht über sich oder über Ihre aktuelle Situation?“, fragte er mich.