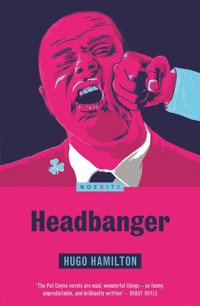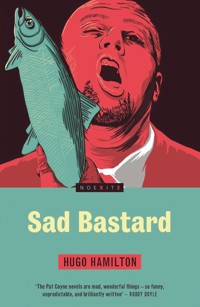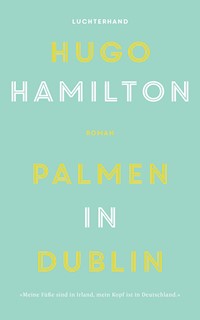3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie ist das, wenn man sich in der Fremde eine neue Heimat aufbaut? In seinem neuen Roman erzählt Hugo Hamilton die Geschichte des Serben Vid Cosic, der nach Dublin geht und dort ein neues Leben, Arbeit, Freunde sucht. Der Blick des Fremden auf Irland, seine Menschen und seine Eigenheiten ist ebenso faszinierend wie die Geschichte der Freundschaft zwischen dem zurückhaltenden Vid und dem temperamentvollen Iren Kevin, einer Freundschaft, die auf Loyalität und Schuld gegründet ist und den Verrat schon in sich trägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Hugo Hamilton
Der irische Freund
Roman
Aus dem Englischenvon Henning Ahrens
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Hand in the Fire« bei Fourth Estate, London.
Genehmigte Ausgabe November 2012 btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2010 Hugo Hamilton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 Luchterhand Literaturverlag,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: semper smile München Covermotiv: © plainpicture/Baelen, Pierre Satz: Greiner & Reichel, Köln CP Herstellung: BB ISBN 978-3-641-11173-1V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Wie ist das, wenn man sich in der Fremde eine neue Heimat aufbaut? Hugo Hamilton erzählt die Geschichte des Serben Vid Ćosić, der nach Dublin geht und dort ein neues Leben, Arbeit, Freunde sucht. Der Blick des Fremden auf Irland, seine Menschen und seine Eigenheiten ist ebenso faszinierend wie die Geschichte der Freundschaft zwischen dem eher zurückhaltenden Vid und dem temperamentvollen Iren Kevin, einer Freundschaft, die auf Loyalität und Schuld gegründet ist und den Keim des Verrats von Anfang an in sich trägt. Hugo Hamilton, der sich schon immer für das Leben zwischen den Welten interessiert, hat einen grandiosen Roman über das heutige Irland verfasst, über Heimat und Fremde und über den schmalen Grat zwischen Freundschaft und Verrat, zwischen Liebe und Gewalt.
HUGO HAMILTON wurde 1953 als Sohn eines irischen Vaters und einer deutschen Mutter in Dublin geboren. Zu Hause sprach er Deutsch und Irisch; das Englische, die Sprache der Straße, wurde von seinem Vater verboten. Mit seinen Erinnerungsbänden »Gescheckte Menschen« und »Der Matrose im Schrank« erregte er großes Aufsehen, die Werke wurden in 20 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Zuletzt erschien der Roman »Echos der Vergangenheit«. Hugo Hamilton lebt in Dublin.
Für Maria
1
Ihr seid schon komisch hier.
Zum Beispiel, was die Freundschaft angeht.
In diesem Land ist die Freundschaft einmalig, ich kenne nichts Vergleichbares. Sie kommt aus dem Nichts. Mit voller Wucht. Ganz oder gar nicht. Ich habe an Orten gelebt, wo man die Freundschaft wie eine Balkonbepflanzung sorgfältig über einen langen Zeitraum pflegt. Hier scheint sie wild zu wachsen.
Man könnte sagen, dass ich ihm behilflich war. Ich fand sein Handy auf der Straße. Ein Bild seiner Freundin war darauf, sie lachte in die Kamera. Sie hieß Helen. Ich hätte alle ihre Nachrichten an ihn lesen können, aber ich wollte nicht neugierig sein. Ich rief sie an und vereinbarte, ihm das Handy noch am gleichen Abend zurückzugeben. Das war eigentlich schon alles. Eine Selbstverständlichkeit. Ich wartete vor einem Laden mit längeren Öffnungszeiten, und als er auf mich zukam, lächelte er so breit, als würden wir uns schon seit einer Ewigkeit kennen. Er bedankte sich und blieb dann stehen. Er ließ mich nicht gehen. Bevor ich mich versah, revanchierte er sich bei mir und lud mich auf einen Drink in eine Bar ein. Er stellte sich als Kevin vor. Kevin Concannon. Ich kannte seinen Namen schon, aber so war es gewissermaßen offiziell. Er sei Anwalt, erzählte er mir, das Handy sei lebenswichtig für ihn, und er sei froh, dass es nicht in falsche Hände geraten sei.
Er zeigte Interesse an mir und wollte wissen, was ich tat. Als ich sagte, ich sei Bautischler auf Arbeitssuche, versprach er, sich umzuhören. Falls ich interessiert sei, könne er mir vielleicht einen Job verschaffen. Er nahm meinen Namen und meine Nummer in seine Kontaktliste auf. Vid Ćosić. Er wiederholte meinen Nachnamen mehrmals, weil er ihn richtig aussprechen wollte. Ćosić. Wie Tschos-itsch.
»Woher kommst du, Vid?«
»Belgrad«, sagte ich, um es kurz zu machen.
Ich hatte wenig Lust, ausführlich zu erklären, warum ich hierhergekommen war und was ich zurückgelassen hatte.
»Serbien«, fügte ich hinzu. »Früheres Jugoslawien.«
Was soll man sagen, wenn sich bei der Nennung seines Heimatlandes jeder nur an eines erinnert? Ich erzählte ihm, ich sei nach einem schweren Autounfall abgehauen. Ich habe reisen, etwas Neues sehen wollen.
»Absolut verständlich«, sagte er.
Ist es wichtig, woher man kommt? Vielleicht ist es ganz egal. Ich wollte mein Heimatland vergessen und neu anfangen. Ich wollte hier Fuß fassen, Land und Leute erkunden. Ich kannte schon ein paar berühmte Namen, zum Beispiel James Joyce und George Best, Bono und Bobby Sands. Ich kannte die wichtigsten Orte wie das General Post Office, den Schauplatz des Osteraufstands, und Burgh Quay, wo der Bus nach Galway abfuhr. Direkt neben der Einwanderungsbehörde. Ich begriff langsam, wie es hier lief, hatte kapiert, wie man »Wie geht’s, wie steht’s?« und »Wo geht’s ab?« sagen musste. Ich begann, die Witze zu verstehen, und versuchte, nicht immer alles bierernst zu nehmen. Ich arbeitete an meinem Akzent, verinnerlichte alle Klischees – zu guter Letzt und in neun von zehn Fällen heilt die Zeit alle Wunden. Um auf keinen Fall falsch verstanden zu werden, benutzte ich nur unverfängliche Ausdrücke. Ich vermied Abkürzungen, verkniff mir Kalauer und die Veralberung von Eigennamen. Ich versuchte, Wörter wie »krass«, »mega« oder »affengeil« möglichst selten zu benutzen. Ich war vorsichtig mit Redewendungen wie »Beine in die Hand nehmen« oder »vor der Glotze hängen«. Ich mied Formulierungen wie »zisch ab« oder »verpiss dich«, weil ich befürchtete, jemanden zu beleidigen. Außerdem konnte ich das Wort »fuck« nicht richtig aussprechen. Aus meinem Mund klang es immer zu hart. In diesem Land wurde es auf so viele Arten ausgesprochen, dass ich irgendwann das Handtuch geworfen hatte.
Er fragte, wie gut ich Irland kennen würde, wo ich schon gewesen sei. Ich erzählte, dass ich den Westen kennenlernen wolle, doch er schlug einen Abstecher nach Süden vor.
»Warst du schon auf Dursey Island?«
»Nein«, antwortete ich.
Er klang ein wenig herrisch und sah mir direkt in die Augen, sein Blick war fest. Er trat einfach so in mein Leben, gab mir Ratschläge, traf Entscheidungen für mich.
»Du musst zuerst nach Dursey Island«, sagte er. »Alles andere kann warten.«
»Warum?«
»Es ist ein einzigartiger Ort«, sagte er. »Heute lebt dort kaum noch jemand. Es gibt nur dich und das Meer.«
Aus welchem Grund sollte ich dorthin? Hatte er eine besondere Beziehung zu dem Ort? Angeblich gab es sechs Grade des Abstands, aber in diesem Land gab es höchstens einen oder zwei. Er schaute zur Tür des Pubs, als könnte er das ganze Land und alle Menschen darin sehen. Er erklärte mir, wie ich auf die Insel kam, die vor dem Südwestzipfel der Beara-Halbinsel in County Cork lag.
»Du setzt mit einer Seilbahn über«, sagte er. »Es dürfte die einzige Strecke im Atlantik sein, die man in einer Seilbahn überquert.«
»Du machst Witze«, sagte ich.
»Nein, im Ernst«, erwiderte er. »Du kannst es nachprüfen, Vid. Es stimmt.«
»Dursey Island.«
»Dursey Island«, wiederholte er. »Erzähl ja niemandem, dass du noch nie dort warst.«
Er gab mir einen Klaps auf den Rücken. Dann stand er auf, bedankte sich noch einmal und ging.
Zwei Tage später befolgte ich seinen Rat tatsächlich. Ich würde ihm erst glauben, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen hatte.
Ich fuhr nach der Karte und verfranste mich. Also hielt ich bei einem Pub, um mich nach dem Weg zu erkundigen. Der Mann hinter der Bar schnitt gerade eine Zitrone in Scheiben, unterbrach seine Arbeit aber, um mir den Weg zu beschreiben. Ich verstand seinen Akzent nicht und konnte meinen Blick nicht von dem Filetiermesser lösen, mit dem er herumfuchtelte. Die Wörter ergossen sich über die Theke, und ich war so abgelenkt, weil er das Messer ständig durch die Luft schnellen ließ, dass ich kaum etwas mitbekam. Der Zitronenduft stieg in meine Nase, und ich wartete auf das Ende der Wegbeschreibung. Er schien meine Verwirrung zu bemerken, denn er fing noch einmal von vorn an. Aber ich konnte mich wieder nicht konzentrieren, weil ich immer nur die silbern blitzende Klinge in seiner Hand anstarrte. Er richtete das Messer auf mich und stieß ruckartig zu, erst nach vorn, dann nach oben. »Immer geradeaus«, sagte er. Hätte ich dicht vor ihm gestanden, dann hätte er mich in den Hals gestochen. Ich nickte höflich, weil er zu erwarten schien, dass ich seine Anweisungen wie ein Schuljunge wiederholte. Ich bedankte mich, um zu vermeiden, dass er mir zum dritten Mal wild fuchtelnd den Weg beschrieb, und sagte, ich wüsste jetzt Bescheid.
Dann fuhr ich in einer schwankenden Seilbahngondel nach Dursey Island, hoch über dem Wasser und mit dem Herz in der Hose, wie man so schön sagt. Als ich ausstieg, fragte ich mich, was an dieser Insel so besonders sein sollte. Sie war zwar wunderschön und auch geschichtsträchtig, aber ich wusste nicht recht, was ich hier zu suchen hatte. Ich wanderte eine Weile umher und fotografierte. Einige Meeresvögel kannte ich noch nicht. Die Wolken waren mir auch neu, denn sie waren schneller und niedriger und schienen vom Atlantik aus unbedingt das Land erreichen zu wollen. Die Wellen brachen sich mit einem Geräusch auf den Felsen, das an das wiederholte laute Zuschlagen einer riesigen Kühlschranktür erinnerte. Ich fand, dass es bessere Ausflugsziele gab, noch beeindruckendere und noch einsamere Orte wie beispielsweise Skellig Rock, der sich wie eine gewaltige, schwarze Rückenflosse aus dem Meer erhob. Auf dem Wasser tanzte Sonnenlicht. Es sah nach Regen aus, aber es blieb trocken. Ein heftiger Wind zerrte an meiner Jacke, und ich glaubte kurz, jemand würde hinter mir stehen. Aber da war niemand, und ich kam mir vor wie der letzte Mensch auf Erden.
Nach ein oder zwei Stunden wollte ich auf das Festland zurückkehren. In der Seilbahngondel, die auf mich zukam, konnte ich einen Jungen erkennen. Als die Tür aufglitt, sprangen ein Dutzend wie aus einer Falle befreite Schafe heraus, deren Hufe auf dem Stahl kratzten und klackerten. Sie hatten es so eilig, das Gras zu erreichen, dass sie eine Art Bockspringen veranstalteten.
Ein Schaf blieb mit einem Bein zwischen Gondel und Plattform stecken, und der Junge versuchte, es zu befreien. Das Tier hatte panische Angst und kämpfte mit weit aufgerissenen Augen um sein Entkommen. Ich half dem Jungen, der mir erzählte, dass die Insel heutzutage vor allem als Weide genutzt wurde. Es gab einige Ferienhäuser, aber die Besitzer waren nur selten da. Die Schafe rupften am Gras, als hätten sie die gefährliche Überfahrt bereits vergessen. Auf der Rückfahrt überwältigten mich die Gerüche von Kötteln und Schafen, und meine Angst legte sich erst, als ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Ich sah zu, wie die Schwester des Jungen weitere Schafe mit Pfiffen und der Unterstützung ihres Hundes in die Gondel trieb. Dann fuhren sie alle gemeinsam zur Insel. Zwischendurch stellte ich mir vor, wie die Tür aufging und die Schafe ins Meer purzelten, eines nach dem anderen, panisch strampelnd, während sie immer rasanter auf den Tod zustürzten. Aber nichts geschah, und abgesehen von der Tatsache, dass ich dort gewesen war, gab es wenig oder nichts Erinnernswertes.
Das war es also. Dursey Island. Es gab diese Insel. Genau wie mich. Sie war zu einem Teil von mir geworden wie ein eingeordnetes Foto. Ich konnte damit angeben, sie besucht zu haben, und allen Leuten erzählen, dass es nicht nur ein Ort auf der Karte war, an dem früher Menschen gelebt hatten, die inzwischen in alle Winde verstreut waren. Aber was war mit all den Orten, die ich nie besuchen würde? Sollte ich herumreisen, um nachzuprüfen, ob jede Halbinsel und jede Stadt in diesem Land tatsächlich existierten? In den meisten Fällen musste man einfach darauf vertrauen.
Ich musste noch viel mehr herausfinden. Vielleicht brauchte ich eine ganz andere Karte. Einen groben Plan, der mir half, mich so gut wie möglich anzupassen. Einen groben Plan für die Freundschaft. Und einen groben Plan für den Verrat. Für Wut und Hass und Mord.
Es gab so vieles, was ich überprüfen musste.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich fühlte mich wohl hier. Ich mochte das Land vom ersten Augenblick an – die Landschaft, den Wind, die durch das Wetter hervorgerufenen Stimmungsschwankungen. Ich wollte nirgendwo anders auf der Welt leben. Ich mochte die Leichtigkeit, mit der man anderen Menschen das Gefühl gab, zu Hause zu sein. Die Redseligkeit. Die Übertreibungen. Die rätselhaften Worte. Ich wollte hierhergehören. Ich wollte mich auf diese außergewöhnliche Freundschaft einlassen.
2
Damals arbeitete ich bei einem Wachdienst, genauer gesagt als Nachtwache in einem Pflegeheim. Für den Anfang gar nicht übel, dachte ich. Und keine schlechte Einführung in dieses Land, denn all die unter einem Dach versammelten Hoffnungen und Enttäuschungen zeigten mir, was sich hinter der Fassade verbarg.
Das Pflegeheim lag in den Außenbezirken Dublins auf dem weitläufigen Gelände einer alten Burg und bot einen Blick auf den von Segelbooten und Fischkuttern genutzten Hafen. Man konnte zuschauen, wie die Schiffe in die Bucht fuhren oder in See stachen. Ein schöner Ort für den Lebensabend, jedenfalls für die Alten, die noch sehen konnten. Nachts warf der Leuchtturm seinen Strahl über das Wasser, und die Küste war von den gelben Lichtern der Stadt gesäumt. Ich lief stündlich mit dem Wachhund Streife und musste mich um Notfälle kümmern, bei denen es sich schlimmstenfalls um brüllende Betrunkene handelte. Mein alter Schäferhund war brav und gehorsam, wenn auch auf eine etwas merkwürdige Art. Er war so gedrillt, dass er nur gehorchte, wenn man zwischen ihm und den Gebäuden ging. Wenn man sich zu weit auf die andere Seite wagte, war man ein ungebetener Eindringling für ihn. Beim ersten Mal musste ich auf einen Öltank fliehen, und er lauerte die ganze Nacht darauf, mich in Stücke reißen zu können. Danach hatte ich kapiert, dass ich nur rechts von ihm gehen durfte.
Doch mir war von Anfang an klar, dass ich nicht für den Wachdienst geschaffen war. Ich war zu lasch. Mir fehlte das Selbstbewusstsein eines Ordnungshüters. Am liebsten wollte ich wieder als Bautischler arbeiten, wenn möglich sogar als Bootsbauer, aber es gab keine freien Stellen. Im Grunde war es nur ein Traum. Ich würde bestenfalls die Möglichkeit bekommen, alte Boote zu restaurieren. Aber ich nutzte weiter jeden Kontakt, um irgendwann in das Baugewerbe einsteigen zu können.
Das Pflegeheim wurde von Nonnen im braunen Habit geführt, die sich aber nicht mehr um die tägliche Pflege kümmerten. Dafür waren herkömmliche Pflegerinnen zuständig. Die paar Nonnen, die es noch gab, gingen am frühen Morgen immer auf dem Gelände spazieren; ihre Hauben standen senkrecht im Wind. Ich lernte eine der Pflegerinnen aus der Nachtschicht näher kennen. Sie hieß Bridie und hatte rote Haare. Sie war in ihren Fünfzigern, also viel älter als ich, aber sie zwinkerte mir immer zu und nannte mich die Liebe ihres Lebens. Sie lachte laut und äffte mich nach, nicht nur wegen meines Akzents, sondern auch wegen meiner Wortwahl. Sie meinte, dass ich manchmal wie ein Schreiben von der Bank klingen würde, weil ich nicht gerade alltägliche Wörter benutzte, die ich aus der Zeitung aufgeschnappt hatte, zum Beispiel »umfassend«, »im Folgenden« oder »bezüglich«.
»Ich lache im Folgenden«, sagte sie dann.
Es dauerte einige Zeit, bis ich die Alltagssprache beherrschte. Zu Anfang sah ich keinen Unterschied zwischen »dann« und »im Folgenden«. Vermutlich klangen meine Sätze wie schlechte Übersetzungen: »Kochen gerade Gerüchte über zu habende Stellen für Zimmermänner?«
Im Pflegeheim waren nicht Einbrecher, sondern Ausbrecher das Problem. Die »Insassen«, wie Bridie sie nannte, besaßen kaum Wertsachen; sie horteten Familienfotos und Bücher, Kekspackungen, Dosen mit exotischen Mintbonbons und Butterscotch. Alle Zimmer rochen nach Apfelstrünken und Gummilaken, manchmal auch nach Banane und Leder. Im Haus galt Alkoholverbot, was einige Leute fast in den Wahnsinn trieb. Eines Nachts ertappte der Hund einen ehemaligen Arzt namens Geraghty dabei, wie er sich über den Rasen davonmachen wollte. Er trug keine Strümpfe, und seine Schnürbänder waren offen. Er stand mit erhobenen Händen da, redete auf mich ein und flunkerte, man habe ihm erlaubt, in den Pub zu gehen. Was sollte ich tun? Ich band ihm die Schuhe zu und ließ ihn laufen. Kurz darauf kam Schwester Bridie herunter, um den Alarm auszulösen, und als man ihn schließlich fand, saß er am Ufer auf einer Bank und sang den Wellen etwas vor.
Als man die Fenster im Erdgeschoss daraufhin mit extra Riegeln sicherte, bat Geraghty mich, ihm eine kleine Flasche Whisky zu besorgen. Schwester Bridie, die wusste, dass ich dafür verantwortlich war, kam nach unten ins Büro, setzte sich auf meinen Schoß und legte mir die Hände um den Hals, als wollte sie mich erwürgen. Doktor Geraghty war oben splitternackt durch die Flure gelaufen, hatte geschrien, er liebe alle Frauen, und war dann in ein Zimmer eingedrungen. Dort klammerte er sich hartnäckig an das Metallbett, während die entsetzte Frau die Decke bis zum Kinn zog und einen Spiegel verlangte, um ihr Haar machen zu können. Als ich ihn auf sein Zimmer bringen wollte, ging er auf mich los. Er hatte vergessen, dass ich ihm den Whisky besorgt hatte. Ich packte ihn beim Arm, und auf einmal war er nicht mehr schlaff und betrunken, sondern drahtig und abwehrbereit. Ich war verblüfft, mit welcher Kraft er sich losriss. Dann starrte er mich wütend an, und ich wusste anfangs nicht, ob er es ernst meinte oder nur Spaß machte.
»Fass mich nicht an«, zischte er. »Woher kommst du? Misch dich hier ja nicht ein.«
»Immer sachte, Doktor«, sagte Bridie energisch.
Sie brachte ihn ohne viel Federlesens weg, einfach kraft ihrer Autorität und Willensstärke. Kurz darauf lag er im Bett, und sie gab ihm einen Kuss auf den kahlen Kopf und schärfte ihm ein, ein braver Junge zu sein. Wie konnte ich einem alten Mann in dessen Heimatland etwas befehlen? Ich kam mir vor wie ein Kind, das Erwachsene zu Bett schicken wollte.
Die meisten Patienten tranken den lieben langen Tag Tee und fanden deshalb nachts keinen Schlaf. Eine alte Frau kam regelmäßig zu mir herunter, und Schwester Bridie riet mir, »mitzuspielen«. Das erwies sich als guter Rat. Die Frau trug ein elegantes, grünes Cape und große Ohrringe, und sie behauptete, ins Theater zu wollen. Unpassend waren nur ihre Hausschuhe, und natürlich war es zwei Uhr früh. Als sie mich bat, ein Taxi zu rufen, wählte ich irgendeine Nummer und sprach mit einer erfundenen Person am anderen Ende der Leitung.
Vielleicht ist jeder bis zu einem gewissen Grad Schauspieler, aber es fiel mir oft schwer, mich in die Person einzufinden, die ich hier darstellen sollte. Während alle um mich herum in ihren Rollen aufgingen, als wären sie dafür geboren, lernte ich noch meinen Text.
Ich konnte gar nicht anders, als die meiste Zeit ich selbst zu sein.
Die auf das Taxi wartende Frau entnahm ihrer Handtasche ein silbernes Zigarettenetui, das angeblich ihrem Vater gehört hatte, einem Veteranen des Unabhängigkeitskrieges. Sie bat mich, einen Zeigefinger auf die von einer Kugel hinterlassene Delle zu legen. Wäre dieses Zigarettenetui nicht gewesen, erzählte sie, dann wäre ihr Vater als junger Mann erschossen worden, und sie hätte nie das Licht der Welt erblickt. Als ich das silberne Etui hielt, dachte ich an den Mann, dem es das Leben gerettet hatte. Der nächtliche Hinterhalt stand mir vor Augen, als hätte ich ihn kürzlich in jenem Krieg erlebt, der mein eigenes Land verheert hatte. Die im Gras verborgenen Kämpfer. Die leere Landschaft. Die gezielt ausgewählte Straßenkurve. Das lange Warten und der Suppengestank, den die Kleider der Männer nach dem Regen ausdünsteten. Die eingebildeten Geräusche in der Ferne und dann, endlich, der Motorenlärm des Lastwagens mit den feindlichen Soldaten, dessen Scheinwerferkegel über das Moor glitten. Die im Torf vibrierende Angst und schließlich die Schüsse, die Schreie von Männern, die schreckliche Stille nach dem Gefecht. Tote lagen auf der Straße, und das Gewehrfeuer hallte wochen- und monatelang über den braunen Moorteichen nach, ja bis heute.
Als sie das Zigarettenetui wieder einsteckte, gestand sie, dass sich ihr Vater so etwas eigentlich nicht habe leisten können, von einer vollen Zigarettenschachtel ganz zu schweigen. Er habe das Etui einem toten britischen Offizier abgenommen und später weitervererbt, weil es ein Talisman für ihn gewesen sei. So sei es mit vielen Denkmälern in diesem Land, die noch von damals stammten, zum Beispiel den Eisenbahngleisen, den aus Granit erbauten Häfen oder dem Obelisken in Form eines »Hexenhuts«, den man ohne ersichtlichen Grund während der Hungersnot auf dem Hügel errichtet habe.
Meine erste Geschichtsstunde. Ich war ihr dankbar dafür, denn sie gab mir das Gefühl, dazuzugehören. Es war, als hätte ich alte Freunde und Feinde. Ich bildete mir ein, mein ganzes Leben hier verbracht zu haben, glaubte, dass Onkel und Tanten von mir sprachen und auf Nachricht von mir warteten. Man konnte so viele Geschichtsbücher über dieses Land lesen, wie man wollte – alles klang erfunden, bis man einen Anknüpfungspunkt fand, der die Geschichte greifbar werden ließ.
Das Taxi kam nicht. Als sie gehen wollte, sagte sie, wie sehr sie sich freue, meine Bekanntschaft gemacht zu haben. Bei ihrem nächsten Besuch wusste sie nicht mehr, dass wir uns schon begegnet waren. Also konnte ich so tun, als hätte ich ihre Geschichte noch nie gehört, und noch einmal das Gefühl genießen, willkommen geheißen zu werden.
Noch häufiger kam Schwester Bridie herunter, um eine Pause von den »unersättlichen Verrückten da oben« zu machen, wie sie sich ausdrückte. Ich erkannte sie schon am Quietschen ihrer weißen Schuhe. Sie setzte sich und versuchte, mich in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wollte wissen, warum ich nach Irland gekommen war und welche dunklen Geheimnisse ich verbarg. Sie fragte, ob ich etwas aus meiner Heimat vermisste, von dem Wetter und den Kuchen einmal abgesehen, und ob ich eine Freundin hätte. Als ich den Kopf schüttelte, glaubte sie mir nicht.
»Du wirkst so unschuldig«, sagte sie mehrmals zu mir, und ich glaubte jedes Mal, vollkommen durchsichtig zu sein.
Sie erzählte mir viel über irische Nonnen. Laut ihren Worten waren die meisten Wilde. Sie sei bei den »gnadenlosen« Schwestern zur Schule gegangen. Sie hätten immer nur die Schwächsten eingestellt. Einem Küchenjungen wurde ein Topf mit heißem Frittierfett über den Kopf gekippt. »Du hättest seine Schreie hören sollen«, sagte sie. »Er hatte tassengroße Brandblasen am Hals. Als sie ihm das Hemd ausziehen wollten, löste sich die Haut wie rotes Seidenfutter. Als Entschädigung haben sie ihm eine Messe angeboten. Eine Messe!« Und sie legte mir nahe, lieber rechtzeitig zu verschwinden.
»Hau ab, bevor sie dich mit siedendem Öl übergießen.«
Am Ende warf sie mir spaßeshalber eine Kusshand zu. Dann ging sie wieder mit quietschenden Schuhen. Ich wusste, dass sich hinter ihrem Lachen Traurigkeit verbarg – wie eine Wunde, die nicht heilen wollte. Doch ich wagte nicht, sie danach zu fragen.
Als ich kündigte, meinte sie, sie habe gewusst, dass ich irgendwann gehen und ihr das Herz brechen würde; das sei der rote Faden ihres Lebens. Sie lud mich zum Abschied auf einen Drink ein. Wir trafen uns in einem nahen Pub. Ohne ihre Uniform wirkte sie älter oder jünger, es war schwer zu sagen. Einerseits mütterlicher, andererseits zerbrechlich wie ein junges Mädchen. Sie saß da, im Mantel und mit der Handtasche neben sich, rührte mit einem Plastikstäbchen im Wodka Tonic und redete die ganze Zeit, denn ich hatte nichts zu erzählen und wusste nicht, was ich fragen sollte. Sie legte ihr Handy neben den Drink auf den Tisch und starrte es eine Weile an, als müsste es jeden Moment klingeln. Dann begann sie zu weinen, und ich wusste beim besten Willen nicht, wie ich mich verhalten sollte, zumal sie weder meine Mutter noch meine Schwester war. Schließlich legte sie mir widersinnigerweise eine Hand auf den Arm, als wollte sie mich trösten. Sie kramte in ihrer Handtasche nach Taschentüchern, um ihre Tränen zu trocknen, holte jedoch einen Brief heraus und bat mich, ihn zu lesen.
Liebe Bridie, hieß es darin, ich schreibe Dir diesen Brief mit schwerem Herzen.
Er war vor dreißig Jahren von ihrem Verlobten geschrieben worden. Ich las ihn langsam durch und murmelte dabei jedes Wort vor mich hin. Soweit ich verstand, hatte er sich von ihr getrennt. Sie hatten eigentlich heiraten wollen. Der Termin hatte schon festgestanden, die Familien waren benachrichtigt. Doch er machte in letzter Minute einen Rückzieher, weil er meinte, dass er zu viel trank und für die Ehe noch nicht bereit war. Er hielt sich für unfähig, sie zu heiraten, und schrieb, er habe ihre Liebe nicht verdient, und ihm bleibe nichts anderes übrig, als nach Amerika auszuwandern.
Vermutlich hat jedes Land seine eigenen Regeln für Liebe und Unehrlichkeit. Unterschiedliche Arten zu verschwinden und die Vergangenheit abzustreifen. Andere Maßeinheiten für Einsamkeit und Glück. Ich hätte den Mann, der diesen Brief geschrieben hatte, am liebsten ausfindig gemacht, um ihm zu sagen, dass er den schlimmsten Fehler seines Lebens begangen hatte. Aber eine Einmischung kam nicht mehr in Betracht, weil die Zeit uns in entrückte Beobachter verwandelt hatte.
Sie erzählte, dass sie kurz nach seiner Abreise ein Kind zur Welt gebracht habe, doch man habe sie überredet, es zur Adoption freizugeben. Während der letzten Jahre hatte sie versucht, Kontakt zu ihrem Sohn aufzunehmen, aber er wollte sich nicht mit ihr treffen. Sie fragte, ob er meiner Meinung nach klug und hübsch sei, was ich natürlich bejahte. Sie wollte wissen, ob er ihr rotes Haar geerbt haben könnte, und dann beantwortete sie alle ihre Fragen selbst und meinte, dass ihr Junge in seiner neuen Familie sicher glücklich sei, dass es besser sei, wenn er die Vergangenheit auf sich beruhen lasse. Er war längst erwachsen und hatte sein eigenes Leben, aber sie sprach von ihm wie von einem Baby. Sie sah mir in die Augen und sagte, sie hoffe, dass er ein wenig wie ich sei, und plötzlich hatte ich das Gefühl, ihr Sohn zu sein, und versprach, mein Bestes zu geben.
Sie hatte den Abschiedsbrief all die Jahre aufbewahrt; sie war nicht an der Endstation aus dem Bus gestiegen, sondern fuhr die Strecke in ihren Träumen immer wieder hin und her.
»Tu, was du für richtig hältst«, sagte sie zu mir, indem sie den Brief wieder einsteckte. Ich fragte mich, ob sie dies auch zu ihrem Verlobten gesagt hatte, nur um ihre Großherzigkeit zu zeigen und sicherzustellen, dass sie als Freunde und ohne Groll auseinandergingen. Sie gab mir einen Knuff mit dem Ellbogen, weil sie es nicht mehr neben mir aushielt, stand auf und nahm mich in die Arme.
»Besuch mich bei Gelegenheit.« Sie lächelte mit geröteten Augen. Dann setzte sie sich wieder und überprüfte ihr Handy auf Nachrichten. Sie winkte mit beiden Händen und riet mir, gut auf mich aufzupassen. Ich verließ den Pub und ging so unachtsam über die Straße, als würde ich mich für unsterblich halten.
3
Um ehrlich zu sein, rechnete ich nicht damit, je wieder von Kevin zu hören, zumal es in der Stadt von Bautischlern nur so wimmelte. Deshalb war ich überrascht, als er mich eines frühen Abends anrief, weil er mit mir über einen kleinen Auftrag im Haus seiner Mutter reden wollte. Noch seltsamer war die Dringlichkeit: Wir müssten uns sofort treffen, sagte er. Danach war alles entspannt, und die Grenzen zwischen Job und Freundschaft verschwammen. Ich fand, dass man beides besser trennte. Man ging manchmal nach der Arbeit zusammen einen trinken, vorausgesetzt, alle waren zufrieden, aber Kevin machte es genau umgekehrt. Er wollte einen mit mir trinken, noch bevor ich die Kosten auch nur ansatzweise abgeschätzt hatte.
Damals hatte ich eine Festanstellung in einer kleinen Baufirma. Da ich mich irgendwann selbständig machen wollte, erledigte ich gern Aufträge nebenbei. Ich kannte einen litauischen Bautischler namens Darius, der seine eigene Werkstatt und einen Transporter besaß. Ich hatte kaum Werkzeuge, und er lieh mir seine, wann immer ich sie brauchte.
Kevin holte mich ab und fuhr mich zu seiner Mutter. Sie bewohnte ein schönes, geräumiges Reihenhaus in einer zum Meer hinabführenden Straße, nicht weit von dem Pflegeheim, in dem ich gearbeitet hatte. Das Haus war eindeutig nicht im besten Zustand, und als er das Auto parkte, bezeichnete er es in Anlehnung an eines der Lieblingslieder seiner Mutter als »Desolation Row«.
Er ließ mich in der Küche stehen und ging nach oben, um seine Mutter zu holen. Doch sie kam mit Handschuhen und Rosenschere aus dem Garten hinter dem Haus herein und starrte mich an wie einen Einbrecher, der den Ausgang nicht mehr fand.
»Darf ich fragen, wer Sie sind?«
Als er kurz darauf wiederkam und uns einander vorstellte, klärte sich alles auf. Sie zog die Handschuhe aus, um mir die Hand zu geben.
»Vid Ćosić«, sagte er, und sie wiederholte den Namen langsam: Tschos-itsch.
Dann standen wir oben im Schlafzimmer und sprachen über Einbauschränke. Als ich fragte, was sie sich vorstelle, sprach sie von Schwarzesche.
»Schwarzesche«, wiederholte ich und lächelte sie warnend an. »In einem Schlafzimmer. Das könnte ein bisschen nach Leichenhalle aussehen.«
Sie schwiegen. Ich war in ein Fettnäpfchen getreten. Seine Mutter seufzte; es klang wie Luft, die einem aufgeschlitzten Reifen entwich. Sie wirkte sehr ernst, und vielleicht war sie ja in Trauer, dachte ich. Sie hatte während der ganzen Zeit nicht gelächelt.
Kevin sprang mir bei und sagte: »Schwarzesche hat etwas sehr Würdevolles.«
»Sicher«, sagte ich, um die Scharte auszuwetzen. »Es kommt immer auf die Verarbeitung an. Was schwebt Ihnen vor? Furnier oder gebeiztes Massivholz?«
In meinen Augen war ein Einbauschrank in einem solchen Zimmer fast eine Travestie. Es handelte sich hier um ein älteres Haus, und der Schrank würde nicht gut aussehen. Aber ich begriff bald, dass man nicht ehrlich sein durfte. Vieles war Geschmackssache, und man musste sich darauf gefasst machen, Schwarzesche als elegante Wahl zu bezeichnen, obwohl es das übelste Holz war, mit dem zu arbeiten man je das Missvergnügen gehabt hatte. Außerdem konnte ich sie nicht umstimmen. Sie hatte ein Bild aus einer Zeitschrift vor Augen. Sie wollte einen Einbauschrank aus Schwarzesche, der von der Fußleiste bis zur Decke reichte.
Sie ahnten offenbar, dass ich günstig war, denn sie erwähnten keinen anderen Handwerker. Weder Geld noch Zeit waren von Bedeutung. Ich wies sie darauf hin, dass ich die Arbeit in meiner Freizeit erledigen musste.
»Ich brauche einen Vorschuss für das Material«, sagte ich.
»Sicher«, sagte er. »Wie viel?«
»Ich kläre die Kosten und melde mich dann.«
»Sag mir einfach Bescheid.«
»Selbstverständlich«, erwiderte ich, weil ich das Wort als gut und neutral empfand.
Damit war die Sache erledigt, und er beförderte mich sofort in den nächsten Pub. Während er auf seine Freundin wartete, mit der er essen wollte, setzte er mich über seine Mutter ins Bild. Ich merkte, dass er sie sowohl bewunderte als auch fürchtete, als wäre er noch ein Schuljunge. Sie sei Lehrerin, erklärte er, und deshalb müsse man sich ihr Lächeln erst verdienen. Manchmal sei sie etwas streng, fügte er hinzu, aber sie könne auch ausgesprochen lustig sein. Und sie sei sehr patent.
Er nannte ein Beispiel, das eher wie eine Warnung klang. Seine Mutter war kürzlich auf der Straße von einem Junkie überfallen worden, der es auf ihre Handtasche abgesehen hatte. Sie lenkte ihn ab, indem sie sagte, was ihr gerade durch den Kopf ging: »Sie haben die Mauer abgerissen.« Der Angreifer sah sich verwirrt um. Wer? Welche Mauer? Und er vergaß die Handtasche und floh mit leeren Händen.
»Keine Sorge«, versicherte Kevin mir. »Ihr werdet prima miteinander auskommen.«
Ein Kostenvoranschlag für diesen Job war keine einfache Sache, denn es gab gewisse Unwägbarkeiten. Bezahlung in Naturalien. Er wusste, dass ich in diesem Land Fuß fassen wollte, und unterstützte meinen Wunsch, mich selbständig zu machen. Er erklärte mir die Regeln, riet mir, wie ich meine Zukunft planen musste, gab mir alle möglichen Tipps für den Anfang.
Ich fühlte mich ernst genommen. Wenn man nicht von hier war, kam man sich nämlich oft vor wie ein ungebetener Gast. Man hatte das Gefühl, auf einer Party zu sein, deren Gäste sich fragten, woher man kam und wer einen eingeladen hatte. Man nahm alles für bare Münze und missverstand die Leute deshalb oft. Es war nicht immer leicht, zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Deshalb war es großartig, wenn einem jemand zur Seite stand. Jemand, der einem erklärte, was auf einen zukam.
Er stellte mich sogar seiner Freundin Helen vor. Sie gab mir die Hand und erinnerte sich daran, dass wir kurz telefoniert hatten. Ich freute mich, sie persönlich kennenzulernen, und wusste sofort, warum er sich in sie verliebt hatte. Ihre Augen strahlten Lebendigkeit aus. Ihr Lächeln war offen. Sobald sie erfahren hatte, woher ich stammte, stellte sie Fragen.
»Belgrad«, sagte sie. »Ich bin ein großer Fan der Musik des Balkans. Diese schnellen Trompeten und Trommeln.«
Das Zusammentreffen mit einer Person, die sich so für mein Land interessierte, weckte kurz mein Heimweh. Sie sagte, sie habe einige CDs aus der Gegend und wolle unbedingt einmal dorthin reisen.
»Ich würde alles geben, um diese Musik live zu hören.«
Sie waren ziemlich gut über das frühere Jugoslawien und den Krieg informiert. Ich konnte ihnen nicht viel Neues erzählen, sondern nur bestätigen, dass Milošević und Karadžić und all die anderen alles zerstört und eine große Verheerung auf der Landkarte hinterlassen hatten. Was sollte man da noch hinzufügen?
Sie erkundigten sich nach meiner Familie. Also erzählte ich ihnen, dass meine Eltern lange nach dem Krieg bei einem Autounfall umgekommen waren. Der Unfall ereignete sich irgendwo auf dem Land während der Fahrt zur Hochzeit meiner Schwester. Meine Eltern waren sofort tot, und ich musste froh sein, dass ich noch am Leben war, falls man das so sagen konnte. Ich nahm an der Beerdigung teil, musste wegen meiner Verletzungen aber über Monate hinweg immer wieder ins Krankenhaus. Seither hatte ich Gedächtnisprobleme.
In Wahrheit wollte ich mich an nichts erinnern. Ich hatte über Frauen gelesen, die aus eigenem Willen erblindeten, nachdem sie Augenzeugen von Kriegsgräueln geworden waren. Sie wollten keine weiteren Schrecken miterleben, und ihre Blindheit schien ein unbewusster Selbstschutz zu sein. Indem sie die Augen vor dem Schlimmsten verschlossen, verloren sie ihr Augenlicht. Vielleicht war es in meinem Fall ähnlich. Ich wollte bestimmte Kindheitserlebnisse vergessen. Man konnte es als freiwilligen Gedächtnisverlust bezeichnen. Die einfachere Erklärung bestand natürlich darin, dass ich bei einem schweren Autounfall am Kopf verletzt worden war und seitdem an Amnesie litt.
Ich bildete mir gern ein, dass ich reinen Tisch gemacht hatte und hier ganz von vorn begann. Früher hatte ich kein Leben gehabt, und ich konnte mich an kaum etwas erinnern.
»Warum hast du dir ausgerechnet dieses Land ausgesucht?«, fragte Kevin, der es vermutlich nicht böse meinte.
»Ich finde es sehr sympathisch«, antwortete ich vorsichtig, weil ich nicht wieder in ein Fettnäpfchen treten wollte. »Und ziemlich neutral.«
»Neutral?«
Ich erzählte nach kurzem Zögern, dass ich eine Weile in Deutschland gelebt hatte. Aber ich hatte mich dort nicht wohlgefühlt. Ich hatte zwar nichts gegen die Deutschen, sah mich aber immer gezwungen, ihr Land zu loben. Hier seien die Menschen vorurteilsfreier, vielleicht auch nachsichtiger, sagte ich. Sie würden offener mit Fehlern aus der Geschichte umgehen.
»Lass ihn in Ruhe«, sagte Helen lächelnd.
Sie diskutierten kurz miteinander, als wäre ich gar nicht da. Sie führten eine vertraute Diskussion, der ich nicht folgen konnte. Helens Tonfall verriet mir, dass sie mich verteidigte, mir Wörter in den Mund legte. Dann verstummten sie, als wäre die Sache nicht so wichtig. Er lachte und legte mir einen Arm um die Schultern.
»Das ging schnell.«
Da fiel mir ein, dass ich noch nichts von meiner Reise an die Südküste erzählt hatte.
»Übrigens habe ich deinen Rat befolgt und bin nach Dursey Island gefahren«, sagte ich.
Das überraschte sie. Helen sah Kevin an, doch er schien zu grübeln und hielt den Kopf gesenkt.
»Dursey Island«, sagte sie. »Du hast ihn nach Dursey Island geschickt?«
»Wohin denn sonst?«, sagte er und sah ihr endlich in die Augen.
»Bist du in der Seilbahn mit den Schafen übergesetzt?«
»Nein, nicht mit den Schafen«, antwortete ich, als bedürfte dieser Punkt besonderer Klärung.
»War es zugleich sonnig und regnerisch?«
Doch sie erwartete nicht, dass ich antwortete. Sie sah nur Kevin an. Ich blieb stumm, denn sie hätten ebenso gut allein dasitzen können, am Rand der Klippen mit Blick auf den Ozean. Sie schauten einander an, und ich hatte das Gefühl, in ihr Schlafzimmer geplatzt zu sein.
4
Einige Tage später rief ich Kevin an, um das Honorar für den Job bei seiner Mutter auszuhandeln. Er lachte über einen meiner Fehler: Ich sagte, es würde »doppelt so wenig« kosten, wie ich zu Anfang geschätzt hatte. Er wies mich auf den Fehler hin und bot an, mir den Vorschuss am gleichen Abend zu geben, so dass ich das Material kaufen und am nächsten Morgen mit der Arbeit beginnen konnte.
Es war ein Freitagabend, und ich trank nach Feierabend mit einigen Arbeitskollegen ein Bier. Ich arbeitete bei einer mittelgroßen Baufirma, die ein gutes Dutzend fest angestellter Mitarbeiter hatte. Wohnhaussanierung. Ich verbrachte meine Zeit mit dem Einsetzen renovierter Türen, dem Einbau neuer Türschwellen, dem Austausch schadhafter Holzdielen und Fußleisten. Der Chef nannte mich beharrlich Vim. Ich berichtigte ihn mehrmals und wies ihn darauf hin, dass ich Vid hieß, doch er blieb bei Vim. Andere Arbeiter nannten mich Viddo. Da mein Vorname nicht mehr weiter abgekürzt werden konnte, zum Beispiel zu Pat oder Joe, konnten sie ihn nur verlängern. Also hieß ich Viduka, Vidukalic oder Vidulator, manchmal auch Vib, der Vibrator, oder eben Vim, das ätzendste Desinfektionsmittel gegen Keime im Haushalt. Der Chef sagte, er werde mich behalten, weil ich die Dinge zu einem Abschluss brachte, und nicht, weil ich so ein guter Bautischler war. Er hätte problemlos bessere Tischler als mich finden können, aber ich hatte ein Händchen dafür, eine runde Sache aus einem Job zu machen. Ich glaube, dass meine Sorgfalt manche Kollegen irritierte, aber das hielt sie nicht davon ab, mich nach Feierabend einzuladen, mit ihnen einen zu zischen, wie sie es nannten.
Ich wurde vom Höhepunkt ihrer Feier aufgesogen. Es kam mir so vor, als feierten sie eine große Party anlässlich des Endes der Welt, um noch einmal so richtig einen draufzumachen. Sie kannten jede Menge Ausreden und Phrasen, die darauf hinausliefen, dass sie jung und noch lange nicht tot waren. Sie waren wild entschlossen, ihr Leben zu genießen, sich für all die hinter ihnen und vermutlich noch vor ihnen liegenden schlechten Zeiten zu entschädigen. Sie sagten ständig an, wie viel sie noch saufen und wie viel Spaß sie haben würden. Sie amüsierten sich königlich, das war offensichtlich, aber ich hatte den Verdacht, dass sie nicht den Augenblick genossen, sondern nur der Wirklichkeit entkommen wollten; vielleicht traten sie einfach einen Schritt zurück und bliesen alles zu einer tollen Geschichte auf, vielleicht konnten sie nur zuschauen, wie ihr Leben an ihnen vorbeizog.
Ich weiß beim besten Willen nicht mehr, wie der Laden hieß. Es war eine Bar im traditionellen Stil, mit einer Bühne, auf der drei Gitarristen standen und Lieder schmetterten, die die meisten Gäste auswendig kannten, ob jung oder alt.
Ein Lied handelte von einer Frau namens Nancy Spain. Es ging um einen Ring, der ihr geschenkt worden war und den sie verloren hatte. Bei jedem Refrain stimmte der ganze Pub in die große Frage ein, wo Nancy Spains Ring geblieben war. Hatte sie ihn verloren? Hatte sie ihn verschenkt? Ich fragte die neben mir sitzenden Männer, wer die Frau war und was mit dem Ring passiert war. Sie wussten es genauso wenig wie ich, ahnten aber, dass die Frage offenbleiben musste. Manche Dinge existieren nur, weil nach ihnen gefragt wird. Alle konnten sich vorstellen, was ein verlorener Ring bedeutete, und sie machten fröhlich mit, zeigten auf den Ringfinger und wiederholten bei jedem Refrain die Geste des Wegschenkens.
Ich traf einen Elektriker, der auf der neuen Baustelle die Kabel verlegt hatte. Ein cooler Typ, Ende fünfzig und mit Ziegenbärtchen. Er unterhielt sich fast geistesabwesend mit mir, ließ die Band nicht aus den Augen und erzählte mir schließlich von einem Kerl namens Dev, der alles »total ruiniert« habe. Ich glaubte zunächst, es wäre ein Kollege vom Bau, und wollte wissen, ob es sich um einen anderen Elektriker handelte. Alle lachten. So war es oft: Man sagte etwas, ohne zu ahnen, dass es komisch war. Sie klärten mich darüber auf, dass Dev die Abkürzung für De Valera war, eine historische Persönlichkeit, ein Mann, über den ältere Leute redeten, als könnte er jederzeit in den Pub schneien und ein Bier bestellen.
Der Elektriker nutzte die Gelegenheit, um mir einen Überblick über die irische Geschichte zu geben. Ich hörte aufmerksam zu, während er von Internierungslagern und Hungerstreiks erzählte. Er nannte Orte und Daten, die mir nichts sagten, aber manche Frauen zusammenzucken ließen. Offenbar hatten die Sorgen der Nation immer noch einen gewissen Sexappeal – nicht nur in meiner Heimat, sondern auch hier. Sie sprachen davon, wie schlecht die Dinge »da oben« in Nordirland stehen würden. Eine Frau meinte, es sei wunderbar, dass es die Checkpoints und die Razzien in aller Herrgottsfrühe nicht mehr gebe, ganz zu schweigen von den Autobomben und zerschossenen Kniescheiben. Trotzdem schien die Vergangenheit immer noch einen großen Reiz auf sie auszuüben. Da gab es viel Leidenschaft. Viele Männer auf der Flucht. Seit dem Beginn des Friedensprozesses, sagte sie, liege ein Geruch nach Desinfektionsmitteln in der Luft, und sofort lachten wieder alle.
Ich verkniff mir weitere dumme Fragen, und sie nannten mich Freund, jedenfalls vorübergehend.
»Wenn dir jemand Ärger macht, polieren wir ihm die Fresse.«
Das Wort »polieren« verwirrte mich anfangs, denn ich dachte dabei an den Polier auf der Baustelle. Sie brachten mich ständig zum Lachen. Jeder lachte schallend oder hielt sich den Bauch vor Lachen. Ich merkte nicht, dass ich dabei war, mich in Ärger hineinzureiten, und war deshalb vollkommen verblüfft, als mir der Elektriker am Ende die Fresse polieren wollte.
Sie nannten einander den ganzen Abend »Knackers«, was ich erst für einen Scherz hielt, denn es bedeutete eigentlich Abdecker. Ich merkte erst nach einer Weile, dass es sich um eine andere Bezeichnung für die »Travellers« handelte, umherziehende Leute wie die Roma in meiner Heimat. Anders als die in Häusern wohnenden braven Bürger lebten sie am Straßenrand in Wohnwagen, jedenfalls bevor dies für illegal erklärt wurde. Ich hatte sie auf meinen Reisen durch das Land gesehen, und man hatte mir erklärt, dass sie von einem gewissen Cromwell vertrieben worden waren, noch so eine verhasste Gestalt aus der irischen Geschichte. »Knacker-drinking« war ein Begriff, mit dem man beschrieb, dass jemand in aller Öffentlichkeit soff.
Allmählich begriff ich, dass Dev, Cromwell und Margaret Thatcher zu den verhasstesten Menschen in diesem Land gehörten. Danach kamen »Knackers« und »Drecksäcke«, dann Junkies, Drogenlords und die Leute, die Krallen an Autos anbrachten, und zu guter Letzt Künstler und Umweltschützer. Am verhasstesten schien eine alte, vor langer Zeit verstorbene Frau namens Peig Sayers zu sein, die in ärmlichen Verhältnissen auf den Blasket Islands gelebt, stets ein Kopftuch getragen und alle gezwungen hatte, Gälisch zu sprechen. Die gefährlichsten Leute waren laut ihren Worten die Schizophrenen, denn sie waren schwer zu erkennen. Sie erglühten nachts leider nicht grün wie Zombies, denen auch noch alle Haare ausfielen. Man konnte nie wissen, wann man sich in Gesellschaft eines Schizos befand. Noch verhasster als alle zusammen waren allerdings die Schmarotzer, denen man nicht über den Weg trauen konnte, wie es hieß.
Ich hatte keine Ahnung, zu welcher Kategorie ich gehörte. Mein Problem bestand darin, dass ich die Einheimischen nicht einordnen konnte. Ich vertraute allen im gleichen Maße. Ich wusste nicht, wem ich aus dem Weg gehen und welche Straßen ich ganz meiden musste.
Im Laufe des Abends schloss ich Bekanntschaft mit einem Mädchen namens Sharon. Sie hatte viele Strähnchen, der Nabel ihres nackten Bauches war mit einem Diamanten dekoriert, und sie hatte Tätowierungen auf den Armen und direkt über dem Po, die alle nach unten wiesen. Sie fragte, ob ich auch tätowiert oder gepierct sei, was ich zu meiner Beschämung verneinen musste. Im Pub gab es jede Menge Typen mit Tätowierungen auf dem Hals, aber sie schien nicht an ihnen interessiert zu sein.
Ihr Lachen klang wie Gewehrfeuer, und ich hielt sie anfangs irrtümlich für eine alte Frau. Sie brachte mich immer wieder zum Lachen, und schließlich bat ich sie, damit aufzuhören, weil ich das Gefühl hatte, platzen zu müssen. Sie lobte mein Englisch und lotste mich vor die Tür, obwohl ich nicht rauchte.
So kam es zu dem Missverständnis. Sie entpuppte sich als Tochter des Elektrikers, mit dem ich mich unterhalten hatte, und er war nicht gerade begeistert über unser Techtelmechtel.
»Komm bloß nicht auf falsche Gedanken«, zischte er mir im Vorbeigehen zu.
Ich hatte vermutlich einen über den Durst getrunken, deutete die Signale nicht richtig und ahnte nichts von der drohenden Gefahr.
Die Band spielte den Song der Bee Gees über einen Mann im Todestrakt, was ich wohl als Warnung hätte auffassen müssen. Im Fernseher, der in einer Ecke der Bar stand, lief ein Spielfilm ohne Ton, weil jeder die Geschichte kannte. Ich glaube, es war Der Pate. Al Pacino versuchte seiner Schwester weiszumachen, dass er ihren Mann nicht hatte ermorden lassen.
Und ich wurde durch die Hintertür des Pubs in einen Unterstand geführt, den man für die Raucher errichtet hatte. Sharon nannte ihn Pagode. Wir setzten uns, doch sie holte keine Zigaretten, sondern einige in Alufolie verpackte Pillen heraus. Sie schluckte eine und bot auch mir eine an, doch ich lehnte ab.
Dann stand sie auf und tanzte zu einem imaginären Techno-Beat, der viel kraftvoller als die im Pub erklingenden Pop-Balladen war. Sie schien mich nicht mehr wahrzunehmen. Schließlich wollte sie mich küssen, packte mich am Nacken und stieß mir die Zunge in den Mund. Mit der anderen Hand griff sie nach meinen Eiern.
»Zeig deinen Schwanz«, verlangte sie.
Ich zögerte so lange, bis sie ungeduldig wurde und nach dem Reißverschluss tastete. Ich stand neben mir, wusste nicht, ob es eine Störung oder eine Rettung war, als ihr Vater erschien, flankiert von zwei Freunden.
»Sharon«, brüllte er. »Rein mit dir.«
»Ah, verpiss dich, Dad.«
Er kam auf uns zu. Seine Freunde blieben für den Fall der Fälle in der Tür stehen. Sharon stritt sich laut schreiend mit ihrem Vater. Es ging um mich. Sie behauptete, alt genug zu sein und es mit jedem treiben zu dürfen, der ihr gefalle, und dies sei nicht mehr das »heilige, katholische Irland«, in dem man seine Tochter nur mit einem bewaffneten Anstandswauwau aus dem Haus lasse.
»Dein Baby ist sechs Monate alt, Sharon«, sagte er.
»Schon gut«, unterbrach ich die beiden und schwankte zur Tür. Ich wollte einfach nur, dass alle der Musik lauschten und Freunde waren. Doch ich war hier überhaupt nicht mehr gefragt.
»Bleib, wo du bist, Polackenschwein.«
»Ich fasse es nicht«, sagte Sharon.
»Der Typ ist nur ein Penner und Schmarotzer.«