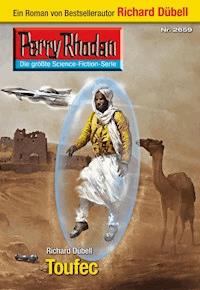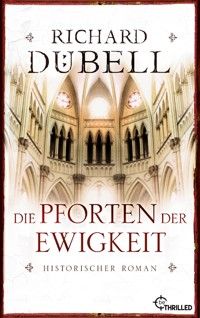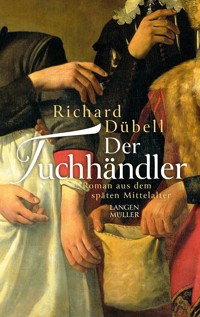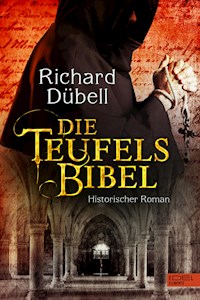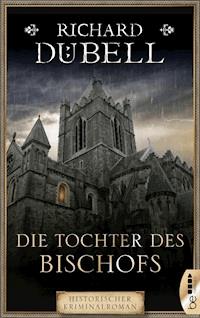7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Heiligabend 1845: Gut Briest ist tief verschneit, ein Schneesturm hält die Region in Atem. Alvin von Briest, seine Frau Louise und sein kleiner Sohn Moritz erwarten ungeduldig die Ankunft von Paul Baermann, einem Freund des Hauses. Doch Paul kommt nicht. Sein Zug ist nie in Genthin angekommen. Alvin ist beunruhigt – bei diesem Wetter kann ein Zugunglück den Tod bedeuten. Gemeinsam mit seinem Freund Otto von Bismarck wagt er sich hinaus in den Sturm, um Paul zu suchen. Louise bleibt mit Moritz auf Gut Briest zurück. Um ihrem Sohn die Angst zu nehmen, erzählt Louise ihm die mittelalterliche Geschichte vom »Hirten«. Auch sie kann nur auf ein Weihnachtswunder hoffen. Wird Alvin Paul noch rechtzeitig finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Heiligabend 1845: Gut Briest ist tief verschneit, ein Schneesturm hält die Region in Atem. Alvin von Briest, seine Frau Louise und sein kleiner Sohn Moritz erwarten ungeduldig die Ankunft von Paul Baermann, einem Freund des Hauses. Doch Paul kommt nicht. Sein Zug ist nie in Genthin angekommen. Alvin ist beunruhigt – die Temperaturen fallen, und er weiß, bei diesem Wetter kann ein Zugunglück den Tod bedeuten. Gemeinsam mit seinem Freund Otto von Bismarck wagt er sich hinaus in den Sturm, um Paul zu suchen. Louise bleibt besorgt mit Moritz auf Gut Briest zurück. Um ihrem Sohn die Angst zu nehmen, erzählt Louise ihm die mittelalterliche Geschichte vom »Hirten«. Auch sie kann nur auf ein Weihnachtswunder hoffen. Wird Alvin Paul noch rechtzeitig finden?
Weihnachten mit Alvin, Louise und Paul – bekannt aus dem Erfolgsroman Der Jahrhundertsturm.
Der Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen bei Landshut. Als Autor von historischen Romanen stürmt er seit Jahren die Bestsellerliste. Inzwischen ist er aber auch als Krimiautor bekannt.
Homepage des Autors: www.duebell.de
In unserem Hause sind von Richard Dübell bereits erschienen:
In der Reihe »Ein Peter-Bernward-Krimi«:
Allerheiligen · Himmelfahrt
Außerdem:
Der Jahrhundertsturm
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1224-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München
Titelabbildung: © bürosüd° GmbH, München
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Der Jahrhundertwinter
Teil 1
Gut Briest, Dezember 1845
Manchmal musterte Louise ihr Gesicht im Spiegel, nur um sicherzustellen, dass sie selbst es war, die ihr daraus entgegenblickte. In den letzten Jahren war das Leben gut zu ihr gewesen. Sie war diese Güte gar nicht mehr gewöhnt gewesen. Es fiel ihr immer noch schwer, auf ihre Fortdauer zu vertrauen. Zuweilen fragte sie ihr Spiegelbild in Gedanken: Louise von Briest, du bist weit gekommen, seit du Louise Ferrand warst und Alvin dich aus dem Elendsviertel in Paris herausgeholt hat; hast du das auch verdient?
Jetzt betrachtete sie ihr Konterfei erneut, aber nur, weil es draußen nicht viel zu sehen gab. Sie blickte zum Fenster des Salons von Gut Briest hinaus in Richtung Gutseinfahrt; die Kerze, die neben ihr auf dem Fenstersims stand, ließ ihr Gesicht in der Fensterscheibe spiegeln. Draußen war alles grau und weiß. Die Welt verschwand in diesem weiß-grauen Gewirbel, nicht einmal die Kapelle zwischen der Gutseinfahrt und dem Herrenhaus war zu sehen. Verrückt. Ein Schneesturm wie dieser am Heiligen Abend! Am späten Vormittag hatte er mit aller Wucht eingesetzt. Jetzt war es früher Nachmittag. Wenn es so weiterging, würden sie am Weihnachtstag eingeschneit sein.
Moritz, der auf dem Teppich vor dem Kamin saß und mit den Krippenfiguren spielte, murmelte vor sich hin. Louise wandte sich ab und lächelte den Zweieinhalbjährigen an. Moritz war in seine Figurenkonstellation vertieft und beachtete sie gar nicht.
Der Kleine war einer der Gründe, warum sie empfand, dass das Leben gut zu ihr war. Er und ihr Ehemann Alvin von Briest, der sie liebte und dessen Liebe sie aus tiefstem Herzen erwiderte. Der dritte Grund war Paul Baermann, Alvins bester Freund – den Louise ebenfalls liebte. Im Grunde genommen war sie eine Katastrophe, diese Liebe, die sie zu den beiden Männern in gleichem Maß empfand und von der nur Paul etwas wusste, aber nicht Alvin … Sie wollte beide Männer behalten, obwohl ihr der Gedanke an Alvin, wenn sie bei Paul gewesen war, stets das Herz gebrochen hatte, so wie es ihr jetzt das Herz brach, an Paul zu denken. Die Sehnsucht war immer groß, immer schmerzhaft und immer süß. Eigentlich hätte sie das Leben verfluchen müssen, das ihr dieses Dilemma eingebrockt hatte, doch die Dankbarkeit, dass sie eine solche Liebe zweimal erfahren durfte, war größer.
Sie seufzte. Paul war auf dem Weg hierher, mit dem Zug auf der neu erbauten Bahnlinie, die von Berlin nach Magdeburg verlief. Dieses Weihnachten würde sie ihre beiden Männer beisammenhaben. Außer einer freundschaftlichen Umarmung und langen Blicken würde sie nichts mit Paul austauschen können, aber das war egal. Hauptsache, er war hier.
Verstohlen betrachtete sie Moritz. Sein bei Geburt dunkles Haar hatte im Herbst begonnen, sich aufzuhellen und einen rötlichen Stich zu bekommen. Sie ahnte, dass er, wenn es sich vollends rot gefärbt haben sollte, seinem Vater plötzlich frappierend ähneln würde. Seinem rothaarigen Vater Paul Baermann, der von seiner Vaterschaft ebenso wenig wusste, wie es Alvin klar war, dass Moritz nicht von ihm war! Und das durften beide Männer auch niemals erfahren. Selbst wenn es bedeutete, dass sie in Zukunft Moritz unter irgendeinem Vorwand verstecken musste, wenn Paul zu Besuch war, Paul, der als Ingenieur einen viel klareren und schärferen Blick hatte als der romantische Gutsverwalter und Offizier Alvin. Doch über diese Brücke würde sie gehen, wenn es so weit war. Dieses Weihnachten, das Weihnachten des Jahres 1845, war es noch nicht so weit.
Seit ihrer Heirat mit Alvin und ihrem Einzug als Gutsverwaltersgattin auf Briest hatte Louise einiges darüber gelernt, wie gänzlich verschieden die preußischen Weihnachtsbräuche von denen in Paris waren. Im Salon von Gut Briest stand ein geschmückter Christbaum, eine Tanne, den Alvin aus eigener Tasche hatte bezahlen müssen, denn Tannen waren selten und teuer, und Levin von Briest, Alvins älterer Bruder, der das Gut geerbt hatte, war ein Geizkragen. Dutzende kleiner Wachskerzen waren mit Draht an den Zweigen befestigt. Zwischen den Ästen hing Weihnachtsgebäck in allen möglichen Formen: Engelsfiguren, Sterne, Tiere. Den Figuren in den unteren Regionen fehlten bereits ein paar Gliedmaßen, ein Beweis dafür, dass Moritz die Gunst der Stunde zu nutzen wusste, wenn Louise ihre Aufmerksamkeit von ihm abwendete.
Louise war der Brauch, einen Christbaum aufzustellen, nur von den deutschen Nachbarn in La Villette bekannt gewesen, dem ärmlichen Viertel, aus dem Alvin sie herausgeholt hatte. Auch die Deutschen in La Villette hatten sich keine Christbäume leisten können, aber sie hatten davon gesprochen. Bevor Louises Vater sich wegen seiner Spielschulden umgebracht und die Ferrands noch in dem schönen großen Haus an der Seine gewohnt hatten, waren Mistelzweige und Weihnachtssterne der traditionelle Schmuck gewesen. Ein Bund aus Misteln fand sich auch unter dem Weihnachtsschmuck auf Gut Briest – er hing neben dem Kamin von der Decke. Alvin bestand darauf, seit er gelernt hatte, dass man sich darunter am Neujahrstag küssen durfte und so dafür sorgte, dass einem die Liebe erhalten blieb.
In einer Hinsicht hatte Louise allerdings darauf bestanden, dass das Brauchtum ihrer Heimat die preußischen Gepflogenheiten ablöste. Am Heiligen Abend gab es auf Briest keinen Eintopf zu essen, sondern das Réveillon, ein Festmahl mit Pasteten, Truthahn und Champagner. Alvin dazu zu überreden, war allerdings nicht schwer gewesen. Louise vermisste die Austern, die traditionell zum Réveillon gehörten, aber man konnte nicht alles haben … und der französische Champagner, den aus dem Bestand seines väterlichen Gutes Schönhausen zu liefern Otto von Bismarck für sich in Anspruch nahm, war der beste, den Louise je getrunken hatte.
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit nach draußen, weil sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrgenommen hatte. Zwei Gestalten tauchten auf einmal aus dem Schneegestöber auf, eine davon so hochgewachsen und breitschultrig, dass es selbst der wild um sie herumflatternde, weite Kutschermantel nicht verbergen konnte. Sie liefen aufs Herrenhaus zu, polterten zur Eingangstür herein und standen gleich darauf im Salon, einen Schwall Kälte mitbringend. Das Hausmädchen huschte hinter ihnen herein und half ihnen aus den Mänteln. Beide stiegen vorsichtig über die von Moritz über den halben Raum verteilten Krippenfiguren und stellten sich mit den Rücken zum Feuer, die Jackenschöße hochgehoben, um sich zu wärmen. Ihre Gesichter waren rot vor Kälte, die Haare zerzaust, ihre Augen blitzten.
Louise lehnte sich gegen das Fenstersims und verschränkte die Arme. »Und? Wisst ihr jetzt mehr als das, was man von hier drinnen sieht, nämlich dass das Wetter katastrophal ist?«
»Haben nun zumindest die … hmmmm … Bestätigung aus erster Hand dafür«, erwiderte der hochgewachsene Mann. Er war blond, trug einen Schnauzbart und hatte eine helle, kratzige Stimme, mit der er manchmal stockend sprach.
Der andere Mann war ebenfalls groß, aber schlanker und dunkelhaarig. Er lächelte. »Louise, mein Schatz, ich hoffe, wir haben genügend passende Teller und Besteck. Wir werden einer mehr für das Réveillon. Otto kann bei diesem Wetter unmöglich nach Schönhausen zurückreiten.«
Der andere Mann straffte sich. »Bin sehr dankbar, aber unmöglich. Ist mein erstes Weihnachten auf Schönhausen seit Vaters Tod. Der Gutsherr kann das Fest nicht anderswo verbringen. Würde außerdem nur stören.«
Louise sagte: »Unsinn, Herr von Bismarck. Sie bleiben hier. Nicht mal ein Reiter wie Sie käme bei diesem Wetter bis nach Schönhausen. Mit Ihrem Besuch, um uns ein frohes Fest zu wünschen, haben Sie uns heute Vormittag schon viel Freude bereitet. Sie verlängern diese Freude, indem Sie bleiben.«
Bismarck räusperte sich verlegen.
Alvin klopfte ihm auf die Schulter. »Damit wäre alles gesagt, Otto. Außerdem – das schwöre ich dir – willst du Louises französisches Abendmahl nicht versäumen. Schon gar nicht die Biskuitrolle zum Dessert! Was gäb’s denn auf Schönhausen?«
»Eintopf«, erwiderte Bismarck düster.
»Nur schade, dass Sie Lily nicht mitgebracht haben«, erklärte Louise, die nicht widerstehen konnte, Bismarck einen kleinen Stich zu versetzen. »Paul kommt auch zu Besuch. Er hätte sich sicher gefreut, seine Schwester wiederzusehen.«
»Ja … hmmmm … sehr schade«, sagte Bismarck, dem man ansehen konnte, dass er sich innerlich wand. Louise betrachtete es mit Vergnügen. Es war eine Art Sport zwischen ihr und dem jungen Gutsbesitzer, mit dem Alvin seit Jahren befreundet war. Bismarck nutzte jede Gelegenheit, um bei Banketten und Einladungen über Frankreich herzuziehen, selbstverständlich nie, ohne zu betonen, dass er damit nur die französischen Politiker meinte und nicht das französische Volk und schon gar nicht die formidabelste Vertreterin dieses Volks, nämlich Louise von Briest. Louise wiederum rieb Bismarck bei jeder passenden Gelegenheit sein Verhältnis zu Pauls Schwester unter die Nase. Bismarck hatte Lily auf Louises und Alvins Hochzeit kennengelernt und sie unter dem äußerst fadenscheinigen Vorwand, er brauche eine Haushälterin, auf sein Gut Kniephof in Pommern mitgenommen. Als er in diesem Herbst Schönhausen nach dem Tod seines Vaters Ferdinand übernommen hatte, war Lily auf Kniephof geblieben.
Louise erlöste Bismarck aus seiner Verlegenheit; sie lachte und sagte: »Es ist schön zu wissen, dass Sie bleiben, Herr von Bismarck. Auf Schönhausen gibt es nur leere Zimmer und ein einsames Mahl vor dem Kamin. Hier gibt es Wärme und Freundschaft.«
»Du hast doch ohnehin kaum Vorräte auf Schönhausen, oder?«, fragte Alvin. »Die Kartoffelfäule hat dich genauso schlimm erwischt wie die meisten.«
Bismarck nickte. Die Zustände auf den Kartoffelfeldern waren seit langem besorgniserregend. Vor vier Jahren hatte die Krankheit zu einem katastrophalen Ernteausfall in den amerikanischen Staaten geführt, jetzt hatte es die europäischen Länder erwischt. Irland nagte am Hungertuch. Schönhausen hatte ebenfalls fast die gesamte Ernte verloren. Alvin war glücklicher weggekommen, weil er aus Geldmangel mehrere verschiedene, zum Teil unpopuläre Kartoffelsorten hatte anbauen lassen. Viele von ihnen waren nicht befallen worden.
»Und mit Paul verstehst du dich doch auch blendend«, erklärte Alvin. Otto und Paul hatten sich ebenfalls auf der Hochzeit kennengelernt, nachdem Alvin ihnen schon wechselseitig voneinander erzählt hatte.
»Was mich darauf bringt, dass Paul schon lange eingetroffen sein müsste, oder nicht?«, fragte Louise.
Alvin nickte. »Der Schneesturm wird den Zug aufhalten. Deshalb sind Otto und ich zur Gutseinfahrt gegangen, um zu sehen, ob der Schlitten vielleicht gerade eintrifft. Der kommt durch den Schnee auch nur langsam voran.«
Einer der Gutsknechte war auf Alvins Geheiß mit einem Pferdeschlitten nach Genthin gefahren, dem nächstgelegenen Bahnhof von Briest aus, um Paul abzuholen. Der Zug von Berlin nach Magdeburg, seit dem Herbst in Betrieb, hielt dort regulär an.
»Wann hätte der Zug eintreffen sollen?«, fragte Bismarck.
»Fahrplanmäßig um kurz nach elf Uhr. Dann noch mal eineinhalb Stunden mit dem Wagen von Genthin bis nach Briest.«
Bismarck spähte auf die Standuhr im Salon. »Zwei Stunden überfällig.«
Er sagte es ganz gelassen, aber Louise hatte plötzlich das Gefühl, dass etwas Unheilverkündendes in seiner Stimme zu hören war.
Etwas später sah Moritz so plötzlich auf, dass Louise, die neben ihm auf dem Boden saß und die Krippenfiguren sortierte, zusammenzuckte. Irgendwie hatte eine Handvoll Zinnsoldaten ihren Weg in das Krippenarrangement gefunden – ein paar Offiziere in Preußischblau samt einem Feldherrn mit weitem Mantel und einem Unteroffizier in Hemdsärmeln, der einen Spaten über der Schulter trug. Sooft sie sie beiseitelegte, räumte Moritz sie wieder zu den anderen Figuren dazu.
Alvin saß mit Bismarck vor dem Feuer; die beiden hatten sich in ihren Sesseln leise raunend die Köpfe über die Unwägbarkeiten des Lebens als Gutsherr heißgeredet. Beide Männer standen auf. Sie hatten es auch gehört – das leise Klingeln von Glöckchen.
Alvin lächelte. »Der Schlitten ist da«, sagte er. »Gehen wir Paul begrüßen.«
Es stellte sich heraus, dass der Schlitten ohne Paul von Genthin zurückgekehrt war. Der durchgefrorene Knecht erklärte mit klappernden Zähnen, dass der Zug irgendwo weit vor Genthin stecken geblieben sein musste. »Die ham eenen mit nem Gaul von Genthin aus losjeschickt det Gleis lang, der kam nach ner Stunde wieder und sagte, det er den Zug nich jefunden hätte und det er umjekehrt wäre, weil vor lauter Schnee die Schienen nich mehr zu sehen jewesen wären.« Der Knecht schniefte und wischte sich die Nase mit dem Jackenärmel. »War halb erfroren, der Ärmste. Die Eisenbahner ham ihn mit nem Schnaps wieder uffjetaut.« Er schielte hoffnungsvoll zu dem Tablett mit den Karaffen. »Det ick nüscht Falschet sage – zwee Schnaps waren’s!«
»Die haben einen Reiter losgeschickt?«, fragte Bismarck. »Funktioniert der … hmmmm … optische Telegraf nicht? Haben doch zwei oder drei Stationen zwischen Genthin und Brandenburg.« Dann beantwortete er seine Frage selbst. »Natürlich nicht. Sicht gleich null.«
Louise fing Alvins besorgten Blick auf.
»Wenn der Zug entgleist ist …«, sagte er.
»Es reicht schon, wenn er stecken geblieben ist, Alvin«, unterbrach Louise. »Für die kleinen Öfen in den Waggons reicht das Feuerholz nicht ewig. Und wenn die Öfen erlöschen, dann wird es kalt – bitterkalt.«
»Was unternimmt das Personal in Genthin?«, fragte Alvin den Knecht.
Der Knecht zuckte mit den Schultern. »Noch’n Schnaps trinken?«
Nun wechselten Alvin und Bismarck bedeutungsvolle Blicke. Ein schwaches Lächeln huschte über Bismarcks Züge. Louise kannte das Lächeln. Es kam immer dann, wenn Bismarck sich anschickte, seiner Abenteuerlust freien Lauf zu lassen.
»Ein halbes Dutzend Männer mit zwei großen Schlitten«, sagte Bismarck.
Alvin nickte. »Und Decken, übriger Kleidung, Laternen, Feuerholz …«
»Schaufeln«, sagte Bismarck.
»Lebensmittel«, sagte Alvin.
»Ersatzpferde«, sagte Bismarck.
»Fackeln«, sagte Alvin.
»Verbandszeug«, sagte Louise.
Die beiden Männer starrten sie an.
Louise warf die Hände in die Luft. »Schaut mich nicht so an. Wenn der Zug verunglückt ist, kann es Verletzte gegeben haben.« Ihr wurde übel vor Angst bei diesem Gedanken, aber sie bemühte sich, klar zu denken.
»Sie hat recht«, sagte Alvin.
»Nicht zu … hmmm … leugnen«, sagte Bismarck.
»Männer!«, sagte Louise und machte sich daran, die Ausrüstung zu organisieren, während Alvin und Bismarck den enttäuschten Knecht mit nach draußen nahmen, um die Rettungsmannschaft auf die Beine zu stellen.
Der Plan war simpel. Alvin, Bismarck und die beiden Pferdeschlitten würden fast geradewegs nach Osten aufbrechen, in Richtung auf Brandenburg zu. Auf diese Weise mussten sie nördlich von Genthin auf die Gleise stoßen und konnten sich an ihnen entlang weiterarbeiten, gegen die Fahrtrichtung. Irgendwann mussten sie auf den Zug stoßen. Ob sie die Schienen überhaupt finden würden, wenn schon der Helfer, der vom Genthiner Bahnhof aufgebrochen war, versagt hatte, war eine andere Frage. Aber lieber, das war Bismarcks Credo, unternahmen sie etwas Idiotisches, bevor sie gar nichts unternahmen.
Die Knechte waren nicht begeistert, aber sie waren es gewöhnt zu gehorchen. Der Autorität, die Otto von Bismarck an den Tag legte, konnte ohnehin niemand Widerstand leisten. Alvin sorgte für die positive Motivation, indem er mit ein paar Schnapsflaschen aus dem Privatbestand seines Bruders in den Hof trat, sie in die Satteltaschen seines Pferds steckte und versprach, sie unterwegs immer wieder kreisen zu lassen.
Die Schlitten mit den Knechten darauf und die beiden Reiter – Alvin und Otto – wurden schon vom Schneetreiben verschluckt, bevor sie an der Kapelle vorbeikamen.
Louise bildete sich ein, das Klingeln der Glöckchen noch eine Weile zu hören, aber was sie tatsächlich vernahm, war das Knacken und Ächzen des auf einmal still gewordenen Gutshauses. Die Flocken wirbelten seltsam lautlos gegen das Fenster. Man hätte meinen sollen, dass ein Schneesturm dieser Stärke den Wind heulen ließ, aber die Flocken tanzten stumm.
Das Hausmädchen servierte Louise Kaffee und für Moritz eine Chocolat; ein weiterer Brauch, den Louise aus Paris mitgebracht hatte und den Alvin lächelnd duldete, obwohl die Preise für die Schokolade ruinös waren. Aber er und sie hatten ihre ersten vertraulichen Worte über einer Tasse Chocolat miteinander gewechselt, als sie sich in Paris kennengelernt hatten. Das Getränk besaß für ihn einen romantischen Wert.
»Det is’n Unglück, so een Unglück, Frau Hauptmann«, murmelte das Hausmädchen. »Die armen Menschen in dem Zug!«
»Danke«, sagte Louise, obwohl sie sich am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Sie hatte die beherrschte, überlegte Frau vorhin nur gespielt. In Wahrheit drückte ihr die Angst um Paul das Herz ab.
Moritz stand plötzlich auf. »Papa?«, fragte er. »Onkel Otto?«
»Papa und Onkel Otto sind losgefahren, um Paul abzuholen«, sagte Louise heiser.
Louise erschrak, als sich das Gesicht des Kleinen unvermittelt verzerrte und er zu schluchzen begann.
»Papa!«, stieß er hervor.
»Der Herr Hauptmann kommt ja bald wieder, Kleener«, versuchte das Hausmädchen, den weinenden Moritz zu trösten. »Soll ick ihm noch eene Schocklade machen, Frau Hauptmann?« In den Augen der gemütvollen Frau standen Tränen angesichts Moritz’ Kummer.
»Ja, bitte.«
Moritz stand mit hängenden Armen vor dem Christbaum und schluchzte. Louise kniete vor ihm nieder und nahm ihn in die Arme. Moritz klammerte sich an ihr fest. »Was hältst du davon«, flüsterte sie ihm ins Ohr, »wenn ich dir eine Geschichte erzähle, bis Papa und Onkel Otto und Paul da sind?«
»Tut man det ooch in Paris, wo Sie herkommen, Frau Hauptmann?«, fragte das Hausmädchen. Sie klaubte ächzend Moritz’ Tasse auf. »Jeschichten erzählen an Heilichabend vor die Bescherung?«
»Nein, das habe ich erst hier gelernt.«
»Det hab ick jeliebt, mein Vater un meine Onkels vorm Baum an Heilichabend, und jeder hat ne Jeschichte erzählt und hat vasucht, die annern zu übertrumpfen. Meine Jeschwister und ick ham jar nich jemerkt, wie die Zeit vergeht!« Das Hausmädchen seufzte in seliger Erinnerung. »Mit solche roten Backen ham wir dajesessen und jelauscht!«
»Geschichte«, sagte Moritz unter Tränen.
Louise setzte sich auf den Boden und zog Moritz auf den Schoß. »Lass mal sehen, welche Geschichte mir einfällt …«
»Ick mach dann noch eene Schocklade«, sagte das Hausmädchen, sichtlich unwillig, den Salon zu verlassen.
Louise ging auf, dass die junge Frau die Geschichte auch hören wollte. Trotz ihrer Sorge um Paul musste sie lächeln. »Wenn du mit der Chocolat kommst, fangen wir an«, sagte sie.
»Ick flieje!«, rief das Hausmädchen und rannte hinaus.
Louise dachte nach. Welche Geschichte kannte sie, die sie Moritz erzählen konnte? Und dem Hausmädchen? Ihr wurde bewusst, dass sie nur eine einzige Weihnachtsgeschichte kannte, und die stammte noch nicht einmal aus Frankreich. Sie hatte sie von einer der deutschen Familien in La Villette gehört. Angeblich war sie tatsächlich geschehen, vor langer Zeit, dort, wo Louises Nachbarn gelebt hatten … hmmm …
Gedankenverloren nahm sie eine der Figuren von der Krippe auf. Es war ein Hirte mit einem Schaf auf den Schultern, aus Gips geformt und leicht beschädigt. Sie stellte den Hirten auf den Teppich.
»Hier«, sagte sie. »Das ist der Ritter Rainald von Mandach. Er ist der Held dieser Geschichte. Und das …«, sie sah sich nach weiteren Figuren um und fand einen Hirtenknaben mit einer Flöte, »… ist Rainalds Sohn Johannes. Er ist ein bisschen älter als du. Und das …«, ein weiterer Hirtenknabe, der auf dem Boden kauerte und ein Lamm auf dem Schoß hielt, »… ist Blanka. Sie ist Rainalds Tochter. Lass sehen, wen brauchen wir noch …?« Louise begann, sich für ihre selbstgestellte Aufgabe zu erwärmen. Im gleichen Maß kehrte die Erinnerung an die Geschichte zurück. »Richtig, wir brauchen Rainalds Pferd! Caesar!« Zu spät fiel ihr ein, wie die Geschichte anfing.
Moritz hatte den Esel bereits aus der Krippe genommen und hielt ihn hoch. »Caesar!«, sagte er.
Louise räusperte sich. Jetzt konnte sie nicht mehr zurück. »Ja«, sagte sie zögernd und legte den Esel neben die drei anderen Figuren, »aber Caesar ist … äh … krank …«
Moritz streichelte die Figur des Esels tröstend.
Louise biss sich auf die Lippen.
»Caesar muss sterben?«, fragte Moritz.
»Wir brauchen noch eine Figur«, stieß Louise hervor, in der Hoffnung, dass sie den Anfang der Geschichte so schnell erzählen konnte, dass Caesars Schicksal an Moritz vorüberflog, »wo nehmen wir die her …?«
Sie fand eine Figur, deren Gesicht vom vielen Anfassen blank gerubbelt war und die eine undefinierbare Kutte trug. Dabei fiel ihr auf, dass Moritz drei seiner Zinnsoldaten vor der Heiligen Familie aufgebaut hatte – einen der Soldaten, den Unteroffizier im Hemd und den Feldherrn. Die Zinnfiguren waren deutlich kleiner als die massigen Gipsfiguren von Josef, Maria und dem Jesuskind.
»Sind das die Heiligen Drei Könige?«, fragte sie lächelnd. »Die muss es doch auch von den Originalfiguren geben, die würden besser dazu passen …« Sie wollte die Figuren beiseiteschieben.
Moritz packte ihre Hand. »Papa, Paul und Onkel Otto«, sagte er und deutete auf die drei Zinnfiguren.
Louise starrte sie sprachlos an. Moritz hatte auf den preußischen Offizier, den hemdsärmeligen Unteroffizier, der gar nicht wie ein Soldat aussah, und den Feldherrn gedeutet. Der Mantel, den der Feldherr trug, sah aus wie der weite Kutschermantel, in dem Otto von Bismarck auf Gut Briest angekommen war.
»Was … was tun die drei da?«, hörte sie sich fragen.
»Kommen heim«, sagte Moritz.
Louise schluckte. Ihr Herz pochte schwer.
»Geschichte?«, fragte Moritz.
Die Tür öffnete sich. Das Hausmädchen kam mit einer dampfenden Tasse herein. »So, kleener Herr, hier is die Schocklade«, sagte sie und kniete vor Moritz nieder. »Jestatten Frau Hauptmann, det ick die Jeschichte ooch höre?«
»Deshalb habe ich gewartet«, sagte Louise, aber sie lächelte wie abwesend und betrachtete immer noch die drei Zinnfiguren. Eine große, halb abergläubische Angst um alle drei Männer stieg auf einmal in ihr auf. Gab es nicht Dutzende von Legenden, in denen jemand an Heiligabend von alten Sünden eingeholt wurde? Sie fröstelte. Sie kannte ihre Sünde genau. Und auch wenn sie sie nur aus Liebe begangen hatte, war es doch eine Sünde. Würde die Sünde sie nun heute einholen, indem ihr die zwei Männer genommen wurden, die sie liebte, und dazu Otto von Bismarck, der bei aller Aufgeblasenheit und Selbstgerechtigkeit immer ein treuer Freund gewesen war?
Louise neigte nicht zu Frömmigkeit, doch jetzt wäre sie am liebsten hinaus zur Kapelle gelaufen und hätte für die Sicherheit der Männer gebetet.
»Geschichte?«, fragte Moritz noch einmal.
»Ja«, sagte Louise und räusperte sich. Sie stellte die gesichtslose Figur, die sie in einer kalt gewordenen Hand gehalten hatte, ab. »Die Geschichte …«
Der Hirte
Teil 1
Die Kapelle war wenig mehr als ein Holzgerüst, in das Weiden- und Haselzweige geflochten und mit Lehm und Erde verschmiert worden waren; das Dach bestand aus Reisigbündeln. Rainald stampfte den Schnee von seinen Stiefeln und kniete ächzend nieder. Er bekreuzigte sich, sah auf das nackte Kruzifix aus behauenen Baumstämmen und wusste nicht, was er sagen sollte.
»Da sind wir nun, Herr«, sagte er schließlich. Er räusperte sich. Von draußen hörte er die Stimme Blankas, ohne verstehen zu können, was die Sechsjährige gesagt hatte. Er hörte eine Antwort in einer unwesentlich tieferen Tonlage: Johannes, drei Jahre älter. »Da sind wir nun«, sagte er zum zweiten Mal. »Alle drei. Die gesamte Familie.« Sein Atem schwebte vor ihm in der Düsternis der Kapelle.
Plötzlich fiel ihm ein, dass er das Schwert noch an der Hüfte trug. Mit vor Kälte tauben Fingern nestelte er die Verschlüsse auf und legte die Waffe neben sich auf den Boden. In den Falten der hellen Lederwicklung am Griff und in der Ziselierung der Parierstange war noch getrocknetes Blut zu sehen, schwarzbraun in der Finsternis. Was er mit Schnee hatte reinigen können, hatte er gereinigt. Er hatte nicht gut gesehen, weil Tränen in seinen Augen gestanden hatten und er sie versucht hatte wegzublinzeln, damit seine Kinder ihn nicht weinen sahen.
»Der zweite Streich war der Schlimmste. Ich starrte Caesar in die Augen und sah das Licht darin schwinden und wusste, dass ich noch einmal würde zuschlagen müssen, um sein Leiden zu beenden.« Er bemerkte, dass er laut gesprochen hatte. Das nackte Kreuz erwiderte nichts. »Ich habe ihn als Fohlen bekommen. Da war ich Knappe. Ich habe ihn aufgezogen und eingeritten. Als Johannes auf die Welt kam, trug er mich aus einem Hinterhalt, obwohl zwei Pfeile in seinem Fleisch steckten – er rannte einfach allen anderen Pferden davon. Auf dem Schlachtfeld vor Iconium stupste er mich so lange mit der Schnauze an, bis ich erwachte; die meisten von den anderen Verwundeten kamen um. Natürlich weißt Du das alles, Herr, genauso wie Du weißt, dass ich nicht anders konnte, als ihn zu töten. Mit dem gebrochenen Bein war nichts mehr zu machen. Die Wölfe hätten ihn sonst gekriegt.« Rainald schwieg einen Augenblick. »Du weißt das alles, Herr, daher bitte ich Dich, mir zu sagen, dass ich das Richtige getan habe, weil ich es selbst nicht weiß.«
Das Kruzifix schwieg. Die Astlöcher schauten ausdruckslos an Rainald vorbei zur Stirnseite der Kapelle, wo das trüber werdende Nachmittagslicht hereinsickerte, als zögere es vor der mächtigen Gestalt, die in der Kapelle kniete. Rainald seufzte.
»Herr, ich vertraue Dir zwei Leben an: das meines Erstgeborenen Johannes und das meiner Zweitgeborenen Blanka. Ohne das Pferd können wir die Didrichsburg kaum vor Einbruch der Nacht erreichen; wir kommen bis Trier, aber dorthin kann ich mich nicht wenden. In der Nacht werden die Wölfe kommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Herr, bitte hilf mir, damit ich meinen Kindern helfen kann.« Er biss die Zähne zusammen, und weil der Schmerz immer noch zu tief war, flüsterte er nur mit gepresster Stimme: »Und schau gnädig auf die Seele Sophias. Sie war eine Heilige im Leben; nimm sie in Dein Reich auf und sage ihr, ich zähle die Tage, bis wir wieder vereint sind.«
Die Kinder hatten einen Kreis in den Schnee gestampft. Blanka trippelte von einem Bein auf das andere. Rainald konnte sehen, dass sie kurz davorstand zu weinen, was unweigerlich dazu führen würde, dass sie keinerlei vernünftigem Argument mehr zugänglich war und nur mit Brüllen und Schubsen vorwärtsbewegt werden konnte. Zumindest fiel Rainald in diesen Situationen nichts anderes ein als zu brüllen und zu schubsen. Johannes’ dunkler Blick war undeutbar.
»Was ist?«, fragte Rainald. Die Stimmung, die in der Kapelle über ihn gekommen war, war bereits verflogen.
»Ich habe was gehört«, sagte Johannes.
»Und was?«
»Ich weiß nicht …«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.