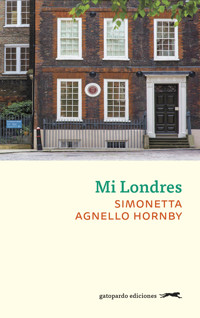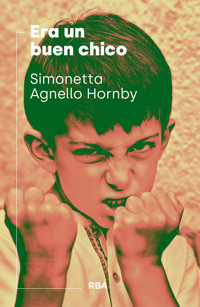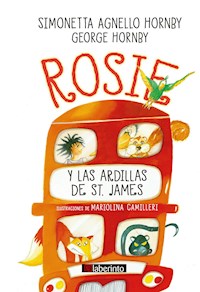12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sizilien Anfang des 20. Jahrhunderts: Die bildschöne Maria wächst als Tochter des Anwalts Ignazio Marra in wohlbehüteten Verhältnissen auf. Ihre Eltern sind außergewöhnlich liberal und erziehen Maria zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Doch als der reiche, deutlich ältere Bergwerksbesitzer Pietro Sala um Marias Hand anhält, sagt das lebenslustige Mädchen ja – aus einer Mischung aus Neugier und Vernunft heraus. Ihr Herz gehört jedoch Giosué, der als Ziehsohn in ihrer Familie aufwuchs. Zunächst versucht Maria, Pietro eine gute Ehefrau zu sein. Als der Lebemann aber immer mehr seiner Spielsucht anheimfällt, sucht Maria die Nähe von Giosué. Der Beginn einer jahrelangen heimlichen Liebe, die auch vor dem Hintergrund der bewegten Zeit immer gefährlicher wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Sizilien Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts: Die bildschöne Maria wächst als Tochter des Anwalts Ignazio Marra in wohlbehüteten Verhältnissen auf. Ihre Eltern sind außergewöhnlich liberal und erziehen Maria zu einer eigenständigen Persönlichkeit. Doch als der reiche, deutlich ältere Bergwerksbesitzer Pietro Sala um Marias Hand anhält, sagt das lebenslustige Mädchen Ja – aus einer Mischung aus Neugier und Vernunft heraus. Ihr Herz gehört jedoch Giosuè, der als Ziehsohn in ihrer Familie aufwuchs. Zunächst versucht Maria, Pietro eine gute Ehefrau zu sein. Als der Lebemann aber immer mehr seiner Spielsucht anheimfällt, sucht Maria die Nähe von Giosuè. Der Beginn einer jahrelangen heimlichen Liebe, die auch vor dem Hintergrund der bewegten Zeit immer gefährlicher wird.
Autorin
Simonetta Hornby wurde 1945 in Palermo geboren und lebt seit über dreißig Jahren als Anwältin in London. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Italiens. Ihr erster Roman, »Die Mandelpflückerin«, erschien 2003 auf Deutsch. Mit »Der Jasmingarten« ist ihr wieder ein ganz großer Bestseller gelungen.
Simonetta Agnello Hornby
Der Jasmingarten
Roman
Aus dem Italienischenvon Verena von Koskull
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Caffè amaro« bei Feltrinelli, Mailand.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung August 2017
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Giangiacomo Feltrinelli Editore
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: © MICHAEL NELSON/arcangel images
mary gaudin /getty images
FinePic®, München
Redaktion: Viktoria von Schirach
BH · Herstellung: han
ISBN: 978-3-641-20794-6V002
www.goldmann-verlag.deBesuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1 Eine altmodische Verlobung
Groß und funkelnd wie der Karren der heiligen Rosalia dröhnte der Isotta Fraschini die Via Grande empor, die sich durch das Dorf Camagni schlängelte. Unter dem Stoffverdeck am Lenkrad saß Pietro Sala – schwarze Ledermütze, blaue, wattierte Jacke, Fliegerbrille, Schal –; neben ihm Leonardo, ebenfalls mit Mütze, Brille und zweireihigem, grauem Staubmantel. In jeder Kurve schrammte der Wagen haarscharf an den Hauswänden entlang. Zahlreiche Augenpaare spähten ängstlich durch die Fensterläden.
Die Via Grande war wie leergefegt. Mit Vorräten und Waren beladene Lasttiere waren hastig an die Eisenringe längs der Treppen gebunden worden, die in die Straße mündeten. Wie aufgeschreckte Ameisen hatten sich die Menschen mitsamt ihren Schubkarren, Fuhrwerken und Kutschen in Sicherheit gebracht. Fremde drängten sich in den Eingängen der Palazzi und auf den Türschwellen der Läden zusammen, die Fuhrleute hatten ihre Karren dicht an die Mauern gelenkt und den Maultieren eine Decke über den Kopf geworfen. Hier und da ertönte ein Eselsschrei oder ein entgeisterter Ausruf. Die Hunde waren in Lauerstellung. Die Eingangstreppen und Kirchenstufen hatten sich in Tribünen und Zufluchtsstätten verwandelt.
Als das von unbelebter Energie getriebene Gefährt vorbeizog, brachen die Schüler des Convitto Nazionale, die sich auf den Schulbalkonen drängten, in begeisterten Applaus aus. Das genügte, um die Normalität wiederherzustellen. Die Hunde kläfften, die Menschen strömten neugierig auf die Straße. Trotz des Auspuffqualms, der in Augen und Nase brannte, rannten die Kinder dem Wagen nach. Wer sind diese Leute? Was machen sie hier? Wo fahren sie hin? Was ist das für ein Auto? In der letzten Kurve verlangsamte der Isotta Fraschini, nahm dann Anlauf und landete schließlich auf dem kleinen Platz vor dem barocken Palazzo Tummia.
Vor der eigens von Blumentöpfen frei geräumten, blitzblank geputzten Pförtnerloge – der Fußboden glänzte, es roch nach Seifenlauge – stand Don Totò bereit, um den Schwager des Hausherrn, Barone Peppino Tummia, in Empfang zu nehmen. Ein letztes Aufbrüllen des Motors, ein Schwenk des Steuerrades, und der Isotta Fraschini passierte das Tor. Pietro sprang aus dem Wagen. Nachdem er Don Totò und die Stallburschen flüchtig begrüßt hatte, stürmte er die Treppe zum Piano nobile hinauf und ließ den verschwitzten Leonardo zurück, der der kleinen, stetig anwachsenden Menschentraube, die sich um ihn und das Auto scharte, eine ausführliche Schilderung der höchst abenteuerlichen Reise aus Fara lieferte. »Und, gefällt dir das Auto?«, fragte Don Totò. Leonardo warf ihm einen langen Blick zu und knöpfte sich den Überrock auf, der ihm bis auf die Schuhe reichte und unter dem eine Kutscherlivree zum Vorschein kam. »Nein. Ich bin der Kutscher der Familie Sala, wie schon mein Vater Don Ciccio, und genau das bleibe ich!«
Das Schlafzimmer der Barone Tummia war zweigeteilt: Auf der einen Seite befand sich das eigentliche Schlafzimmer, in das Caterina, das Hausmädchen der Baronin, Pietro eingelassen hatte, und auf der anderen, versteckt hinter einem Vorhang, ein Salon, der am Ende der Repräsentationsräume lag. Vollständig angekleidet lehnte Giuseppina Tummia in den Kissen und häkelte. Als ihr die Ankunft ihres Bruders angekündigt wurde, setzte sie sich auf, legte die Handarbeit beiseite und breitete sich das Schultertuch sittsam über die nackten Füße.
»Pietru, was für eine Freude, dich zu sehen … Du warst seit Ewigkeiten nicht mehr hier.«
Pietro ließ sich unbefangen auf der Bettkante nieder und plauderte sogleich drauflos, damit seine ältere Schwester keine Fragen stellen oder ihm Vorwürfe machen konnte. Vergeblich.
»Ich begreife nicht, wie unser Vater dir erlauben konnte, mit dem Automobil zu kommen. Auf diesen Straßen! Das ist lebensgefährlich, für dich und für die Hunde. Die kommen vor Schreck noch unter die Räder, und dann gerät der Wagen ins Schleudern, und du bezahlst mit deinem Leben!«
»Der Fortschritt hat eben seinen Preis. Ein Reiter riskiert dafür, vom Pferd zu fallen oder Schlimmeres. Und vergiss nicht, dass ich ein Glückspilz bin … das wird bei den Autos nicht anders sein. Bei der ›Targa Florio‹ letztes Jahr hat der Isotta Fraschini glänzend abgeschnitten, er ist absolut zuverlässig. Ich werde schon nicht umkommen, das verspreche ich dir!« Pietro ergriff die Hand der Schwester und küsste sie. »Dein Mann hat mir erzählt, Fuma Vecchia stehe zum Verkauf und euer Schwager Ignazio Marra sei damit betraut. Ich sehe ihn heute Vormittag. Ich würde gern ein Jagdrevier daraus machen und den Turm zu einer Sommerfrische umbauen. Dann wären wir Nachbarn und würden uns häufiger sehen.«
»Sobald deine erste Begeisterung verflogen ist, wirst du es genauso fallen lassen wie das Haus in Palermo, das Ducrot für dich eingerichtet hat. Wie lang hat es dich dort gehalten? Zwei oder drei Monate? Dir gefällt es nur in Monte-Carlo!« Giuseppina blickte auf ihre Häkelarbeit und schüttelte den Kopf. »Noch so eine Flause!« Und dann: »Wie geht es Mamà?«
»Wie immer: Sie sitzt glücklich zwischen ihren jungen Nonnen und häkelt Stolas, genau wie du«, sagte er mit einem schwer zu deutenden, leicht gereizten Gesichtsausdruck. Dann verabschiedete er sich von seiner Schwester und versprach, bis Mittag zurück zu sein.
Mit lästiger Beharrlichkeit stemmte der Wind sich in den engen Straßen gegen die Passanten, die so taten, als kümmerte sie der Fremde nicht, der erhobenen Hauptes und forschen Schrittes an ihnen vorüberlief.
»Amerikaner?«, fragte die Zuckerbäckerin.
»Nicht doch! Der muss Italiener sein«, antwortete ihre Enkelin.
»Was will er hier?«
»Keine Ahnung«, entgegnete die Enkelin zerstreut.
»Besser Amerikaner als Italiener. Die bringen wenigstens Geld, statt uns mit ihren Steuern auszuplündern!«
»Viel besser!«, rief eine Kundin, die gerade eine Tüte Kringel gekauft hatte. »Die Italiener rauben uns die Söhne! Denkt nur an all die schmucken Kerle, die der Militärdienst und der Krieg in Afrika uns genommen haben!«
Die Hausmeisterloge schien verwaist. RECHTSANWALTIGNAZIOMARRA stand auf einem Schild an der Eingangstür. Niemand war da, um Pietro zu empfangen, doch dann tauchte eine Hand aus dem Dunkel auf, bedeutete ihm mit kreisendem Zeigefinger, die Treppe in den zweiten Stock hinaufzusteigen, und dann mit gerecktem Daumen, auf die Klingel zu drücken.
Süßer Jasminduft lag in der Luft. Pietro sog ihn tief ein, jeder Atemzug erfüllte seine feine Nase mit Wohlgefühl. Auf den Stufen waren tappende Schritte zu hören, dann war es wieder still. Vor dem weit geöffneten Fenster auf dem Treppenabsatz hing eine üppige Kaskade rosig-weiß blühender Zweige. Ein dunkelhaariger Junge drückte sich in die Ecke neben dem Fensterrahmen und spähte gebannt in den Hof hinunter. Als er Pietro bemerkte, fuhr er zusammen, lupfte die Mütze und setzte seinen Abstieg fort.
Ignazio Marras Büro war nüchtern eingerichtet: mit Büchern und Aktenordnern gefüllte Vitrinen, ein Schreibtisch und Stühle aus dunklem Holz. Zwei Drucke an der Wand verrieten seine politische Zugehörigkeit: ein betagter Francesco Crispi mit Walrossbart und ein junger, versonnener Giuseppe Mazzini. Die geschäftliche Unterredung dauerte nur kurz – Pietro akzeptierte die vom Verkäufer geforderte Summe und verlangte nur den Turm vor der Unterschrift noch besichtigen –, und die beiden wollten gerade auseinandergehen, als Kindergeschrei zum Fenster emporschallte. Neugierig beugte sich Pietro hinaus. »Alle Achtung! Ich hatte den üblichen Innenhof erwartet, doch das ist ja ein grünes Paradies. Ist das Ihr Werk?« Pietro hatte dem Schwager seiner Schwester gegenüber einen familiären Ton angeschlagen.
Da Ignazio kein Haus auf dem Land besaß, hatte er den Hof in ein idyllisches Refugium verwandelt, wo man der sommerlichen Hitze entgehen, Besuch empfangen und die Kinder spielen konnten.
»Die Pflanzen haben sich den Hof geradezu einverleibt«, sagte er stolz. »Ringsherum habe ich eine Art Korridor frei gelassen, auf den die Wirtschaftsräume und das Speisezimmer hinausgehen, und entlang der Mauern zwölf Sträucher Kletterjasmin gepflanzt. Inzwischen ist er bis zu den Fenstern emporgewachsen. Der Duft gibt mir das Gefühl, auf dem Land zu sein, und außerdem hält er die Mücken fern.«
In der Mitte des Hofes erhob sich eine mit blühenden Rosen überwachsene Gartenlaube, von der vier buchsbaumgesäumte Pfade abgingen.
»Der einzige Luxus, den ich mir gegönnt habe, ist die moderne Glastür zum Speisezimmer.« Er deutete in Richtung der mit Terrakottafliesen gepflasterten runden Terrasse davor, die mit gusseisernen Tischen, Stühlen und Bänken, Kübelbäumchen sowie zwei nackten Frauenstatuen bestückt war. Direkt unter dem Bürofenster lag ein kleiner Duftgarten mit Lavendel, Rosmarin, Salbei, Oregano, Zitronengras und Lorbeerbäumen, in der Mitte eine Glyzinienlaube, in deren Schatten zwei Frauen saßen und ein Tischtuch bestickten. Der Gemüsegarten lag vor der Küche: Töpfe mit Petersilie, Minze und Basilikum, ein schmales, rechteckiges Beet mit blühenden Auberginenpflanzen und dichten Bananenstauden. Von hier oben hatte Ignazio den gesamten Garten im Blick. Unter den großen Bananenblättern stand eine greise Frau – vermutlich eine alte Magd – in einem dunkelblauen Kleid mit spitzengesäumter Haube und hellblauer Schürze und hängte nasse Taschentücher in die Lorbeerzweige, ohne sie festzuklammern. Ignazio deutete auf zwei konzentrische Kreise: ein Rondell aus Zitrusbäumen, zwischen deren glänzendem Laub sich wie Girlanden die Wäscheleinen spannten, eingefasst von einem zweiten Kreis aus Weinreben. »Damit man die aufgehängte Wäsche nicht sieht«, erklärte er. Dann entschuldigte er sich kurz und wandte sich dem Pförtner zu, der gekommen war, um ihm ein Schreiben zu überbringen.
Pietro blickte wieder hinaus. Zwei Jungen rannten hinter einem höchstens acht Jahre alten Buben her, der mit einer Zwille in der Hand über Hecken und Beete durch den Garten stob, hinter die Büsche sprang und rief: »Die kriegt ihr nicht! Das ist meine! Meine!« Die beiden Stickerinnen in der Laube, von denen die eine grau, die andere weiß gekleidet war, folgten den Kindern mit ihren Blicken. Die Weißgekleidete, deren Haar zu einem glänzenden Zopf geflochten war, erhob sich und lief den beiden kleinen Jungen nach. Sie war selbst blutjung. Sie überholte die beiden und bekam den kleinen Ausreißer zu fassen, der keinen Widerstand leistete. Die zwei Verfolger waren ohne einen Mucks stehen geblieben. Der Hautfarbe und den Gesichtszügen nach mussten sie Brüder sein. Auf einen Wink des Mädchens traten die drei gefügig näher, blinzelten zu ihr empor und ließen den mit ruhiger, klarer Stimme vorgetragenen Tadel in verzückter Andacht über sich ergehen. Ungeniert nahm Pietro das Mädchen in Augenschein: dichtes, kastanienbraunes Haar, ovales Gesicht, olivfarbener Teint, kräftige Brauen, dunkle Augen, gerade Nase und volle Lippen. Und als hätte sie ihn ebenfalls verhext, konnte er die Augen nicht mehr von ihr lassen: wie sie so dastand, aufrecht und leicht außer Atem, in ihrem hochgeschlossenen weißen Musselinkleid mit dem engen Mieder und dem geraden, mit einer Schoßfalte versehenen Rock, stellte sie nichts ahnend ihren Körper zur Schau – Busen, Hintern, Schenkel –, als wäre sie nackt, und je länger Pietro sie ansah, desto beredter und schöner erschienen ihm ihre ebenmäßigen Züge mit den großen, strahlenden, mandelförmigen Augen. Das Mädchen schwieg. Alles stand still. Dann hob sie die Hand und fuhr den dreien zärtlich über die Locken. Nacheinander drückten die Jungen ihr einen Kuss auf die Wange und trotteten, der Kleine in der Mitte, kleinlaut ins Haus. Die Zwille in der Hand blickte sie den Kindern liebevoll nach. Abermals betrachtete Pietro die perfekt geformte sich hebende und senkende Brust, die schmale Taille, den anmutig geschwungenen Rücken. Schleppenden Schrittes schlurfte die Alte auf das Mädchen zu. »So ist es recht, gut gemacht!«, lobte sie mit der überlauten Stimme der Schwerhörigen.
»Danke, Maricchia«, entgegnete das Mädchen und streichelte ihr über den Arm.
Dann kehrte sie zu ihrer Stickerei zurück, stimmte leise und gefühlvoll ein neapolitanisches Liebeslied an und wiegte den Kopf dazu im Takt. Pietro lauschte. Ignazio, der sich zu ihm gesellt hatte, hörte ebenfalls zu.
»Wer ist sie?«
»Meine Tochter.«
»Sie ist wunderschön …«, murmelte Pietro, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
Während ihre Finger über das Leinen huschten, sangen, tuschelten und lachten die Mädchen. Die Graugekleidete hatte ein unscheinbares Gesicht und schien die Ältere zu sein. Emsig stichelte sie vor sich hin. Auch die andere ließ die Nadel kaum sinken, gönnte sich jedoch hin und wieder eine kleine Pause. Mal beobachtete sie einen Spatz, der herabschoss, um einen Wassertropfen vom Brunnen zu erhaschen, mal sah sie den vorbeiziehenden Wolken nach, immer wieder wandte sie den Kopf, um zu sehen, wer den Hof betrat, und beschenkte jeden Neuankömmling mit einem strahlenden Lächeln und einem Winken. Dann wandte sie sich wieder ihrer Stickarbeit zu, strich mit der Hand darüber, nahm die Nadel auf und fiel erst mit der neuen Strophe in den Gesang der anderen ein.
Ab und zu hielten die beiden inne, um sich mit neuem Garn zu versorgen. Mit der kleinen Schere, die an einem Band vor ihrer Brust hing, schnitt das Mädchen ein Stück Faden ab, nahm die Nadel zwischen die Finger und machte sich ans Einfädeln: Ihre Zungenspitze blitzte zwischen den vollen Lippen hervor und benetzte das Fadenende. Wenn der Faden dennoch nicht durch das Nadelöhr passen wollte, ging sie abermals sorgfältig mit der Zunge darüber, spitzte ihn an, hob die Nadel und nahm mit halb geöffneten Lippen und gerecktem Kinn das Öhr ins Visier, derweil die schlanken Finger ihrer Linken den Faden von oben nach unten glatt strichen und drehten, bis der kapriziöse Hauptdarsteller ihrer Stickerei sich endlich fügte. Es waren rhythmische, zeremonielle Gesten wie die einer Priesterin. Berückend. Sinnlich. Heftiges Verlangen überkam Pietro. Er versuchte den Blick abzuwenden – vergeblich.
Ein Windstoß erfasste die nachlässig in den Lorbeerbaum gehängten Taschentücher. Sie wehten empor und verfingen sich in den obersten Zweigen. Die Alte kreischte auf. Sogleich kamen andere Frauen aus der Küche gelaufen, doch das Mädchen war schneller. Ohne zu merken, dass es beobachtet wurde, kletterte es in den Baum und pflückte die Tücher herunter. Pietro betrachtete ihre anmutigen Gesten, den wohlgeformten Körper, das erhitzte Gesicht, die lockigen Strähnen, die sich aus dem Zopf gelöst hatten und ihr in die Stirn fielen, den prallen Busen. Seine Erregung wuchs. Als es alle Taschentücher beisammenhatte, reichte das Mädchen sie der Alten, kehrte zur Freundin zurück und nahm die Handarbeit wieder auf. Die beiden sangen A cura ’e mamma. Als hätte es den Blick des Fremden bemerkt, rückte das Mädchen seinen Stuhl unter die Laube. Pietro beugte sich vor, um sie wieder in den Blick zu bekommen. Leise vor sich hin singend spähte sie verstohlen in Pietros Richtung und lächelte. Pietro wünschte, dieses Lächeln gälte ihm, ihm allein. Er begehrte sie. Wollte sie berühren. Besitzen. Er verschlang sie mit den Augen und spürte ohne jede Scham, wie sein Glied anschwoll.
»Wie heißt sie?«
»Maria.«
Es folgte eine lange Stille. »Maria … Maria …«, murmelte Pietro. Er sah Ignazio an, atmete tief durch und richtete sich auf. »Würden Sie sie mir geben?«
2 Ein Tag, der alle ratlos macht
Die Mittagsstunde war längst vorüber. Leise verkochte der Nudelauflauf im Ofen. Die Familie Tummia hatte sich im Salon versammelt und wartete verärgert auf Pietro. »Lasst uns zu Tisch gehen! Ich sterbe vor Hunger!«, jammerte die siebzehnjährige Carolina, doch niemand schenkte ihr Gehör. Giuseppina schalt ihren Mann dafür, dass er ihren Bruder in der verrückten Idee, Fuma Vecchia zu kaufen, bestärkt hatte. »Wie konntest du ihn nur mit deinem Schwager zusammenbringen? Wo doch alle Welt weiß, dass Ignazio Marra ein Sozialist ist, dem das Geld durch die Finger rinnt. Er hat das Leben deiner Schwester und seiner Kinder zerstört … dem würde ich keine Lira anvertrauen!«
»Lasst uns doch endlich essen! Die Pasta wird sonst ungenießbar!«, klagte Carolina.
Die Vorstellung von zerkochter Pasta brachte die Eltern dazu, ihre Diskussion zu beenden. Gerade wollten sie Leonardo zu den Marras hinüberschicken, als Pietro durch die Tür trat und um Verzeihung bat. »Aber ich habe einen sehr guten Grund für meine Verspätung: das Herz!« Er verkündete, er habe sich in Ignazio Marras Tochter Maria verliebt und beabsichtige, die Verlobung so bald wie möglich bekannt zu geben. »Danke, Peppino, dass du mir dazu geraten hast, Fuma Vecchia zu kaufen. Wir werden dort unsere Sommer verbringen, ganz in eurer Nähe!« Abwartend hielt Pietro inne, um die Glückwünsche für die zweite Vermählung zwischen den Familien Sala und Tummia entgegenzunehmen. Niemand sprach ein Wort.
»Was sagt Maria denn dazu, Onkel?«, traute sich Carolina schließlich zu fragen.
»Ich habe sie nur von Weitem gesehen. Sie wird sich freuen, sobald wir uns kennengelernt haben«, antwortete Pietro gelassen und sah seine Schwester an. Der Blickwechsel währte nur kurz, denn Giuseppina erlitt einen Schwächeanfall: Sie sackte aufs Sofa, ließ den Kopf gegen die Lehne sinken und fiel geflissentlich in Ohnmacht. Ungerührt zogen sich die beiden Männer Richtung Balkon zurück und sahen zu, wie Carolina ihrer Mutter routiniert Beistand leistete: Sie hielt ihr das Riechsalz unter die Nase und kniff sie in die Finger; währenddessen spitzte sie die Ohren, um sich die Unterredung zwischen Vater und Onkel nicht entgehen zu lassen. Pietro wollte unverzüglich mit Leonardo nach Fara aufbrechen, den Vater über seine Absichten in Kenntnis setzen und noch am selben Abend zurückkehren. »Ich werde selbst fahren!«
»Neiin!«, stöhnte Giuseppina, die just wieder zu sich gekommen war. »Nein … nein … tu das nicht! Fahr nicht, Pietruzzo …« Eine weitere Ohnmacht warf sie aufs Sofa zurück.
Die Männer blieben an der Balkontür stehen und musterten sie mit leichtem Ennui. »Was rätst du mir?«, fragte Pietro seinen Schwager.
»Du solltest wissen, dass die Familie Marra knapp bei Kasse ist. Er ist ein fähiger Anwalt, aber seine politischen Ansichten schmecken den Grundbesitzern nicht, sie haben nicht vergessen, wie leichtsinnig er sich in der Zeit der sizilianischen Arbeiterbünde für den Pöbel starkgemacht hat. Er hat nur wenige gut zahlende Mandanten. Neben den Kindern hat er noch zwei Aufständische unter seinem Dach, die Schwester und die Tochter eines Freundes aus dem Piemont, der entweder verschollen oder gestorben ist, und einen achtzehnjährigen Jungen, den Sohn des toskanischen Schuldirektors, der 93 während der Landarbeiteraufstände umgekommen ist. Und möglicherweise füttert er auch noch in Palermo das eine oder andere Fräulein durch … wovon meine Schwester nichts wissen darf, verstanden? Geld für die Mitgift hat er sicherlich keines, das braucht er für das Studium seiner Söhne. Ich erzähle dir das alles, weil dein Vater zu meiner Zeit lange um die Mitgift deiner Schwester gefeilscht hat.«
»Bei Maria wird das keine Rolle spielen«, entgegnete Pietro großspurig. »Außerdem bezog sich meine Frage auf die Ohnmachtsanfälle deiner Frau.«
»Ach so. Versprich ihr aber, dass Leonardo fährt. Und dann mach einfach, was du willst.« Unter dem Vorwand, selbst mit Leonardo sprechen zu wollen, verließ Peppino gekränkt das Zimmer.
Pietro gesellte sich zu den Frauen.
»Aber Onkel, wenn Maria nichts von deinen Absichten weiß und dich gar nicht kennt … dann seid ihr also noch gar nicht verlobt?«, fragte Carolina.
Pietro kam nicht dazu, ihr zu antworten.
»Du!«, zischte es matt vom Sofa. »Du!« Mit dem ausgestreckten rechten Arm deutete Giuseppina anklagend auf ihren Bruder. »Du, der du dich der Freundschaft mit Prinzen und Großherzögen rühmst! Du, der du dein Leben in den elegantesten Hotels der Welt verbringst! Du, der du dich so gern als mondäner Gastgeber gerierst! Du, der du den großen Kunstsammler gibst!« Ihre Stimme wurde mit jedem Satz lauter und giftiger. »Du, der du dich für einen Connaisseur hältst!« Dann überschlug sich die Stimme: »Du willst jetzt eine Landpomeranze zur Frau nehmen, die keine blasse Ahnung von der Welt hat, die noch nicht einmal Palermo kennt?! Die Tochter eines bettelarmen Sozialisten?! Dass ich nicht lache! Und unser Vater wird ebenfalls herzlich darüber lachen!« Mit diesen Worten sank Giuseppina in die Kissen zurück und rollte wild mit den Augen. Pietro erwiderte nichts. Gequält richtete sich Giuseppina auf und fuhr mit mühsam beherrschter Stimme fort: »Wenn du unbedingt eine Frau aus Camagni willst, dann nimm meine Tochter, die ist wenigstens von Stande!« Ohne ihren Bruder zu Wort kommen zu lassen, wandte sie sich an Carolina. »Würdest du deinen Onkel heiraten?«
Carolina, die alles stumm mit angehört hatte, sah ihren Moment gekommen: Breitbeinig kippte sie in den väterlichen Sessel und wurde ohnmächtig.
3 Ein Blitz aus heiterem Himmel
Titina war gerade im Esszimmer und erklärte dem neuen Dienstmädchen Maddalena – ein dralles Ding mit rabenschwarzem Haar, nicht älter als ihre Tochter –, wie der Tisch zu decken sei: »Die Brotkörbe stehen links und rechts von der Tischdekoration, die Suppenschüssel platzierst du vor meinem Mann«, als plötzlich Ignazio mit grimmigem Gesicht zur Fenstertür hereinstürmte und Maddalena mit einem barschen »Raus mit dir« entließ.
»Was ist denn los, Ignazio?« Titina war über das unziemliche Benehmen ihres Gatten nicht erfreut.
»Pietro Sala hat um Marias Hand angehalten.«
»Um Gottes willen! Wie kommt er dann darauf? Doch bestimmt nicht wegen der Mitgift!«
»Er hat mir zu verstehen gegeben, dass er im Bilde sei. Er weiß sehr gut, dass sie keine angemessene Mitgift haben wird, doch das ist ihm egal. Er hat sich verliebt, verstehst du?! Er war hier, in meinem Büro, vor einer Viertelstunde! Er beabsichtigt, Fuma Vecchia zu kaufen, und wollte gerade gehen, als er zufällig noch einen Blick in den Hof warf. Dort saßen Maria und Egle und stickten, und da hat ihn der Blitz getroffen!« Ignazio packte einen der Brotkörbe und schleuderte ihn auf den Tisch. »Ein Blitz. So wahr ich hier stehe.« Er blickte seine Frau eindringlich an. »Verstehst du, Titina? Er hat sie gesehen und wollte sie haben!«
»Keine Sorge, das geht vorüber«, konstatierte Titina resolut. »Ein Strohfeuer.« Dennoch konnte sie ihre Unruhe nicht verbergen. Sie griff nach den Salzstreuern und stellte sie wieder hin, überprüfte die Wasserkrüge, strich die Servietten glatt, faltete sie zusammen, glättete sie erneut und redete dabei unermüdlich vor sich hin. »Wir wissen doch von Giuseppina, was für ein Schürzenjäger er ist. Ein Nichtsnutz. Ein Leichtfuß. Der hat seinem armen Vater das Leben weiß Gott schwer gemacht!« Sie nahm die Fingerschalen vom Tisch, stapelte sie auf der Anrichte und stellte sie wieder zurück. »Er hat eine Schwäche für Damen von Welt. Meine Maria ist so unschuldig!« Sie drapierte die Likörgläser um die kristallene Rosolio-Flasche. »Er ist zu alt für sie. Und gut aussehen tut er auch nicht: klein, mit Brille … Er sieht aus wie ein Jude! Er ist älter als ich, er muss fast vierzig sein!«
»Aber ich sage doch, er hat sich verliebt, Titina. Verliebt! Verstehst du?«, beharrte ihr Ehemann. »Er will einen Hausstand gründen. Weshalb sollte er sich sonst ein Ferienhaus gleich neben dem seiner Schwester kaufen?«
»Und was hast du ihm geantwortet?« Endlich nahm Titina ihn ernst.
»Dass sie sich erst kennenlernen müssen. Maria entscheidet, sie allein. Ehrlich gesagt, wenn er ihr gefällt, ist Pietro Sala eine großartige Partie. Morgen sind wir alle in Fuma Nuova, und die beiden werden sich begegnen. Wenn’s passt, dann passt’s.«
»Aber Maria ist doch noch ein Kind!«
»In ihrem Alter warst du bereits Ehefrau und Mutter.«
»Mag sein, aber die Zeiten haben sich geändert.« Titina sprach jetzt leise und überdeutlich: »Du hast mir beigebracht, dass die Frau dem Mann ebenbürtig ist. Dass wir Frauen früher oder später das Wahlrecht bekommen werden. Du sagtest, Präsident Zanardelli habe das bereits erwogen. Und dass irgendwann vielleicht sogar die Scheidung möglich sein wird … Heutzutage heiraten die Frauen nicht mehr, sobald sie erwachsen sind. Sie studieren, arbeiten, unterrichten … Es gibt Lehrerinnen, die weit weg von zu Hause arbeiten und respektiert werden. Die Frauen von heute sind modern, und unsere Tochter ist die modernste von allen! Pianistin wollte sie werden, bis sie einsehen musste, dass wir es uns bei vier auszubildenden Söhnen nicht leisten können, sie aufs Konservatorium zu schicken!«
»Meine liebe Titina, sag bloß nicht, du hast es bereut, mich geheiratet zu haben …« Ignazio umfasste ihre Taille.
»Das habe ich ebenso wenig bereut wie das, was du mir beigebracht hast … Aber das waren andere Zeiten! Und außerdem … hast du mir gefallen, und ich habe mich in dich verliebt.« Titina streichelte ihm zärtlich über die Wange.
Nach dem Essen bat Ignazio seine Tochter, mit ihm im Esszimmer zu bleiben. So pflegte er es immer zu tun, wenn er mit seinen Kindern im Guten wie im Schlechten unter vier Augen reden wollte. Mit Maria, seiner Ältesten und dem einzigen Mädchen, waren diese Gespräche von besonderer, geradezu rührender Vertraulichkeit: Der Vater versuchte seine heiß geliebte Tochter politisch zu erziehen, und obgleich die Ausbildung seiner Söhne hätte Vorrang haben sollen, bestärkte er sie darin, jedem anderen Menschen ebenbürtig zu sein und sich in einer Welt, in der das Frauenwahlrecht noch undenkbar war, Respekt zu verschaffen. Widerstrebend trat Maria zu ihrem Vater an die Fenstertür, die auf den Garten hinausging. Viel lieber wäre sie Klavierspielen gegangen. Im Hause Marra gab es nur ein Piano, an dem man sich abwechseln musste. Seit Maria vierzehn geworden war und nicht mehr zur Schule ging, war das Instrument zu ihrem Refugium geworden: Kaum war es frei und sie hatte keine Hausarbeiten mehr zu erledigen – was selten vorkam –, flüchtete sie sich dorthin. Nach dem Mittagessen war es für sie reserviert, und sie verzichtete freiwillig auf die Mittagsruhe, um zu spielen. Das waren die schönsten Stunden des Tages für sie.
Wie die Mutter ihr aufgetragen hatte, beaufsichtigte Maria die ungeübte Maddalena beim Abräumen. Mit Gesten und vielsagenden Blicken half sie dem von der Anwesenheit des Hausherrn eingeschüchterten Mädchen, die benutzten Teller richtig zu stapeln, die Gläser und das saubere Besteck einzusammeln und die Servietten in ihre Ringe zurückzustecken, und raunte ihr hier und da ein ermunterndes »Gut gemacht!« zu, egal wie gut sie ihre Sache tatsächlich machte.
»Heute Morgen ist Pietro Sala bei mir gewesen, der Schwager deines Onkels Peppino. Er ist am Kauf von Fuma Vecchia interessiert, um den Turm in ein Sommerhaus umzuwandeln und das dazugehörige Jagdrevier zu nutzen.« Maria hörte geduldig zu. Sie wusste, dass der Vater bei ihren Unterredungen gern weit ausholte.
»Als er gerade gehen wollte, fiel sein Blick in den Hof und …« Er brach ab.
»Die Kleinen haben gestritten«, kam Maria ihm zuvor. »Ich hoffe, sie haben euch nicht gestört. Sie haben doch gar keinen Radau gemacht«, nahm sie die Brüder in Schutz.
»Nein, nicht sie, du …«
»Egle und ich haben nur ein bisschen gesungen … aber das tun wir doch oft …« Ignazio betrachtete sie gedankenverloren und stellte sie sich beim Singen vor. Maria blickte ihn verständnislos an. »Hat er sich über mich beschwert?«
»Mein Kind, du hast nichts Schlechtes oder Unschickliches getan. Nun … Die Sache ist so: Er hat dich gesehen und in Augenschein genommen … und sich in dich verliebt. Er will dich zur Frau.« Die letzten Sätze stieß er in einem Atemzug hervor. Überwältigt von der Wucht seiner Worte starrten er und Maria sich an.
»Er kennt mich doch gar nicht! Und ich habe keine Ahnung, wer er ist!«
»Deshalb will ich ja mit dir reden. Du weißt, wer er ist. Wir sind miteinander verschwägert, seine Schwester hat den Bruder deiner Mutter geheiratet. Er ist älter als deine Mutter, aber der Altersunterschied zwischen dir und ihm ist geringer als der zwischen mir und deiner Mutter. Als wir geheiratet haben … war sie vierzehn und ich schon über vierzig.«
Bei der Erinnerung an die blutjunge Titina wurde der unverbesserliche Romantiker Ignazio sentimental. »Er will dich zur Frau«, wiederholte er.
»Und was soll ich tun?« Maria war verwirrt. »Was hält Mamà davon?«
»Deine Mutter und ich sind einer Meinung. Erlaube mir, dir die Situation zu umreißen. Pietro Sala ist eine hervorragende Partie. Vor vielen Jahren hat sein Vater eine Baronie erworben, und das ganze Dorf nennt sie jetzt Barone, obwohl der Titel ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Er ist mehr als wohlhabend, besitzt Ländereien und Bergwerke und ist der einzige männliche Erbe seines Vaters und des ledigen Onkels. Er wurde in Neapel erzogen, reist durch die Welt und genießt das Leben. Er liebt die schönen Künste und ist äußerst gebildet. Ich glaube nicht, dass er politische Neigungen hegt, und wenn doch, dann wären sie liberal – das Gegenteil von meinen. Er möchte mehr Zeit in Camagni verbringen, deshalb will er Fuma Vecchia kaufen. Gewiss hat er schon zahlreiche Frauen gehabt. Aber jetzt will er dich. Zur Frau und Mutter seiner Kinder.«
»Wie kann er mich lieben! Er kennt mich doch gar nicht!«
»Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel.«
»Wie ist so ein Blitz?« Maria hob den Kopf und blickte den Vater neugierig an.
»Er schlägt urplötzlich in dein Leben ein und verbrennt dich.« Die Verlegenheit trieb ihm den Schweiß ins Gesicht. »Er legt alles um dich herum in Schutt und Asche. Du hast nur noch Augen für deine Liebste.«
»Ist dir das auch passiert?«
»Ja.«
Maria sah ihn abwartend an.
»Ich habe es nie bereut, mich in deine Mutter verliebt und dich bekommen zu haben«, murmelte er befangen.
»Und meine Brüder«, verbesserte sie ihn, wieder ganz Tochter und fürsorgliche Schwester.
»Also, Maria, antworte!«
»Ich kenne ihn doch gar nicht …«
»Du wirst ihn morgen kennenlernen, beim Empfang der Tummia in Fuma Nuova. Man wird ihn dir vorstellen.«
Maria erstarrte, ihr Blick verfinsterte sich.
»Du musst nicht mit ihm reden, wenn er dir nicht gefällt«, schob der Vater hastig nach. »Es ist ganz allein deine Entscheidung. Du kannst sagen: ›Nein danke, Signor Blitzschlag, ich habe Ihnen nichts zu sagen und will nichts von Ihnen wissen‹, oder aber: ›Mal sehen, was Signor Blitzschlag zu bieten hat‹.« Er versuchte, unbeschwert zu klingen und sie zum Lächeln zu bringen.
Maria ging nicht darauf ein. »Was rätst du mir?«
»Das, was dir auch deine Mutter rät. Lerne ihn kennen, hör dir an, was er zu sagen hat, und triff dann deine Entscheidung. Dies wird immer dein Zuhause bleiben.« Nachdenklich fügte er hinzu: »Dass wir dich ausgerechnet jetzt verheiraten, wer hätte das gedacht …«
»Etwa wegen der Mitgift?«
»Ich weiß nicht, was du meinst …«
»Giosuè wird dieses Jahr mit der Schule fertig und Filippo in zwei Jahren. Der Unterhalt und das Studium der beiden wird einiges kosten. Wie sollst du da noch meine Mitgift aufbringen?« Sie stieß einen verzweifelten Seufzer aus. »Die würde mehr Geld verschlingen als meine Ausbildung!«
»Woher weißt du das?«
»Die Wände haben Augen und Ohren. Ich weiß, dass wir wenig Geld haben, aber ich beklage mich nicht!« Sogleich bereute Maria ihre harten Worte. Die finanzielle Situation der Familie und ihre verwehrte Ausbildung waren gewiss das Letzte, worüber der Vater mit ihr reden wollte. Vergeblich versuchte sie, ihre Lippen zu einem versöhnlichen Lächeln zu schürzen. »Lieber verzichte ich aufs Heiraten und sorge dafür, dass meine Brüder eine gute Universität besuchen können. Und ich möchte ebenfalls arbeiten und Geld verdienen, um meiner Familie zu helfen.«
»Du denkst zu viel nach und siehst Dinge, die es nicht gibt …«, spöttelte der Vater. »Hör zu. Als Allererstes solltest du entscheiden, ob du Pietro Sala kennenlernen möchtest. Über alles andere reden wir später. Er will dich zur Frau, mit oder ohne Mitgift.« Ignazio blickte sie einen Moment lang schweigend an. »Ich gehe jetzt in den Klub«, sagte er schließlich. »Denk darüber nach, meine Schöne, und dann sag mir, wie du dich entschieden hast.« Sie umarmten sich mit feuchten Augen, doch es floss keine Träne.
4 Nach jeder finsteren Nacht geht die Sonne wieder auf
Maria war die Treppe hinaufgestürmt, sie wollte allein sein und Klavier spielen. Das vertrauliche Gespräch mit dem Vater hatte sie vorlaut werden lassen, und der diffuse Ärger über sich selbst schlug um in Furcht: Was, wenn sie ihn gekränkt hatte und er ihren nachmittäglichen Plaudereien an der Terrassentür nun ein Ende setzte?
Sie zog die Partitur von Edvard Griegs Konzert in a-Moll aus dem Notenregal. Giosuè hatte es ihr kürzlich geschenkt, und sie hatte sich sofort in das Stück verliebt. Sie streichelte den Umschlag und stellte die Noten auf den Ständer. Ehe sie zu spielen anfing, ließ sie den Blick aus dem Fenster schweifen. Die Rückseite des Hauses ging auf den kargen, steilen und dennoch dicht bebauten Nordhang des nach der gleichnamigen Kirche l’Addulurata genannten Hügels hinaus. Der Südhang, auf dem sich die vornehmen Palazzi und die Hauptkirche erhoben, fiel sanft zur Ebene ab. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich einige der ärmlichen Hütten in zweistöckige Häuser verwandelt, deren dicken Mauern ein Labyrinth aus Durchgängen und Sackgassen, schmalen Sträßchen und Treppen bildeten. In den ursprünglich von Juden bewohnten Häusern lebten nun die Armen des Dorfes; viele standen auch einfach leer. Am Fuß des Hügels endete der Ort, und die Ebene von Camagni begann. Flach und grün wie ein See dehnte sie sich bis zum Horizont und schlug dort in sanften Weizenwogen gegen die Ausläufer der bewaldeten Hügel, über denen sich klar und strahlend der blaue Himmel wölbte. Auf einem dieser Hügel lag Fuma Vecchia. Maria kniff die Augen zusammen und versuchte vergeblich, den Turm auszumachen. Entmutigt wandte sie sich wieder den Noten zu.
Dem Wunsch der Mutter folgend öffnete sie das Fenster, um den Alten und den Frauen vom Nordhang, die kaum vor die Tür kamen, eine Freude zu machen. Hin und wieder bat ihr unsichtbares Publikum sie lautstark um ein bekanntes Lied oder eine Opernmelodie, und sie erfüllte diese Wünsche bereitwillig.
Die Sonne brannte vom Himmel, die Straße war wie leergefegt. Eine düstere Vorahnung ergriff Maria. Sie würde fortgehen, weit weg von dieser innig geliebten kleinen Welt. Nie mehr würde sie diesen Ausblick genießen. Lebt wohl, ihr Hoffnungen, mit Giosuè zu lernen, einen Abschluss zu machen und als Lehrerin zu arbeiten … Giosuè würde ihr fehlen.
Eine ferne Erinnerung.
Eine kalte Januarnacht. Maria war drei Jahre alt. Laute Männerstimmen im Haus hatten sie geweckt. Sie hatte eine vage Ahnung vom Treiben der Briganten, von Entführungen und nächtlichen Heimsuchungen durch Soldaten und befürchtete das Schlimmste. Sie tastete nach ihrem kleinen Bruder. Filippo, kaum älter als ein Jahr, schlief friedlich im Bett neben ihr. Sie kroch zurück unter die Decken und lauschte. Endlich vernahm sie die beruhigende Stimme des Vaters. Sie kuschelte sich ein, griff sich einen Lakenzipfel und strich sich damit über die Oberlippe. Das wohlig sanfte Kitzeln ließ sie in den Schlaf gleiten.
Am nächsten Morgen aßen die Kinder ihren von Maricchia mit Nelken und Zimt gewürzten Frühstücksbrei aus heißer Milch und altbackenem Brot und blieben in der Kammer vor der Küche, wo Filippo friedlich mit der Katze spielte und Maria sich die Zeit damit vertrieb, die Schnur des Kreisels auf- und abzuwickeln. Gebannt kauerte sie sich an die Eingangstür, um zu horchen, wer kam und ging, und ein paar Gesprächsfetzen aufzuschnappen. Doch es war allenfalls Geflüster zu hören, und dann neue, unbekannte Geräusche: Hammerschläge, Möbelrücken … Endlich kam die Mutter herein. Sie hatte tiefe Augenringe, das dunkle Kleid spannte über ihrem schwangeren Bauch. Sie gab Filippo einen flüchtigen Kuss und streckte die Hand nach Maria aus. »Kommst du mit mir ins Wohnzimmer?« Maria folgte ihr vertrauensvoll. Vor der Tür hielt die Mutter inne. »Gestern ist Giosuès Vater gestorben. Der Junge hat die ganze Nacht neben der Bahre verbracht. Giosuè hat dich gern, er liest dir so oft vor …« Wohl wissend, dass sie Maria mit einer Aufgabe betraute, die eine Dreijährige zwar erfüllen, aber schwerlich begreifen kann, fuhr sie fort: »Versuche, ihn zu einer Tasse Milch bei euch in der Küche zu überreden.« Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit, und Maria konnte sehen, wie sich ihr sonst so behagliches Wohnzimmer verändert hatte. Sofas und Sessel waren gegen die Wände gerückt und schwarz verhüllt, ebenso die Bilder und Spiegel. In der Mitte unter dem Lüster stand ein mit rotem Tuch bedeckter Katafalk. Zu seinen Füßen knieten Männer mit gesenkten Köpfen, murmelten Gebete, erhoben sich und machten weiteren Männern Platz. Neben dem Leichnam stand Giosuè. Allein. »Geh, Maria …«, flüsterte ihre Mutter und schob sie in das Zimmer.
Das Bild von Giosuè neben dem Sarg legte sich über das von den Dächern Camagnis. Maria sah die Szene lebhaft vor sich: Die Mutter führte sie zu Giosuè und trat dann zurück, sie nahm seine Hand und zog ihn, sich der Blicke der Umstehenden wohl bewusst, wortlos und mit erhobenem Kopf zur Tür. Ohne Giosuè aus den Augen zu lassen, wichen die Männer zur Seite, doch der hatte den Blick starr auf Maria gerichtet, die sich bei jedem Schritt ermutigend nach ihm umdrehte.
An jenem Tag vor über zehn Jahren war Giosuè Teil ihrer Familie geworden.
Noch eine Erinnerung.
Im Dezember war der Vater zum Schulleiter gegangen, um über Giosuès Zukunft zu sprechen, der die Schule kurz vor seinem neunzehnten Geburtstag im Juni verlassen würde. Bei Tisch hatte er verkündet, der Direktor halte Giosuè für den besten Schüler seines Instituts und er könne zwischen den angesehensten Universitäten Italiens wählen. Giosuè hatte Maria einen Blick zugeworfen, den sie glückstrahlend erwidert hatte.
Nach dem Essen bat der Vater Maria zu bleiben und eröffnete ihr sichtlich verlegen, was sie bereits wusste: Giosuès Mutter war krank. Bis der Junge in ihr Haus gekommen war, hatte der Vater ihn allein aufgezogen. »Tonino hat mich zu Giosuès Vormund gemacht. Für den Fall der Fälle wollte er ihn in meiner Obhut wissen, er wollte nicht, dass er zur Stiefschwester komme. Er wusste, dass ich ihn in seinem Sinne erziehen würde. Inzwischen wissen wir, dass Giosuè das Zeug hat, den Traum seines Vaters zu erfüllen. Und das wird er auf unsere Kosten tun.« Er sah seiner Tochter direkt in die Augen. »Das bedeutet, dass weniger Geld für euch bleibt, verstehst du?«
Maria nickte.
»Ich möchte, dass du mir hilfst, sollte mir ebenfalls etwas zustoßen. Bisweilen ist Giosuè genauso arglos wie sein Vater. Er sieht die Schlechtigkeiten der anderen nicht und kann keine Bitte abschlagen. Er schont sich nicht, denkt nicht an seine schwache Gesundheit. Als er nach seiner Typhuserkrankung gleich wieder loslegte, als wäre nichts gewesen, ging es ihm schließlich so schlecht, dass er das Schuljahr wiederholen musste. Er scheut keine Mühen, erst recht nicht, wenn es darum geht, anderen zu helfen. Genau wie Tonino an jenem 20. Januar 1893, als er ermordet wurde.« Der Vater zögerte einen Moment lang. »Du musst wissen, dass Giosuès Mutter Jüdin ist. Der Antisemitismus wird erst verschwinden, wenn die Christen aufhören, ihn zu predigen, wie sie es jeden Karfreitag tun. Viele russische Juden sind in andere Länder Europas geflohen, und viele weitere werden ihrem Beispiel folgen. Kümmere dich um Giosuè, hab ein Auge auf ihn … und steh ihm mit deinem Rat zur Seite, er hört auf dich. Du bist klug, Maria.« Er blickte sie eindringlich an und wirkte erschöpft. »Du musst ihn beschützen. Versprichst du mir das?«
Maria versprach es. Sie senkte den Kopf, griff nach der Hand des Vaters und küsste sie.
»Signora Maria, ich wäre so weit«, krächzte die alte Amme von unten. Breitbeinig hatte sie ihren Platz im imaginären Konzertsaal eingenommen und saß, die zu lesenden Linsen in der blauen Schürze, auf ihrer Türschwelle. »Versprochen! Versprochen, Annettina!«, rief Maria schnell noch ganz in Gedanken und trat vom Fenster zurück.
»Zu freundlich!«, entgegnete die Alte ungeduldig, während die ersten Noten schon zu ihr herabklangen und die Straße erfüllten.
Marias Hände flatterten zunächst parallel über die Tasten, von einer Oktave zur nächsten, danach fielen einzelne Töne wie Regentropfen auf ein Fensterbrett in einem glockenklaren Allegro moderato und schwollen schließlich zu einem erhabenen, beglückenden Andante maestoso an.
Es war neun Uhr abends; Zeit, sich für die Nacht fertig zu machen. Ein scheinbar ruhiger Tag war zu Ende gegangen. Vor dem Zubettgehen hatten die Jungen mit Maricchia und Egle in der Küche gegessen. Es herrschte eine drückende Hitze, in der es vor Mücken wimmelte. Maria war in den Garten hinuntergegangen, um sich eine Schüssel Jasminblüten zu pflücken, deren Duft die Insekten fernhielt. Giosuès Zimmer ging auf den Garten hinaus, und häufig kam er zu ihr herunter, um mit ihr die Pflanzen zu wässern und über den Tag zu plaudern. Maria erzählte ihm, was sich zugetragen hatte und worüber die Erwachsenen redeten, er berichtete ihr aus den Zeitungen, die er in der Schule las, sie besprachen ihre Pläne für den folgenden Tag und lachten über Giosuès unnachahmlich komische, aber niemals bösartige Imitationen anderer Leute.
Nur die trockensten Beete wurden gegossen, denn Wasser war knapp und nachts zählte jeder Tropfen doppelt. Gewissenhaft versorgte Giosuè jede Pflanze mit der richtigen Menge. Maria musterte ihn verstohlen. Er war mittelgroß, tadellos gekleidet, hatte einen dunklen Teint, lockiges Haar, entschlossene, markante Züge und schöne Hände – ein hübscher Kerl. Wie gern hätte sie ihn umarmt und ihm gesagt, wie großartig er alles gemeistert hatte, dass alle im Haus ihn liebten und wie dankbar sie ihm für die Hilfe war, die er ihr und ihrem Vater leistete.
Ihr Vater genoss den Ruf, ein exzellenter Anwalt für Sachenrecht zu sein: Eigentum, Erbau, Erbpacht, Nießbrauch, Nutzung und Dienstbarkeit. Als Maria noch klein gewesen war, zur Zeit der Arbeiterbünde, hatte er die Bauern vertreten, die für das Nutzungsrecht der ihnen zustehenden staatlichen Ländereien kämpften, und sich den Staat und seine Mandanten zum Feind gemacht. Die Leute wandten sich an andere Anwälte und kamen nur in den vertracktesten Fällen höchst widerwillig auf ihn zurück. Aus Mangel an Mandaten waren die jungen Juristen nach und nach fortgegangen. Sogar seinen Referendar hatte der Vater entlassen müssen, und Giosuè, der von einem Jurastudium träumte, hatte das Zimmer direkt neben dem Büro bezogen und erledigte seine Hausaufgaben fortan am Referendarstisch, um Ignazio jederzeit zur Hand gehen zu können und von ihm zu lernen.
Mit Einwilligung der Mutter durfte Giosuè Maria beim Lernen helfen. Es war ein schwerer Schlag für sie gewesen, als die Eltern ihr eröffnet hatten, dass sie die Schule wie ihre Cousinen mit vierzehn verlassen würde. Sie hatte stets geglaubt, ihre Eltern würden sie ebenso unterstützen wie ihre Brüder und alles dafür tun, dass sie einen Schulabschluss machen und einen Beruf ergreifen könne. Daraufhin hatte Giosuè ihr einen Vorschlag gemacht: Er würde das Schulamt um den Studienplan für Lehramtsstudenten bitten, sich den Stoff aneignen und Maria darin unterrichten. Dem Vater würden sie erst davon erzählen, wenn sie die Prüfung als externe Kandidatin bestanden hätte. Fortan stellte Giosuè ihr die Aufgaben und korrigierte sie mit rotem und blauem Stift.
Im Gegenzug versorgte Maria ihn mit Säften und Kräutertees, wenn er krank war, und mit ausgelesenen Zeitschriften und Zeitungen. Wenn die trockene Wäsche zum Bügeln in der Vorküche stand, zog sie heimlich seine Sachen aus dem Korb, untersuchte sie auf Löcher, kaputte Nähte oder fehlende Knöpfe und flickte sie unbemerkt. Und wenn er traurig oder bedrückt war, tröstete sie ihn wie eine Mutter.
Wäre es mit alldem vorbei, wenn sie heiratete?
»Woran denkst du?« Giosuè kannte sie gut.
»Jemand hat um meine Hand angehalten. Mein Vater meint, ich sollte ihn kennenlernen.«
»Ich muss dir etwas verraten.«
»Du hast einen Studienplatz bekommen!«, tippte Maria. »Wohin gehst du?«
»Aufs Festland …«
Ihr Blick verdüsterte sich. »Wir werden einander vergessen.«
»Unmöglich!« Giosuè schüttelte energisch den Kopf. »Unmöglich!« Er stellte sich vor sie hin und hinderte sie am Weitergießen. Ängstlich sah Maria ihn an, sie hatte ihn noch nie so aufgebracht erlebt.
»Dass wir einander vergessen, ist völlig ausgeschlossen! Wir sind seelenverwandt, Maria! Unsere Seelen sind miteinander verflochten! Wir sind mehr als Geschwister! Enger als Geschwister! Verstehst du? Wir teilen ein Schicksal!« Er blickte sie eindringlich an. »Der Mord an meinem Vater hat uns geeint. Hättest du mich nicht aufgerüttelt und mir den nötigen Lebensmut gegeben, um zu einem Sohn zu werden, der seiner würdig ist und seine Wünsche erfüllt … Das werde ich dir nie vergessen … Wir sind eins, egal wohin uns das Leben verschlägt!« Er verstummte erregt. Blass starrte Maria auf die Gießkannen, die leer an ihren Händen baumelten.
»Verzeih«, murmelte Giosuè.
»Nicht doch, du hast ja recht …« Versonnen blickte sie ihn an. »Lass uns schlafen gehen, na komm …«, sagte sie schließlich und streichelte seinen Arm.
Unruhig wälzte sich Maria im Bett. Ihr Vater wollte Giosuè das gesamte Studium finanzieren. Doch würde das Geld reichen, um auch Filippo studieren zu lassen? Die Ehe mit Pietro Sala würde die Sache erleichtern – ein Esser weniger und eine Tochter unter der Haube, ohne dass man sich um die Mitgift sorgen musste. »Nach jeder finsteren Nacht geht die Sonne wieder auf«, pflegte Maricchia zu sagen. Was, wenn dieser Pietro Sala ihr tatsächlich gefiel?
Sie schob das Laken zur Seite, griff nach der Schüssel mit den Jasminblüten und atmete ihren öligen Duft ein. Die Lampe auf dem Treppenabsatz brannte noch, offenbar war ihr Vater vom Klub noch nicht wieder zurück. Sie öffnete die Tür, um Licht einzulassen, und holte eine Briefkarte hervor.
Lieber Vater,
ich bitte um Verzeihung für mein heutiges Betragen, ich hatte nicht erwartet, die Aufmerksamkeit von Baron Sala zu erregen. Ich nehme Deinen Rat an und sehe der morgigen Begegnung erwartungsvoll entgegen.
Deine ergebene, Dich liebende Tochter
Maria
Es war das erste Mal, dass sie ihrem Vater schrieb. Sie steckte die Karte in einen Umschlag und schob ihn unter der elterlichen Schlafzimmertür hindurch.
Dann kroch sie unter die Decken und schlief ein, den Lakenzipfel auf den Lippen.
5 Vuttara
Mit gerunzelter Stirn und aufeinandergepressten Lippen kämpfte Giosuè gegen eine Erinnerung an, die er nicht zulassen wollte, noch nicht. Sie umgarnte ihn, streichelte ihm Haut und Haar, kitzelte seine Ohren, verweilte unter seiner Nase in der Hoffnung, eingelassen zu werden. Doch er wehrte sich, er war nicht bereit dazu. Er starrte aus dem Fenster zum Schein der Petroleumlampe hinüber, die den Flur vor den Schlafgemächern der Marras erhellte. Sonst war alles dunkel. Ein weiß gekleideter Schemen huschte an der Lampe vorbei. Es war Maria. Wie sie im hochgeschlossenen weißen Nachthemd, den geflochtenen Zopf über der Schulter, bedächtig in ihr Zimmer zurückkehrte, strahlte sie eine kindliche Gelassenheit aus, die Giosuès Widerstand brach und seinen Erinnerungen freien Lauf ließ.
Es war der 20. Januar 1893, und er war sechs Jahre alt. Als einziges Kind alter Eltern, beide glühende Sozialisten, war er zu Hause unterrichtet worden und hatte sich als glänzender Schüler erwiesen. Er wirkte ein wenig zu erwachsen für sein Alter – die Außenwelt kannte er nur durch die Freunde und die politischen Aktivitäten seines Vaters, der ihn überallhin mitnahm, als wäre er sein Schatten – und war in der Familie von Anwalt Marra, dem besten Freund seines Vaters, wie zu Hause.
Sie waren vor Sonnenaufgang aufgestanden, um mit dem Anwalt nach Vuttara zu reiten, wo die Landarbeiterbewegung ein zweihundertfünfzig Hektar großes, fruchtbares Lehen, das an den Staat gefallen war und unter den Bauern von Vuttara aufgeteilt werden sollte, symbolisch besetzen wollte. Dieses Land hatte auch den Appetit anderer, sehr einflussreicher Männer geweckt, die nur darauf warteten, es sich in bewährter Manier unter den Nagel zu reißen: Die Gemeinde wurde genötigt, die Vergabe der Parzellen so lange hinauszuzögern, bis man Verbündete gefunden und die zuständigen Beamten bestochen hatte. Dann schlug man zu und ließ das Land schnell auf seine Kinder oder einen Strohmann überschreiben.
Sie hatten Picknickdecken und reichlich Essen für sich und die Freunde in Vuttara eingepackt – geschnittenes Brot, in Butterbrotpapier eingepacktes Omelett, Orangen, Wasser, Kekse. »Das wird ein Festessen, bestimmt werden wir dort eine Menge Leute sein!«, sagte der Vater, während sie das schlafende Camagni verließen. »Die Gemeinde scheint einverstanden zu sein, dass die Ländereien an die Bauern verteilt werden, deshalb werden sie unbewaffnet marschieren. Die Arbeiterbünde werden immer mehr respektiert. Das wird ein schöner Tag.« Die Teilnahme der beiden Mittfünfziger war eine Solidaritätsbekundung gegenüber den Freunden des Arbeiterbundes und eine symbolische Kampfansage an den ehemaligen Freund und garibaldinischen Mitstreiter Francesco Crispi, der die Seite gewechselt hatte und die Arbeiterbünde niederschlagen wollte. »Das wird ein herrlicher Tag«, bekräftigte der Vater immer wieder, als wollte er sich selbst davon überzeugen.
Sie waren im Hinterland: Berge, Hügel, Täler, vom winterlichen Regen angeschwollene Flüsse. Das schräge Licht der Morgensonne fiel auf die spitzen Felssäulen, die wie Türme oder Obelisken auf den Bergkämmen aufragten, und ließ ihre Farben und Maserungen erstrahlen. Im Tal malten ihre Schatten bizarre Figuren auf die bestellten Felder. An den steilen Berghängen leuchteten die ersten Blüten der wilden Mandelbäume wie rosa Wattebäusche zwischen den Felsbrocken und Zwergpalmen hervor. Im Gänsemarsch erklommen die Stuten den Pfad.
Kein Haus, kein Mensch oder Tier, nicht einmal ein Vogel war unter dem strahlenden Firmament zu sehen. Nichts regte sich. Giosuè sog den feuchten Duft der Erde ein und umschlang die väterliche Brust: Er war restlos glücklich.
In den vergangenen Monaten hatte der Vater alles darangesetzt, Giosuè seine sozialistischen Überzeugungen zu vermitteln – die allgemeine Schulpflicht, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Er erzählte ihm vom Feudalismus, der erst kurz vor der Landung Garibaldis abgeschafft worden war, und dass es den Baronen damals verboten gewesen sei, ihre Lehen zu veräußern: Sie verwalteten die Städte, in denen sie für Ordnung sorgten, Recht sprachen, die Gefängnisse unterhielten und die königliche Armee mit Soldaten versorgten – sie hatten das Gewaltmonopol. »Die armen Bewohner der Ländereien außerhalb der Kommunen, Kommunisten genannt, hatten hingegen nur vier Rechte, die sogenannten Usi: Holz schlagen, Steine brechen, Wildkräuter sammeln und Lasttiere weiden. Vom Anspruch auf ein solches Recht hing ab, ob man unter freiem Himmel schlief oder ein Dach über dem Kopf hatte, ob man hungerte oder eine Suppe im Bauch hatte.« Er hielt kurz inne und fügte streng hinzu: »Die Forderungen der Arbeiter, die wir heute besuchen werden, sind vielleicht bescheiden und nicht neu, aber sie sind von größter Wichtigkeit!«
Dann lächelte er wieder. »Dieser Marsch von fünfhundert Bauern ist der Auftakt einer besseren Zukunft für alle. Das wird ein herrlicher Tag!«
Während sie sich dem Dorf näherten, verfinsterte sich die Stimmung der beiden Männer. Vergeblich hielten sie Ausschau nach den befreundeten Sozialisten und Freimaurern, die wie auch andere Unterstützer der Arbeiterbünde ihre Teilnahme an der Feier der Landvergabe zugesichert hatten. Doch es fehlte jede Spur. Dann, plötzlich, ertönte Gesang. Sie trieben die Pferde auf eine Hügelkuppe und erblickten die fünfhundert Bauern, die sich in der Ebene vor dem Dorf versammelt hatten, um laut singend zu dem ihnen versprochenen Land zu marschieren.
»Präge dir das gut ein, Giosuè.« Der Vater machte eine ausladende Geste in Richtung Tal. »Diese Ländereien sind Gemeingut: Sie gehören allen.« Er gab der Stute die Sporen und trabte den Pfad Richtung Dorf hinunter.
Die Anführer diskutierten. Unruhig waren die Demonstranten stehen geblieben und warteten auf Anweisungen. Der Gesang hallte über die Ebene. In leichtem Trab umrundeten die beiden Stuten die Menschenmenge. Ignazio Marra und Tonino Sacerdoti grüßten ihre Freunde und wurden zurückgegrüßt. Am liebsten wäre Giosuè vom Pferd gestiegen, um mitzumarschieren. »Das geht nicht, sie müssen ihr Land allein besetzen. Wenn es so weit ist, feiern wir zusammen«, sagte der Vater.
Zwei Freimaurerfreunde, ein Anwalt und der Bürgermeister von Tilocca, gesellten sich zu ihnen, und gemeinsam beschlossen sie, abseits des Aufmarsches zu frühstücken. Unter einem Johannisbrotbaum auf einer Anhöhe stiegen sie vom Pferd, stärkten sich, tranken den mitgebrachten Wein, ließen den Blick über die fünfhundert Demonstranten schweifen und unterhielten sich angeregt: über den Belagerungszustand, die Politiker, die Mobilisierung der Soldaten und den Zustand der Armee, die Crispi nach Afrika entsenden wollte, um Italien zu einer Kolonialmacht zu machen. Giosuè saß ein wenig abseits. Er hatte das Omelett mit Pfeffer bestreut, den er in einem Tütchen mitgebracht hatte, es zwischen zwei Brotscheiben geklemmt, alles fest zusammengedrückt und hineingebissen – es schmeckte saftig und köstlich. Er warf ein paar Krumen zwischen die Steine und welken Blätter und beobachtete belustigt die aufgeregt herumwuselnden Ameisen, die sich immer wieder neu orientieren mussten.
Die beiden Freunde waren zu den Demonstranten hinuntergegangen; der Vater verstaute die Reste der Brotzeit in der Satteltasche und war jetzt auch bereit für den Marsch.
»Giosuè, ich möchte dir etwas sagen.« Er legte seinem Sohn die Hände auf die Schultern. »Deine Mutter und ich haben dich zu einem aufrechten, respektvollen, fleißigen und großzügigen Menschen erzogen, der niemandem etwas zuleide tut.«
Er musterte ihn mit liebevoller Strenge. Er war sich bewusst, dass Giosuè zwar sensibel, aber noch ein Kind war und eigentlich zu jung für solche Gespräche, aber zugleich hoffte er, dass seine mit Leidenschaft vorgetragenen Worte eines Tages Früchte tragen würden. »In einer zivilisierten, friedlichen Gesellschaft muss das Gewaltmonopol beim Staat liegen. Die Gewalt darf einzig dem Staat obliegen: Sie ist unteilbar. Vergiss das nicht! Das Gewaltmonopol liegt bei der Polizei und dem Militär – interne und externe Gewalt. Wenn sie dem Staat entgleitet, verliert er die Kontrolle, und das ist sein Tod. Missbraucht er sie, verliert er das Vertrauen seiner Bürger. Gebraucht er sie falsch, verwirrt er das Volk und verliert seinen Respekt. Hierzulande haben die Regierenden alle Verantwortung an die Mafia abgegeben, und wir sind dabei, zu einem Staat im Staate zu werden. Es gib keine Gewissheiten mehr, keine Freiheit, keine Gerechtigkeit.«
Giosuè sah seinem Vater in die Augen und schielte von Zeit zu Zeit verstohlen zu den hungrigen Ameisen hinüber.
»Ignazio, was meinst du dazu?«
»Ich meine, du hast recht!«
»Die königliche Armee besteht aus unwilligen, ignoranten Rekruten, die keine Lust zum Kämpfen haben.«
»Die Offiziere sind schlecht ausgebildet …«
»… und den Generälen mangelt es an Urteilsvermögen.«
»Genau wie den Regierenden!«
Tonino wandte sich wieder an seinen Sohn. »Giosuè, nach der Schule wirst du zur Militärakademie gehen. Du wirst es weit bringen, und dann ist es an dir, das Militär zu Stärke und Verantwortung zu erziehen. Bleibe stets ein Diener deines Volkes!«
»Bravo!«, stimmte der Anwalt zu.
»Wenn ich nicht mehr sein sollte, musst du aus ihm den besten General Italiens machen, Ignazio!« Tonino drückte den Arm seines Freundes und mit dem letzten Schluck Wein tranken sie auf die königliche Armee.
Sie kehrten Richtung Dorf zurück. Vorsichtig tasteten sich die Stuten den karstigen Abhang hinunter. Die Sonne war aufgegangen, die Luft frisch und klar. Vuttara, das sich an den rosigen, blau geäderten Felsen eines Berges schmiegte, schien noch zu schlafen. Die Fenster waren verrammelt, die Gassen menschenleer. Selbst die Hunde waren verschwunden.
Weitere Demonstranten waren hinzugekommen, auch sie unbewaffnet. Sie wären am liebsten schon losmarschiert und sangen, um ihre Unruhe zu zügeln. Tonino und Ignazio sprangen vom Pferd, begrüßten ihre Freunde, stiegen wieder in den Sattel und beobachteten das Treiben: Die Anführer redeten mit ein paar Männern, die ebenfalls keine Waffen trugen. Vom Bürgermeister oder den Stadträten war nichts zu sehen.
Endlich setzten sie sich in Bewegung. Geschlossen, geeint, geordnet.
Das Geräusch von Stiefeln auf Kopfsteinpflaster. Wie bei einem über die Ufer tretenden Bach tauchten auf einmal an den Seiten der Marschierenden Feldhüter, Landpächter und Tunichtgute auf, die aus unterirdischen Verstecken dazustießen – aus Kellern, Krypten, Lagerräumen. Sie waren angeheuert, um Ärger zu machen. Wortlos, grimmig.
Als hätten sie nichts gesehen und gehört, verließen die Demonstranten ruhig und geordnet das Dorf. Die Flut folgte ihnen durch die Ebene und rückte allmählich heran. Die singenden Demonstranten beschleunigten ihre Schritte. Ein paar Köpfe wandten sich um. Niemand sagte ein Wort.
Dann lief der Strom der Verfolger plötzlich laut schreiend los und versuchte, die Marschierenden mit Schmähungen und Beschimpfungen aus der Reserve zu locken.
»Die sind nicht von hier, das hört man. Die sind extra angereist«, bemerkte Anwalt Marra.
»Sie werden nichts ausrichten. Unsere Leute sind anständig, die lassen sich nicht provozieren. Und sollten sie doch reagieren, werden die Leute aus Vuttara eingreifen. Die sind alle unbewaffnet. Mach dir keine Sorgen«, entgegnete Tonino. Er hob den Arm und winkte den Demonstranten zu, die ihn erkannt hatten. Der Anwalt jedoch runzelte besorgt die Stirn, er kniff den Mund unter dem dichten Schnurrbart zusammen, während er den Hügel fixierte, den er schon seit einer Weile im Auge behielt. Auf dessen Kuppe tauchten jetzt plötzlich Dutzende Soldaten auf, bewaffnet, in Formation und kampfbereit. Wie auf ein geheimes Zeichen bedrängten die Angreifer nun massiv die Marschierenden, die abermals das Tempo beschleunigten, um Abstand zu gewinnen.
Das Dorf war wie erstarrt. Türen und Fenster blieben geschlossen, keine Menschenseele war zu sehen.
Auf einen Ruf hin bückten sich die Angreifer nach Pflastersteinen und schleuderten sie halbherzig in Richtung der Demonstranten, als wollten sie Zeit gewinnen.
»Das sieht nicht gut aus«, murmelte der Anwalt. Sie stiegen vom Pferd und banden die Stuten an einen Baumstumpf. Giosuè wurde unter einem Mandelbaum hinter einem Felsblock versteckt. Von dort würde er gefahrlos zusehen können. Dann stießen die beiden Männer zu den Demonstranten. Jemand löste sich aus der Menge, umarmte sie und reihte sich wieder ein.
Die königliche Armee rückte geschlossen heran, es schienen Hunderte zu sein. Sie kamen immer näher.
Die Angreifer eröffneten den Kampf: Jetzt flog jeder Stein gezielt und traf. Sie drängten heran, doch die Demonstranten marschierten unbeirrt weiter. Manche wurden getroffen, stolperten, rappelten sich wieder auf. Kein Steinwurf wurde erwidert. Doch mit einem Mal änderte sich alles: Die Werfer zielten, um zu töten. Der Erste, der zu Boden ging, war der Mann, der Giosuès Vater eben noch umarmt hatte. Ein Stein hatte ihn am Kopf getroffen, er blutete.
»Helft mir!«, schrie er.
»Du nimmst Giosuè, wenn ich nicht zurückkehre!« Und schon war Tonino im Gedränge verschwunden.
Er kniete neben dem Mann und versuchte verzweifelt, die Wunde zu reinigen und die Blutung zu stillen. Andere eilten herbei, und Giosuè verlor den Vater aus den Augen. Ein erster Schuss fiel. Weitere Gewehrsalven folgten, abgefeuert von der Armee. Panik brach aus, die Leute stoben schreiend durcheinander, manche flohen, andere versuchten, den Verwundeten zu helfen. Nur der vordere Teil des Demonstrationszuges zog unbeirrt singend weiter.
Die Soldaten, die in der Ebene Stellung bezogen hatten, schossen. Schreie. Schüsse. Schreie. Schüsse. Die Schreie schwollen an, dann wurde es still.
Sonst hatte Giosuè so gut wie keine Erinnerungen an jenen Tag und auch an den folgenden nicht. Später hieß es, es habe eine Feuerpause gegeben, damit die Dorfbewohner, die bei den ersten Schüssen aus ihren Häusern gekommen waren, die Verletzten bergen konnten. Auch zu seinem Vater war jemand gelaufen. Er erinnerte sich, dass er nicht geweint hatte. Er erinnerte sich, dass der Anwalt ihn auf seine Stute gehoben und vor sich in den Sattel gesetzt hatte. Das andere Pferd folgte ihnen mit dem in eine Decke gewickelten Leichnam seines Vaters. Er erinnerte sich, dass es Nacht gewesen war, als sie in Camagni bei den Marras eingetroffen waren.