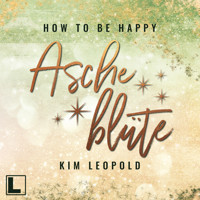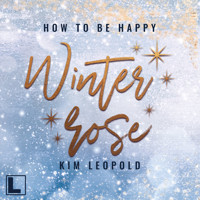2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach seinem Herzen wird Mikael durch einen Zauber aus dem Palast verbannt. Er trifft auf Yanis, Melvin und Willem. Gemeinsam suchen sie Unterschlupf bei einer alten Freundin Mikaels, deren Arbeit für den König der Rebellen sie in Schwierigkeiten gebracht hat. In der Zwischenzeit kämpft Alex mit den seltsamen Nebenwirkungen durch Ivans Zauber und beginnt, an seinem Verstand zu zweifeln. Während er mit Moose Tyros' persönliche Sachen sichern will, stoßen die beiden Wächter auf noch mehr Geheimnisse … Kim Leopold hat eine magische Welt mit düsteren Geheimnissen, nahenden Gefahren und einem Hauch prickelnder Romantik erschaffen, bei dem Fantasy-Lover voll auf ihre Kosten kommen. Der Kampf der Rebellen – Band 10. der Urban Fantasy Serie Black Heart!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Black Heart 10
Der Kampf der Rebellen
Kim Leopold
Für die Frauen, die gerne und laut fluchen.
❤
Mögen deine Entscheidungen deine Hoffnungen widerspiegeln, nicht deine Ängste.
[was bisher geschah]
1448 - In dem aztekischen Mechtatitlan beobachtet die junge Hexe Ichtaca eine Opferung, die sie an die ihrer Mutter erinnert. Ihr bester Freund und Krieger Nanauatzin nimmt an dem Ritual teil - einige Zeit später ermahnt er sie, ihre Magie nicht öffentlich zu nutzen, um sich somit nicht in Gefahr zu bringen.
2018 - Nach dem Angriff der Hexenjäger auf den Palast der Träume sind die Ratsmitglieder und Lehrer immer noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Ivan übernimmt eine führende Rolle, doch der Fluch, der ihn während des Angriffs getroffen hat, schreitet immer weiter fort.
Azalea und die anderen kümmern sich um den neuen Gestaltwandler Melvin, bis dieser seine Wandlungen unter Kontrolle hat. In der Zwischenzeit bahnt sich zwischen Yanis, Melvin und ihr etwas Romantisches an.
Emma flickt den verletzten Willem zusammen und stellt ihn zur Rede. Dabei findet sie heraus, dass er sich nicht an die gemeinsame Zeit erinnern kann. Sie schmieden Pläne für die Zukunft, doch dann wird Emma entführt.
[prolog]
Ichtaca
Mechtatitlan, 1448
Ich hülle mich enger in mein Tuch und versuche, mich nicht von der Dunkelheit um mich herum beeindrucken zu lassen. Am Tag ist der Weg zum Fluss nicht so schaurig, es ist die Nacht, die alles anders wirken lässt. Das Meer klingt bedrohlich, während ich hier stehe und fröstelnd warte.
Ich wünschte, wir könnten uns tagsüber treffen und über die Dinge reden, für die wir in diesen frühen Morgenstunden allerdings auch kaum Zeit haben. Aber wir sind nicht mehr die Kinder, die wir einmal waren. Jetzt sind wir erwachsen und eine so enge Bindung, wie sie uns verbindet, würde für zu viel Gespräch im Dorf sorgen.
»Taca?«
Erleichtert drehe ich mich um und sehe, wie sich eine große Gestalt aus den Schatten löst und auf mich zukommt. Der Sand knirscht unter seinen Fußsohlen, doch ansonsten bewegt er sich beinahe lautlos.
»Ich dachte schon, du kommst nicht«, klage ich Nanauatzin mein Leid. In den anderen Nächten war er meistens vor mir da. Die Gewissheit, dass er bereits an unserem geheimen Ort sein würde, hat meine Ängste verjagt. Heute auf ihn warten zu müssen, hat einen bitteren Nachgeschmack auf meiner Zunge hinterlassen – und doch würde ich immer wieder hier stehen und auf ihn warten.
»Ich würde dich niemals stehen lassen.« Er nimmt mich in den Arm und vergräbt seine Nase in meinem Haar. Ich schlinge meine Arme um seinen starken Körper und atme seinen wohligen Duft ein. »Bei den Göttern, du wirst mir so sehr fehlen.«
Mein Herz macht einen Hüpfer, weil es so selten ist, dass wir uns diese Dinge wirklich sagen können. Umso bedeutsamer ist dieser Moment für mich.
»Du mir auch«, wispere ich und lasse meine Hand an seine Wange gleiten. Die feinen Härchen kratzen an meiner Haut, aber ich liebe dieses Gefühl. Es ist der Beweis dafür, dass unser Leuchten doch noch zusammengefunden hat, obwohl ich schon fast nicht mehr daran geglaubt habe. »Ich wünschte, du könntest bleiben.«
Meine Lippen finden seine und ersticken die Widerworte, die er gefunden hätte. Die Verpflichtungen, die Angst vor dem, was vor ihm liegt. Eine Schlacht wie keine andere. Ein Kampf, der nicht seiner ist und den er dennoch zu kämpfen bereit ist, um die zu schützen, die er liebt. Es ist nur ein voller Mondmonat, den er fort sein wird, doch er fehlt mir jetzt schon.
Unsere Momente fehlen mir. Aber das tun sie sowieso immer. Sie sind viel zu kostbar und selten, als dass ich davon je genug kriegen würde. Seit er mich vor ein paar Monden das erste Mal geküsst hat, würde ich ihn am liebsten nie wieder gehen lassen.
Er zieht mich dichter an sich heran und vertieft den Kuss. Meine Knie werden weich, als sich unsere Zungen berühren und einen aufregenden Tanz miteinander vollführen. Ich fühle mich nicht länger wie das Mädchen, das für ihren besten Freund schwärmt, sondern wie die Frau, zu der er immer wieder zurückkehren wird.
Atemlos löst Nanauatzin sich von mir und lehnt seine Stirn an meine. Sein Atem ist süß und liebkost meine Lippen. »Mein Herz gehört dir, Ichtaca. Für alle Monde.«
Seine Worte lösen ein Kribbeln in meinem Bauch aus, das sich bis in meine Beine zieht. Meine Knie werden weich, mein Mund ganz trocken.
Es sind die Worte, die wir benutzen, wenn wir Ehen schließen. Die Worte, die Menschenleben für immer verbinden.
Dass er sie in Liebe zu mir sagt …
»Ich werde für alle Monde darauf achtgeben«, erwidere ich das Versprechen mit Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob es ohne Gäste überhaupt zählt. Ob wir nun ein richtiges Paar sind oder bloß Liebende, die für immer der Dunkelheit gehören werden. Was es auch ist, es ist das Beste, was mir je passiert ist. »Mein Herz gehört dir, Nanauatzin. Für alle Monde.«
»Und auch ich werde für alle Monde darauf achtgeben.«
❤
Ich wache beim lauten Geräusch von Vaters Husten auf. Am liebsten würde ich mir die Hände auf die Ohren pressen, so sehr tut es mir weh, wie heftig er husten muss. Es wird immer schlimmer. Besonders nachts, wenn die Kälte ins Gemäuer kriecht, weil das Feuer zur Glut verkommen ist.
Gähnend stehe ich auf, schlüpfe in meine Stiefel und lege mir mein Tuch um die Schultern, bevor ich zum Kamin gehe und Feuerholz nachlege. Ich kann mich schon nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal durchgeschlafen habe.
»Ichtaca«, krächzt Vater zwischen zwei Hustenanfällen. Ich setze mich neben ihn auf das Bett, um nach seiner Hand zu greifen. Sie fühlt sich in meiner ganz kalt und klamm an. Mein Herz wird schwer.
»Ich bin hier.«
Um ihn herum riecht die Luft muffig, nach Krankheit, nach Abschied. Der Geruch macht mir Angst. Ich bin doch noch nicht bereit, ihn zu verlieren.
Ich strecke eine Hand aus, um sie an seine Stirn zu legen. »Vater …«
Er glüht. Seine glasigen Augen blinzeln mich müde an, bevor er sie einfach schließt. Panik ergreift mich, und ich treffe endlich die Entscheidung, die ich so lange hinausgezögert habe. Ich lasse mein Licht aufleuchten. Lasse es frei und konzentriere mich darauf, es in seinen Körper gleiten zu lassen, um die Dunkelheit zu vertreiben. In ihm sind so viele Schatten. So viele dunkle Flecken, die mein Licht vertreiben muss, dass es eine ganze Weile dauert, bis sein Atem ruhiger wird. Weniger rasselnd.
Ich spüre, wie es ihm von Augenblick zu Augenblick besser geht. Wie die Krankheit von ihm abfällt.
Er greift nach meinen Händen. Ich öffne die Augen und lächle ihn an. Meine Hände zittern, weil mich seine Heilung so viel Kraft gekostet hat. Ich wünschte, Mutter wäre noch hier, um mir zu zeigen, wie ich es besser machen kann. Wie ich schneller wieder zu Kräften kommen kann. »Geht es dir besser?«
»Taca, das hättest du nicht machen sollen«, wispert er rau. Seine Stimme ist nur noch eine Erinnerung an die Krankheit, die ihn die letzten Tage begleitet hat. »Du weißt, dass sie reden werden. Ich will dich nicht verlieren.«
»Das wirst du nicht«, verspreche ich ihm, aber seine Worte jagen mir einen Schauder über den Rücken. Genauso ist es Mutter auch ergangen. Sie hat ihr Licht benutzt, um zu helfen … und ein paar Tage später war sie fort. Ihrer Familie beraubt und zum Dienst im Tempel berufen. »Wir verraten es niemandem. Und jetzt schlaf noch etwas. Du musst dich erholen.«
Ich warte noch eine Weile, bis seine Atemzüge ruhiger werden und ich merke, dass er wieder eingeschlafen ist. Erst dann stehe ich auf und taumle zu unseren Vorräten, um mir etwas von dem Brot zu genehmigen, das ich am Vortag gebacken habe.
Alles hat seinen Preis.
❤
Ein paar Tage später schrubbe ich gerade unsere Feuerstelle, als jemand an die Tür klopft. Verwundert stehe ich auf, streiche mir die schmutzigen Hände an der Schürze ab und öffne die Tür.
»Nanauatzin?« Freude füllt mein Herz, als ich ihn vor mir stehen sehe. So früh hätte ich nicht mit ihm gerechnet. »Du bist schon wieder zurück?«
Er nickt, aber irgendwas an seinem Blick lässt mich stocken. Im nächsten Moment tritt jemand neben ihn. Es ist ein anderer Krieger, ein Mann in einer höheren Position als Nanauatzin. Sein Gesicht ist grimmig, die Mundwinkel abschätzig nach unten gezogen.
»Was hast du getan?«, scheinen Nanauatzins Lippen zu formen. Verwirrt schüttle ich den Kopf. Ich weiß nicht, wovon er redet. Wieso sehen sie mich an, als hätte ich einen Menschen getötet?
»Es hat sich herumgesprochen, dass du eine Zauberin bist«, erklärt der andere Mann. Ein Schauder läuft über meinen Rücken. »Der Priester möchte, dass du in seinen Dienst trittst.«
»Was? Nein!«, widerspreche ich und will instinktiv die Tür zuschlagen. Ein Fehler, wie sich gleich herausstellt, denn das bringt den Mann dazu, sich mit seinem Gewicht gegen die Holztür zu drücken und Gewalt anzuwenden, weil er denkt, ich würde mich wehren. Ehe ich mich versehe, hat er mir die Hände auf den Rücken gedreht.
»Was soll das?«, fauche ich und versuche mich loszureißen, doch sein Griff ist eisern. »Nanauatzin, tu doch etwas.«
Dieser hebt hilflos die Schultern. Ich kann den Kampf in seinen Augen sehen, aber er bleibt regungslos. »Ich kann nicht. Mir sind die Hände gebunden.«
»Aber ...« Ich atme schwer aus, denn mir wird bewusst, was das zu bedeuten hat. Vater hat recht behalten. Die Leute haben geredet, weil sie gesehen haben, dass es ihm wie durch ein Wunder so schnell wieder besser ging. Und was wäre da naheliegender, als dass ich ihm geholfen habe, so wie es vor einigen Jahren auch meine Mutter getan hat?
Es liegt in meinem Blut.
Meinem Blut, das irgendwann geopfert werden wird.
So wie das meiner Mutter.
»Lass mich los«, schreie ich den Mann an, der mich aus unserem Haus zerrt, um mich zum Tempel zu bringen. Wenn ich erst da bin, gibt es keinen Ausweg mehr. Dann werden sie mich zwingen, Dinge zu tun, die ich nicht tun will. »Ich habe nichts getan. Ich schwöre es!«
»Ich befolge bloß meine Anweisungen«, presst er mühsam hervor, während er mich weiterschiebt. Ein paar Leute bleiben stehen und beobachten das Spektakel, das wir ihnen bieten.
»Taca, hör auf.« Nanauatzins Stimme klingt so unendlich traurig. Er hat längst aufgegeben. »Du musst mit uns kommen. Du hast keine andere Wahl.«
Ich starre ihn wütend an. In seinen dunklen Augen funkelt der Kummer, aber ich kann nicht verstehen, wieso er hier ist. Wieso ausgerechnet er mich abholt, um mich in den sicheren Tod zu begleiten.
»Warum?«, frage ich ihn tonlos, während ich mit den Tränen kämpfe. »Warum verrätst du mich?«
[1]
Alex
Österreich, 2018
»Was ist los?« Ein ungutes Gefühl breitet sich in meinem Bauch aus, während ich darauf warte, dass sich die Fahrstuhltüren öffnen.
Moose tritt ein Stück zur Seite und zieht seine Karte noch einmal durch das Lesegerät. Statt wie sonst grün aufzublinken, leuchtet die LED-Lampe rot.
Dreimal.
»Die Tür ist gesperrt.«
»Wie jetzt, gesperrt?« Daniel schiebt sich an Jakob und Tarek vorbei und zückt seine eigene Karte. »Probier die mal.«
»Das wird nichts bringen«, murmelt Moose, nimmt die Karte aber trotzdem entgegen, um es damit zu versuchen. Die Lampe bleibt rot. »Irgendwas stimmt da nicht. Sieht aus, als hätte Lotta die Tür blockiert.«
Ich atme schwer aus. Wenn Lotta die Tür blockiert, bedeutet das dann … sind wir zu spät? Waren die Hexenjäger schneller als wir?
»Ich nehm den Weg über die Klamm.« Ich schultere meinen Rucksack und drehe mich um.
»Warte.«, hält Moose mich zurück. »Ich kann den Fahrstuhl hacken. Das geht schneller, als den Berg hochzusteigen.«
Schon holt er sein Tablet aus dem Rucksack und lässt seine Finger über den Bildschirm fliegen. Die anderen sehen sich unsicher um. Ich selbst tigere in der Tiefgarage auf und ab. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass das Verriegeln der Tür nichts Gutes zu bedeuten hat.
Louisa ist da oben.
Ivan.
All die anderen Menschen, die ich zu meiner Familie zähle.
Ich will bei ihnen sein. Seite an Seite mit ihnen kämpfen, wenn es nötig ist.
»Wir sollten uns auf das Schlimmste gefasst machen«, höre ich Daniel wie durch einen Schleier.
»Das Schlimmste?« Jakob schnaubt auf. »Was kann noch schlimmer sein als das, was in Marokko gelaufen ist?«
Er hat immer noch nicht überwunden, dass Tyros tot ist. Genauso wenig wie der Rest von uns.
»Aber Daniel hat recht.« Ich bleibe stehen und blicke die anderen ernst an. »Rüstet euch aus, während Moose sich um das Schloss kümmert. Unser Gepäck können wir später holen.«
Ich gehe zurück zum Auto, und werfe meinen Rucksack auf den Rücksitz, bevor ich den Kofferraum öffne und die Abdeckung hochklappe, die unsere beträchtliche Waffensammlung vor den Augen Neugieriger schützen soll.
Schnell statte ich mich mit einem Schwertgurt für die zwei Krummschwerter aus, mit denen ich zuletzt so viel trainiert habe. Meinen Gürtel tausche ich gegen einen weiteren Holster, in dem ich Handfeuerwaffen und Dolche verstaue.
Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten, während Moose seine ganz eigene Magie benutzt, um den Fahrstuhl zu entsperren. Am liebsten würde ich wirklich gerne außen rumlaufen. Den Weg durch die Klamm nehmen, jede zweite Stufe der alten Holztreppe zwischen den Felswänden überspringen, bis ich schwer atmend oben ankomme - aber er hat recht. Die Zeit, die er zum Hacken der Tür braucht, ist nicht mal annähernd mit der zu vergleichen, die die Strecke über die Klamm benötigen würde.
»Ich hab’s«, ruft Moose nach wenigen Minuten. Kurz darauf gleiten die Fahrstuhltüren auseinander. Wir eilen hinein, halten den Atem an, bis wir oben ankommen und uns das Chaos überwältigt.
Schweratmend schlage ich die Augen auf. Mein Herz rast, meine Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Auf meiner Zunge liegt ein ekliger Geschmack, der die Übelkeit in mir aufsteigen lässt. Gerade rechtzeitig kann ich mich auf die Seite rollen und würge. Ich ächze, ringe nach Luft, bis sich alles in mir zusammenzieht, wieder und wieder, und ich doch keine Erleichterung empfinde.
Schließlich breche ich kraftlos zusammen. Erst jetzt spüre ich die salzige Nässe auf meinen Wangen, fühle den Verlust, als wäre ich wieder der kleine Junge, der seine Eltern verloren hat.
Nur sind es dieses Mal so viele Menschen mehr.
Freya.
Tyros.
Silas.
Louisa.
Gott, Louisa. Mein Herz zieht sich erneut zusammen, doch je mehr ich an sie denke, umso leichter kommt es mir plötzlich vor. Unsere gemeinsame Zeit scheint eine Ewigkeit her zu sein. Ihr Lachen bloß noch eine entfernte Erinnerung.
Und das macht mich erst richtig fertig. Wieso leide ich nicht? Wieso fehlt sie mir nicht so sehr, dass ich nicht mehr atmen kann? Hat sie mir so wenig bedeutet?
Nein. Ich schüttle den Kopf. Wir kannten uns zwar noch nicht lange, aber das, was zwischen uns war, war echt.
Nicht so wie dieses wattige Gefühl, das ich gerade empfinde. Irgendwas stimmt nicht. Es ist, als wäre meine Welt aus den Fugen geraten. Als hätte man Schaumstoff zwischen die Ritzen gespritzt, der Dinge fernhalten soll.
Ich hab dir einen Teil der Last genommen. Vor meinem inneren Auge flackert die Erinnerung auf. Ein Klopfen an meine Tür, Ivans blasses Gesicht. Seine Tränen. Sein familiärer Duft in meiner Nase, während seine Arme mich halten. Mir Halt geben.
Er hat seine Magie auf mich angewandt.
Deshalb fühle ich mich so verwirrt. Deshalb ist da kein stechender Schmerz, kein Unglaube, keine Sinnlosigkeit. Er hat mir meine Trauer genommen.
Meine Liebe.
Was hat er sich bloß dabei gedacht? Einfach so mit meinen Gefühlen zu spielen? In meinen Kopf einzudringen und mir vorzuschreiben, wie ich mich zu fühlen habe?
Wütend setze ich mich auf und greife nach meinem Handy. Als ich den Flugmodus ausschalte und sich mein Handy mit dem WLAN verbindet, blinkt eine neue Nachricht auf.
Ivan: Geht’s dir besser?
Ich tippe so heftig auf das Display ein, dass ich befürchte, es könnte jeden Moment kaputtgehen.
Alex: Was hast du verdammt nochmal getan?! Mein Kopf fühlt sich an wie Watte! Komm her und mach es rückgängig!
Ungeduldig warte ich darauf, dass er online kommt und meine Nachricht beantwortet, aber da sich nach fünf Minuten immer noch nichts getan hat, werfe ich mein Handy zurück in die Kissen und balle die Hände zu Fäusten.
Atmen, Alex. Atmen.
Nachdem ich mich wieder einigermaßen beruhigt habe, höre ich auf zu grübeln und beschäftige mich stattdessen mit den Dingen, auf die ich sofort eine Antwort bekommen kann. Duschen, anziehen, frühstücken, Arbeit suchen.
Mich beschäftigen, damit ich nicht nachdenken kann.
Damit ich nicht das Gefühl habe, jemand hätte in meinem Verstand herumgewühlt wie in einem Haufen Dreck.
Ich schlage die Decke zurück, stehe auf und suche mir etwas Frisches zum Anziehen heraus, bevor ich ins Badezimmer gehe und die Sachen dort auf den Rand des Waschbeckens lege. Ich nehme mir ein neues Handtuch aus dem Schrank und hänge es auf den Handtuchhalter neben der Dusche.
In der Dusche drehe ich das Wasser kalt, vielleicht hilft es mir dabei, die Magie und das betäubende Gefühl abzuwaschen. Ich schließe die Augen und habe das Gefühl, im Regen zu stehen.
»Tja, das ist dann wohl meine Tochter Louisa.« Marita klingt enttäuscht, dabei hat sie mir vor wenigen Augenblicken noch so viel von ihrer Tochter erzählt, dass ich das Gefühl habe, die letzten Jahre mit ihr verbracht zu haben.
Ich betrachte das Mädchen auf dem Flur neugierig. Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, war sie noch fünf Jahre jünger und sehr viel weniger … weiblich. Jetzt ist sie ein paar Zentimeter gewachsen und hat Kurven bekommen, die ich nur unschwer übersehen kann – selbst, wenn ich wollte.
Ihre blauen Augen funkeln mich wütend an. Sie verschränkt die Arme unter der Brust und setzt damit unwissentlich ihr Dekolleté in Szene. Ich unterdrücke ein Grinsen und schaue ihr wieder ins Gesicht, bevor sie noch mitbekommt, wo mein Blick hingewandert ist.
Die Haare kleben ihr nass am Kopf, an ihrer Stirn hat sie einen schwarzen Fleck. Ist das Öl?
Sie reibt sich durchs Gesicht, und ihr Blick bleibt am Stoff ihres Ärmels hängen.
»So ein Scheißdreck«, flucht sie plötzlich, und es fällt mir schwer, das Lachen zu unterdrücken.
Marita schnalzt mit der Zunge. »Tut mir leid, Alexander. Louisa ist manchmal …« Sie hebt hilflos die Hände.
»Sehr sympathisch«, beende ich ihren Satz, weil ich es nicht ertrage, dass sie noch etwas Schlechtes über diese junge Frau sagt, die aussieht, als hätte sie einen harten Tag hinter sich.
Louisas Augen weiten sich überrascht. Scheinbar ist sie es nicht gewohnt, dass jemand ihrer Mutter widerspricht. Bestärkt von ihrer Reaktion überwinde ich den Abstand zwischen uns, um ihr endlich die Hand zu reichen. »Freut mich, dich kennenzulernen, Louisa.«
Sie öffnet die Lippen, bekommt jedoch keinen Ton heraus. Ich will etwas sagen, aber auch mir hat es irgendwie die Kehle zugeschnürt. So komme ich wenigstens in den Genuss, ihre Hand für einen Moment länger zu halten.
Marita seufzt enttäuscht auf, und Louisas Blick gleitet an mir vorbei. Dann wird ihr wohl klar, wie unhöflich ihr Benehmen gerade ist, und sie räuspert sich. »Die Freude ist ganz meinerseits«, presst sie hervor.
Mir wird warm ums Herz.
»Fuck«, wispere ich entsetzt und kämpfe gegen die Tränen. »Fuck, Fuck, Fuck.«
Helle Blitze zucken vor meinen Lidern auf, das Wasser rinnt heiß über meinen Rücken, einen Moment später verschwimmt die Erinnerung. Es fühlt sich an, als wäre sie schon eine Ewigkeit her.
Nachdenklich drehe ich den Wasserhahn ab und öffne die Duschkabine, um nach meinem Handtuch zu greifen, doch ich greife ins Leere.
Hab ich …? Verwirrung breitet sich in mir aus, weil das Handtuch nicht dort ist, wo es sein sollte. Schließlich entdecke ich es auf dem Boden. Es muss runtergerutscht sein, während ich geduscht habe.
Dabei hätte ich schwören können, dass ich es so penibel wie immer aufgehängt habe.
[2]
Farrah
Russland, 2018
In meinen Adern pulsiert die Wut. Sie frisst sich durch meinen Körper und sorgt dafür, dass ich am liebsten alles klein schlagen würde. Aggressionen sind keine Lösung, denke ich schnippisch und presse mich dicht gegen den kalten Backstein, um für einen Moment die Augen zu schließen und mich auf meine Mission zu konzentrieren.
Wenn er doch nur nicht so ein mieser Verräter wäre! Gott! Ich stoße einen stummen Schrei aus und lasse meine Faust gegen die Wand krachen. Der Putz splittert ab. Die Schmerzen zucken durch meinen Körper und holen mich auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ich öffne die Hand, hebe sie vor meine Augen und beobachte, wie die Wunden zu leuchten beginnen und sich von selbst wieder verschließen. Die Magie gibt mir das Gefühl, unverwundbar zu sein - was mich in eine trügerische Sicherheit wiegt, die mir schon einmal beinahe zum Verhängnis wurde.
Dennoch schaffe ich es nicht, andere vorauszuschicken. Um die wichtigen Dinge kümmere ich mich lieber selbst.
Bevor jemandem auffallen kann, dass eine wildfremde Frau im Morgengrauen durch die Straßen streift, als hätte sie Böses im Sinn, mache ich mich lieber auf den Weg. Ich stelle den Kragen meines Mantels auf und versuche, auf dem frischen Schnee nicht auszurutschen.
Es ist bitterkalt in Russland, und ich sehne mich bereits jetzt nach einem warmen Bad in meinem Häuschen in der Toskana. Vielleicht sollte ich auf dem Rückweg einfach einen Umweg über Mexiko machen, um mich dort mit Sonne und Wärme aufzutanken.
Jegor Stanislavs Villa liegt im Süden der Stadt, gut verborgen hinter den Gassen, in denen die Armut zu Hause ist. Die zerfallenen Häuser können unmöglich genug Wärme spenden, um die Familien vor der Kälte zu schützen.
Mein Blick fällt auf eine junge Frau, die in eine Decke eingewickelt am Fenster steht und raucht. Sie beobachtet mich argwöhnisch. Ich nicke ihr zu.
»Kalt heute«, sage ich in perfektem Russisch.
»Es ist immer kalt.« Sie hustet und wickelt sich enger in ihre Decke ein. Aus dem Inneren der Wohnung ertönt eine Kinderstimme. Die Frau vor mir seufzt. »Jetzt nicht, Ilja. Schlaf noch ein bisschen, ja? Es ist noch viel zu früh.«
Mir fallen ihre fahle Haut und der fiebrige Glanz in ihren Augen auf. Sie ist krank, und ich könnte wetten, dass sie sich allein um ihr Kind kümmert.
»Hier.« Ich sehe mich kurz in alle Richtungen um, bevor ich ihr einen Bund russischer Rubel hinhalte. Sie kann ihn besser gebrauchen als einer von Stanislavs Leuten. Argwöhnisch sieht sie auf das Geld, das im leichten Wind flattert.
Meine Finger werden kalt, und allmählich befürchte ich, sie spuckt mir jeden Moment vor die Füße, weil sie den Schein nicht annehmen will, aber dann erwärmen sich ihre Gesichtszüge.
»Warum tun Sie das?«
»Weil ich genug davon habe und Sie es offenbar gut gebrauchen können.« Ich lächle sie an und konzentriere mich darauf, ihre Hand abzufangen, als sie nach dem Geld greift. Ich lege meine andere auf ihre und schicke eine gute Portion Heilmagie in ihren Körper, damit es ihr in ein paar Stunden besser geht. »Schonen Sie sich und gönnen Sie sich und ihrem Kleinen eine vernünftige Mahlzeit, ja?«
Ich lasse sie los und erwidere ihren mit Tränen gefüllten Blick fest.
»Danke! Haben Sie vielen Dank.«
Ich winke ab und verabschiede mich von ihr, um meinen Weg fortzusetzen. Die kurze Begegnung mit ihr hat mir dabei geholfen, mich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich bin hier, um Gutes zu tun, nicht, um Rache zu üben. So einfach ist das.
Und doch dreht sich mir der Magen um, als ich wenige Augenblicke später vor dem Anwesen stehe. Der krasse Widerspruch zu den Häusern in der Umgebung macht mich krank. Statt seinen Wohlstand in vergoldeten Zäunen und einer riesigen Auffahrt auszudrücken, könnte Stanislav auch einfach mal der Bevölkerung in seiner Stadt helfen.
Ich laufe langsam am Zaun entlang und beobachte das strahlende Anwesen in Ruhe. Hinter den großen Sprossenfenstern erkenne ich nicht viel, dafür ist es zu weit weg, aber an der linken Ecke des dreistöckigen Gebäudes biegt gerade eine Wache ab. Stanislav lässt seine Schoßhündchen hier also regelmäßig patrouillieren. Irgendwie muss er ja dafür sorgen, dass seine Beute nicht rauskommt.