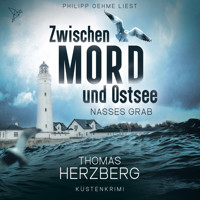3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wegners erste Fälle
- Sprache: Deutsch
Der Kiez: Nur um Haaresbreite und schwer verletzt überlebt Hauptkommissar Kallsen einen feigen Mordanschlag. Wegner, der in erster Linie mit seinem Privatleben beschäftigt ist, hat plötzlich alle Hände voll zu tun: Er muss die Verantwortlichen finden und nebenbei weitere Gefahr von seinem Chef fernhalten. Ein Spagat, bei dem er Hilfe von unerwarteter Seite bekommt. Doch jeder vermeintliche Schritt nach vorne sorgt anderenorts für neues Chaos. Am Ende sind nicht nur zahlreiche Menschenleben, sondern auch der Frieden auf dem ganzen Kiez in Gefahr …
Aus der Reihe Wegners erste Fälle:
- »Eisiger Tod« (Teil 1)
- »Feuerprobe« (Teil 2)
- »Blinde Wut« (Teil 3)
- »Auge um Auge« (Teil 4)
- »Das Böse« (Teil 5)
- »Alte Sünden« (Teil 6)
- »Vergeltung« (Teil 7)
- »Martin« (Teil 8)
- »Der Kiez« (Teil 9)
- »Die Schatzkiste« (Teil 10)
- »Mausetot« (Teil 1)
- »Psycho« (Teil 2)
- »Der Hurenkiller« (Teil 1)
- »Der Hurenkiller – das Morden geht weiter …« (Teil 2)
- »Franz G. - Thriller« (Teil 3)
- »Blutige Rache« (Teil 4)
- »ErbRache« (Teil 5)
- »Blutiger Kiez« (Teil 6)
- »Mörderisches Verlangen« (Teil 7)
- »Tödliche Gier« (Teil 8)
- »Auftrag: Mord« (Teil 9)
- »Ruhe in Frieden« (Teil 10)
- »Kaltes Herz« (Teil 1)
- »Skrupellos« (Teil 2)
- »Kaltblütig« (Teil 3)
- »Ende gut, alles gut« (Teil 4)
- »Mord: Inklusive« (Teil 5)
- »Mörder gesucht« (Teil 6)
- »Auf Messers Schneide« (Teil 7)
- »Herr Müller« (Teil 8)
- »Ausgerechnet Sylt« (1)
- »Eiskaltes Sylt« (2)
- »Mörderisches Sylt« (3)
- »Stürmisches Sylt« (4)
- »Schneeweißes Sylt« (5)
- »Gieriges Sylt« (6)
- »Turbulentes Sylt« (7)
- »Nasses Grab« (1)
- »Grünes Grab« (2)
- »Der Schlitzer« (Teil 1)
- »Deutscher Herbst« (Teil 2)
- »Silvana« (Teil 3)
- »Marthas Rache« (Schweden-Thriller)
- »XIII« (Thriller)
- »Zwischen Schutt und Asche« (Nachkrieg: Hamburg in Trümmern 1)
- »Zwischen Leben und Tod« (Nachkrieg: Hamburg in Trümmern 2)
- »E.S.K.E.: Blutrausch« (Serienstart E.S.K.E.)
- »E.S.K.E.: Wiener Blut« (Teil 2 - E.S.K.E.)
- »Ansonsten lächelt nur der Tod«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der Kiez (Wegners erste Fälle)
Hamburg Krimi
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Der Kiez
Wegners erste Fälle
Thomas Herzberg
Alle Rechte vorbehalten
Fassung: 1.01
Cover: Titel: Hochland / photocase.de; Hamburg Skyline: pixelliebe/stock.adobe.com
Covergestaltung (oder Umschlaggestaltung): Marius Gosch, www.ibgosch.de
Die Geschichte ist frei erfunden. Alle Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und/oder realen Handlungen sind rein zufällig. Sämtliche Äußerungen, insbesondere in Teilen der wörtlichen Rede, dienen lediglich der glaubhaften und realistischen Darstellung des Geschehens. Ich verurteile jegliche Art von politischem oder sonstigem Extremismus, der Gewalt verherrlicht, zu selbiger auffordert oder auch nur dazu ermuntert!
Ein großes Dankeschön geht an meine lieben Testleserinnen und meinen einzigen Testleser (in alphabetischer Reihenfolge):
Antje, Bärbel Mörseburg, Birgit, Nicolas, Renate Schmidt
(Ihr seid die Besten!)
Inhalt
Nur um Haaresbreite und schwer verletzt überlebt Hauptkommissar Kallsen einen feigen Mordanschlag. Wegner, der in erster Linie mit seinem Privatleben beschäftigt ist, hat plötzlich alle Hände voll zu tun: Er muss die Verantwortlichen finden und nebenbei weitere Gefahr von seinem Chef fernhalten. Ein Spagat, bei dem er Hilfe von unerwarteter Seite bekommt. Doch jeder vermeintliche Schritt nach vorne sorgt anderenorts für neues Chaos. Am Ende sind nicht nur zahlreiche Menschenleben, sondern auch der Frieden auf dem ganzen Kiez in Gefahr …
Bisher sind in der Reihe Wegners erste Fälle erschienen:
»Eisiger Tod« (Teil 1)
»Feuerprobe« (Teil 2)
»Blinde Wut« (Teil 3)
»Auge um Auge« (Teil 4)
»Das Böse« (Teil 5)
»Alte Sünden« (Teil 6)
»Vergeltung« (Teil 7)
»Martin« (Teil 8)
»Der Kiez« (Teil 9)
Prolog
»Siehst du: Ich hab dir doch gesagt, dass der Klose früher oder später über Brokdorf stolpert.« Gerd Kallsen donnerte seine halbvolle Bierflasche auf den Wohnzimmertisch, wo bereits vier leere Exemplare standen. Die 20:00-Uhr-Ausgabe der Tagesschau und deren Inhalte zu kommentieren, gehörte zu den allabendlichen Disziplinen des Hauptkommissars.
Sein Schäferhund Rex, der gegenüber im Sessel lag, drehte die Ohren und hob kurz den Kopf. Doch der fiel schon im nächsten Moment wieder auf seine Pfoten hinunter. Offensichtlich interessierte er sich nicht für den ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg und noch weniger für ein Kernkraftwerk vor deren Toren.
Trotzdem fuhr Kallsen unbeirrt fort: »Du wirst noch an meine Worte denken: Spätestens im Mai ist unser Freund Klose Geschichte und wir müssen uns mit ’nem neuen Gesicht im Rathaus anfreunden. Bin gespannt, wer das Rennen macht.«
Von dieser Spannung ließ sich Rex offensichtlich nicht anstecken, denn er reagierte dieses Mal überhaupt nicht. Verdrehte nicht mal die Ohren.
Kallsen rülpste geräuschvoll, um Platz für einen weiteren Schluck aus seiner Bierflasche zu schaffen. In der Tagesschau sprach Dagmar Berghoff gerade über Versuche der deutschen Bundesregierung, im Konflikt am Persischen Golf zu vermitteln. Iran und Irak führten dort eine schwer bewaffnete Auseinandersetzung, die im Begriff war, den Weltfrieden zu gefährden.
Kallsen hatte natürlich den passenden Kommentar parat: »Der Schmidt wird auch nichts daran ändern. Wenn du mich fragst, hätte er in Hamburg bleiben sollen. Jedes Jahr als Kanzler zählt für vier. Mindestens! Das ist wie bei uns in der Mordkommission.«
Dieses Mal hob Rex wieder den Kopf. Eine Stimme vorausgesetzt, hätte er sicherlich protestiert. Schließlich verbrachte sein Herrchen als Leiter dieser sagenhaften Mordkommission seine Zeit hauptsächlich damit, Kuchen zu essen und große Reden zu schwingen. Die Arbeit ließ er gerne von anderen erledigen.
Kallsen wollte sich auf seinem Sofa langmachen, dabei rutschte ihm die Bierflasche aus der Hand. Der Rest daraus lief über die ausgebeulten Knie seiner Pyjamahose.
»Verdammte Scheiße!« Er nahm eines der abgewetzten Sofakissen zur Hand und versuchte, das Malheur damit zu beseitigen. Natürlich erfolglos.
Rex verfolgte seine Bemühungen mit hellwachen Augen. Schließlich kamen unter den Sofakissen oft genug Reste von Erdnüssen oder Chips zutage. Doch plötzlich schoss der Kopf des Schäferhundes herum.
Jemand machte sich hörbar an Kallsens Wohnungstür zu schaffen.
Der hatte sich gerade erst stöhnend vom Sofa hochgestemmt und schaute auf die Knie seiner mit Bier besudelten Pyjamahosen hinunter. »Ich wette, das ist Manni.« Kallsen lachte röhrend. »Der hat die Vorstellung bei seinen Schwiegereltern versaut und jetzt braucht er ’ne starke Schulter zum Ausheulen – aber vorher soll er noch ’nen Sechserpack Bier auftreiben. Danach nimmt Vati ihm die Beichte ab. Und du bist unser Zeuge!«
Rex lag zwar noch im Sessel, aber seine volle Aufmerksamkeit galt der Wohnungstür. Als die mit gewaltigem Krachen nach innen aufflog, ging sogar der Schäferhund für einen kurzen Moment in Deckung.
Kallsen taumelte nach hinten, wurde jedoch von seinem Sofa ausgebremst und plumpste wie ein Sack herunter. Beinahe im selben Moment – und mit einer Geschwindigkeit, die niemand dem Hauptkommissar zugetraut hätte – verschwand seine Rechte unter einem der großen Kissen, um von dort mit seiner Dienstwaffe zurückzukehren.
Einen halben Atemzug später stand ein Hüne mit kantigem Gesicht und raspelkurzen Haaren mitten im Wohnzimmer, einen gewaltigen Revolver in Vorhalte.
Weil sich dessen Mündung ausgerechnet auf sein Herrchen richtete, verzichtete Rex auf einen Umweg über den Teppichboden und sprang direkt vom Sessel ab. Seine Instinkte als ehemaliger Polizeihund versteckten sich zwar immer häufiger hinter Leckereien und Spielzeugen, ganz in Vergessenheit geraten waren sie aber noch nicht.
Angesichts eines wohlgenährten Schäferhundes von mindestens vierzig Kilo, der ihn von der Seite ansprang, geriet der Angreifer ins Straucheln und taumelte zur Seite. Der Revolver landete auf dem Teppichboden, während Rex‘ Eckzähne längst ihren Weg durch den Ärmel einer Jacke gefunden hatten. Ein schmerzerfüllter Schrei erklang. Ohne es zu wissen, hatte der Schäferhund damit einem zweiten Angreifer freie Schussbahn beschert. Der stürmte ins Wohnzimmer, seine Pistole auf Kallsen gerichtet.
Das erste Projektil durchschlug den Oberschenkel des Hauptkommissars. Der fiel nach hinten in die Sofakissen und warf sich instinktiv zur Seite, sodass der zweite Schuss ihn knapp verfehlte.
In dieser Position schaffte es Kallsen lediglich, zwei Kugeln auf den Angreifer abzufeuern, mit dem Rex noch beschäftigt war. Instinktiv ließ der Schäferhund von dem Mann ab, vollbrachte es aber nicht mehr rechtzeitig, nach dem Unterarm des zweiten Angreifers zu schnappen. In dessen Hand steckte die Pistole, deren Mündung noch immer auf Kallsen zeigte.
Ein weiterer Schuss dröhnte durchs Wohnzimmer. Die dazugehörige Kugel durchschlug Kallsens Hals.
Rex machte einen gewaltigen Satz nach vorne. Seine Zähne umklammerten den nächsten Unterarm und hatten sich längst durch den Ärmel einer Lederjacke gebohrt. Der zweite Angreifer brüllte und fluchte, während Kallsen auf dem Sofa immer lauter stöhnte und Rex mit Flüchen anfeuerte.
Von weiter hinten hallten erste Stimmen durchs Treppenhaus. Eine davon rief »Polizei«, die andere um Hilfe, was wohl mehr oder weniger auf’s Gleiche hinauslief.
Diese Verwirrung nutzend, hatte es der zweite Angreifer geschafft, Rex einen Tritt zu verpassen und den Schäferhund damit für einen Moment abzuschütteln. Der war schon im Begriff nachzusetzen, als Kallsen noch lauter als zuvor stöhnte.
Rex sah sich vermutlich einem – für Schäferhund-Verhältnisse – schrecklichen Konflikt gegenüber. Vor sich Angreifer Nummer zwei, der im Begriff war zu fliehen. Hinter ihm sein Herrchen, das Hilfe brauchte. Seinen tierischen Instinkten geschuldet, stand der Schäferhund kurz darauf vor dem Sofa und jaulte kläglich, weshalb auch immer.
Im Treppenhaus waren schwere Schritte zu hören, die die Stufen hinunterrasten …
1
Ein paar Stunden später, mitten auf dem Kiez
»Willst du mich verarschen, Ronny? Ich hab doch gesagt, ihr sollt den Scheißkerl kaltmachen … nicht bloß erschrecken!« Theo Engelbrecht lehnte im Hinterzimmer seiner Kiezkneipe an seinem Schreibtisch. Darauf türmten sich allerlei Papiere, auf den ersten Blick Rechnungen und Lieferscheine. Das Gegröle aus dem Schankraum erreichte an einem Freitagabend kurz vor Mitternacht seinen Zenit und schaffte es mit Leichtigkeit durch die geschlossene Tür. Durch die war kurz zuvor das Ziel seiner Attacke hereingekommen: Ronny, ein breitschultriger Riese, der so auch eins zu eins in die Zeit der Höhlenmenschen gepasst hätte.
»Du bist noch bekloppter, als du aussiehst!«, fuhr Theo wütend fort. Danach stieß er sich mit lässiger Bewegung vom Schreibtisch ab und machte ein paar Schritte nach vorne, bis er direkt vor Ronny angekommen war. »Und kannst du mir mal verraten, warum du allein bist? Wo ist Alex geblieben?«
»Den hat’s erwischt!«
Theos Augenbrauen wanderten nach oben. Ansonsten schien ihn der Tod eines seiner Handlanger nicht besonders zu interessieren.
Ronny versuchte es stammelnd mit einer Erklärung: »Wir sind in die Wohnung rein, wie du gesagt hast. Aber da war plötzlich so’n Köter – und dieser Kallsen hatte ’ne Waffe. Du hast doch gesagt, dass er …«
»Kann mich nicht erinnern, euch zwei Idioten gegenüber von ’nem Spaziergang gesprochen zu haben. Dafür hätt ich euch wohl kaum bezahlt.« Theo machte einen weiteren Schritt nach vorne. Mit seinem rechten Zeigefinger tippte er dem Riesen vor sich gegen die Stirn, als hätte er vor, ein Loch hineinzubohren. Und auch die Beschimpfungen gingen weiter: »Dein alter Herr hätte lieber’n Gummi benutzen sollen. Hast du ’ne Ahnung, was los ist, wenn Kallsen den Anschlag überlebt und herausfindet, dass ich hinter allem stecke?«
»Ich hab ihn zweimal getroffen, Boss. Der überlebt garantiert nicht.«
»Da hab ich von meinem Informanten aus dem Krankenhaus aber was anderes gehört«, erklärte Theo kopfschüttelnd. »Wenn Kallsen überlebt, war alles umsonst. Und falls jemand das Maul nicht halten kann, weiß der Scheißkerl gleich, wo er suchen muss.«
»Wer sollte denn …?« Ronny verstummte mitten im Satz. Sein Gesicht verzog sich. Wahrscheinlich hatte er sich die Frage zwischenzeitlich selbst beantwortet. »Ich kann nichts dafür«, jammerte er wie ein kleiner Junge. »Woher hätten wir denn wissen sollen, dass der Typ sich wehrt? Und dass er ’nen Hund hat, hast du uns auch nicht gesagt. Dann hätten wir bestimmt nicht …«
»Der Auftrag war doch eindeutig!«, fuhr Theo aufgebracht dazwischen. »Ihr fahrt hin, erledigt Kallsen und bekommt eure Kohle. Mal ehrlich: Kann es noch einfacher sein?«
Die Antwort klang jämmerlich: »Der Scheißköter hat mich gebissen.« Zur Erklärung hielt Ronny seinen rechten Arm empor. Im unteren Bereich wies seine Lederjacke mehrere Löcher auf. »Jacky vom Tresen hat ’nen Verband drum gemacht, ansonsten wär ich wahrscheinlich schon …«
»Ich will den ganzen Mist nicht hören!«, fauchte Theo dazwischen. »Wenn’s nach mir ginge, hätte dir der Köter den Arm auch gerne abbeißen dürfen – dann müsste ich mir wenigstens dein bescheuertes Gelaber nicht anhören.«
Nach dieser eindrucksvollen Mitleidsbekundung herrschte eine Weile Schweigen. Und während Ronny noch immer mit hängenden Schultern vor der Tür stand, war Theo hinter seinem Schreibtisch angekommen. Er zog eine Schublade weiter unten heraus.
»Ich kann’s noch mal probieren, Boss. Wenn Kallsen aus dem Krankenhaus rauskommt, dann …«
»… versaust du’s garantiert wieder!«, vervollständigte Theo, von freudlosem Lachen begleitet. Er richtete sich hinter seinem Schreibtisch auf. Danach war auch klar, was er aus der Schublade geholt hatte: einen Revolver. Von kleinem Kaliber, wie ihn Frauen gern in ihrer Handtasche verstauen. Dessen Mündung zeigte direkt in Ronnys Gesicht.
Doch der sah noch relativ unbekümmert aus, war solche Drohgebärden offensichtlich gewohnt. »Ich bring das wieder in Ordnung, Boss. Indianerehrenwort!«
»Indianerehrenwort«, wiederholte Theo gedehnt. »Du hast sie echt nicht mehr alle.«
Ronny zuckte mit den Schultern. Was sollte er auf eine solche Feststellung auch erwidern?
Sein Chef hingegen kam immer mehr in Fahrt. »Was ist, wenn die Bullen dich schnappen und unter Druck setzen? Hältst du dann auch artig die Fresse … als großer Indianerhäuptling?«
»Logisch!«
»Und wenn einer von denen genauso korrupt wie seine Kiez-Kollegen ist – was willst du anstellen, wenn sie deiner kleinen Schwester ’ne Wumme an den Kopf halten? Ganz entspannt ’ne Friedenspfeife stopfen und die Sache am Lagerfeuer aussitzen?«
Ronnys Miene verzog sich angestrengt, ein Anzeichen dafür, dass er den Sinn von Metaphern nicht auf Anhieb erkannte. Und weil er sich mit seiner Antwort zu viel Zeit ließ, stand Theo kurz darauf nur noch zwei Meter von ihm entfernt. Die Mündung des Revolvers zeigte mittlerweile auf Ronnys Eingeweide.
Auf dessen Stirn standen inzwischen Schweißperlen, was seine demonstrierte Zuversicht nicht gerade glaubhafter erscheinen ließ. »Ich krieg das schon hin, Boss. Gib mir’n bisschen Zeit, dann …«
»Zeit?«, wiederholte Theo. Sein höhnischer Tonfall verriet, was er von dieser Bitte hielt. »Du hast es immer noch nicht kapiert: Wir haben alles, aber keine Zeit. Kallsen war ganz dicht davor, uns allen auf die Schliche zu kommen. Und wenn er die Aktion heute tatsächlich überlebt, dann ist er morgen vielleicht schon einen Schritt weiter. Das kann uns alle hinter Gitter bringen … oder Schlimmeres.«
Ronny brachte nicht mehr als ein fragendes Gesicht zustande.
»Kallsen ist mir im Prinzip scheißegal«, erklärte Theo mit beinahe versöhnlicher Stimme. »Wenn’s nach mir ginge, hätte er sich gern in die Rente verabschieden und bis zum Abnibbeln mit seinem Köter Gassi gehen dürfen. Dahinter steckt viel mehr, du dämlicher Hornochse!«
Trotz dieser neuen Beschimpfung entspannte sich Ronnys Gesicht zusehends. Seine nächste Frage läutete er mit einem Grinsen ein. »Für wen arbeiten wir eigentlich, Boss?«
»Wenn ich das erzähle, müsste ich dich hinterher erschießen.«
»Dann lässt du’s lieber«, kam es dümmlich lachend zurück.
Theo setzte einen halben Schritt nach hinten. Die Mündung des Revolvers zeigte unverändert auf die Eingeweide seines Handlangers. Im Schankraum schwoll das allgemeine Gegröle noch weiter an. Der Streit dort lief wohl langsam aus dem Ruder.
Ronny nutzte die Gelegenheit für einen unbeholfenen Vorstoß: »Alex ist tot und wegen mir brauchst du dir keine Sorgen zu machen: Ich halt garantiert die Fresse.«
»Ich weiß!« Theo setzte noch einen halben Schritt zurück. Die Hand, in der er den Revolver hielt, wanderte ein paar Zentimeter empor. Der Schuss war nicht viel lauter als das Knallen einer Schranktür; war nebenan vermutlich niemandem aufgefallen. Und selbst wenn: Auf dem Kiez herrschten raue Sitten und es gab nur selten jemanden, der Mumm genug hatte, vor Gericht bei seiner Aussage zu bleiben. Spätestens, wenn bezahlte Schläger vor der Tür standen, verlor manch einer spontan das Gedächtnis und alle zuvor noch so farbenfrohen Erinnerungen.
Und käme in diesem Moment jemand durch die Tür ins Hinterzimmer, dann würde der nur über einen Muskelberg mit einem kleinen Loch in der Brust stolpern. Ronnys Kampf mit Gevatter Tod hatte lediglich ein paar Sekunden gedauert. Nach einem letzten schweren Atemzug sah sein Gesicht völlig entspannt aus. Beneidenswert!
Theo wollte sich gerade zu seinem Opfer hinunterbücken, da klingelte hinter ihm auf dem Schreibtisch das Telefon. Und das war sicherlich kein Zufall. Diese Nummer hatte nur eine Handvoll Leute. Einem davon hätte er sie – rückblickend betrachtet und allein nach den Ereignissen des heutigen Tages – lieber nicht geben sollen. Aber es gab eben Dinge, die man nicht rückgängig machen konnte.
Nach zwei langen Schritten stand Theo vor seinem Schreibtisch. Er hoffte, das Klingeln würde aufhören. Doch das Schicksal tat ihm diesen Gefallen nicht, also nahm er den Hörer ab.
Am anderen Ende der Leitung hörte er jemanden atmen. Dessen erste Frage erklang mit leiser, aber eiskalter Stimme: »Ist er tot?«
»Ich hab keine Ahnung«, erklärte Theo übereilt. Den verzweifelten Unterton hätte er sich lieber erspart. »Von den Typen, die ich auf Kallsen angesetzt hab, ist einer tot und der andere …« Sein Blick fiel auf Ronny, der ein paar Meter entfernt reglos auf dem Teppichboden lag. »… auch. Aber der Trottel meinte, er hätte Kallsen zweimal getroffen – einmal davon in Hals oder Kopf.«
»Ist er tot?«, fragte die Stimme ein weiteres Mal völlig unbeirrt.
Also blieb Theo nichts anderes übrig, als seinen ohnehin löchrigen Wissensstand preiszugeben. »Ich hab einen im Krankenhaus, der meint, sie hätten ihn nach der Not-OP in den Aufwachraum geschoben. Aber da kommen wir momentan nicht an ihn ran, da wimmelt es nur so von Bullen.«
»Also ist er nicht tot.«
Theo schwieg. Was hätte er auch antworten sollen? Er war kein Arzt und auch mit Wahrscheinlichkeitsrechnung tat er sich für gewöhnlich schwer.
Dieses Schweigen sorgte am anderen Ende der Leitung für eine unmissverständliche Aufforderung: »Kümmer dich darum, ansonsten …«
»Ich krieg das schon hin!« Theos Stimme klang so dünn, dass er nicht einmal selbst an seine Worte glaubte. »Ich probier vielleicht morgen schon was im Krankenhaus und wenn das nicht klappt, dann …« Den Rest konnte er sich genauso gut sparen. Sein Gesprächspartner hatte aufgelegt.
2
»Wer ist denn da, verdammt?« Diese Frage musste sich durch eine geschlossene Wohnungstür bis ins Treppenhaus dahinter kämpfen. Dem Bewohner – laut Klingelschild ein gewisser Horst Brettschneider – war seine Wut mehr als deutlich anzuhören.
Es musste also eine Erklärung her: »Hier ist Wegner … Manfred Wegner.«
Doch auch diese Vorstellung änderte nichts an der Stimmung auf der anderen Seite der Tür. »Bist du schwerhörig? Verschwinde! Und wenn’s unbedingt sein muss, komm morgen wieder.«
»Ich muss mit Ihnen reden, Herr Brettschneider. Jetzt!«
»Und was willst du? Hast du ’ne Ahnung, wie spät es ist?«
Wegner stand dort wie ein begossener Pudel. Und er wusste genau, wie spät es war. Zweifellos gab es kaum einen schlechteren Zeitpunkt als Mitternacht, um in einem Treppenhaus zu stehen, in dem kurz zuvor das Licht verloschen war. Doch der Weg zum Schalter und zurück würde Horst Brettschneider womöglich genug Zeit lassen, um eine Unterhaltung, die ohnehin nur durch eine geschlossene Wohnungstür hindurch erfolgte, zu beenden.
Es mussten also Fakten her, und Wegner hatte auch nicht mehr vor, anderen Hausbewohnern gegenüber Rücksicht zu üben. »Kallsen hat’s erwischt!« Seine Stimme hallte deutlich lauter als zuvor durchs Treppenhaus. »Er liegt in Altona … sieht nicht gut aus.«
Eine ganze Weile passierte nichts. Wegner wollte es schon mit Klopfen oder weiteren Details probieren, da drehte sich vor ihm plötzlich ein Schlüssel im Schloss. Die Wohnungstür – für Altbau-Verhältnisse auf den ersten Blick viel zu massiv – öffnete sich nur einen Spalt weit. Dann tauchte das aufgeschwemmte Gesicht von Horst Brettschneider auf, ein Mann von geschätzt Ende fünfzig.
Dessen erste Frage hatte erwartungsgemäß nichts mit einer freundlichen Begrüßung zu tun: »Und was hab ich damit zu tun?«
Angesichts einer solchen Reaktion zuckte Wegner nur mit den Schultern. Zum ersten Mal fiel ihm auf, dass dieser Brettschneider ihm nicht ins Gesicht, sondern auf die Brust starrte. Gerade so, als gebe es dort etwas Besonderes zu sehen.
Wegner folgte dem Blick, konnte im Halbdunkel allerdings nichts entdecken. Angesichts frostigen Schweigens ließ er in Gedanken den vergangenen Abend Revue passieren. Die Eltern seiner Verlobten Gisela hatten ihn zum Essen eingeladen, wollten ihren Schwiegersohn in spe an einem Freitagabend endlich richtig kennenlernen. Solche Veranstaltungen waren in den Monaten zuvor entweder an Wegners Dienstplan gescheitert oder mündeten im Chaos und vorzeitigem Abbruch. Deshalb hatte Wegner sich dieses Mal Störungen durch die Einsatzleitstelle verbeten und in Sachen Notfälle auf seinen Chef Gerd Kallsen verwiesen.
Als dann das Telefon im Flur seiner Schwiegereltern klingelte und es hieß, der Anruf sei für Wegner, dachte der noch an einen schlechten Scherz. Doch dem Kollegen aus der Einsatzleitstelle war nicht nach Lachen zumute. Es ginge um eine Schießerei, ausgerechnet in Kallsens Wohnung. Und man wisse noch nichts Genaues, erklärte der Kollege mit schüchterner Stimme, aber es stünde fest, dass sich der Hauptkommissar dabei zwei Kugeln eingefangen habe. Einer der Angreifer läge tot in dessen Wohnzimmer, hieß es noch.
Vor Schreck war Wegner der Telefonhörer aus der Hand gerutscht und er spürte nur noch, wie ihm schwindelig wurde. Als er wenig später auf dem Fliesenboden im Flur seiner Schwiegereltern lag, hatte ihn Gisela mit einem nassen Handtuch schnell wieder in die Realität zurückgeholt.
Ein paar Minuten später saß er in seinem Dienstwagen. Doch selbst angesichts solcher Hiobsbotschaften erinnerte er sich an einen Zettel, den ihm Kallsen nur zwei Wochen zuvor mit hochwichtiger Miene zugesteckt hatte. Darauf ging es um Maßnahmen und Anweisungen, die genau einen solchen Fall betrafen: einen Angriff auf den Hauptkommissar.
Wegner hatte den Zettel seinerzeit mehrfach geknickt und lachend eingesteckt, seinen Chef sogar auf die Schippe genommen. Damit, dass er diesen Zettel so schnell wieder aus seiner Brieftasche fischen müsste, hatte er nicht gerechnet. Bis zu diesem Abend!
Mit zitternden Fingern drehte Wegner den Zündschlüssel und raste nicht etwa in Richtung Berliner Tor, dem Ort des Geschehens, sondern stand in einem dunklen Treppenhaus und musste sich vor einem Mann rechtfertigen, den er nicht mal kannte und der ihm immer noch auf die Brust starrte.
›Alles nur wegen eines Zettels‹, fluchte Wegner innerlich. Es hätte nicht verrückter sein können. Aber es passte zu Kallsen und dessen immer absurderen Ideen.
Angesichts längeren Schweigens verfinsterte sich das Gesicht des Wohnungsinhabers noch weiter. »Was ist los, Jungchen? Hat’s dir die Sprache verschlagen?«
»Kallsen hat mir Ihre Adresse gegeben und gesagt, dass ich als Erstes zu Ihnen fahren soll – also, falls ihm was passiert.«
Horst Brettschneider zuckte mit den Schultern. Die wortlose Variante, ›Na und‹ zu sagen.
Wegner glaubte schon, das Gespräch sei beendet, als sich die Tür vor ihm ein Stück weiter öffnete. Er musste sich seitwärts hindurchschieben und stand kurz darauf in einem ebenfalls halbdunklen Wohnungsflur. Alles rundherum war höchstens schemenhaft zu erkennen.
Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss. Er spürte eine Hand an seiner Jacke und musste feststellen, dass dieser Brettschneider eine Pistole auf ihn richtete.
»Woher soll ich denn wissen, dass Kalle dich wirklich schickt?«, erklang es dazu zischend.
Wegner wollte in die Jackentasche greifen, seinen Dienstausweis herausholen, doch schon der Beginn dieser Bewegung sorgte bei seinem Gegenüber offensichtlich für Nervosität. Er spürte die Mündung der Pistole in seinen Eingeweiden.
»Wie heißt Kalles Hund?«, wollte Horst Brettschneider plötzlich von ihm wissen. Dessen Fokus lag mittlerweile nicht mehr auf Wegners Brustkorb, sondern etwa auf Halshöhe.
Unabhängig davon tat der gut daran, schnell zu antworten: »Rex! Er heißt Rex …«
Die Antwort sorgte für ein zufriedenes Nicken. »Und wie heißt seine Schwester?«
Wegner zuckte innerlich zusammen. Er wusste nicht besonders viel über das Privatleben seines Chefs. Auch, weil der gern einen Hehl daraus machte. Und von einer Schwester, so viel stand fest, hatte Wegner bisher nie gehört.
Weil sich die Mündung der Pistole immer tiefer in seine Eingeweide grub, versuchte er es notgedrungen mit der Wahrheit: »Ich wusste nicht mal, dass er ’ne Schwester hat. Wohnt die auch hier in Hamburg?«
Der Druck in seinen Eingeweiden ließ nach, war kurz darauf komplett verschwunden.
Als Zeichen des plötzlich vorhandenen Vertrauens drehte ihm Horst Brettschneider sogar den Rücken zu und schlurfte durch seinen Wohnungsflur davon. Nach jedem zweiten Schritt tastete er links und rechts von sich in die Luft, um die Orientierung zu behalten.
Wegner fiel es wie Schuppen von den Augen. Der Mann war blind. Deshalb musste er sich an Geräuschen und Bewegungen orientieren.
Innerlich atmete Wegner erleichtert aus. Ein Blinder mit einer Pistole – das hätte auch ganz anders ausgehen können. Noch stand er wie angewurzelt im Wohnungsflur und wusste nicht, was er tun sollte. In seiner Ratlosigkeit folgte er dem Mann, der gerade nach rechts abbog.
In die Küche, wie Wegner kurz darauf feststellte. Dort tastete sich der Hausherr gerade an seinem Buffet entlang und öffnete einen Brotkasten. In dem befand sich allerdings kein Backwerk, sondern eine Cognacflasche. Den seltsamen Aufbewahrungsort mal beiseite gelassen, kein schlechter Tropfen.
»Willst du auch einen?«, fragte Brettschneider, nachdem er in einem Regal über sich zwei Gläser ertastet hatte. Doch der Ton in seiner Stimme verriet, dass er auf’s Gegenteil hoffte.
Und Wegner tat ihm den Gefallen. Er wollte ohnehin nüchtern und auf jeden Fall bei klarem Verstand bleiben. Also schüttelte er den Kopf.
»Was ist? Willst du einen oder nicht?«
Wegner entschuldigte sich. »Hatte vergessen, dass Sie blind sind. Nein danke.«
Als sich Horst Brettschneider zu ihm umdrehte, hatte er plötzlich eine Brille auf der Nase. Deren Gläser konnte man reinen Gewissens als schusssicher bezeichnen. Dazu erklang eine Erklärung: »Ich bin nicht blind … nicht ganz.«
Wegner wusste darauf nichts Vernünftiges zu erwidern. Er versuchte es mit einer Frage: »Wie ist das passiert? Ein Unfall?«
»Ich war zweieinhalb Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Hab irgendwann ’ne Hirnhautentzündung bekommen. Die Scheißkerle hatten mich schon auf ’nen Haufen mit Leichen geschmissen. Hätte mich ein Gefreiter von gerade mal achtzehn nicht gerettet, dann …« Brettschneider verstummte von einem Moment zum nächsten. Sein Gesicht verzog sich angewidert.
Was Wegner keineswegs wunderte. Selbst Anfang der Achtziger liefen noch genug Männer herum, die den Zweiten Weltkrieg und dessen unbeschreibliches Grauen am eigenen Leibe erlebt und bis heute nicht vergessen hatten. Doch das aufstrebende Deutschland interessierte sich nicht für diese, vom Schicksal gezeichneten Männer. Wollte sie am liebsten vergessen und sich vorzugsweise einem Wirtschaftswunder und friedlichen Zeiten widmen.
»Du sagst, Kalle wurde angeschossen?«, fuhr Brettschneider fort. »Hast du auch ’ne Ahnung, wer’s war?«
Wegner hatte sich einen Stuhl unter dem Küchentisch herausgezogen und unaufgefordert Platz genommen. In der Küche roch es nach gebackenem Hähnchen. Er schaute sich um und fand eine Tüte, in der wohl die Reste davon steckten. Zumindest ein Teil davon, denn zwei größere Knochen lagen der neben der Tüte. Ein Zeichen dafür, dass sein unfreiwilliger Gastgeber auch mit Brille kaum etwas sehen konnte.
»Jetzt red schon!«, fluchte der Mann nach einem weiteren Schluck aus seinem Glas, das schon beim ersten Hinsehen mindestens drei Macken aufwies. Für einen Cognac dieser Preisklasse musste anderenorts ein edler Schwenker herhalten. »Kalle hat’s erwischt … geht die Geschichte noch weiter?«
Wegner fischte Kallsens Zettel aus der vorderen Tasche seiner Jeans, wofür er halb aufstehen musste. Danach fiel er auf den Stuhl zurück und hielt seinem unfreiwilligen Gastgeber den Zettel entgegen. Im nächsten Moment fiel ihm ein, dass er es lieber mit einer Erklärung probieren sollte. »Kalle hat mir Ihre Adresse vor etwa zwei Wochen gegeben. Meinte, wenn ihm was zustößt, soll ich als Erstes zu Ihnen fahren.«
»Hat er dir auch erzählt, warum?«
Wegner grunzte, ein mehr oder weniger deutliches Nein.
Das sorgte bei seinem Gegenüber für offenes Erstaunen. »Er hat dir überhaupt nichts erzählt? Heißt das: Du weißt nicht mal, wer ich bin?«
Wegner hatte von diesem Versteckspiel langsam die Nase voll. Entsprechend genervt klang seine Stimme. »Nein! Ich weiß nicht, wer Sie sind! Und seien Sie mir bitte nicht böse: Ich hab langsam das Gefühl, als würde ich mit Ihnen nur meine Zeit vergeuden. Kann das sein?«
Diese rüde Feststellung sorgte in Brettschneiders Gesicht für einen Anflug von Heiterkeit. Er zog sich die Brille von der Nase, die offensichtlich ohnehin nicht half und kündigte seine nächsten Worte schmunzelnd an: »Dann spitz mal schön die Ohren, Jungchen.«
3
Nach dem Telefonat mit seinem Auftraggeber hatte sich Theo eilig eine Jacke übergezogen, die Tür zum Hinterzimmer von außen doppelt verriegelt und stand kurz darauf vorne im Schankraum hinterm Tresen. Die Registrierkasse, für Außenstehende ein Sinnbild der Rechtschaffenheit, stand einen Spalt offen. Wie immer! Vom größten Teil der Umsätze an diesem Abend würde das Finanzamt niemals erfahren.
Bis auf ein paar einzelne Erinnerungsstücke leerte Theo die Scheinfächer komplett und stopfte deren Inhalt nacheinander in die Taschen seiner Jeans. Sein Pseudo-Geschäftsführer – ein spindeldürrer Ex-Knacki mit klebrigen Fingern und einem Durst, der es mit jedem Ackergaul hätte aufnehmen können – schaute ihn mit riesigen Augen an. »Was passiert denn jetzt? Hast du was Größeres vor?«
Theos Lachen übertönte nicht nur die Musik, sondern auch das allgemeine Gegröle. »Falls du dir wieder selbst die Taschen vollstopfen willst, musst du noch’n bisschen was für dein Geld tun.«
Eine Antwort auf diese offene Provokation blieb aus, denn vor der Musikbox gab es neuen Streit. Zwei Männer, beide sichtlich betrunken, hatten es auf einen dritten abgesehen. Der taumelte nach einem kräftigen Schubser zurück, stieß am Ende seiner Rückwärtsbewegung gegen die Musikbox und sorgte dafür, dass der Refrain von Peter Kents ›It’s a real good feeling‹ hüpfte und wieder von vorne anfing.
Ein paar Frauen, die ein Stück entfernt tanzten, beschwerten sich lautstark und fluchten um die Wette.
Zwei andere Männer fühlten sich offensichtlich berufen, der holden Weiblichkeit zu Hilfe zu eilen. Aber nicht etwa zum Schlichten, denn die Bierflasche des einen flog quer durch die Kneipe und landete scheppernd in der bunten Glasfront der Musikbox. Peter Kent verstummte augenblicklich – mit dem guten Feeling hatte es sich wohl erst mal erledigt. Ein paar Sekunden später sorgte das auslaufende Bier für einen Kurzschluss ... im Schankraum nebenbei für völlige Dunkelheit. Sogar das Gekreische der Frauen verstummte plötzlich.
Für Theo der perfekte Moment, um Abschied zu nehmen. Seine Kneipe – die schon länger ohnehin nur noch als Deckmantel für seine sonstigen Kiez-Geschäfte fungierte – würde er nie wieder von innen sehen, so viel stand fest.
***
»Kalle und ich sind Brüder – Halbbrüder, um genau zu sein.« Für diese Erklärung hatte Horst Brettschneider sich vorgetastet und ebenfalls am Küchentisch Platz genommen. Er kippte den Rest aus seinem Glas herunter, danach klang seine Stimme wie ein Reibeisen. »Wir haben denselben Vater, aber nicht dieselbe Mutter. Kapiert?«
Wegner war nicht mal erstaunt. Kallsen war schon als Chef schwer durchschaubar, als Privatmann kannte er ihn so gut wie gar nicht. Was vielleicht auch daran lag, dass die wenigsten Polizisten überhaupt ein Privatleben ihr Eigen nennen konnten.
Brettschneider fuhr einfach fort: »Und Kalle hat dir wirklich gar nichts erzählt?«
»Was hätte er mir denn erzählen sollen?«, erkundigte sich Wegner unwirsch. Zum ersten Mal versuchte er es mit einer Gegenfrage: »Waren Sie auch in unserem Verein?«
»Du meinst, ob ich’n Bulle war?«
Wegner beschränkte sich auf ein Nicken. Dann fiel ihm auf, dass das nicht reichte und er schob eilig ein »Ja« hinterher.
»Gott bewahre! Als wenn in unserer Familie ein schwarzes Schaf nicht schon genug wäre.«
Wegner wartete noch einen Moment ab, aber es ging nicht weiter. In seinen Gedanken war er bei Kallsen, dessen Schäferhund Rex und Gisela, denn er hatte seiner Verlobten im Zuge eines übereilten Aufbruchs versprechen müssen, sich alsbald zu melden. Dafür wurde es höchste Zeit.
Und als könne er Gedanken lesen, kam ihm Horst Brettschneider mit Worten auf halbem Weg entgegen: »Ich geb dir am besten Kalles Krempel und danach machst du dich vom Acker.«
»Welchen Krempel?«
Wegner bekam keine Antwort. Sein Gastgeber erhob sich schwerfällig, schlurfte zielsicher und ohne Orientierungshilfe durch seine Küche, bis er vor dem Herd stand. Dort bückte er sich so tief, als wolle er seinen Kopf in den Backofen stecken. Tatsächlich aber ging es um ein Schubfach unter dem Ofen, das er herauszog. Unter zwei scheinbar fabrikneuen Backblechen und einer ebenfalls unbenutzten Kuchenform lag ein Umschlag. Ganz dünn, auf den ersten Blick leer.
Nachdem sich Brettschneider wieder aufgerichtet hatte – dem Anschein nach ein akrobatischer Akt, der ihm die letzte Kraft abforderte – steckte der Umschlag kurz darauf zwischen Wegners Fingern.
Der tastete zunächst und fühlte lediglich einen winzigen Schlüssel darin. »Was ist das?«
Sein Gastgeber stöhnte genervt. »Ich glaube, Kalle hat auch einen Zettel für dich reingesteckt. Es geht um ein Schließfach, in dem du angeblich findest, was du brauchst.«
»Was brauche ich denn?«, wollte Wegner wissen. Diese Frage bereute er im nächsten Moment, denn Brettschneiders Gesicht lieferte schon die halbe Antwort.
Die zweite Hälfte folgte umgehend: »Ich glaub, du brauchst ’nen Arschtritt, damit du endlich verschwindest.«
Von diesem Moment an war sich Wegner hundertprozentig sicher, dass er es wirklich mit Kallsens Halbbruder zu tun hatte. Derartige Freundlichkeiten lagen wohl in der Familie. Als er wenig später auf seinen Füßen stand, hielt er Horst Brettschneider seine Rechte entgegen. Doch der konnte dieses Angebot entweder nicht sehen oder legte keinen Wert auf Höflichkeiten zum Abschied.
Wegner hatte sich mit dem Rausschmiss abgefunden, ließ sich eine letzte Frage allerdings nicht nehmen. »Soll ich Sie auf dem Laufenden halten, was aus Kallsen wird?«
»Verzichte!«
»Also, wenn ich ’nen Halbbruder hätte, dann …«
»… such dir doch einen, um den dich kümmern kannst. Und jetzt raus!«
Zurück auf der Straße blieb Wegner neben seinem Dienst-Audi stehen und holte ein paar Mal tief Luft. Der April zeigte Hamburgs Einwohnern zumindest nachts gerne noch die kalte Schulter. Tagsüber lag Frühling in der Luft, aber spätestens gegen Mitternacht fielen die Temperaturen noch regelmäßig unter den Gefrierpunkt. Doch nicht mal das störte Wegner. Er wollte einen klaren Kopf bekommen. Seine nächsten Schritte sollten möglichst von Logik und am wenigsten von Emotionen bestimmt sein. Anders als sonst – schließlich fehlte ihm dieses Mal der Gegenpol: Gerd Kallsen.
Was dessen Halbbruder und sein rüdes Verhalten betraf, hatte Wegner sogar ein bisschen Verständnis. Viele Männer, die für Deutschland in den Krieg gezogen waren, fühlten sich heute vergessen und von ihrer Regierung vernachlässigt. Die meisten lebten von Sozialhilfe: Zu wenig, zum Leben und zu viel, zum Sterben, sagten kritische Stimmen.
Als Wegner auf dem Fahrersitz saß, ließ er sich über die Zentrale mit Giselas Festnetznummer verbinden. Nach endlosem Tuten krächzte ihre verschlafene Stimme aus dem Lautsprecher. »Geht’s dir gut, Manfred?«
»Es ging mir schon besser«, antwortete er wahrheitsgemäß.
»Was ist mit deinem Chef?«
Wegner hatte diese Frage natürlich vorhergesehen, deshalb platzte die Antwort aus ihm hervor: »Ich will so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Aber vorher muss ich Rex aus seiner Wohnung holen, bevor er noch ins Tierheim kommt.«
»Brauchst du Hilfe?«
Wegner wollte schon ablehnen, besann sich dann aber eines Besseren. »Kann ich ihn bei dir vorbeibringen? Wenn ich ihn vor dem Krankenhaus im Auto lasse, ist hinterher wahrscheinlich nicht mehr viel davon übrig.«
»Und du? Kommst du klar?«
Wegner langte zum Zündschlüssel. Als der Motor lief, wurde seine Stimme lauter. »Ich fahr jetzt los! Auf dem Weg nach Altona bring ich dir Rex vorbei. Ist das okay für dich?«
»Und wann geht’s denn für dich ins Bett?«
Wegner spürte Wut in sich aufsteigen, aber deren Auswirkungen hatte Gisela wohl am wenigsten verdient. »Lass gut sein! Gib mir ’ne Stunde, dann steh ich vor deiner Haustür.«
»Vergiss nicht, Futter für Rex mitzubringen. Sonst frisst er wieder meinen ganzen Kühlschrank leer und ist hinterher trotzdem nicht satt.«
4
»Ich brauch ein Auto«, sagte Theo gleich zur Begrüßung, als er in einem winzigen Büro im zweiten Stock eines Stundenhotels am Hans-Albers-Platz ankam. Vor ein paar der anderen Türen auf dieser Etage standen grell geschminkte Frauen, die wohl noch auf ein schnelles Geschäft vor Feierabend hofften. Doch dieses Kunststück wurde immer schwieriger. Schließlich hatte sich auf der Reeperbahn längst rumgesprochen, dass es hier für fünfzig Mark nicht etwa die große Liebe, sondern im besten Fall einen schnellen Job mit der Hand gab. Und von solchen Verlockungen nahmen mittlerweile selbst grölende Kerle im Vollrausch immer häufiger Abstand.
Theos Gesprächspartner, ein Albaner, an dessen Namen er sich nicht mal erinnern konnte, nickte bereitwillig. Kein Wunder: Dessen Chef – ein gewisser Redzep, dessen Männer schon seit längerem Angst und Schrecken auf dem Kiez verbreiteten – kassierte jeden Monat mindestens fünf Riesen, um für Theos Sicherheit zu garantieren. Diese vermeintliche Heldentat bestand aus gelegentlichen Drohgebärden und ansonsten aus der puren Existenz der Albaner, mit denen sich niemand anlegen wollte. Schwarzmaler prophezeiten dieser Tage, dass sich der komplette Kiez schon sehr bald in albanischer Hand befinden würde.
»Ein Auto brauchst du also«, wiederholte der Muskelprotz, der den Schreibtisch, hinter dem er saß, wie eine Miniaturausgabe wirken ließ. »Was für’n Auto?«
Theo stöhnte genervt. »Eines, in dem die Bullen mich nicht gleich anhalten, weil die Karre gezockt ist. Ich muss raus aus der Stadt. Und zwar sofort!«
»Was hast du denn plötzlich gegen Hamburg?«, erkundigte sich eine tiefe Männerstimme. Die gehörte zu Redzep, dem Chef der Albaner, der sich unbemerkt von hinten angeschlichen hatte. Eine von dessen riesigen Pranken lag auf Theos Schulter. »Hast du schon wieder ’ner Nutte den Hals umgedreht oder was ist los?«
Theo erinnerte sich an sein Missgeschick, bei dem eine seiner Huren ihr trotziges Verhalten mit dem Leben bezahlen musste. Das hatte die ganzen Probleme mit diesem Bullen namens Kallsen überhaupt erst ins Rollen gebracht.
Seinerzeit hatte er Redzep alles regeln lassen. Für fünf Riesen im Monat konnte der auch ruhig mal ein bisschen mehr tun, als nur mit breitem Kreuz herumzulaufen und Leute zu erschrecken.
»Ich will nicht viel erklären«, erwiderte Theo und befreite sich aus der Umklammerung einer Pranke. Danach zog er die Scheine aus seinen Hosentaschen und warf sie mit verächtlicher Geste auf den Schreibtisch. Auf den ersten Blick handelte es sich um zwei- bis dreitausend Mark. »Ist mir auch egal, wie alt die Karre ist. Hauptsache, sie ist sauber und läuft.«
»Wer hat dir denn die Nacht versaut?«, fragte Redzep lachend. »Du kommst hier erst raus und kriegst dein Auto, wenn ich weiß, was los ist. Also red schon!«
»Ich hab Ärger«, gab Theo widerwillig zu.
»Ärger mit wem?«
»Spielt das ’ne Rolle?«
Redzep sah zwar nicht zufrieden aus, trotzdem wandte er sich an seinen Handlanger. »Haben wir denn ein Auto für unseren lieben Theo?«
Der Muskelprotz nickte grinsend.
Irgendwas an diesem Gehabe kam Theo seltsam vor. Aber er hätte nicht sagen können, was.
»Drüben in der Talstraße steht unser alter Caddy.« Fleischige Finger fanden die Scheine auf dem Schreibtisch, kurz darauf steckten die in einer Hemdtasche. »Die Kohle reicht dicke für die alte Karre, Boss.«
Redzep packte Theo an beiden Schultern gleichzeitig. Noch wirkte diese Geste unter Männern wie eine freundschaftliche Aufmunterung. »Und du willst mir wirklich nicht sagen, was dein Problem ist?«
»Kannst du dir das nicht denken? Ich hab ein Problem … mit ihm.«
»Wieso? Hat er letzten Monat keine Kohle von dir bekommen?«
»Um Kohle geht’s dieses Mal nicht«, gab Theo widerwillig zu. »Ich sollte unbedingt was für ihn erledigen und das hat … nicht ganz geklappt.«
Redzep ließ Theos Schultern los, aber nur, um ihn danach in Richtung Schreibtisch zu stoßen. Mit dem Fuß schob der Albaner die Tür hinter sich zu, um die Blicke neugieriger Frauen auszusperren.
»Was soll der Scheiß?«, beschwerte sich Theo wütend. Er hatte sich an der Schreibtischplatte festhalten und wieder in einigermaßen aufrechte Position bringen können. »Du hast wohl vergessen, wer dir jeden Monat …« Die letzten Worte blieben ihm im Halse stecken.
Oder sie verabschiedeten sich, zusammen mit einem Schwall hellroten Blutes, weiter unten durch seine Kehle. Denn hinter Theo war der zweite Albaner kurz zuvor aufgesprungen und hatte ihm den Hals mit einem langen Messer von einem Ohr zum anderen aufgeschlitzt.
Redzep machte einen beherzten Schritt nach vorne und packte Theos jetzt schon beinahe leblosen Körper mit beiden Händen, bevor der zu Boden fallen konnte. Er fluchte in Richtung seines Handlangers: »Sieh zu, dass du ’ne Plane auftreibst. Der Idiot blutet uns hier sonst den ganzen Teppich voll.«
In den kraftvollen Pranken eines anderen hängend, röchelte Theo ein letztes Mal. Der Kommentar in Sachen ›Teppich‹ war nicht mal mehr zur Hälfte in seinem Verstand angekommen.
5
Als Wegner in Kallsens Wohnung ankam, erklärte ihm ein Kollege in Uniform gleich das erste Chaos: »Der Hund wollte den Notarzt beißen.« Es folgte ein Fingerzeig in Richtung Küchentür, hinter der schreckliches Gejaule zu hören war. »Freddy hat selbst ’nen Schäferhund und hat ihn irgendwann in die Küche locken können. Seitdem traut sich keiner mehr da rein.«
Wegner deutete ins Wohnzimmer. Dort lagen auf dem Teppichboden verstreut medizinische Notfallutensilien. Die Kollegen der Spurensicherung waren eingetroffen und wollten offensichtlich zunächst am Gesamtbild nichts verändern. »Was wisst ihr bis jetzt?«
Der Uniformierte zeigte durch die offene Tür ins Wohnzimmer. Unter dem Tisch, auf dem nur ein paar leere Bierflaschen standen, lag ein bulliger Körper, die Gliedmaßen seltsam verdreht. Ein sicheres Anzeichen für spontanes Ableben. »Einer von den Streifenkollegen, die zuerst hier waren, ist sich sicher, dass der Typ vom Kiez kommt. Nen Ausweis hat er allerdings nicht dabei.«
»Wäre ja auch zu schön«, stöhnte Wegner. »Sonst noch was?«
»Nach den Schüssen haben die Nachbarn aus dem Fenster geguckt und einen Kerl weglaufen sehen ... angeblich groß und mit Bart. Zwei andere Nachbarn von ganz oben meinten, der Typ hätte keinen Bart gehabt und wäre nicht besonders groß gewesen.«
Wegner fasste das Ergebnis mit nüchterner Stimme in Worte: »Aber alle waren sich einig, dass da nach den Schüssen einer weggelaufen ist. Dann waren es auf jeden Fall zwei, richtig?«
»Mindestens, ja.«
Nach dieser ersten vermeintlichen Bankrotterklärung wollte Wegner schon das Wohnzimmer betreten, doch das Jaulen von Rex hielt ihn zunächst davon ab.
»Ich weiß gar nicht, was wir mit ihm anstellen sollen«, jammerte der Kollege in Uniform. »Mich bekommen keine zehn Pferde mehr in die Küche.«
»Ist schon gut!« Wegner schaute nach links und dann wieder nach rechts. Rex heulte noch lauter. Vermutlich hatte er eine vertraute Stimme gehört und wollte deshalb dringender als je zuvor aus seinem Gefängnis befreit werden.
Ein Kollege der Spurensicherung lehnte sich aus dem Wohnzimmer in den Flur und nahm Wegner die Entscheidung ab. »Wir haben hier drinnen bis jetzt nichts Besonderes gefunden. Nur ’ne blutige Fußspur auf dem Teppich und haufenweise Patronenhülsen – das war mal ’ne anständige Schießerei, würd ich sagen.«
Wegner schaute seinen Kollegen entgeistert an. »Soll ich etwa darüber lachen?« Er wartete keine Antwort ab, sondern drehte sich wieder in Richtung Küchentür. Mit dem Prozedere an Tatorten kannte er sich bestens aus. Hier würde er nur im Weg herumstehen und zumindest vorerst nichts ausrichten können. Also stand er im nächsten Moment schon vor der Küchentür. Dahinter fand er Rex, den jemand mit seiner Leine ganz kurz am Heizungsrohr neben dem Küchentisch festgebunden hatte.
Der Schäferhund jaulte herzzerreißend und begann jetzt auch noch zu bellen. Wegner ging vor ihm in die Knie und ließ sich bereitwillig das komplette Gesicht abschlabbern. Er konnte kaum etwas sehen, aber seine Finger fanden wenigstens den Knoten in der Leine und lösten ihn.
Rex sprang auf seine Schultern, hatte wohl vor, einen ohnehin lichten Haarschopf aufzufressen. Irgendwann schaffte Wegner es, den Schäferhund zu bändigen. »Willst du mit zu Gisela?«, fragte er und stellte zufrieden fest, dass allein dieser Name für ein wenig Beruhigung in der einfach gestrickten Welt eines Schäferhundes sorgte. Vermutlich erinnerte sich Rex’ Magen an den Inhalt einer Aufschnittdose oder ein halbes Dutzend Kotelettknochen, deren Reste sich auch heute noch regelmäßig im Büro der Mordkommission anfanden.
Ein weiterer Kollege der Spurensicherung steckte den Kopf in die Küche. »He, Manni … wir können im Wohnzimmer vor lauter Zeitungen kaum treten? Schätze, da liegen über tausend Stück rum. Ich hab gerade eben ein Abendblatt aus den frühen Fünfzigern gefunden.«
»Rührt die Dinger bloß nicht an!«, mahnte Wegner. »Wenn er aus dem Krankenhaus kommt und eine fehlt, dann reißt er nicht euch, sondern mir den Kopf ab.«
»Da sind ein paar blutverschmierte dabei«, ging es unbeirrt weiter. »Die müssen wir aber zur Spurensicherung mitnehmen.«
»Aber die anderen lasst ihr schön liegen!«
»Und was ist, falls Kallsen nicht …?«
Wegner fuhr wütend dazwischen: »Dann sind die Zeitungen meine kleinste Sorge!« In seinem Magen machte sich ein mulmiges Gefühl breit. Bisher hatte er sich geweigert, an diese letzte Konsequenz überhaupt zu denken. Er hatte seinen Verstand mit anderen Dingen beschäftigt und sich vorgegaukelt, alles wäre noch einigermaßen glimpflich abgelaufen.
Der nächste Kommentar des Kollegen sollte wohl für Klarheit sorgen, aber machte alles nur noch schlimmer: »Thomas vom Einunddreißigsten meint, das wird nichts mehr mit Kallsen. Er hat gesehen, wie sie ihn weggefahren haben. War wohl nicht mehr viel von ihm übrig.«
Wegner, dessen Finger Rex’ Fell mechanisch kraulten, hob den Kopf. All seine aufgestaute Wut entlud sich in einer einzigen Frage: »Ist dieser sagenhafte Thomas etwa Arzt?«
»Glaub nicht«, kam es unbeeindruckt zurück. »Dann würd er wohl nicht Streife fahren, oder?«