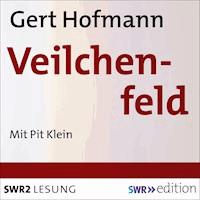Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Enkel Gert Hofmann geht als Kind jeden Tag mit dem Großvater ins Kino (23 Sitzplätze, viele Stehplätze), wenn der zum Stummfilm erzählt und Klavier spielt. »Aufpassen und nicht schlafen jetzt, wir kommen an eine sehr schöne Stelle!« ruft er in den unruhigen Zuschauerraum und bringt, sein Bambusstöckchen in der Hand, den Leuten die Romanze auf der »Hintertreppe« zwischen Fritz Kortner und Henny Porten nahe. Dabei fühlt er sich als Künstler und zu Höherem berufen. Dann kommt der erste Tonfilm nach Limbach. Der Kinobesitzer hofft, mit den sprechenden Bildern mehr Zuschauer ins Kino zu locken. Der Film und der Kinoerzähler sind von da an Feinde: je lauter der eine tönt, desto weniger darf der andere sagen. Bis sich die Nazis in Limbach breitmachen: da hofft der Großvater, daß »die Bewegung« den deutschen Stummfilm zu ihrer Sache macht... Der Roman wurde von Bernhard Sinkel mit Armin Mueller-Stahl in der Rolle des Großvaters verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der Enkel Gert Hofmann geht als Kind jeden Tag mit dem Großvater ins Kino (23 Sitzplätze, viele Stehplätze), wenn der zum Stummfilm erzählt und Klavier spielt. »Aufpassen und nicht schlafen jetzt, wir kommen an eine sehr schöne Stelle!« ruft er in den unruhigen Zuschauerraum und bringt, sein Bambusstöckchen in der Hand, den Leuten die Romanze auf der »Hintertreppe« zwischen Fritz Kortner und Henny Porten nahe. Dabei fühlt er sich als Künstler und zu Höherem berufen. Dann kommt der erste Tonfilm nach Limbach. Der Kinobesitzer hofft, mit den sprechenden Bildern mehr Zuschauer ins Kino zu locken. Der Film und der Kinoerzähler sind von da an Feinde: je lauter der eine tönt, desto weniger darf der andere sagen. Bis sich die Nazis in Limbach breitmachen: da hofft der Großvater, daß »die Bewegung« den deutschen Stummfilm zu ihrer Sache macht … Der Roman wurde von Bernhard Sinkel mit Armin Mueller-Stahl in der Rolle des Großvaters verfilmt.
Gert Hofmann
Der Kinoerzähler
Roman
Carl Hanser Verlag
In memoriam Karl Hofmann, 1873—1944, Kinoerzähler
1
Mein Großvater Karl Hofmann (1873—1944) arbeitete lange im Apollo-Kino in der Helenenstraße in Limbach/Sachsen. Ich kannte ihn gegen sein Lebensende, mit seinem Künstlerhut, dem Spazierstock, dem breiten Ehering aus Gold, der dann und wann nach Chemnitz ins Pfandhaus ging, doch immer wiederkam. Auf die Idee, mit einem Stock zu laufen, hat er mich gebracht, lange nach seinem Tode. Er hatte Probleme mit den Zähnen und sagte: Wenn überhaupt, werde ich mal vom Gebiß aus sterben. Schließlich brachte ihn etwas ganz anderes um.
Mein Großvater war der Kinoerzähler und -klavierspieler von Limbach. Die gab es damals noch. Viele kamen von den Rummelplätzen, »aus den äffischen Urgründen der Kunst« (der Großvater). Das sah man ihrer Kleidung an. Im Kinosaal trugen sie einen blauen oder roten Frack mit goldenen oder silbernen Knöpfen, eine weiße Fliege, weiße Beinkleider, manchmal Stulpenstiefel. Andere traten im Smoking auf.
Aufpassen und nicht träumen, jetzt kommt eine großartige Stelle, vielleicht die großartigste, rief der Großvater und griff nach seinem Zeigestock. Mit dem fuchtelte er viel herum. Die paar, die gekommen waren, waren sofort still. Man hätte, sagte der Großvater, ein Mäuschen … Nun, was eine Maus eben so macht. Kaum daß man einen seufzen oder schnarchen hörte. Ich war winzig. Ich lehnte im Kinostuhl. Ich nahm alles auf.
Jawohl, ein Dompteur war ich, sagte der Großvater, wenn er mir dann und wann »sein früheres Selbst erklärte«. Nur hatte er ein Bambusstöckchen statt der Hetzpeitsche in der Hand. Das gehörte zu der Erzählmontur, die er hatte wie der Infanterist seine Infanteriemontur und der Kavallerist seine Kavalleriemontur.
Und du hattest …
Meine Erzählmontur, sagte der Großvater.
Möglich — was ist nicht alles möglich in der Erinnerung! —, daß der Großvater in dieser Montur tatsächlich besser erzählte als in Rock und Hose. Das behauptete er jedenfalls. Kaum hatte er sein Fräckchen an, kamen die Sätze schon. Er traute sich dann auch mehr zu: stärkere Ausdrücke, mehr Nebensätze, ungewöhnliche Vergleiche, überraschendere Wendungen, Bilder. Auch machte er »in Uniform« seine Sätze länger. Was für eine Zeit! In der ich gelebt haben muß — und wie! —, doch ist nicht viel geblieben.
Und dort unten, mußt du dir vorstellen, sagte der Großvater und hatte seinen Stock in der Hand. Mit dem zeigte er auf die Welt. Vorher stampfte er auf den Boden, damit ich auch aufpaßte. Er zeigte in den leeren Saal und sagte: Dort in der Dunkelheit sitzt das Publikum, da gehört es hin. Aus dieser Dunkelheit heraus starrt es mich an. Und auf welchen Körperteil starrt es mir? Nun, sagte er, auf den Mund natürlich, auf meine Zähne. Das will ich aber nicht. Es soll auf meine Montur schauen. Wenn es meine Montur sieht, glaubt es mir nämlich mehr.
Da hatte der Großvater dann mehr Zeit, sich Sätze auszudenken. »Denn jeden muß ich mir ausdenken, keiner schwimmt in der Luft herum.« Die Reden der anderen Kinoerzähler, selbst in größeren Städten, waren geschwollen, ihre Aussprache verwaschen, die Zusammenhänge zwischen den Leinwandbildern — sie flackerten so — und den Worten für die Zuschauer oft unverständlich. Längere Wörter, sagte der Großvater, betonen sie auch falsch. Ihre Erklärungen kommen entweder zu früh — vor dem Bild — oder zu spät — danach —, so daß zwischen dem, was man sieht, und dem, was man hört … Man sieht den Zusammenhang nicht. Nach einer halben Stunde ist die Luft zum Ersticken. Tatsächlich, sagte der Großvater und schaute mich ernst an, ersticken oft welche.
Du meinst, sie sind tot?
Tot.
Und was machst du da?
Ich warte, bis keiner schaut, dann trage ich sie raus.
Sind sie denn nicht zu schwer?
Ich zieh sie an den Füßen, sagte der Großvater ungerührt.
Erzähl dem Jungen nicht solches Zeug, sagte die Großmutter. Er kann dann nicht schlafen.
Er erzieht den Jungen zur Grausamkeit, sagte die Mutter. Kein Wunder, daß er in Schweiß gebadet aufwacht.
Auch im Apollo wurde viel geschwitzt. Andere, besonders die älteren Leute, schliefen lieber. Bei den Verfolgungs- und Totschlagszenen wachten sie wieder auf. Dann schnieften sie gern. Dazu das »verbrecherische Gequalme, das streng bestraft gehörte« (die Mutter). Wenn das Qualmen dem Großvater zuviel wurde, hängte er sein Schild »Rauchen untersagt — Lebensgefahr!« auf. Dann rauchte er alleine. Wenn seine Kehle trocken war, griff er zu der Bierflasche mit dem Schnappverschluß. Sie stand neben seiner Kiste, auf die er beim Erzählen manchmal stieg. Da konnte man ihn besser sehen. Diese Luft! Und diese Hitze! Manchmal kamen Kollegen. Sie hatten steife Hüte auf und Ringe in den Ohren. Beim Kino blieben sie nicht lange. Als Hitler und der Tonfilm kamen, gingen sie ohne Geräusche zum Zirkus zurück. Der Großvater blieb hängen.
Sein »Steckbrief« zu dieser Zeit: Nach dem Mittagessen sein sattgegessener Anblick, im Sonntagsrock, mit Krawatte, Krawattennadel, Bürstenschnitt, so wie er durch Limbach zog. Jetzt mit dem überschäumenden Bierglas und, in derselben Hand — ein Kunststück! —, einer »Zigarre mit Bauchbinde«. Wenn der Fotograf Wilhelm fertig war, steckte der Großvater sie sich an und sagte: So, nun darf ich, oder? Dann nahm er einen Schluck. Hinter ihm an der Wand die Schauspielerfotografien seiner mittleren Jahre: Pola Negri als Carmen, Henny Porten als Luise Rohrbach, Asta Nielsen als Das Straßenmädchen Marie, Theda Bara gleichfalls als Carmen, aber ganz anders als die Negri. Zur Großmutter soll der Großvater einmal gesagt haben: Tatsächlich, ich kann die Welt ohne das Kino nicht mehr aushalten!
Das fürchte ich auch, hatte die Großmutter geantwortet.
Asta Nielsen schätzte er aus Gründen, über die er sich nicht auslassen wollte, am höchsten.
Diese Gründe, sagte die Großmutter, sind ihre kleinen, aber wohlgeformten Brüste.
Den zarten Hals sehr hochgereckt, »wie ein Schwan, bis zu den Sternen«, hing sie in der Mitte seiner Fotografien. Sie war also doppelt eingerahmt und hing »in der Höhe seines Männerherzens, da hat er sie hingehängt« (die Großmutter). Der Großvater, auf seiner Fotografie, gab den Blick auf Asta Nielsen frei. Man überschaute beide. Seine Kopfhaltung zeigte: Er wußte, sie hing hinter ihm.
Oft saß er auf seinem Raucherstuhl und faßte sein Leben zusammen. Ich saß auf der Hitsche vor ihm. Damit du später weißt, wer ich war, und es den Leuten sagen kannst und nichts verlorengeht, sagte er. 1910 war für ihn ein wichtiges Jahr, da kam der Kinematograph Apollo nach Limbach, mit seinen dreiundzwanzig Sitz- und Stehplätzen, »bis die Wände brachen«. Schlägermützen auf den Köpfen, die Hände im Hosensack, zogen die Limbacher neugierig vor die Kinematographentür und »wagten sich nicht rein«. Keiner war je in einem Kino gewesen. Sie verschnauften ein bißchen, ehe der Saal — die Lasterhöhle, sagte die Mutter — sie verschluckte. Später kamen sie wieder raus und zogen in den Krieg. Nach dem Krieg — der Großvater war halbtot wieder nach Hause geschickt worden, »er marschierte ihnen nicht schnell genug« (die Großmutter) — war er, weil sonst nichts in der Nähe war, »ins Apollo gerutscht«. (Er sagte nie, daß er da arbeitete, weil die Großmutter da lachte.) Erst hatte er nur ausgeholfen und »ein paar Pfennige, später Milliarden dazuverdient«. Den Rest hatten »seine Frauen« herbeizaubern müssen. Die Sitzkiste gab es schon.
In den Vorstellungen, sagte er, bin ich, mit dem Stock in der Hand, immer aufgesprungen. Wenn mich eine Stelle packte, bin ich auf meine Sitzkiste — eine alte Teekiste aus Ceylon — gestiegen und habe ins Publikum geschaut.
Wie denn?
Streng, sagte der Großvater. Er hatte, weil er so viel rauchte, braune Fingerkuppen und keine guten Augen. »Er sieht bloß, was er will« (die Großmutter). Lange war er zu eitel, um eine Brille aufzusetzen. Er hatte aber eine. Von den Zuschauern verlangte er mehr Ruhe. Ich, unvorstellbar klein — ist er nicht winzig, und wird er nicht immer winziger, rief der Großvater oft —, hockte auf den Fingerspitzen in der vordersten Sitzreihe, weil er mich da nicht aus den Augen verlor. Hier sah ich meinen ersten Film, Geheimnisse einer Seele (1926, mit Werner Krauss und Ruth Weyher). Der handelt von einem Mann, den die Idee verfolgt, er müßte seine Frau ermorden. Manchmal, wenn er morgens aufwacht, denkt er, er hat sie schon. Er täuscht sich aber immer wieder, er hatte es bloß geträumt. Er wird von einem guten Freund, der gleichzeitig ein berühmter Arzt ist, von seiner Idee geheilt. Er wird mit der Frau sogar noch glücklich, weil sie plötzlich ein Kind bekommt. Der Großvater, bei Geheimnisse einer Seele, trug seine Erzähleruniform. Die Bierflasche stand neben ihm. Er ließ kein Auge von der Leinwand, höchstens, um mal zu schauen, ob ich noch da war. Dann redete er weiter. Keiner hätte den Film verstanden ohne ihn. Neben ihm, falls ein Feuer ausbrach, stand ein voller Wassereimer. Manchmal, weil er beim Erzählen an so viel denken mußte, stieß er den Eimer um. Da stand alles unter Wasser. Er rief: Ach, du grüne Neune! und: Und nun etwas Musik! Vorher holte er schnell noch die Frau vom Haus nebenan. die immer aufwischte. Alle zogen die Beine hoch. Der Großvater spielte Cavalleria rusticana. Es wurde geraucht und geredet. Dann ging der Film weiter.
Der Schatten des Großvaters, wenn er den Kopf hob und in einen Filmhimmel sah! Die dickgequalmte Kinoluft! Das Rauschen des Regens hinter dem Wort Notausgang, draußen vor der Tür! Ich schlief dann oft ein. Andererseits die Betretenheit beim Betrachten des Kunstmenschen Golem, beim Lauschen auf sein Schicksal, wenn der Großvater es beschrieb. (Der Golem, 1914, mit Paul Wegener, Lyda Salmonova und Adolf Steinrück, sowie Der Golem, wie er in die Welt kam, 1920, mit denselben, dazu Otto Gebühr). Nach dem Film hielt er mich fest bei der Hand. Wir taumelten auf die Straße. Die Nacht war hereingebrochen. Wir fanden uns schwer zurecht. Der Großvater schüttelte den Kopf und sagte: Daß es so was gibt!
Ich fragte: Gibt es so was nicht?
Doch doch, sagte er, aber selten!
Wenn es nur voller gewesen wäre!
Für Herrn Theilhaber lohnt sich der Aufwand nicht mehr, es geht dem Ende zu, sagte die Mutter, als der Großvater wieder mal im Apollo erzählt hatte. Wir aßen schnell noch was. Die Frauen, der Gesundheit wegen, aßen eine Bemme mit weißem Käse, ich eine mit Leberwurst. Da mußte die Mutter plötzlich an die vielen Limbacher und Oberfrohnaer denken, die, statt ins Apollo zu gehen, immer zu Hause hockten. Und den Großvater wieder nicht gehört und gesehen hatten und sich damit etwas Unvergeßliches hatten entgehen lassen. Wer weiß, wie lang’s noch spielte! Auch Herr Theilhaber, der manchmal an der Kasse saß, konnte am Wegbleiben des großen Publikums keine Freude haben.
Die finanziellen Lasten, die ihm das aufbürdet, sind untragbar, sagte der Großvater zu seinen zwei Frauen. Wir nickten alle. Sogar auf eine Schließung des Apollo hatte Herr Theilhaber schon angespielt. Was dann?
Das beste in solchen Fällen ist, sagte der Großvater, man denkt nicht mehr dran!
Um sich für die Abendvorstellung zu sammeln, lief der Großvater am Nachmittag stundenlang ums Apollo. Da sah Herr Theilhaber gleich, daß er schon da war, falls der mal früher kam. Manchmal nahm mich der Großvater mit. Ich hatte kurze Strümpfe an, im Winter wollene lange. Der Großvater konnte Herrn Theilhaber dann auch schon am Nachmittag behilflich sein. Da konnte der mit eigenen Augen sehen, wie unentbehrlich der Großvater war. Wenn Herr Theilhaber ihm den Kinoschlüssel anvertraut hätte, hätten wir noch früher rein gekonnt »und das Kino nackicht gesehen«. (Bald würde Herr Theilhaber dem Großvater einen Schlüssel geben, das wußten wir damals bloß noch nicht.) Vorm Apollo war es aber auch schön, besonders das Lüftchen, falls eins wehte. Der Großvater nahm den Künstlerhut dann in die Hand, damit er ihm nicht wegflog. Da kamen die Haare, die er noch hatte, durcheinander. Dann sammelte der Großvater sich. Er sammelte sich am allerbesten, wenn man ihn viel grüßte. Wenn er mit mir durch Limbach lief, und es grüßte ihn keiner, fühlte er sich wie gestorben. Gern ließ er sich erst auf der einen Straßenseite, dann auf der anderen grüßen. Dabei rauchte er einen Stumpen, falls grad einer in seiner Tasche war. Den mußte er, ein bißchen von sich weg, in der Hand halten, wo ich nicht lief, »sonst bringt er mit seinem Rauch das arme Wurm noch um« (die Großmutter). Der Großvater redete wenig, weil er nun denken mußte. Er dachte an die Abendvorstellung und an den Auftritt, der auf ihn zukam, wöchentlich sechsmal. Das Programm wurde oft gewechselt, manchmal die Woche dreimal. Beim Laufen redete der Großvater mit sich selbst. Er sagte: Und nun der große Heinrich George! Wie führe ich den ein? Oder: Sag ich’s ihnen hier, daß sie ihn liebt, oder sag ich’s ihnen später? Manchmal fragte er sich ganz allgemein, wie man »das Material verteilt und die Kunst an den Mann bringt«.
Denn das ist kein Zuckerschlecken hier bei den Banausen, sagte er, aber ich schaff’s, ich schaff’s!
Den Film ließ sich der Großvater vom Vorführer Salzmann meistens schon vorher einmal zeigen, damit er wußte, »was auf ihn zukam«. Herr Salzmann war, wenn wir kamen, meist noch gar nicht da. »Wie dieser Mann sich Zeit läßt!« Wir liefen noch einmal ums Apollo. »Er kommt sicher bald!« Herr Salzmann kam aber erst, wenn er mußte. Wir gingen auf und ab. Ich mußte dann den Schnabel halten, weil der Großvater den Film, ehe er ihn anderen erzählte, erst sich selbst erzählen mußte. Einzelne Wörter, die er verwenden wollte, hatte er sich auf ein Stück Papier geschrieben. Das hob er gut auf, nur vergaß er oft, wo. Oder er mußte sich überlegen, in welchem Zusammenhang er die Wörter, die er aufgeschrieben hatte, bringen wollte, war es in dem Film mit Emil Jannings oder in dem mit Greta Garbo? Der Großvater hielt meine Hand. So ging der Nachmittag vorbei.
Da, rief der Großvater, siehst du ihn?
Wen?
Am Himmel! Jetzt ist er fast verschwunden!
Wer denn?
Der Nachmittag, sagte er. Zurück blieb die Silhouette des Großvaters in den Schaukästen, wenn er »die Plakate studierte, als wollte er sie auswendig lernen«. Sein italienisches Aussehen mit der untersetzten Gestalt, seine gekurvte, undeutsche Nase, der Schnurrbart, an dem er zwirbelte, als wollte er ihn »mit Fleiß verlängern«.
Will ich auch, sagte er.
Sein häufiger, mit einem Stoß seines Spazierstocks unterstrichener Ausruf: Warum können die Limbacher mich nicht verknusen? Was auf Gegenseitigkeit beruht! Wir gehören nicht hierher!
Ich auch nicht?
Du auch nicht.
Sondern? Wo gehören wir denn hin?
In eine andere Welt, die aber erst noch hergestellt werden muß, sagte der Großvater.
Und in welcher Himmelsrichtung liegt die, fragte sein Freund Cosimo.
Und der Großvater, zum weiten Horizont: Da, irgendwo da!
Nach der Sonnabendvorstellung, wenn er das Kinolicht ausgedreht hatte und nach seinem Schluck Bier vom »Rüdesheimer« allein nach Hause kam, war er »erledigt, Augen, Kopf, Füße, alles«. Selbst die Hände zitterten ihm. Da soll der Großvater, während wir schon schliefen, den angeschmorten Sonntagsbraten der Großmutter aus dem Ofenrohr gezogen und »vor lauter Gier mit einem Ränftchen verspult oder weggeputzt haben, der hemmungslose Mensch« (die Großmutter). Ihre Empörung im Morgenlicht, wenn sie an den Ofen ging und die »miesen Reste« erblickte! Sollte das ihr Sonntagsbraten sein? »Daß er sich nicht schämt!« Nun mußte die Großmutter hintenrum zum Fleischer Hilsebein — »zu Hilsersch« — und ihn bitten, ihr was zu verkaufen oder »vorzuschießen«, damit bei uns Sonntagmittag was auf den Tisch kommen konnte.
Nach dem Sonntagsessen — Krautwickel oder Kartoffelstückchen mit sauren Gurken — zog er die Jacke aus und legte sich ein Stündchen aufs Ohr. Auch die Schuhe zog er aus. Leider war das Sofa so kurz, daß selbst dieser eher kleine Mann — »klein, aber oho!« (die Großmutter) — beim Liegen die Beine anziehen mußte. »Natürlich mit den katastrophalsten Folgen für meine Blutzirkulation.« Oder er bekam »sein Wadenkrämpfchen«, auf das er dann immer schon wartete. Mühsam stand er wieder auf und hüpfte hin und her. Da mußte er achtgeben, daß er nicht stürzte und sich was brach. »Seine Knochen sind nämlich aus Glas« (die Großmutter).
Danach zog der Großvater, den seine Unruhe nicht auf dem Sofa duldete, mit Herrn Cosimo und mir in den Hohen Hain. Wir waren das Männertrio, sangen aber nicht. Das waren unsere Sonntagnachmittage, »wie Gott sie uns hinwarf«. Der Großvater redete viel. Manchmal nahm er dabei seinen Künstlerhut ab, manchmal schob er ihn bloß in den Nacken. Manchmal zog er sein Taschentuch hervor und rollte es straff zusammen. Er sagte zu mir: Eine Wurst! und wischte sich damit die Stirn. Dann schaute er sich das Tuch genau an, schüttelte den Kopf und sagte: Wie ich schwitze! Was das wohl bedeutet! Was Gutes sicher nicht! Dann redete er von seinen unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen, »damit du wenigstens mal davon gehört hast und zu gegebener Zeit an deine Kinder weitergeben kannst, was für ein Mensch ich war«. Nach Amerika auswandern, oh, nach Amerika auswandern oder noch weiter, und endlich alles hinter sich lassen! Es sammelt sich ja so viel an im Leben, was man hinter sich lassen möchte. Bei Ihnen nicht, Cosimo?
Doch, sagte Herr Cosimo, bei mir auch!
Leider hatte der Großvater den Moment verpaßt, wo er alles hätte abstoßen und auswandern können. Nun hatte er, »wo er auch hinfaßte, schon Moos und Kräuter angesetzt«. Dabei hätte er sich so gern noch mal verändert! Zum Beispiel wäre er gern noch ein Stück »in die Höhe gewachsen, und wenn’s fünf Zentimeter gewesen wär’n!« Er behauptete: Ich war mal größer! Nach meiner Geburt — 1931 — und dem Verschwinden meines natürlichen — der Großvater sagte: unnatürlichen — Vaters »zu den anderen Verbrechern nach Berlin« soll er vor Zorn, daß jemand seine Tochter »reingelegt und was von ihr gehabt hat, ohne dafür zu zahlen«, noch kleiner geworden sein. »So klein wie jetzt war ich noch nie!« Auch wünschte er sich bessere Backenzähne zum Speckkauen, mehr Haare zum Kämmen und ein zuverlässigeres Gerät zum Stoßen für die Großmutter und Fräulein Fritsche, die bei der Kläranlage wohnte.
Was denn für ein Gerät, fragte ich.
So wie manche Männer eins haben, sagte der Großvater. Wenn du immer schön brav bist, kriegst du auch mal eins.
In Limbach ging das Gerücht, daß der Großvater mit diesem fünfundzwanzig Jahre jüngeren Fräulein ein nun schon »eine Ewigkeit, nein, länger« sich hinziehendes »überplatonisches Verhältnis« hätte. Manchmal, wenn die Großmutter noch den Schlaf der Gerechten schlief, besuchte er sie kurz »in ihrem Häuschen und in ihrem Bettchen« (die Großmutter). Auch nachts, hieß es, trafen sie sich, beim Amselgrund im Hohen Hain.
Sogar im Winter seid ihr Hand in Hand gesehen worden, sagte die Großmutter, daß du dich nicht schämst!
Da schüttelte der Großvater den Kopf und sagte: Das, wie viele andere Dinge, bildest du dir ein.
Herr Cosimo lief, wenn wir spazierengingen, einen halben Schritt hinter dem Großvater, um zu zeigen, er war nicht so wichtig. Wenn beide etwas sagen wollten, sagte Herr Cosimo: Nach Ihnen, Hofmann! und ließ den Großvater zuerst. Dagegen ließ der Großvater Herrn Cosimo auf der baufälligen Holzbrücke den Vortritt, um zu sehen, ob sie noch hielt. Wenn sie noch hielt und Herr Cosimo war drüber, betrat er sie dann auch. Ganz zuletzt kam ich. Auf der anderen Seite lief Herr Cosimo langsamer und erklärte uns sein Leben. Zuerst, sagte er, möchte jeder natürlich wissen, wieso ich noch nicht verhungert bin. Ich lebe, sagte er, von der Wohlfahrt, unser Vater Staat hält mich aus. Das machte Herrn Cosimo aber nichts. Er wußte, daß das Fürsorgegeld in seinem Fall nutzbringend angelegt war. Eine Würde, die ich durch Staatsbetrug verlieren könnte, habe ich sowieso nicht, ich bin seit Jahrzehnten würdelos, sagte Herr Cosimo und zitierte: Wer Schweiß vergießt und sich nicht drückt, der ist verrückt!
Daß dieser Mensch sich nicht schämt, sagte die Mutter und stellte sich vor den Brotschrank, weil sie dort am besten ans Abendessen denken konnte. Sie wußte wieder nicht, was sie uns geben sollte. Daß der Großvater immer mit so einem spazierenging! Nun, sagte sie, mich wundert’s nicht!
Und was gibt’s zum Abendbrot, fragte ich.
Was Gott uns schenkt, sagte die Mutter.
Also Rattenschwanzsalat?
Mit frischen Mäusezähnen!
Herr Cosimo hatte keinen Künstlerhut. Er trug eine Schiebermütze. Er behauptete, er käme aus einer Abdeckerfamilie. Er sagte: Von langer Hand. Aber das ist, wie das meiste, was er uns erzählt, erfunden, sagte der Großvater. Jedenfalls glaube ich’s nicht. Sie seien auch als Scharfrichter aufgetreten. Da habe er gelernt, daß es immer die Falschen seien, die den Kopf hinhalten müßten.
Und dann, fragte ich.
Zu dritt, »wie die Drei Musketiere« — früher sagtest du »Muskeltiere«, sagte der Großvater —, zogen wir durch Wald und Flur. Das Wetter war immer schön. Manchmal trug ich Großvaters Künstlerhut, manchmal den Spazierstock. Da passierte es dann immer. Der Großvater wurde plötzlich unruhig. Er fing zu schnaufen an. Manchmal war was in seiner Kehle, oder er sagte, es sei. Da holte er tief Luft und drückte, es wollte was raus. Er lief langsamer, blieb stehen, zog seinen Notizblock aus der Rocktasche und schrieb etwas nieder.
So, sagte er, das wär’s!
Und jetzt, fragte ich.
Bin ich erleichtert.
Dann steckte er den Block wieder in seine Rocktasche. Herr Cosimo nickte und sagte: Ja, so muß es sein! Wieder was Neues, Hofmann, nicht? Na, hoffentlich lohnt sich’s! Ich drücke jedenfalls die Daumen! Mehr kann unsereins nicht tun. Ja, das Werk, das Werk! Keiner wußte, ob Herr Cosimo das wirklich meinte. Wenn sich der Großvater dann etwas beruhigt hatte und ich ihn fragte: Was hast du denn geschrieben?, sagte er: Sätze! oder: Wortsalat. Jetzt, sagte er, muß ich den Salat bloß noch salzen, pfeffern, ein bißchen Essig und Öl drübergießen und gut umrühren!
Und dann?
Dann kann Platz genommen und zugegriffen werden.
Und wenn ich fragte: Und was für Sätze essen wir heut?, sagte er: Die, die mir eben durch den Kopf gegangen sind. Vielleicht kann ich sie mal gebrauchen.
Wozu?
Für ein Gedicht.
Und das Gedicht? Wozu braucht man das?
Schluß jetzt, rief der Großvater, wenn du nicht weißt, wozu man ein Gedicht braucht, kann ich mit dir nicht reden. Er brauchte Gedichte eben. Herr Cosimo war kein Dichter. Das hätte mir noch gefehlt, rief er und schüttelte sich. Dafür hatte er einen Strick in der Jacke, mit dem mal einer gehenkt worden war. Jedenfalls zog Herr Cosimo manchmal einen heraus und sagte: Das ist der Strick, mit dem … Es ist schon etwas her. Auch wenn wir von was ganz anderem redeten, zog er plötzlich den Strick heraus und hielt ihn mir unter die Nase. Er sagte: Da, faß an!, und ich mußte den Strick anfassen. Danach mußte ich noch daran riechen, aber er roch bloß nach Strick. Wenn wir dann wieder zu Hause waren, winkte mich der Großvater zu sich. Und was, fragte er, machst du jetzt?
Jetzt wasche ich mir die Hände.
Warum?
Weil ich den Strick angefaßt habe.
Wasch sie also, sagte der Großvater, aber mit Seife!
Jedenfalls, sagte Herr Cosimo auf unserem Spaziergang, handelt es sich um den Strick von einem Gehenkten, den ich gekannt habe.
Sie haben den Mann gekannt, fragte ich.
Sehr gut!
Und an dem Strick hat er gehangen?
Bis zu seinem bitteren Ende.
Herr Cosimo kannte viele Leute. Viele wanderten nun aus. Morgens, wenn ich aus dem Bett stieg, war wieder ein Dutzend weg. Über wen, wenn das so weiterging, sollte der Großvater dann mit Herrn Cosimo reden?
Der Großvater, von unseren »Spaziergängen mit Gespräch«, kannte Herrn Cosimos Leben wie sein eigenes, so wie Herr Cosimo das Leben des Großvaters wie sein eigenes kannte, »mit und ohne Warzen«. Meist redeten sie von Filmen, die sie beide gesehen oder einer von ihnen verpaßt hatte. Von ihren zwei Frauen war noch eine übrig, die kannte nur der Großvater gut. Herr Cosimo war »nicht ihre Blutgruppe«, er ließ sie aber trotzdem immer grüßen. Der Großvater und Herr Cosimo, beim Debattieren, waren gut eingespielt. Wenn einem ein Wort nicht kam, half ihm der andere aus. Sie blieben dann stehen und suchten gemeinsam, wie das Wort wohl heißen könnte. Der eine suchte im Himmel oben, der andere weiter unten. Sie fanden auch immer was. Dann riefen sie: Ja, das ist es! und gratulierten einander. Falls einem einmal etwas zustoßen und er das Gedächtnis oder die Sprache verlieren sollte, würde der andere einspringen und ihm weiterhelfen. Und sagen, was in dem und dem Jahr in Limbach/Sachsen passiert oder geäußert worden war. Alle sagten, sie paßten gut zusammen und ergänzten sich.
Wenn er sich doch bloß mehr waschen würde, sagte die Großmutter.
Du meinst, er wäscht sich nicht, fragte der Großvater.
Allerdings!
Da könntest du recht haben, sagte er nachdenklich, oft wäscht er sich wohl nicht.
Im gleichen Schritt, Ellenbogen an Ellenbogen, die davon schon ganz abgewetzt waren, zogen wir durch den Hohen Hain. Überall sangen Vögel. Nach einer guten halben Stunde kamen wir auf der anderen Seite wieder raus.
Und jetzt, fragte der Großvater und blieb stehen.
Jetzt, sagte Herr Cosimo, bleibt uns nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Falls wir nicht überhaupt und für alle Zeiten weiter geradeausgehen und der Welt nach und nach abhanden kommen wollen.
Nein, rief ich, ich will wieder heim!
Auf dem Rückweg Gespräche, Gespräche! Zuerst über unaufgeklärte Verbrechen, rätselhafte Naturerscheinungen, die Möglichkeit, die Welt zu verändern, die Arbeitslosigkeit. Allein in Limbach gab es nun zweitausend, Herr Cosimo hatte sie gezählt. Danach über Herrn Cosimos Herz, mit dem sich schon längst kein Staat mehr machen ließ. Dann über die Herzen des Großvaters und der Großmutter, wie lange die noch halten würden. Das des Großvaters hielt ewig, das der Großmutter wahrscheinlich nicht ganz so lange, sie mußte sich so viel ärgern. Schließlich mein eigenes kleines Herz, das sicher auch ewig hielt. Zu dem Abdecker war seine Freundschaft — »ich setze dieses Wort auch beim Reden in Gänsefüßchen, weil es so was nicht gibt!« — so eng, weil der Großvater als junger Mensch einmal beim Zirkus gearbeitet und dort viele wie ihn gekannt hatte. Der Zirkus hatte »Orfeo« geheißen. In diesem Zirkus war der Großvater in einer Livree aufgetreten, zuerst als Nummernankündiger. Später hatte er die Artisten an der Hand in die Arena geführt und sie dem Publikum vorgestellt. Er war auch Stallbursche, Hilfsarbeiter, Billeteur und Nachtwächter gewesen. Beim Nummernankündigen stand er zwischen dem Direktor und dem Clown, der ganze Zirkus lag vor ihnen. Das machte dem Großvater eine solche Freude, daß er, statt bei der Sache zu bleiben, manchmal versucht hat, kleine Geschichten »und sonstige Zutaten« dazuzudichten. »Die Phantasie ging durch mit ihm« (die Großmutter). Damit zog er das Programm unnötig in die Länge und mußte ausgewechselt werden.
Es ist im Zirkus wie im Leben, sagte der Großvater zu Herrn Cosimo, früher oder später scheitert alles, und du wirst ausgewechselt.
Was scheitert denn, fragte ich.
Was Sie sagen, sagte Herr Cosimo zum Großvater, da hat der Krümel recht, ist dunkel. Ich werde es mir aber trotzdem durch den Kopf gehen lassen.
Der Zirkus lag nun hinter ihm. Mit ihm hatte der Großvater die Nachbarländer bereist, ausgenommen die Schweiz, die hatte ihn nicht reingelassen und …
Schluß mit dem Firlefanz, sagte Herr Cosimo, und wir zogen weiter. Die Sonne ging unter. Ein Wind kam auf. Es ging wieder nach Hause.
Und nun stellen Sie sich einen Menschen wie mich vor, sagte der Großvater und lief wieder an der Spitze. Was kann so ein Mensch noch tun, um das Leben auszuhalten, wenn er alles schon getan hat, und nichts hat geholfen?
Eine ausgezeichnete, fast schon philosophische Frage, sagte Herr Cosimo, aber ich weiß es auch nicht! Vielleicht noch mehr spazierengehen?
Nein!
Vielleicht mit den Füßen durchs Wasser? Dann und wann an Blumen riechen?
Woran riechen, rief der Großvater ungläubig.
An Blumen!
Überhaupt zog es Herrn Cosimo, der als Sohn und Enkel von Abdeckern aus einer naturverbundenen Familie kam, zurück in die Natur, wo er sich in die Käfer und die Vögel hineinversetzen konnte. Dem Großvater war das nicht möglich. Er hatte mit der Natur nichts im Sinn. Wenn Herr Cosimo fragte: Warum nicht?, sagte er: Sie ist mir nicht künstlich genug!
Sind Sie sicher, daß Sie künstlich meinen und nicht künstlerisch, fragte Herr Cosimo, der sich mit dem Großvater immer noch nicht duzte. Er wollte den Duzvorschlag nicht machen, der Großvater aber auch nicht. Sie meinen, fragte Herr Cosimo, nicht zufällig ein anderes Wort? Es gibt ja so viele.
So viele, sagte der Großvater, gibt es auch nicht.
Ein paar, sagte Herr Cosimo, gibt es schon.
Trotzdem, sagte der Großvater, meine ist künstlich!
Tatsächlich?
Ohne Zweifel!
Danach liefen wir wieder ein Stück. Im Sitzen, im Liegen, beim Spazierengehen machte sich der Großvater so seine Gedanken. Er »suchte viel herum«. Zum Beispiel suchte er nach einer »zweiten Welt« jenseits der natürlichen, die langweilte ihn. Morgens, wenn ich aus dem Bett sprang, stand er schon am Küchenfenster und suchte. Auch tagsüber, wenn er sich Notizen fürs Kino machte und »gar nicht genug Papier verurschen konnte« (die Großmutter), suchte der Großvater. Beim Spazierengehen blieb er oft stehen, legte die Hand auf die Augen und wollte etwas sagen. Er hatte bloß vergessen, was, und mußte es erst suchen. Dann sagte er: Nein, wieder nichts! und zog mich weiter. Das hieß, daß der Großvater die zweite Welt immer noch nicht gefunden hatte. Sogar nach dem Abendbrot, wenn er ins Apollo und ich »in die Falle« mußte, suchte er noch. Es war gar nicht so einfach. Außer der einen Welt, die wir hatten, gab es ja sonst keine! »Vielleicht gibt es nicht mal die!« Deshalb beneidete der Großvater jeden, der eine zweite Welt hatte und sie, sagen wir, malen konnte, wie der Maler Böcklin (1829—1901) seine Toteninsel. Malen konnte der Großvater aber nicht, wegen seiner Hände, die er sich als Gerber ruiniert hatte. Auch musikalisch war er leider nicht genug, um beispielsweise seine Stimme zu entwickeln. Schlimmer noch: er hatte keine! Er hatte in seiner Zirkuszeit zu viel brüllen müssen. Und was sein bißchen Klavierspielen anging … Ein eigenes Klavier hatte der Großvater nie besessen. Er hat nicht genug üben können. Ja, wenn er mehr hätte üben können! Statt dessen schrieb er nun, manchmal am Tag vier Stunden. Er schrieb »Phantasiestücke, Einsichten und Aussichten für einen Kopf und zwei Hände«, wie: Glück und Unglück haben beide etwas Positives und etwas Negatives, ein Hinten und ein Vorne! (Eigentlich hatte der Großvater hier etwas anderes sagen wollen, aber was, war ihm überm Schreiben entfallen. Da habe ich eben das geschrieben, es weiß ja keiner sonst!) Oder: Wir gehen so gerne in die Natur, weil sie uns ihre Meinung über uns nicht sagen kann! Oder: Das Kino ist für uns gerade noch rechtzeitig gekommen. Wenn es nicht gekommen wäre, hätten wir uns Hand in Hand in den Großen Teich stürzen müssen! Was er hoffte: vielleicht könnte er diese Sätze einmal aneinanderlegen und eine Philosophie daraus machen. Er fühlte sich erst am Anfang. Ich jedenfalls setze, sagte der Großvater, als wir wieder vor unserer Wohnung standen und Herrn Cosimo abgestoßen hatten, jeden Morgen meinen Künstlerhut auf und sehe meiner Zukunft mit Spannung entgegen! Auf jeden Fall, sagte er und schaute auf seine Taschenuhr, ist’s in zwei Stunden soweit. Dann hat die Misere ein Ende!
Was denn für eine Misere, fragte ich.
Was für eine Misere wohl, sagte er, das Leben natürlich!
Und was kommt jetzt?
Das Apollo, sagte der Großvater, was sonst?
2
Der Großvater ging nun auf die Dreiundsechzig und hatte einen braunen Bart. Der Bart war gefärbt. Die Kinder auf der Straße riefen: Guten Tag, Herr Kinoerzähler! Der Großvater tat dann immer, als wäre er über ihren Gruß überrascht, und sagte: Nanu! und lüftete seinen Künstlerhut, aber nur ein wenig. Grüßte ihn ein »Großer«, lüftete er ihn etwas mehr und sagte: Einen schönen Tag ohne unangenehme Zwischenfälle wünsche ich! Dabei hielt er mich fest an der Hand. Gern hätte er sich überhaupt mit »Herr Kinoerzähler« anreden lassen, doch kam keiner darauf. Morgens war er gern alleine. Da saß er im Haus herum und schickte die Großmutter zu unserem Hauswirt Lange in die Pestalozzistraße, wegen der neuen Zeitung. Das war immer die von gestern, die Herr Lange dann ausgelesen hatte. Die Großmutter fragte: Mußt du in aller Herrgottsfrühe denn schon diese Zeitung in dich hineinfressen? Es ist doch nur Mord und Totschlag drin.
Der Großvater sagte: Ich muß!
Da zog die Großmutter ihre Wolljacke an, ging mit mir um die Ecke, klopfte an Herrn Langes Küchenfenster und sagte: Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Herr Lange, aber hätten Sie vielleicht das Blatt von gestern für meinen Karl? Er ist so neugierig.
Herr Lange fragte: Kommt er sich’s denn nicht selber holen?
Ich fürchte, heut nicht, sagte die Großmutter, er hatte eine schwere Nacht. Es gab was mit der Adele Sandrock. Jetzt ruht er sich ein bißchen aus.
Na dann, sagte Herr Lange und reichte der Großmutter die alte Zeitung. Die Großmutter faltete sie glatt zusammen, da sah sie aus wie neu. Dann sagte sie: Schönen Dank auch, Herr Lange!, und wir gingen wieder heim. Hier, damit du dich beschäftigen kannst, sagte die Großmutter zu Hause und hielt dem Großvater die Zeitung hin. Nun war er wieder auf dem laufenden, nur eben mit einem Tag Verspätung. Am Montag war er sogar zwei Tage hinterher und hatte viel nachzuholen.
Nach unserer Rückkehr vom Hohen Hain war das Wetter nicht mehr so schön. Wir traten in unseren Hof. Ein Streifen von der Sonntagssonne lag noch auf unserem Garten. Ich hatte mich schnell umgezogen. Ich trug meine Gärtnerschürze. Ich hatte eine Schaufel in der Hand, wollte aber nicht spielen. Die Frauen sprachen vom Großvater, der im Schlafzimmer verschwunden war. Er legte, ehe er »auf Arbeit« ging, gern die Füße hoch.
Er ist nicht nur ein Künstler ohne Brot, sondern auch ohne Kunst, sagte die Großmutter herzlos. Sie wollte sagen: Aus so einer Kunst kann nichts werden. Er hatte zwar den Ausdrucksdrang des Künstlers, doch keine bestimmte Begabung. Oder, wie die Großmutter sagte, damit jeder sie verstand: Es scheint, als wollte aus ihm was raus, aber es ist nichts drin! Ja, wenn was drin wäre! Aber der Drang ist alles. Auch ohne die Beharrlichkeit und den Fleiß des Künstlers war der Großvater, leider! Er wollte bloß beeindrucken, aber ruckzuck! Doch womit? Weißt du es, fragte die Großmutter die Mutter, während der Großvater nebenan die Füße hochgelegt hatte.
Niemand weiß es, sagte die Mutter, die beim Bohnenschnippeln war. Sie hatte ihre Schürze um. Die Bohnen waren dünn und zart. Sie gingen in den Emailletopf, eine nach der anderen. Die Großmutter, die daneben saß, sah aus, als würde sie sie zählen. Sie zählte sie aber nicht. Sie sagte, sie wüßte auch nicht, womit der Großvater alle beeindrucken wollte. Er mußte nun ins Apollo, um sich einen Film anzusehen.
Darf ich mit, fragte ich die Mutter.
Nein.
Warum nicht?
Du bist noch zu klein. Der Großvater braucht Ruhe beim Erzählen.
Das hieß für ihn erzählen: Endlich, endlich, egal womit, beeindrucken, endlich, endlich gehört werden! Um noch besser zu erzählen und in der Dunkelheit des Apollo noch tieferen Eindruck zu machen, erweiterte er seinen Wortschatz. »Da hole ich mehr raus.« Also Satz- und Wortstudien mit Hilfe alter Tageszeitungen und eines Schullexikons, das später auf mich überging. In dem las er immer. Es lag mal in seinem Bett, mal auf dem Örtchen. »Er blättert Tag und Nacht« (die Großmutter). Wenn wichtiger Besuch kam, setzte er sich auf das Lexikon, da wirkte er größer. Die Wörter, die er abends im Apollo verwenden wollte, notierte er sich morgens auf einen Zettel. Die schnitt ihm die Großmutter zurecht. Ehe er mit mir durch die Stadt ging, mußte ich ihn fragen: Hast du auch deine Zettel?
Moment, sagte er und griff in seine Tasche. Er sagte: Ja, sie sind hier! Oder er rief: Na, so was! Jetzt hätte ich die Zettel um ein Haar vergessen! Die Zeit, die wir verloren hätten! Gut, daß ich dich habe. Dann steckte er sie in seine Rocktasche und trug sie die Helenenstraße hinauf, dann auf der anderen Seite wieder herunter. Er studierte sie, bis alles in ihn »übergegangen war«. Manchmal trug er die Zettel auch in den Hohen Hain. Dort holten wir ein paarmal tief Luft, dann kehrten wir wieder um. Sein Rock stak immer voller Zettel, in jeder Tasche waren welche. Wenn die Großmutter an sein Schrankfach ging, um seine Jacke auszubürsten, konnte sie über so viele Zettel nur den Kopf schütteln. »So viele, bei einem so kleinen Kino, braucht er wirklich nicht!« Der Großvater sah sie nie wieder.
Als »Meister kurzatmiger Gefühle« (die Großmutter) steckte er voller Pläne, aus denen nichts wurde. Statt dessen der nächste Plan! Er wollte ein neuartiges Buch verfassen und »von hinten nach vorn drucken lassen« (um 1936), er wußte nur noch nicht, was er reinschreiben sollte. Oder er wollte seine Singstimme ausbilden lassen, »besonders in den tieferen Lagen«. Oder Schmetterlinge sammeln und sie »der Schönheit nach« im Chemnitzer Heimatmuseum unter Glas zeigen.
Wenn es mir gelingt, sagte er, die zehn mächtigsten Männer der Erde in meine Ausstellung zu locken und sie ihnen, bei gutem Licht natürlich, vorzulegen, sind wir dem ewigen Frieden wieder ein Stück näher.
Nun, sagte die Großmutter, ein Verlangen ist da, doch wo soll er damit hin?
Der Großvater war »allgemein begabt, aber das führt zu nichts«. Unerschütterlich seine Überzeugung, er überrage die anderen Limbacher und Chemnitzer turmhoch, weil er mehr »empfängt«. Er war nicht bloß ein Lebenskünstler wie der Friseur Erblich, sondern ein Kunstkünstler wie der Nobelpreisträger Paul Heyse (1830—1914), der in einem Schloß bei München gewohnt hat und in den der Großvater als junger Mensch in Schwabing einmal um ein Haar hineingelaufen wäre. Er hat ihn sofort erkannt.
Jeden Abend gegen sechs — »Bis auf Montag, da spielen wir Geschlossen — ging der Großvater ins Apollo. Sobald er es betreten hatte, nahm er seinen Künstlerhut ab und grüßte, falls schon einer da war. Manchmal grüßte er auch, wenn keiner da war, vielleicht kam dann einer. Dann hängte er seinen Künstlerhut an den Nagel, »doch nicht seine Persönlichkeit«. Die Stiefel hatte er Tag und Nacht an den Füßen, »er schwitzt sie fleißig durch« (die Großmutter). Dann ging er in den Vorführraum und hoffte, daß heute Zuschauer kamen. Er stellte sich an die Tür Betreten verboten und machte die Augen zu. Da hörte er besser. Ein Ohr hatte er an der Tür, ein Bein war eingeknickt. Manchmal hielt er auch ein Auge ans Schlüsselloch. Er lauschte lange und verzweifelt. Zu wenig, wieder viel zu wenig! Wieder wurde es nicht voll! Deshalb wartete der Großvater lieber noch ein bißchen, ob nicht doch noch einer kam oder vielleicht zwei. Da, wenn er so wartete, und es kam keiner, erschien er mir auf einmal sehr klein. Sein Gesicht, die Lippen und die Augenbrauen hatte er nun geschminkt, auch sein Fräckchen hatte er an. In der Hand hielt er seine Kiste, auf die er nun gleich steigen und »sein Mundwerk in Bewegung setzen« würde. Sie verströmte Teegeruch. Daß er schon über sechzig war, sah ihm keiner an, jedenfalls nicht in der Dunkelheit. Wenn er etwas größer gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen. Manchmal sagte er: Zu alt, zu alt! Bei der Arbeit war er pünktlich. »Ohne halt ich’s nicht aus.« Wieder schaute er mit seinem besseren Auge — »es ist besser, aber nicht gut« — durchs Schlüsselloch in den Kinosaal. Er wollte »die Massen strömen sehen«. Wenn er sein Ohr daran legte, rauschte der Kinosaal wie das Meer. Das kam, weil er so leer war.
Komisch, sagte der Großvater zu Herrn Salzmann, ich seh keinen! Und du?
Herr Salzmann, der jüngere Augen hatte, sagte: Sechs Stück.
Nur sechs, rief der Großvater traurig.
Also, sagte Herr Salzmann, packen wir’s, oder?
Der Großvater räusperte sich und sagte: Je leerer es ist, um so schrecklicher rauscht es. Hörst du’s?
Nein, sagte Herr Salzmann, aber ich stell mir’s vor.
Es waren die Größe und die Leere und die eigenartige Akustik, die im Apollo so rauschten. Der Großvater legte die Hände auf die Ohren, er wollte das Rauschen nicht hören. Er machte sich viele Sorgen. Zum Beispiel, daß er mitten in einer Vorstellung die Stimme verlor, und es kam nichts raus. Oder daß man ihn, wenn er seinen Film erzählte, in den hinteren Reihen nicht hörte. Der Großvater stand vorn an der Leinwand und redete und redete, und sie hörten ihn nicht. Manchmal kratzte er sich hinterm Ohr und sagte: Vielleicht ist mein Gehör zu alt? Dann packte er mich bei der Schulter und stellte mich, obwohl Herr Salzmann schon auf seine Uhr schaute und rief: Also was, fangen wir heut nicht an?, neben die Leinwand. Dann mußte ich, während der Großvater bei den hinteren Plätzen war, etwas rufen wie: Ich stehe hier und rufe was und hoffe, der Film fängt bald an!
Du darfst nicht so ungeduldig sein, sagte der Großvater, erst muß ich wissen, ob ich noch was höre, ehe ich anfangen kann.
Aber ich bin doch gar nicht ungeduldig, rief ich durch das leere Apollo, ich warte doch gern! Dann rief ich noch einmal: Ich stehe immer noch hier und rufe was und bin nicht ungeduldig, aber es müßte nun eigentlich anfangen.
Da stellte der Großvater zu seiner Freude fest, er hörte alles, es ging keine Silbe verloren. Im Gegenteil, die Worte vergrößerten sich. Sie füllten das Apollo ganz aus.
Als ob es voll wäre, so klingt es, sagte der Großvater.
Es kamen dann noch Herr Lange, den Herr Theilhaber, weil sie sich so lange kannten, umsonst reinlassen mußte, Herr Cosimo und ein paar alte Kinoweiber. Die durften auf Kinderkarten rein, sie hatten nicht viel Geld. Zuletzt kam Fräulein Fritsche und winkte dem Großvater zu, aber bloß mit einem Finger, es durfte keiner sehen. Dann ging der Großvater schnell noch mal aufs Örtchen, damit er während der Vorstellung nicht mußte. Er schaute ein letztes Mal, ob es vielleicht noch mehr geworden waren. Er fragte auch Herrn Salzmann: Sind es jetzt mehr?
Kaum.
Na, vielleicht werden’s noch mehr, sagte der Großvater.
Ich lass mich immer überraschen, da fährt man am besten, sagte Herr Salzmann, und der Großvater sagte: Eins steht fest: Voll wird es nicht. Und hoffte, es wären wenigstens mehr als acht, weil Herr Theilhaber die Vorstellung sonst ausfallen lassen und alle nach Hause schicken könnte. Das machte er nicht gern, im Gegensatz zu Herrn Salzmann. Der schickte sie sogar nach Haus, wenn es sieben waren und sie gar nicht gehen wollten, er schob sie einfach raus. Er brauchte sich um die Einnahmen ja nicht zu kümmern, er war fest angestellt. Wenn acht oder neun da waren, und Herr Salzmann konnte sie nicht nach Hause schicken, holte der Großvater noch einmal tief Luft und sagte: So, Salzmann, jetzt wird’s ernst. Jetzt wünsch mir Glück.
Und wie macht man das, dir Glück wünschen, fragte Herr Salzmann, der wußte, daß man den Großvater leicht »grantig machen« konnte.
Sag: Toi-toi-toi, sagte der Großvater.
Herr Salzmann trat neben seinen Vorführapparat und machte: Toi-toi-toi!
Der Großvater holte tief Luft und trat in den Apollo-Saal. Dann machte er sich auf den Weg zur Leinwand, er mußte sich nun »sein Brot verdienen«. Dieser Weg, weil der Saal so leer war, war schrecklich lang. Der Großvater schaute zum Teil auf den Boden, zum Teil in die Luft. Nun, ganz leer war’s nicht! Herr Lange, Herr Cosimo und Fräulein Fritsche saßen da und warteten auf ihn. Manchmal winkte ihm auch ein anderer zu. Der Großvater kannte natürlich alle, wenn auch nicht beim Namen. Die, die er nicht mit Namen kannte, kannte er vom Zunicken. Er wußte auch, wo sie ungefähr wohnten und ob sie Arbeit hatten. Viele hatten keine. Natürlich kannten den Großvater alle. Die Kiste in der rechten Faust, lief er — die Großmutter sagte tippelte — mit kurzen, raschen Schritten den Seitengang hinab. Im Grunde war er ja ein kleiner Mann, »doch das vergißt man, wenn er redet« (die Großmutter). Mit der freien Hand streifte er über die Außensitze. Alle leer, alle leer! Und was noch schlimmer war: Nun kam auch keiner mehr! Als der Großvater an der Leinwand war, hatte er jede Reihe berührt. Jetzt fühlte er sich zu Hause. Da fing es auf der Leinwand zu flimmern an. Hoffentlich fing der Film heut kein Feuer! In diesem Augenblick war der Großvater immer sehr aufgeregt. Man sah’s ihm bloß nicht an, so riß er sich zusammen. Er stellte seine Kiste auf den Boden. Dann drehte er den Klaviersessel hoch, weil er mit seinen kurzen Armen alle Tasten erreichen wollte. »Auf meine Musik können sie nicht verzichten! Sollen sie warten.« Er trödelte gern.
Und wenn du mal gar nicht kommst, fragte ich.
Warum sollte ich nicht?
Wenn du tot bist?
Da gibt es kein Kino mehr.
Der Großvater hatte sich hingesetzt. Da fing es auch schon an. Zuerst kam sein Klavier. Die Musik, die er machte, war schön. Sie war aber auch notwendig, weil sie das Rattern des Vorführapparates übertönte. Wenigstens lenkte sie davon ab. Auch vertrieb sie den Zuschauern die Zeit, falls der Film wieder mal gerissen war und Herr Salzmann ihn flicken mußte.
Ich muß mal wieder, rief er dann zum Großvater nach vorn, es dauert zehn Minuten!
Capito, rief der Großvater vom Klavier, ich halte die Festung.
Sein Stöckchen lag auf dem Klavierdeckel. Noten brauchte der Großvater nicht, er konnte sowieso keine lesen. Energisch warf er die Frackschöße zurück und ließ sich auf seinen Schemel fallen. Er streckte die Arme so weit vor, daß seine Jackenärmel bis zu den Ellenbogen rutschten. Dann fing er zu spielen — die Großmutter sagte: zu klimpern —