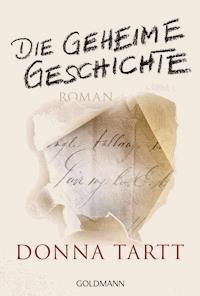2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexandria, eine kleine Stadt in den Südstaaten: Hier wächst Harriet Cleve in einem Zuhause voller Geborgenheit auf, und dennoch lastet ein dunkler Schatten auf ihrer Kindheit. Zwölf Jahre sind seit jenem Moment vergangen, in dem für die Familie Cleve die Welt jäh zum Stillstand kam: Eine Nachbarin fand Harriets neunjährigen Bruder Robin erhängt an einem Baum. Die Umstände seines rätselhaften Todes blieben in all der Zeit ungeklärt, und so fasst in diesem heißen Sommer die eigensinnige Harriet den Entschluss, Robins Mörder um jeden Preis ausfindig zu machen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1171
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Dunkle Wolken kündigen an einem Frühlingsabend ein Gewitter an, doch bei der Familie Cleve herrscht rege Betriebsamkeit. Es ist Muttertag, und alle haben sich zum traditionellen Festessen versammelt: Da ist Charlotte, die Mutter des neunjährigen Robin, der kleinen Allison und der erst wenige Monate alten Harriet, und da sind Charlottes Mutter Edie sowie ihre drei Schwestern. Während die Frauen letzte Vorbereitungen für das Essen treffen, zucken bereits erste Blitze am Himmel, und plötzlich überkommt Charlotte eine dumpfe Ahnung drohenden Unheils. Als ein gellender Schrei die Luft zerreißt, weiß sie, dass tatsächlich etwas Schreckliches geschehen ist: Eine Nachbarin hat Robin entdeckt – erhängt an einem Baum. Die mysteriösen Umstände von Robins Tod werden nie ganz aufgeklärt, der Mörder wird nie gefasst. So wächst Harriet heran, ohne ihren Bruder je gekannt zu haben, und ihre bohrenden Fragen nach seinem grausamen Schicksal werden in der Familie nur mit beharrlichem Schweigen beantwortet. Doch Harriet hat ihren eigenen Kopf, und als sie zwölf Jahre alt ist, macht sie sich auf die Suche nach dem Mörder ihres Bruders ...
Weitere Informationen zu Donna Tartt
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Donna Tartt
DER KLEINE FREUND
Roman
Ins Deutsche übertragen von Rainer Schmidt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Little Friend« bei Alfred A. Knopf, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Donna Tartt
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: gettyimages/Elyse Lewin
Th · Herstellung: kw
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-22596-4V003
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Neal
»Gleichwohl ist … die geringste Erkenntnis, die wir von diesen höchsten Wahrheiten erreichen können, wertvoller und unserer Sehnsucht würdiger als die sicherste Erkenntnis der geringfügigen irdischen Dinge.«
THOMAS VON AQUIN SUMMA THEOLOGICA I, 1,5 AD 1
Meine Damen und Herren, ich bin nunmehr mit einer Handschelle gefesselt, an deren Herstellung ein britischer Mechaniker fünf Jahre gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob ich mich daraus befreien werde oder nicht, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich mein Bestes tun werde.
HARRY HOUDINI, LONDON HIPPODROME, SAINT PATRICK’S DAY 1904
PROLOG
Für den Rest ihres Lebens würde Charlotte Cleve sich die Schuld am Tod ihres Sohnes geben, weil sie entschieden hatte, das Muttertagsessen abends um sechs stattfinden zu lassen und nicht mittags nach der Kirche, wie es bei den Cleves sonst üblich war. Die älteren Cleves hatten ihren Unmut über diese Planung zum Ausdruck gebracht, und wenn dies auch hauptsächlich auf ihren prinzipiellen Argwohn gegen jegliche Art von Neuerung zurückzuführen war, ahnte Charlotte, dass sie auf das unterschwellige Murren hätte hören sollen – als eine zarte, aber ominöse Warnung vor dem, was geschehen würde, eine Warnung, die einem zwar selbst rückblickend noch reichlich undeutlich erscheint, die aber vielleicht so gut war wie jede andere, auf die wir in diesem Leben hoffen dürfen.
Sosehr die Cleves das Erzählen liebten und sich gegenseitig sogar die geringfügigeren Ereignisse ihrer Familiengeschichte wiederholt schilderten – Wort für Wort, mit ausgefeilten stilistischen und rhetorisch wirksamen Pausen, ganze Sterbeszenen oder auch hundert Jahre zuvor gemachte Heiratsanträge –, die Ereignisse dieses schrecklichen Muttertags wurden doch niemals erörtert. Niemals, nicht einmal in unbeobachteten Zweiergruppen, zusammengeführt durch eine lange Autofahrt oder durch geteilte Schlaflosigkeit in nächtlichen Küchen, und das war ungewöhnlich, denn mit Hilfe dieser familiären Erörterungen machten die Cleves sich einen Reim auf die Welt. Noch die grausamsten und willkürlichsten Katastrophen – der Feuertod, der einen von Charlottes Cousins im Säuglingsalter ereilt hatte, oder der Jagdunfall, bei dem Charlottes Onkel zu Tode gekommen war, als sie noch zur höheren Schule ging – wurden ständig bei ihnen durchgespielt, und die sanfte Stimme ihrer Großmutter und die strenge ihrer Mutter verschmolzen harmonisch mit dem Bariton ihres Großvaters und dem Geschnatter der Tanten. Bestimmte Ausschmückungen, improvisiert von wagemutigen Solisten, wurden eifrig aufgenommen und vom Chor ausgearbeitet, bis sie schließlich mit vereinten Kräften bei einem einzigen Lied angelangt waren, einem Lied, das dann auswendig gelernt und von der ganzen Gesellschaft wieder und wieder gesungen wurde, und nach und nach höhlte es die Erinnerung aus und nahm den Platz der Wahrheit ein: Der zornige Feuerwehrmann, gescheitert in seinen Bemühungen, den winzigen Leichnam wiederzubeleben, vollzog die süße Wandlung zum weinenden Feuerwehrmann. Der trübselige Hühnerhund, den der Tod seines Herrn für mehrere Wochen in Verwirrung stürzte, gestaltete sich zur kummervollen Queenie der Familienlegende, die ihren Geliebten unermüdlich im ganzen Hause suchte und nachts untröstlich in ihrem Zwinger heulte und die in freudiger Begrüßung bellte, wenn der liebe Geist durch den Garten herankam, ein Geist, den nur sie selbst wahrnehmen konnte. »Hunde können Dinge sehen, die wir nicht sehen können«, intonierte Charlottes Tante Tat stets aufs Stichwort an der entsprechenden Stelle der Geschichte; sie hatte eine mystische Ader, und der Geist war eine von ihr eingeführte Neuerung.
Aber Robin: ihr lieber kleiner Robs. Mehr als zehn Jahre später war sein Tod noch immer eine Qual; da gab es kein Detail zu beschönigen, und keiner der narrativen Kunstgriffe, die den Cleves zu Gebote standen, konnte das Grauenvolle daran beheben oder umwandeln. Und da diese eigenwillige Amnesie verhindert hatte, dass Robins Tod in jene gute alte Familiensprache übersetzt wurde, die selbst die bittersten Geheimnisse zu behaglicher, begreiflicher Form glättete, war die Erinnerung an die Ereignisse jenes Tages von chaotischer, fragmentierter Beschaffenheit – gleißende Spiegelscherben eines Albtraums, die aufblitzten beim Duft der Glyzine, beim Knarren einer Wäscheleine oder wenn das Licht eines Frühlingstags einen bestimmten Gewitterton annahm.
Manchmal erschienen diese eindringlich aufstrahlenden Erinnerungen wie die Bruchstücke eines bösen Traums – als wäre das alles nie geschehen. Und doch schien es in vielfacher Hinsicht das einzig Wirkliche zu sein, das in Charlottes Leben je geschehen war.
Die einzige Erzählweise, die sie diesem Gewirr von Bildern überstülpen konnte, war die Überlieferung des Rituals, das seit ihren Kindertagen unverändert war: der fest gefügte Rahmen des Familientreffens. Aber selbst das war wenig hilfreich: Gebräuche waren in jenem Jahr missachtet, Hausregeln ignoriert worden. Rückblickend verschmolz alles zu einem Wegweiser, der in Richtung Katastrophe deutete. Das Essen hatte nicht wie sonst im Hause ihres Großvaters stattgefunden, sondern bei ihr. Die Ansteckbouquets waren aus Cymbidiumorchideen gewesen, nicht aus den üblichen Rosenknospen. Hühnerkroketten – die alle gern aßen, die Ida Rhew immer gelangen, die man bei den Cleves zu Geburtstagen und an Heiligabend reichte – hatte es jedoch noch nie am Muttertag gegeben; da hatte es, soweit sich irgendjemand erinnern konnte, überhaupt nie etwas anderes gegeben als Zuckererbsen, Maispudding und Schinken.
Ein stürmischer, leuchtender Frühlingsabend, tief hängende, verwischte Wolken und goldenes Licht, der Rasen übersät von Löwenzahn und Wiesenblumen. Die Luft roch frisch und straff nach Regen. Lachen und Geplauder im Haus, und einen Augenblick lang erhob sich die quengelnde Stimme von Charlottes alter Tante Libby hoch und klagend über die andern: »Aber ich habe so etwas noch nie getan, Adelaide, noch nie im Leben habe ich so etwas getan!« Der ganzen Familie Cleve machte es Spaß, Tante Libby aufzuziehen. Sie war eine Jungfer und hatte Angst vor allem, vor Hunden und Gewittern und Früchtebrot mit Rum, vor Bienen, Negern und der Polizei. Ein kräftiger Wind zerrte an der Wäscheleine und wehte auf dem Brachgrundstück auf der anderen Straßenseite das hohe Unkraut flach. Die Fliegentür flog zu. Robin kam herausgerannt, quiekend vor Lachen über einen Witz, den seine Großmutter ihm erzählt hatte (Warum ist der Brief feucht? Weil die Frankiermaschine leckt.), und sprang immer zwei Stufen auf einmal herunter.
Es hätte zumindest jemand draußen sein müssen, der auf das Baby aufpasste. Harriet war damals noch nicht einmal ein Jahr alt, ein schweres, ernstes Baby mit schwarzem Schopf, das niemals weinte. Sie war draußen auf dem Weg vor dem Haus, festgeschnallt in ihrer tragbaren Schaukel, die vor- und zurückwippte, wenn man sie aufzog. Ihre Schwester Allison, vier Jahre alt, spielte auf den Stufen still mit Weenie, Robins Katze. Anders als Robin, der in diesem Alter unaufhörlich und ausgelassen mit seinem rauen Stimmchen geschwatzt und sich vor lauter Vergnügen über seine eigenen Witze auf dem Boden gekugelt hatte, war Allison scheu und ängstlich und weinte, wenn jemand ihr das ABC beibringen wollte; und die Großmutter der Kinder (die auf dieses Verhalten mit Ungeduld reagierte) kümmerte sich kaum um sie.
Tante Tat war schon früh draußen gewesen und hatte mit dem Baby gespielt. Charlotte selbst, die zwischen Küche und Esszimmer hin- und herrannte, hatte ein-, zweimal den Kopf hinausgestreckt – aber sie hatte nicht genau Acht gegeben, weil Ida Rhew, die Haushälterin (die beschlossen hatte, ihre montägliche Wäsche schon jetzt in Angriff zu nehmen), immer wieder im Garten erschien, um Kleider auf die Leine zu hängen. Charlotte war deshalb zu Unrecht beruhigt gewesen, denn an ihrem normalen Waschtag – montags – war Ida immer in Hörweite, ob im Garten oder bei der Waschmaschine auf der hinteren Veranda, und so konnte man selbst die Kleinsten gefahrlos draußen allein lassen. Aber Ida war an diesem Tag gehetzt, verhängnisvoll gehetzt, denn sie hatte die Gäste zu versorgen und nicht nur das Baby, sondern auch den Herd im Auge zu behalten. So war sie miserabler Laune, weil sie normalerweise sonntags um eins nach Hause kam, und jetzt musste nicht nur ihr Mann, Charley T., selbst für sein Essen sorgen, sondern sie, Ida Rhew, versäumte auch noch die Kirche. Sie hatte darauf bestanden, das Radio in die Küche zu stellen, damit sie wenigstens die Gospelshow aus Clarksdale hören konnte. Mürrisch wurschtelte sie in ihrem schwarzen Dienstbotenkleid mit der weißen Schürze in der Küche herum, die Lautstärke ihrer Evangeliumssendung bockig laut gestellt, und goss Eistee in hohe Gläser, während die sauberen Hemden draußen auf der Wäscheleine sich drehten und um sich schlugen und in ihrer Verzweiflung vor dem kommenden Regen die Arme hochrissen.
Robins Großmutter war auch irgendwann auf der Veranda gewesen; so viel stand fest, denn sie hatte ein Foto gemacht. Es gab nicht viele Männer in der Familie Cleve, und handfeste, maskuline Tätigkeiten – Bäume beschneiden, Reparaturen im Haushalt vornehmen, die Älteren zum Einkaufen und in die Kirche fahren – waren größtenteils ihr zugefallen. Sie erledigte das alles fröhlich und mit einem forschen Selbstbewusstsein, zum Erstaunen ihrer schüchternen Schwestern. Von ihnen konnte keine auch nur Auto fahren, und die arme Tante Libby hatte solche Angst vor Geräten und mechanischen Apparaten jeglicher Art, dass sie schon bei der Aussicht darauf, eine Gasheizung anzuzünden oder eine Glühbirne zu wechseln, in Tränen ausbrach. Sie waren zwar fasziniert von der Kamera, aber auch auf der Hut vor ihr, und sie bewunderten den unbekümmerten Wagemut ihrer Schwester im Umgang mit diesem männlichen Instrument, das Laden und Zielen und Abdrücken erforderte wie eine Pistole. »Seht euch Edith an«, sagten sie dann, wenn sie sahen, wie sie den Film zurückspulte oder mit fachmännischer Geschwindigkeit die Schärfe einstellte. »Es gibt nichts, was Edith nicht kann.«
Es war eine Familienweisheit, dass Edith bei aller Brillanz auf vielfältigen Fachgebieten keine besonders glückliche Hand mit Kindern hatte. Sie war stolz und ungeduldig, und ihre Art ließ wenig Platz für Herzlichkeit. Charlotte, ihr einziges Kind, lief immer zu ihren Tanten (vorzugsweise zu Tante Libby), wenn sie Trost, Zuneigung und Bestätigung brauchte. Harriet, das Baby, hatte noch kaum erkennen lassen, dass sie irgendjemanden bevorzugte, aber Allison graute es vor den energischen Versuchen ihrer Großmutter, sie zur Aufgabe ihrer Schweigsamkeit anzustacheln, und sie weinte, wenn sie bei ihr bleiben musste. Aber, oh, wie hatte Charlottes Mutter den kleinen Robin geliebt, und wie hatte er ihre Liebe erwidert. Sie – eine würdevolle Dame mittleren Alters – spielte mit ihm im Vorgarten Fangen, sie fing Schlangen und Spinnen in ihrem Garten und gab sie ihm zum Spielen, und sie brachte ihm lustige Lieder bei, die sie als Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg von den Soldaten gelernt hatte.
EdieEdieEdieEdieEdie! Sogar ihr Vater und ihre Schwestern nannten sie Edith, aber Edie war der Name, den er ihr gegeben hatte, als er gerade hatte sprechen können und kreischend vor Vergnügen wie toll auf dem Rasen umhergerannt war. Einmal, als Robin ungefähr vier war, hatte er sie ganz ernst altes Mädchen genannt. »Armes altes Mädchen«, hatte er gesagt, gravitätisch wie eine Eule, und ihr dabei mit seiner kleinen, sommersprossigen Hand die Stirn getätschelt. Charlotte wäre es nicht im Traum eingefallen, mit ihrer schneidigen, geschäftsmäßigen Mutter so vertraulich umzugehen, schon gar nicht, wenn sie mit Kopfschmerzen im Schlafzimmer lag; aber die Sache hatte Edie sehr erheitert, und inzwischen war es eine ihrer Lieblingsgeschichten. Ihr Haar war grau, als er zur Welt kam, aber als sie jünger war, war es leuchtend kupferrot gewesen, genau wie Robins. Für Robin Rotkehlchen schrieb sie auf die Schildchen an seinen Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken oder Für meinen roten Robin. In Liebe von deinem armen alten Mädchen.
EdieEdieEdieEdieEdie! Er war jetzt neun, aber seine traditionelle Begrüßung, sein Liebeslied an sie, war zu einem Scherzwort in der Familie geworden, und er sang es quer durch den Garten, wie er es immer tat, als sie an jenem Nachmittag, an dem sie ihn zum letzten Mal sah, auf die Veranda herauskam.
»Komm und gib dem alten Mädchen einen Kuss«, rief sie. Für gewöhnlich ließ er sich gern fotografieren, aber manchmal war er scheu – dann kam nichts als ein verwischter Rotschopf, spitze Ellenbogen und Knie auf hastiger Flucht dabei heraus –, und als er jetzt die Kamera an Edies Hals sah, nahm er Reißaus und bekam vor Lachen einen Schluckauf.
»Komm zurück, du Schlingel!«, rief sie, und dann hob sie spontan die Kamera und drückte trotzdem auf den Auslöser. Es war das letzte Bild, das sie von ihm hatten. Verschwommen. Eine flache grüne Fläche, leicht schräg, mit einem weißen Geländer und dem wogenden Glanz eines Gardenienbusches scharf im Vordergrund, am Rande der Veranda. Ein düsterer, gewitterfeuchter Himmel, ineinander verfließendes Indigo und Schiefergrau, wallende Wolken, umstrahlt von Zacken aus Licht. In der Ecke des Bildes rannte Robin, ein verwischter Schatten mit dem Rücken zum Betrachter, über den nebligen Rasen hinaus und seinem Tod entgegen, der – beinahe sichtbar – dastand und ihn erwartete, an dem dunklen Fleck unter dem Tupelobaum.
Tage später, als sie im verdunkelten Zimmer lag, war im Nebel der Tabletten ein Gedanke durch Charlottes Kopf gehuscht. Immer wenn Robin irgendwo hinging – zur Schule, zu einem Freund, zu Tante Edie, um den Nachmittag bei ihr zu verbringen –, war es ihm sehr wichtig gewesen, auf Wiedersehen zu sagen, und zwar auf zärtliche und häufig ausgedehnte und zeremonielle Art und Weise. Sie hatte tausend Erinnerungen an kleine Zettel, die er geschrieben hatte, an Kusshände aus Fenstern, an seine kleine Hand, die vom Rücksitz eines abfahrenden Wagens auf und ab flatterte: Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Als Baby hatte er sehr viel eher bye-bye als hello sagen können, und er hatte die Leute damit begrüßt und sich von ihnen verabschiedet. Charlotte kam es besonders grausam vor, dass es diesmal kein Aufwiedersehen gegeben hatte. Sie war so außer sich gewesen, dass sie sich nicht mehr klar an ihren letzten Wortwechsel mit Robin entsinnen konnte, ja, nicht einmal daran, wann sie ihn das letzte Mal gesehen hatte, während sie doch etwas Konkretes brauchte, irgendeine kleine, unwiderrufliche Erinnerung, die die Hand in ihre schieben und sie begleiten konnte, wenn sie jetzt blind durch diese jäh entstandene Wüste des Daseins stolperte, die sich vom gegenwärtigen Augenblick bis zum Ende ihres Lebens vor ihr ausdehnte. Halb von Sinnen vor Trauer und Schlaflosigkeit, hatte sie unentwegt mit Libby geplappert (Tante Libby war es gewesen, die sie über diese Zeit hinweggebracht hatte, Libby mit ihren kühlen Tüchern und ihrem Lavendelöl, Libby, die Nacht um Nacht mit ihr wach geblieben war, Libby, die nie von ihrer Seite gewichen war, Libby, die sie gerettet hatte), denn weder ihr Ehemann noch sonst jemand hatte ihr auch nur den fadenscheinigsten Trost spenden können, und auch wenn ihre eigene Mutter (die auf Außenstehende den Eindruck machte, sie »verkrafte die Sache gut«) sich in ihren Gewohnheiten und ihrer Erscheinung nicht veränderte und weiter tapfer ihren täglichen Pflichten nachging, würde sie doch nie wieder so sein wie früher. Der Schmerz hatte sie versteinert, und es war schrecklich mitanzusehen. »Raus aus dem Bett, Charlotte!«, blaffte sie und stieß die Fensterläden auf. »Hier, trink eine Tasse Kaffee, bürste dir das Haar, du kannst nicht ewig so herumliegen.« Und sogar die unschuldige alte Libby erschauerte manchmal vor der gleißenden Kälte in Edies Blick, wenn sie sich vom Fenster abwandte und ihre Tochter anschaute, die reglos im dunklen Schlafzimmer lag: wild und erbarmungslos wie Arcturus.
»Das Leben geht weiter.« Das war einer von Edies Lieblingssätzen. Es war eine Lüge. In jenen Tagen erwachte Charlotte immer noch in einem medikamentösen Delirium, um ihren toten Sohn für die Schule zu wecken, und fünf- oder sechsmal in der Nacht schrak sie aus dem Bett hoch und rief seinen Namen. Und manchmal glaubte sie einen oder zwei Augenblicke lang, Robin sei oben und das alles nur ein böser Traum. Aber wenn ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten und sie das scheußliche, verzweifelte Durcheinander (Papiertaschentücher, Pillenfläschchen, welke Blütenblätter) auf dem Nachttisch verstreut sah, fing sie wieder an zu schluchzen – obwohl sie schon geschluchzt hatte, bis ihr die Rippen wehtaten, denn Robin war nicht oben und auch sonst an keinem Ort, von dem er je wieder zurückkommen würde.
Er hatte Spielkarten zwischen die Speichen seines Fahrrads geklemmt. Als er noch lebte, war es ihr nicht klar gewesen, aber durch dieses Knattern hatte sie sein Kommen und Gehen verfolgen können. Ein Kind in der Nachbarschaft hatte ein Fahrrad, das sich genauso anhörte, und immer wenn sie es in der Ferne hörte, überschlug sich ihr Herz für einen schwebenden, ungläubigen Moment von prachtvoller Grausamkeit.
Hatte er nach ihr gerufen? Der Gedanke an seine letzten Augenblicke zerstörte ihre Seele, und trotzdem konnte sie an nichts anderes denken. Wie lange? Hatte er leiden müssen? Den ganzen Tag starrte sie an die Schlafzimmerdecke, bis die Schatten darüber hinwegschlichen, und dann lag sie wach und starrte im Dunkeln auf das Schimmern des Leuchtzifferblatts.
»Du tust niemandem auf der Welt einen Gefallen, wenn du den ganzen Tag weinend im Bett liegst«, sagte Edie energisch. »Du würdest dich sehr viel besser fühlen, wenn du dich anziehen und zum Frisör gehen würdest.«
In ihren Träumen war er ausweichend und distanziert, enthielt ihr irgendetwas vor. Sie sehnte sich nach einem Wort von ihm, aber er schaute ihr nie in die Augen, sprach nie. Libby hatte ihr während der schlimmsten Tage immer wieder etwas ins Ohr gemurmelt, etwas, das sie nicht verstanden hatte. Es war uns nie bestimmt, ihn zu haben, Darling. Er hat nicht uns gehört, und wir sollten ihn nicht behalten. Es war unser Glück, dass er überhaupt so lange bei uns war.
Und dieser Gedanke war es, der Charlotte im Nebel der Medikamente an jenem heißen Morgen in ihrem verdunkelten Zimmer in den Sinn kam: dass Libby die Wahrheit gesagt hatte. Dass Robin, seit er ein Baby gewesen war, auf irgendeine seltsame Art sein Leben lang versucht hatte, ihr auf Wiedersehen zu sagen.
Edie war die Letzte, die ihn gesehen hatte. Danach wusste eigentlich niemand mehr etwas Genaues. Während die Familie im Wohnzimmer plauderte – die Schweigepausen wurden jetzt länger, und alle schauten sich wohlig um und warteten darauf, dass sie zu Tisch gerufen wurden –, kauerte Charlotte auf Händen und Knien vor der Anrichte im Esszimmer und wühlte nach ihren guten Leinenservietten (beim Hereinkommen hatte sie gesehen, dass der Tisch mit den baumwollenen Alltagsservietten gedeckt gewesen war; Ida behauptete – typisch –, sie habe noch nie von den andern gehört und die karierten Picknickservietten seien die einzigen, die sie habe finden können). Charlotte hatte die guten eben gefunden und wollte Ida rufen (Siehst du? Sie waren genau da, wo ich es gesagt habe.), als sie plötzlich das sichere Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte.
Das Baby. Dem Baby galt ihr erster Gedanke. Sie sprang auf, ließ die Servietten auf den Teppich fallen und rannte hinaus auf die Veranda.
Aber Harriet fehlte nichts. Sie saß immer noch angeschnallt in ihrer Wippe und starrte ihre Mutter mit großen, ernsten Augen an. Allison saß auf dem Gehweg und hatte den Daumen im Mund. Sie wiegte sich – offenbar unversehrt – vor und zurück und gab ein wespenartiges Summen von sich, aber Charlotte sah, dass sie geweint hatte.
Was ist los?, fragte sie. Hast du dir wehgetan?
Aber Allison schüttelte den Kopf, ohne den Daumen aus dem Mund zu nehmen.
Aus dem Augenwinkel sah Harriet am Rande des Gartens eine Bewegung aufblitzen – Robin? Doch als sie aufblickte, war dort niemand zu sehen.
Bist du sicher?, fragte Charlotte. Hat das Kätzchen dich gekratzt?
Allison schüttelte den Kopf: nein. Charlotte kniete nieder und untersuchte sie rasch: keine Beulen, keine Schrammen. Die Katze war verschwunden.
Immer noch voller Unbehagen gab Charlotte ihr einen Kuss auf die Stirn und führte sie ins Haus (»Willst du nicht in die Küche gehen und sehen, was Ida macht?«), und dann ging sie wieder hinaus, um nach dem Baby zu sehen. Sie hatte diese traumartig aufblitzende Panik schon öfter gespürt, meistens mitten in der Nacht, und immer wenn ein Kind weniger als sechs Monate alt gewesen war; dann war sie aus tiefem Schlaf hochgeschossen und zum Kinderbett geeilt. Aber Allison fehlte nichts, und das Baby war wohlauf … Sie ging ins Wohnzimmer und deponierte Harriet bei ihrer Tante Adelaide, hob die Servietten vom Esszimmerteppich auf und wanderte – immer noch halb schlafwandelnd, sie wusste nicht, warum – in die Küche, um das Aprikosenglas für das Baby zu holen.
Ihr Mann Dix hatte gesagt, dass man mit dem Essen nicht auf ihn warten sollte. Er war auf der Entenjagd. Das war gut und schön. Wenn Dix nicht in der Bank war, war er meistens auf der Jagd oder drüben im Haus seiner Mutter. Sie stieß die Küchentür auf und schob einen Schemel vor den Schrank, um das Glas für das Baby herauszuholen. Ida Rhew stand gebückt vor dem Herd und zog ein Blech mit Brötchen heraus. Gott, sang eine brüchige Negerstimme aus dem Transistorradio, Gott ändert sich nie.
Die Gospelsendung. Diese Gospelsendung war etwas, das Charlotte quälte, auch wenn sie nie jemandem davon erzählt hatte. Wenn Ida diesen Krach nicht so laut aufgedreht hätte, dann hätten sie vielleicht hören können, was im Garten vor sich ging, hätten vielleicht merken können, dass etwas nicht stimmte. Andererseits (nachts warf sie sich im Bett hin und her und versuchte ruhelos, die Ereignisse bis zu einer ersten Ursache zurückzuverfolgen) war sie es gewesen, die die fromme Ida gezwungen hatte, überhaupt am Sonntag zu arbeiten. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Der Jahwe des Alten Testaments hatte Menschen immer wieder für sehr viel weniger zerschmettert.
Diese Brötchen sind fast fertig, sagte Ida Rhew und beugte sich wieder vor dem Herd.
Ida, die übernehme ich schon. Ich glaube, es gibt Regen. Hol doch die Wäsche herein, und rufe Robin zum Essen.
Als Ida steif mit einer Armladung weißer Hemden ächzend zurückkam, sagte sie mürrisch: Er kommt nicht.
Sag ihm, er soll auf der Stelle herkommen.
Ich weiß nicht, wo er ist. Hab ihn ein halbes Dutzend Mal gerufen.
Vielleicht ist er über die Straße gelaufen.
Ida warf die Hemden in den Bügelkorb. Die Fliegentür knallte. Robin, hörte Charlotte sie schreien. Komm her jetzt, oder es setzt was.
Und dann noch einmal: Robin!
Aber Robin kam nicht.
Ach, um Himmels willen, sagte Charlotte, und sie trocknete sich die Hände an einem Küchenhandtuch ab und ging hinaus.
Draußen wurde ihr – mit leisem Unbehagen, das mehr Ärger war als irgendetwas anderes – klar, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie suchen sollte. Sein Fahrrad lehnte an der Veranda. Er wusste, dass er so kurz vor dem Abendessen nicht mehr weggehen durfte, schon gar nicht, wenn sie Besuch hatten.
Robin!, rief sie. Ob er sich versteckt hatte? In der Nachbarschaft wohnten keine Kinder in seinem Alter; zwar kamen ab und zu verwahrloste Kinder, schwarze wie weiße, vom Fluss herauf zu den breiten, von Eichen überschatteten Gehwegen der George Street, aber jetzt war keins von ihnen zu sehen. Ida hatte ihm verboten, mit ihnen zu spielen, aber manchmal tat er es trotzdem. Die Kleinsten waren zum Erbarmen mit ihren verkrusteten Knien und schmutzigen Füßen; Ida Rhew verscheuchte sie schroff aus dem Garten, aber Charlotte gab ihnen, wenn sie sich mild gestimmt fühlte, mitunter einen Vierteldollar oder ein Glas Limonade. Wenn sie hingegen älter wurden – dreizehn oder vierzehn –, war sie froh, wenn sie sich ins Haus zurückziehen und es Ida überlassen konnte, sie mit all ihrem Ingrimm zu verjagen. Sie schossen mit Luftgewehren auf Hunde, stahlen Sachen von den Veranden der Leute, benutzten eine unflätige Sprache und streunten bis spät nachts durch die Straßen.
Ida sagte: Ein paar von den verkommenen kleinen Jungs sind vorhin die Straße runtergelaufen.
Wenn Ida »verkommen« sagte, meinte sie »weiß«. Ida hasste die armen weißen Kinder und gab ihnen mit unbeirrbar einseitigem Zorn die Schuld an sämtlichen Gartenmissgeschicken, selbst an denen, für die sie nach Charlottes Ansicht unmöglich verantwortlich sein konnten.
War Robin bei ihnen?, fragte Charlotte.
Nein.
Wo sind sie jetzt?
Hab sie verjagt.
In welche Richtung?
Runter, Richtung Depot.
Die alte Mrs. Fountain von nebenan in ihrer weißen Strickjacke und mit der Schmetterlingsbrille war in ihren Vorgarten gekommen, um zu sehen, was los war, begleitet von ihrem hinfälligen Pudel Mickey. Die beiden sahen sich auf komische Weise ähnlich: spitze Nase, starre graue Löckchen, misstrauisch vorgeschobenes Kinn.
Na, rief sie fröhlich, feiert ihr ’ne große Party da drüben?
Nur die Familie, rief Charlotte zurück und suchte den dunkler werdenden Horizont jenseits der Natchez Street ab, wo die Bahngleise sich flach in die Ferne erstreckten. Sie hätte Mrs. Fountain zum Essen einladen sollen. Mrs. Fountain war Witwe, und ihr einziges Kind war im Koreakrieg gefallen, aber sie war eine Nörglerin und eine bösartige Klatschbase. Mr. Fountain, Inhaber einer Textilreinigung, war früh gestorben, und die Leute behaupteten scherzhaft, sie habe ihn unter die Erde geredet.
Was ist los?, fragte Mrs. Fountain.
Sie haben Robin nicht gesehen, oder?
Nein. Ich war den ganzen Nachmittag oben und habe den Speicher ausgeräumt. Ich weiß, ich sehe furchtbar aus. Sehen Sie den ganzen Plunder, den ich herausgeschleppt habe? Ich weiß schon, dass die Müllabfuhr erst am Dienstag kommt, und es ist mir unangenehm, das ganze Zeug einfach so auf der Straße zu lassen, aber ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wo ist Robin denn hingelaufen? Können Sie ihn nicht finden?
Er ist sicher nicht weit, sagte Charlotte und trat auf den Gehweg hinaus, um die Straße hinunterzuspähen. Aber es ist Essenszeit.
Gibt gleich ein Gewitter, sagte Ida Rhew und schaute in den Himmel.
Sie glauben doch nicht, dass er in den Fischteich gefallen ist, oder?, fragte Mrs. Fountain besorgt. Ich hab immer schon befürchtet, dass eins von diesen Kleinen da mal reinfällt.
Der Fischteich ist nicht einmal einen halben Meter tief, sagte Charlotte, aber sie machte doch kehrt und ging nach hinten in den Garten.
Edie war auf die Veranda herausgekommen. Ist was?, fragte sie.
Er ist nicht hinten, rief Ida Rhew. Ich hab schon geguckt.
Als Charlotte an der Seite des Hauses am offenen Küchenfenster vorbeiging, hörte sie immer noch Idas Gospelsendung.
Sanft und liebevoll ruft Jesus,
Ruft nach dir und ruft nach mir,
Sieh nur, an der Himmelspforte
Wacht und wartet er auf uns…
Der Garten lag verlassen da. Die Tür des Werkzeugschuppens stand offen: leer. Eine faulige Schicht von grünem Schaum lag unberührt auf dem Goldfischteich. Charlotte blickte hoch, und ein Blitz zuckte wie ein zerfaserter Draht durch die schwarzen Wolken.
Mrs. Fountain sah ihn zuerst. Ihr Schrei ließ Charlotte wie angewurzelt stehen bleiben. Sie drehte sich um und rannte zurück, schnell, schnell, aber nicht schnell genug – trockener Donner grollte in der Ferne, der Gewitterhimmel tauchte alles in ein seltsames Licht, und der Boden neigte sich ihr entgegen, als sie mit den Absätzen in der schlammigen Erde versank, während immer noch irgendwo der Chor sang, und ein jäher, kräftiger Wind, kühl vom aufziehenden Regen, rauschte über ihr durch die Eichen, dass es klang wie das Schlagen riesiger Flügel, und der Rasen bäumte sich grün und gallig auf und umwogte sie wie das Meer, während sie blindlings und voller Entsetzen dorthin stürzte, wo, wie sie wusste – denn es war alles da, alles, in Mrs. Fountains Schrei –, das Allerschlimmste sie erwartete.
Wo war Ida gewesen, als sie angekommen war? Wo Edie? Sie erinnerte sich nur an Mrs. Fountain, die eine Hand mit einem zerknüllten Kleenex fest an den Mund presste und hinter der perlschimmernden Brille wild mit den Augen rollte, an Mrs. Fountain und den kläffenden Pudel und an das volle, unirdische Vibrato – von irgendwoher, von nirgendwoher und von überallher zugleich – in Edies Schreien.
Er hing mit dem Hals an einem Strick, der über einen niedrigen Ast des schwarzen Tupelobaums geschlungen war, der an der ausgewucherten Ligusterhecke zwischen Charlottes und Mrs. Fountains Haus stand, und er war tot. Die Spitzen seiner schlaffen Tennisschuhe baumelten zwei Handbreit über dem Gras. Die Katze, Weenie, lag bäuchlings ausgestreckt und o-beinig auf einem Ast und schlug mit einer Pfote geschickte Finten nach Robins kupferroten Haaren, die glänzend vom Wind zerzaust waren – das Einzige an ihm, das noch die richtige Farbe hatte.
Komm heim, sang der Radiochor melodiös:
Komm heim,
du, der du müde bist, komm heim…
Schwarzer Rauch quoll aus dem Küchenfenster. Die Hühnerkroketten auf dem Herd waren angebrannt. Einst ein Lieblingsgericht der Familie, konnte sie nach jenem Tag niemand mehr anrühren.
KAPITEL 1
Die tote Katze
Zwölf Jahre nach Robin Cleves Tod wusste man darüber, wie es gekommen war, dass er in seinem eigenen Garten an einem Baum erhängt gestorben war, noch genauso wenig wie an dem Tag, als es passiert war.
Die Leute in der Stadt sprachen immer noch über seinen Tod. Meistens sagten sie »der Unfall«, auch wenn die Fakten (wie man sie auf Bridgepartys, beim Frisör, im Anglergeschäft und beim Arzt im Wartezimmer sowie im Speiseraum des Country Club erörterte) eher etwas anderes vermuten ließen. Jedenfalls war es schwer vorstellbar, wie ein Neunjähriger es schaffen sollte, sich durch einen dummen Zufall oder ein Missgeschick aufzuhängen. Alle kannten die Details, und sie gaben Anlass zu mancherlei Spekulation und Debatte. Robin war mit einem Faserkabel von nicht alltäglicher Art erhängt worden, wie es manchmal von Elektrikern benutzt wurde, und niemand hatte eine Ahnung, woher es stammte oder wie es in Robins Hände gekommen sein sollte. Das dicke Material war widerspenstig, und die Kriminalpolizei aus Memphis hatte dem (inzwischen pensionierten) Town Sheriff gesagt, ihrer Meinung nach hätte ein kleiner Junge wie Robin die Knoten nicht selbst knüpfen können. Das Kabel war auf nachlässige, amateurhafte Weise am Baum befestigt, aber ob dies auf Unerfahrenheit oder auf Hast seitens des Mörders schließen ließ, wusste niemand. Und die Male am Leichnam (sagte Robins Kinderarzt, der mit dem staatlichen Leichenbeschauer gesprochen hatte, der wiederum den Obduktionsbericht der County-Behörden gelesen hatte) deuteten darauf hin, dass Robin nicht an einem Genickbruch gestorben, sondern stranguliert worden war. Manche glaubten, er sei dort stranguliert worden, wo er gehangen hatte; andere vermuteten, er sei auf dem Boden erwürgt und erst nachträglich an den Baum gehängt worden.
In den Augen der Stadt und der Familie Robins gab es kaum Zweifel daran, dass Robin irgendeinem Verbrechen zum Opfer gefallen war. Was für einem Verbrechen aber genau oder wer es begangen hatte, das wusste niemand zu sagen. Seit den zwanziger Jahren waren zweimal Frauen aus prominenten Familien von ihren eifersüchtigen Ehemännern ermordet worden, aber das waren alte Skandale, und die Beteiligten waren längst verstorben. Und ab und zu fand sich ein toter Schwarzer in Alexandria, aber diese Morde wurden (wie die meisten Weißen eilig betonten) im Allgemeinen von anderen Negern begangen, und es ging dabei in erster Linie um Negerangelegenheiten. Ein totes Kind war da etwas anderes – Furcht erregend für alle, ob Arm oder Reich, Schwarz oder Weiß –, und niemand konnte sich vorstellen, wer so etwas getan haben sollte oder warum er es getan hatte.
In der Nachbarschaft redete man von einem geheimnisvollen Schleicher, und Jahre nach Robins Tod behaupteten immer noch Leute, sie hätten ihn gesehen. Allen Berichten zufolge war er ein Riese, aber darüber hinaus gingen die Beschreibungen auseinander. Manchmal war er schwarz, manchmal weiß, und zuweilen wies er besonders anschauliche Merkmale auf: einen fehlenden Finger, einen Klumpfuß, eine rote Narbe quer über der Wange. Es hieß, er sei ein bösartiger Handlanger, der das Kind eines texanischen Senators erwürgt und an die Schweine verfüttert habe; ein ehemaliger Rodeoclown, der kleine Kinder mit ausgefallenen Lassotricks in den Tod locke; ein schwachsinniger Psychopath, entflohen aus der psychiatrischen Klinik in Whitfield und in elf Staaten polizeilich gesucht. Aber auch wenn die Eltern in Alexandria ihre Kinder vor ihm warnten und auch wenn man seine massige Gestalt regelmäßig zu Halloween in der Nähe der George Street umherhinken sah, blieb der Schleicher eine schemenhafte Gestalt. Nach dem Tod des kleinen Cleve hatte man jeden Tramp, jeden Landstreicher, jeden Spanner im Umkreis von hundert Meilen festgenommen und verhört, aber die Ermittlungen hatten nichts ergeben. So dachte niemand gern daran, dass ein Mörder frei herumlief, und die Angst blieb bestehen. Vor allem befürchtete man, dass er immer noch in der Nachbarschaft herumschlich: dass er in einem diskret geparkten Auto saß und spielende Kinder beobachtete.
Die Leute in der Stadt redeten über diese Dinge. Robins Familie verlor darüber nie auch nur ein Wort.
Robins Familie sprach über Robin. Sie erzählten sich Anekdoten aus seinen Babytagen, aus dem Kindergarten, aus der Baseballzeit in der Little League, all die niedlichen und lustigen und bedeutungslosen Anekdoten, an die man sich erinnerte, die er irgendwann gesagt oder getan hatte. Seine Tanten entsannen sich an Unmengen von Bagatellen: an Spielsachen, die er gehabt, an Kleider, die er getragen hatte, an Lehrer, die er geliebt oder gehasst hatte, an Spiele, die er gespielt, und an Träume, die er erzählt hatte, an Dinge, die er gemocht, sich gewünscht oder am meisten geliebt hatte. Manches davon traf zu, manches eher nicht, und vieles davon konnte niemand so genau wissen, aber wenn die Cleves sich einmal entschlossen hatten, in irgendeiner subjektiven Angelegenheit übereinzustimmen, wurde diese, automatisch und wohl unwiderruflich, zur Wahrheit, ohne dass jemandem die kollektive Alchimie bewusst war, die dies bewirkte.
Die mysteriösen, widersprüchlichen Umstände von Robins Tod gehorchten dieser Alchimie nicht. So stark die redigierenden Instinkte der Cleves auch waren, es gab doch keinen Plot, der sich den Fragmenten überstülpen ließe, keine Logik, aus der man etwas hätte ableiten können, keine Lektion, die im Rückblick zu lernen gewesen wäre, keine Moral. Robin selbst oder das, was sie von ihm in Erinnerung hatten, war alles, was sie besaßen, und die erlesene Schilderung seines Charakters – im Laufe mehrerer Jahre auf das Sorgsamste ausgeschmückt – war ihr größtes Meisterwerk. Weil er ein so einnehmender kleiner Stromer gewesen war und weil gerade seine Schrullen und Eigenheiten der Grund dafür gewesen waren, dass sie ihn alle so sehr geliebt hatten, wurde die impulsive Aufgewecktheit des lebenden Robin in ihren Rekonstruktionen mitunter schmerzhaft klar sichtbar: Fast war es, als sause er auf seinem Fahrrad die Straße hinunter an ihnen vorbei, vorgebeugt, mit flatternden Haaren, hart und wild in die Pedale tretend, sodass das Fahrrad hin- und herwackelte – ein launisches, kapriziöses, lebhaftes Kind. Aber diese Klarheit war irreführend, sie verlieh einem größtenteils frei erfundenen Bild trügerische Glaubhaftigkeit, denn an anderen Stellen war die Geschichte offenkundig ausgehöhlt und leicht zu durchschauen, strahlend, aber seltsam konturlos, wie es das Leben von Heiligen manchmal ist.
»Wie gut hätte Robin das gefallen!«, sagten die Tanten immer liebevoll. »Wie hätte Robin gelacht!« In Wahrheit war Robin ein flatterhaftes und unbeständiges Kind gewesen, melancholisch in einzelnen Augenblicken, geradezu hysterisch in anderen, und im Leben hatte diese Unberechenbarkeit einen großen Teil seines Charmes ausgemacht. Aber seine jüngeren Schwestern, die ihn im eigentlichen Sinne nie gekannt hatten, wuchsen auf mit der völligen Gewissheit über die Lieblingsfarbe ihres toten Bruders (Rot), über sein Lieblingsbuch (»The Wind in the Willows«) und seine Lieblingsfigur darin (Mr. Toad). Sie kannten sein Lieblingseis (Schokolade) und seine Lieblings-Baseballmannschaft (die Cardinals) und tausend andere Dinge, die sie – als lebendige Kinder, die heute am liebsten Schokoladeneis essen und morgen Pfirsicheis bevorzugen – nicht einmal genau von sich selbst hätten sagen können. Infolgedessen war die Beziehung zu ihrem toten Bruder von höchst intimer Natur; sein starkes, leuchtendes, unveränderliches Ich strahlte beständig, verglichen mit dem Wankelmut ihres eigenen Charakters und den Launen der Menschen, die sie kannten. Sie wuchsen also auf in dem Glauben, dies sei auf irgendeinen seltenen, engelsgleichen Glanz der Schöpfung in Robins Wesen zurückzuführen und keineswegs auf die Tatsache, dass er tot war.
Robins kleinere Schwestern hatten keine Ähnlichkeit mit ihrem Bruder, als sie älter wurden, und auch untereinander unterschieden sie sich sehr.
Allison war jetzt sechzehn. Aus dem mausartigen kleinen Mädchen, das leicht blaue Flecken und Sonnenbrand bekam und über fast alles in Tränen ausbrach, war ganz unerwartet die Hübsche geworden: lange Beine, rehbraunes Haar und große, samtige, rehbraune Augen. Ihr ganzer Charme lag in ihrer Unbestimmtheit. Sie sprach leise und bewegte sich schleppend, und ihre Züge waren verschwommen und verträumt, und für ihre Großmutter Edie, die funkelnde Farbigkeit schätzte, war sie eine ziemliche Enttäuschung. Allisons Blüte war zart und kunstlos wie die Blüte des Grases im Juni und bestand ganz und gar aus einer jugendlichen Frische, die (was niemand besser wusste als Edie) als Erstes vergehen würde. Sie war eine Tagträumerin, sie seufzte oft, ihr Gang war ungelenk, schlurfend und mit einwärts gewandten Zehen, und ihre Art zu sprechen war nicht besser. Immerhin, sie war hübsch auf ihre scheue, milchweiße Art, und die Jungen in ihrer Klasse hatten angefangen, sie anzurufen. Edie hatte sie beobachtet, wie sie (den Blick gesenkt, das Gesicht glühend rot) den Hörer zwischen Schulter und Ohr klemmte, mit der Spitze ihres Oxfordschuhs vor und zurück über den Teppich scharrte und vor Verlegenheit stammelte.
Wie schade, klagte Edie laut, dass ein so reizendes Mädchen (reizend, wie Edie es aussprach, trug unüberhörbar die Last von schwach und anämisch in sich) eine so schlechte Haltung hatte. Allison solle darauf achten, dass ihr die Haare nicht dauernd in die Augen fielen. Allison solle die Schultern zurücknehmen und aufrecht und selbstbewusst dastehen, statt in sich zusammenzusacken. Allison solle lächeln, den Mund aufmachen, Interessen entwickeln, die Leute über ihr Leben befragen, wenn ihr sonst nichts Interessantes zu sagen einfalle. Solche Ratschläge, wenngleich gut gemeint, wurden häufig in der Öffentlichkeit und mit solcher Ungeduld erteilt, dass Allison weinend aus dem Zimmer stolperte.
»Na, mir ist es egal«, sagte Edie dann laut in die Stille, die solchen Auftritten folgte. »Jemand muss ihr ja beibringen, wie man sich benimmt. Wenn ich ihr nicht so im Nacken säße, wäre das Kind nicht in der zehnten Klasse, das kann ich euch sagen.«
Das stimmte. Allison war zwar nie sitzen geblieben, aber sie war doch mehrmals gefährlich nah davor gewesen, besonders in der Grundschule. Träumt viel, stand unter »Betragen« in Allisons Zeugnissen. Unordentlich. Langsam. Setzt sich nicht ein. »Tja, ich schätze, da müssen wir uns einfach ein bisschen mehr anstrengen«, sagte Charlotte vage, wenn Allison wieder mit schlechten Noten nach Hause kam.
Allison und ihrer Mutter schienen die schlechten Zeugnisse nichts auszumachen, Edie dafür aber umso mehr, und zwar in einem alarmierenden Ausmaß. Sie marschierte in die Schule und verlangte Besprechungen mit den Lehrern; sie quälte Allison mit Lektürelisten, Übungskarten und Bruchrechnen, und sie korrigierte Allisons Aufsätze und Physikprojekte mit rotem Stift – noch jetzt, wo sie zur Highschool ging.
Es hatte keinen Sinn, Edie daran zu erinnern, dass Robin selbst auch nicht immer ein guter Schüler gewesen war. »Zu ausgelassen«, antwortete sie dann schnippisch. »Er hätte sich schon noch früh genug beruhigt und zu arbeiten angefangen.« Bis hierher und nicht weiter ließ sie es zu, das eigentliche Problem zur Kenntnis zu nehmen, denn alle Cleves waren sich darüber im Klaren, dass Edie einer, wie ihr Bruder, lebhaften Allison alle schlechten Zeugnisse der Welt nachgesehen hätte.
Während Edie durch Robins Tod und die Jahre danach ein wenig sauertöpfisch geworden war, war Charlotte in eine Gleichgültigkeit abgedriftet, die jeden Bereich des Lebens stumpf und farblos werden ließ, und wenn sie versuchte, für Allison Partei zu ergreifen, tat sie es auf eine hilflose, halbherzige Weise. In dieser Hinsicht ähnelte sie allmählich ihrem Ehemann Dixon, der seine Familie zwar finanziell anständig versorgte, seinen Töchtern aber nie viel Ermutigung oder Interesse entgegengebracht hatte. Seine Achtlosigkeit richtete sich nicht persönlich gegen diesen oder jenen; er hatte einfach zu vielen Dingen eine Meinung, und seine geringe Meinung von Töchtern brachte er ohne Scheu und in beiläufigem, humorvollem Plauderton zum Ausdruck. (Keine seiner Töchter, wiederholte er gern, werde einen Cent von ihm erben.)
Dix hatte nie viel Zeit zu Hause verbracht, und jetzt war er kaum noch da. Er entstammte, Edies Ansicht nach, einer Familie von gesellschaftlichen Emporkömmlingen (sein Vater hatte ein Geschäft für Installationsbedarf gehabt), und als er, von ihrer Familie, ihrem Namen angelockt, Charlotte geheiratet hatte, war es in dem Glauben geschehen, sie habe Geld. Die Ehe war nie glücklich gewesen (lange Abende in der Bank, lange Nächte beim Poker, Jagen und Angeln und Football und Golf – jeder Vorwand war ihm recht, um für ein Wochenende zu verschwinden), aber nach Robins Tod wurde sein Frohsinn noch stärker beeinträchtigt. Er wollte das Trauern hinter sich bringen; er ertrug die stillen Zimmer nicht, die Atmosphäre von Vernachlässigung, Mattigkeit, Trübsal, und er drehte den Fernseher so laut, wie es ging, und er marschierte in einem Zustand andauernder Frustration im Haus umher, klatschte in die Hände, zog Jalousien hoch und sagte Dinge wie: »Reißt euch zusammen!« und »Jetzt mal wieder auf die Beine kommen hier!« und »Wir sind doch ein Team!« Dass niemand seine Bemühungen zu schätzen wusste, erstaunte ihn. Und als es ihm mit all seinen Äußerungen nicht gelang, die Tragödie aus seinem Zuhause zu vertreiben, verlor er schließlich jedes Interesse daran. Rastlos und immer öfter blieb er wochenlang weg und hielt sich in seinem Jagdcamp auf, bis er schließlich spontan einen hoch dotierten Bankjob in einer anderen Stadt annahm. Er stellte es als großes und selbstloses Opfer dar, aber wer Dix kannte, wusste, dass er nicht zum Wohle seiner Familie nach Tennessee zog. Dix wollte ein schillerndes Leben, mit Cadillacs und Pokerpartys und Footballspielen, mit Nightclubs in New Orleans und Urlaub in Florida, er wollte Cocktails und Gelächter, eine Frau, die sich unentwegt die Haare machen ließ und das Haus makellos sauber hielt und die bereit war, jederzeit im Handumdrehen das Tablett mit den Hors d’œuvres hervorzuzaubern.
Aber Dix’ Familie war weder schwungvoll noch schillernd. Seine Frau und seine Töchter waren eigenbrötlerisch, exzentrisch, melancholisch. Schlimmer noch: Wegen des Vorfalls betrachteten die Leute sie alle, sogar Dix selbst, als irgendwie befleckt. Freunde gingen ihnen aus dem Weg, Ehepaare luden sie nicht mehr ein, Bekannte riefen nicht mehr an. Daran war nichts zu ändern. Die Menschen ließen sich nicht gern an Tod oder Unheil erinnern. Und aus all diesen Gründen fühlte Dix sich genötigt, seine Familie gegen ein holzgetäfeltes Büro und ein flottes Gesellschaftsleben in Nashville einzutauschen, ohne sich im Geringsten schuldig zu fühlen.
Sosehr Edie sich über Allison ärgerte, so sehr beteten die Tanten sie an, und für sie waren viele der Eigenschaften, die Edie so frustrierend fand, heiter, ja sogar poetisch. Ihrer Meinung nach war Allison nicht nur die Hübsche, sondern auch die Sanfte: geduldig, niemals klagend, behutsam im Umgang mit Tieren und alten Leuten und Kindern – lauter Tugenden, soweit es die Tanten betraf, die alles an guten Zensuren oder klugen Reden weit in den Schatten stellten.
Die Tanten verteidigten sie loyal. Nach allem, was das Kind hat durchmachen müssen, sagte Tat einmal wütend zu Edie. Das genügte, um Edie zum Schweigen zu bringen, wenigstens für eine Weile. Denn niemand konnte vergessen, dass Allison und das Baby an jenem schrecklichen Tag als Einzige draußen gewesen waren, und auch wenn Allison erst vier gewesen war, gab es kaum einen Zweifel daran, dass sie etwas gesehen hatte, höchstwahrscheinlich etwas so Furchtbares, dass es sie aus dem Gleichgewicht gebracht hatte.
Unmittelbar danach war sie von der Familie und von der Polizei rigoros befragt worden. War jemand im Garten gewesen, ein Erwachsener, ein Mann vielleicht? Allison hatte unerklärlicherweise angefangen, ins Bett zu machen und nachts schreiend aus wütenden Albträumen hochzuschrecken, aber sie hatte sich geweigert, ja oder nein zu sagen. Sie lutschte am Daumen, drückte ihren Stoffhund fest an sich und wollte nicht einmal sagen, wie sie hieß oder wie alt sie war. Niemand, nicht einmal Libby, die sanfteste und geduldigste ihrer alten Tanten, konnte ihr ein Wort entlocken.
Allison erinnerte sich nicht an ihren Bruder, und sie hatte sich auch nie an irgendetwas im Zusammenhang mit seinem Tod entsinnen können. Als sie klein war, hatte sie manchmal nachts wach gelegen, wenn alle andern im Haus schon schliefen, und dann hatte sie auf den Schattendschungel an der Schlafzimmerdecke gestarrt und so weit zurückgedacht, wie sie konnte, aber alles Suchen war nutzlos, denn es gab nichts zu finden. Der freundliche Alltag ihres frühen Lebens war immer da – Veranda, Fischteich, Miezekatze, Blumenbeete, nahtlos, strahlend, unveränderlich –, aber wenn sie ihre Erinnerung weit genug zurückwandern ließ, erreichte sie unweigerlich einen seltsamen Punkt, wo der Garten leer war, das Haus hallend und verlassen, allenthalben Anzeichen dafür, dass noch kürzlich jemand da gewesen war (Wäsche hing an der Leine, das Geschirr vom Lunch war noch nicht abgeräumt), aber ihre ganze Familie war fort, verschwunden, und Robins orangegelbe Katze – damals noch ein Kätzchen, nicht der träge, feistbackige Kater, der aus ihm werden sollte – war plötzlich sonderbar geworden, jagte wild und mit leeren Augen quer über den Rasen und schoss auf einen Baum, voller Angst vor ihr, als wäre sie eine Fremde. Sie war nicht ganz sie selbst in diesen Erinnerungen, nicht, wenn sie so weit zurückreichten. Zwar erkannte sie die physikalische Umgebung, in der sie angesiedelt waren, genau – George Street Nummer 363, das Haus, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht hatte –, aber sie, Allison, war nicht erkennbar, nicht einmal für sich selbst: Sie war kein Kleinkind, auch kein Baby, sondern nur ein Blick, ein Paar Augen, die auf einer vertrauten Umgebung verweilten und sie betrachteten, ohne Persönlichkeit, ohne Körper, Alter oder Vergangenheit – als erinnere sie sich an Dinge, die sich zugetragen hatten, bevor sie geboren war.
Über all das dachte Allison nicht bewusst nach, sondern auf äußerst vage und unfertige Weise. Als sie klein war, kam sie nicht auf den Gedanken, die Bedeutung dieser körperlosen Eindrücke zu hinterfragen, und jetzt, da sie älter war, fiel es ihr erst recht nicht ein. Sie dachte kaum über die Vergangenheit nach, und darin unterschied sie sich wesentlich von ihrer Familie, die über wenig anderes nachdachte.
Niemand in ihrer Familie konnte das verstehen. Sie hätten es nicht einmal verstanden, wenn sie den Versuch unternommen hätte, es ihnen zu erklären. Für beständig von Erinnerungen belagerte Gemüter wie die ihren, für die Gegenwart und Zukunft allein als Systeme der Wiederkehr existierten, war eine solche Weitsicht unvorstellbar. Die Erinnerung – fragil, dunstig-hell, wundersam – war für sie der Funke des Lebens selbst, und fast jeder ihrer Sätze begann mit irgendeinem Appell an sie: »Du erinnerst dich doch an den Batist mit dem grünen Zweigmuster, oder?«, fragten ihre Mutter und ihre Tanten dann beharrlich. »An die rosarote Floribunda? An diese Zitronenteekuchen? Erinnerst du dich an dieses wunderbar kalte Osterfest, als Harriet noch ein ganz kleines Ding war – als ihr im Schnee Eier gesucht und in Adelaides Vorgarten einen großen Schnee-Osterhasen gebaut habt?«
»Ja, ja«, log Allison dann. »Ich erinnere mich.« Und in gewisser Weise tat sie es auch. Sie hatte die Geschichten so oft gehört, dass sie sie auswendig kannte und, wenn sie wollte, erzählen, ja, sogar ein oder zwei beim Überliefern vernachlässigte Details einfügen konnte: wie sie und Harriet (zum Beispiel) aus den rosa Blüten, die vom erfrorenen Holzapfelbaum heruntergefallen waren, die Nase und die Ohren für den Schnee-Osterhasen gemacht hatten. Diese Geschichten waren ihr ebenso vertraut wie die Geschichten aus der Kindheit ihrer Mutter oder die Geschichten aus Büchern. Aber keine davon schien auf wirklich fundamentale Weise mit ihr verbunden zu sein.
Die Wahrheit war – und das war etwas, das sie niemals irgendjemandem gegenüber eingestand –, dass es furchtbar viele Dinge gab, an die Allison sich nicht erinnern konnte. Sie hatte keine klare Erinnerung daran, im Kindergarten gewesen zu sein oder im ersten Schuljahr, oder an sonst irgendetwas, wovon sie eindeutig hätte sagen können, es habe sich ereignet, bevor sie acht gewesen war. Es war ein äußerst beschämender Umstand, einer, den sie (großenteils erfolgreich) zu verschleiern bemüht war. Ihre kleine Schwester Harriet behauptete, sich an Dinge aus ihrem ersten Lebensjahr zu entsinnen.
Obwohl sie nicht einmal sechs Monate alt gewesen war, als Robin starb, sagte Harriet, sie könne sich an ihn erinnern, und Allison und die übrigen Cleves glaubten, dass dies wahrscheinlich der Wahrheit entsprach. Ab und zu rückte Harriet mit irgendeiner obskuren, aber erschreckend akkuraten Kleinigkeit heraus – mit einem Detail zu Wetter oder Kleidung oder zu dem Essen auf einer Geburtstagsparty, bei der sie nicht einmal zwei Jahre alt gewesen war –, und alle hörten mit offenem Mund zu.
Aber Allison konnte sich überhaupt nicht an Robin erinnern. Das war unverzeihlich. Sie war fast fünf Jahre alt gewesen. Und sie konnte sich auch nicht an die Zeit nach seinem Tod erinnern. Sie wusste detailliert über die ganze Affäre Bescheid: über die Tränen, den Stoffhund, ihr Schweigen. Sie wusste, wie der Kriminalpolizist aus Memphis – ein großer, kamelgesichtiger Mann mit vorzeitig weiß gewordenem Haar, der Snowy Olivet geheißen hatte – ihr Bilder von seiner eigenen Tochter namens Celia gezeigt und ihr Mandel-Schokoriegel aus einer Großhandelspackung in seinem Wagen geschenkt hatte und wie er ihr auch andere Bilder gezeigt hatte, Bilder von farbigen und von weißen Männern mit Bürstenhaarschnitten und schweren Augenlidern. Wie sie, Allison, auf Tattycorums blausamtenem Plaudersofa gesessen hatte – sie hatte damals bei Tante Tat gewohnt, sie und das Baby, denn ihre Mutter lag noch im Bett – und wie sie mit tränenüberströmtem Gesicht die Schokolade von den Mandelriegeln abgebröckelt hatte und kein Wort hatte sagen wollen. Sie wusste das alles, nicht, weil sie sich daran erinnerte, sondern weil Tante Tat es ihr erzählt hatte, und zwar viele Male, in ihrem Sessel, den sie dicht vor die Gasheizung gestellt hatte, wenn Allison sie an den Winternachmittagen nach der Schule besuchen kam; ihre schwachen, alten, sherrybraunen Augen waren auf einen Punkt auf der anderen Seite des Zimmers gerichtet, und ihre Stimme klang liebevoll, geschwätzig, in Erinnerungen schwelgend, als erzähle sie eine Geschichte über jemanden, der nicht anwesend war.
Die scharfäugige Edie war weder so liebevoll noch so tolerant. Die Geschichten, die sie Allison vorzugsweise erzählte, hatten oft einen eigentümlich allegorischen Unterton.
»Die Schwester meiner Mutter«, pflegte sie anzufangen, wenn sie Allison vom Klavierunterricht nach Hause fuhr, ohne je den Blick von der Straße zu wenden, und dabei hielt sie die kraftvolle, elegante Habichtsnase hoch in die Luft, »die Schwester meiner Mutter kannte einen kleinen Jungen namens Randall Schofield, dessen Familie bei einem Tornado zu Tode kam. Er kam von der Schule nach Hause, und was glaubst du, was er sah? Sein Haus war vom Wind in Trümmer gelegt worden, und die Neger, die auf dem Anwesen arbeiteten, hatten die Leichen seines Vaters und seiner Mutter und seiner drei kleinen Brüder aus der Ruine gezogen, und da lagen sie alle, so blutig, wie man es sich nur denken kann, und nicht einmal mit Laken zugedeckt, Seite an Seite ausgestreckt nebeneinander wie ein Xylophon. Einem der Brüder fehlte ein Arm, und in der Schläfe der Mutter steckte ein eiserner Türstopper. Na, und weißt du, was mit dem kleinen Jungen passiert ist? Er ist stumm geworden. Und er hat die nächsten sieben Jahre kein Wort gesprochen. Mein Vater sagte, er trug immer einen Stapel Hemdenpappen und einen Fettstift bei sich, und er musste jedes Wort, das er zu irgendjemandem sagen wollte, aufschreiben. Der Mann, der in der Stadt die Reinigung führte, schenkte ihm diese Hemdenpappen.«
Edie erzählte die Geschichte gern. Es gab Variationen davon, wie zum Beispiel Kinder, die vorübergehend blind geworden waren oder sich die Zunge abgebissen oder den Verstand verloren hatten, nachdem sie diesem oder jenem schrecklichen Anblick ausgesetzt gewesen waren. Aber sie hatten alle einen leicht vorwurfsvollen Unterton, ohne dass Allison je genau hätte sagen können, worin er bestand.
Allison verbrachte die meiste Zeit allein. Sie hörte Schallplatten. Sie machte Collagen aus Bildern, die sie aus Illustrierten ausgeschnitten hatte, und krumme Kerzen aus geschmolzenen Malstiften. Sie zeichnete Ballerinen und Pferde und Mäusebabys auf die Ränder in ihrem Geometrieheft. Beim Mittagessen saß sie an einem Tisch mit einer Gruppe von ziemlich beliebten Mädchen, aber außerhalb der Schule traf sie sich selten mit ihnen. Oberflächlich betrachtet, war sie eine von ihnen: Sie war gut gekleidet und hatte eine klare Haut, und sie wohnte in einem großen Haus in einer hübschen Straße, und wenn sie auch nicht munter oder lebhaft war, so hatte sie doch nichts an sich, was Abneigung hätte erregen können.
»Du könntest so beliebt sein, wenn du wolltest«, sagte Edie, die jeden Trick kannte, wenn es um die gesellschaftliche Positionierung ging, selbst auf dem Niveau des zehnten Schuljahrs. »Das beliebteste Mädchen in deiner Klasse, wenn du nur Lust hättest, dich darum zu bemühen.«
Allison wollte sich nicht darum bemühen. Sie wollte nicht, dass die anderen Kinder gemein zu ihr waren oder sich über sie lustig machten, aber solange niemand sie behelligte, war sie glücklich. Und von Edie abgesehen behelligte sie auch niemand weiter. Sie schlief viel. Sie ging allein in die Schule. Sie spielte mit den Hunden, denen sie unterwegs begegnete. Nachts träumte sie von einem gelben Himmel und einem weißen Ding davor, das aussah wie ein aufgeblähtes Laken, und diese Träume beunruhigten sie sehr, aber sie vergaß sie, wenn sie aufwachte.
Allison verbrachte viel Zeit bei ihren Großtanten, an den Wochenenden und nach der Schule. Sie half ihnen beim Einfädeln und las ihnen vor, wenn ihre Augen müde waren, sie kletterte auf Trittleitern, um Dinge von hohen, staubigen Regalborden zu holen, und hörte ihnen zu, wenn sie von verstorbenen Schulfreundinnen und sechzig Jahre zurückliegenden Klavierkonzerten erzählten. Manchmal machte sie nach der Schule Süßigkeiten für sie, Toffee, Zuckerschaumbällchen, die sie für ihren Kirchenbasar mitnehmen konnten. Dabei benutzte sie eine kalte Marmorplatte und ein Zuckerthermometer, akribisch wie ein Chemiker, folgte dem Rezept Schritt für Schritt und strich die Zutaten im Messbecher mit einem Buttermesser glatt. Die Tanten – selbst wie kleine Mädchen, Rouge auf den Wangen, Locken in den Haaren, fröhlich und aufgekratzt – trippelten hin und her und ein und aus, entzückt über das Treiben in ihrer Küche, und redeten einander mit den Spitznamen ihrer Kindheit an.
So eine gute kleine Köchin, sangen die Tanten alle miteinander. Wie hübsch du bist. Ein Engel bist du, dass du uns besuchen kommst. Was für ein braves Mädchen. Wie hübsch. Wie süß.
Harriet, das Baby, war weder hübsch noch süß. Harriet war schlau.
Seit sie sprechen konnte, sorgte Harriet für eine Art quälender Unruhe im Hause Cleve. Wild auf dem Spielplatz, grob zu Gästen, stritt sie sich mit Edie, lieh sich in der Bibliothek Bücher über Dschingis Khan und bereitete ihrer Mutter Kopfschmerzen. Sie war zwölf Jahre alt und in der siebten Klasse. Obwohl sie eine ausgezeichnete Schülerin war, wurden die Lehrer nicht mit ihr fertig. Manchmal riefen sie ihre Mutter an oder Edie, denn jeder, der die Cleves kannte, war sich darüber im Klaren, dass sie diejenige war, mit der man tunlichst redete; sie war sowohl Feldmarschall als auch Oligarchin, sie hatte die größte Macht in der Familie, und sie würde am ehesten etwas unternehmen. Aber selbst Edie wusste nicht genau, wie sie mit Harriet umgehen sollte. Harriet war nicht wirklich ungehorsam oder widerspenstig, aber sie war hochfahrend, und irgendwie gelang es ihr, beinahe jeden Erwachsenen, mit dem sie in Kontakt kam, zu verärgern.
Harriet besaß nichts von der verträumten Fragilität ihrer Schwester. Sie war von stämmiger Gestalt wie ein kleiner Dachs, mit runden Wangen, einer spitzen Nase, schwarzen, kurz geschnittenen Haaren und einem schmalen, entschlossenen kleinen Mund. Ihr Ton war forsch, ihre Stimme hoch und dünn und ihre Sprechweise für ein Kind aus Mississippi seltsam knapp, sodass Fremde oft fragten, woher um alles in der Welt sie diesen Yankee-Akzent habe. Der Blick ihrer hellen Augen war durchdringend und dem Edies nicht unähnlich. Die Ähnlichkeit zwischen ihr und ihrer Großmutter war ausgeprägt und blieb nicht unbemerkt; aber die lebhafte, wildäugige Schönheit der Großmutter war bei ihrem Enkelkind nur noch wild und ein bisschen beunruhigend. Chester, der Gärtner, verglich die beiden insgeheim gern mit einem Falken und einem kleinen Hühnerhabicht.
Für Chester und für Ida Rhew war Harriet ein Quell von Verdruss und Heiterkeit zugleich. Seit sie sprechen konnte, zottelte sie ihnen bei ihrer Arbeit hinterher und fragte sie unaufhörlich aus. Wie viel Geld verdiente Ida? Konnte Chester das Vaterunser? Würde er es für sie aufsagen? Es erheiterte die beiden, wenn sie unter den für gewöhnlich friedfertigen Cleves Zwietracht säte. Mehr als einmal hatte sie für Zwistigkeiten gesorgt, die beinahe ernste Ausmaße angenommen hätten: indem sie Adelaide erzählte, dass weder Edie noch Tat die Kissenbezüge, die sie für sie bestickt hatte, je behalten, sondern sie eingepackt und anderen Leuten geschenkt hätten, oder indem sie Libby davon in Kenntnis setzte, dass ihre Dillgurken keineswegs die kulinarischen Hochgenüsse seien, für die sie sie hielt, sondern ungenießbar, und dass die große Nachfrage bei Nachbarn und Verwandten nur auf ihre seltsame Wirksamkeit als Herbizid zurückzuführen sei. »Kennst du die kahle Stelle im Garten?«, fragte Harriet. »Hinten vor der Veranda? Vor sechs Jahren hat Tatty ein paar von deinen Gurken dort hingekippt, und seitdem ist da nichts mehr gewachsen.« Harriet war entschieden dafür, die Dillgurken in Gläsern zu konservieren und als Unkrautvernichter zu verkaufen. Libby würde Millionärin werden.
Tante Libby hörte erst nach drei oder vier Tagen auf zu weinen. Bei Adelaide und den Kissenbezügen war es noch schlimmer. Anders als Libby machte es Adelaide Spaß zu grollen; zwei Wochen lang sprach sie nicht mit Edie und Tat, und eiskalt ignorierte sie die versöhnlichen Torten und Pasteten, die man auf ihre Veranda brachte – sie ließ sie stehen, damit die Hunde aus der Nachbarschaft sie fraßen. Libby war entsetzt über diesen Zwist (sie traf daran keine Schuld, denn als einzige der Schwestern war sie loyal genug, Adelaides Kissenbezüge zu behalten, so hässlich sie auch waren), und sie eilte hin und her und bemühte sich, Frieden zu stiften. Fast hätte sie Erfolg gehabt, als es Harriet erneut gelang, Adelaide aufzubringen, indem sie ihr erzählte, dass Edie die Geschenke, die sie von Adelaide bekam, niemals auch nur auspackte, sondern nur das alte Namensschildchen abmachte und ein neues anbrachte, bevor sie sie weiterschickte: an Wohltätigkeitsorganisationen meistens, auch an solche für Neger. Diese Angelegenheit war so verheerend, dass noch jetzt, Jahre später, jede Erwähnung zu Gehässigkeiten und unterschwelligen Vorwürfen führte, und Adelaide legte jetzt besonderen Wert darauf, ihren Schwestern zum Geburtstag und zu Weihnachten etwas demonstrativ Verschwenderisches zu kaufen – eine Flasche Shalimar zum Beispiel oder ein Nachthemd von Goldsmith’s in Memphis –, wobei sie dann nicht selten vergaß, das Preisschild zu entfernen. »Ich persönlich bevorzuge selbst gemachte Geschenke«, hörte man sie dann laut in Gegenwart der Damen in ihrem Bridgeclub oder vor Chester im Garten deklamieren, über die Köpfe ihrer gedemütigten Schwestern hinweg, die gerade dabei waren, die unerbetenen Extravaganzen auszupacken. »Sie sind wertvoller. Sie zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat. Aber für manche Leute zählt nur, wie viel Geld man ausgegeben hat. Sie finden, ein Geschenk ist nichts wert, wenn es nicht aus dem Geschäft kommt.«
»Mir gefallen die Sachen, die du machst, Adelaide«, sagte Harriet dann immer. Und das stimmte auch. Sie hatte zwar keine Verwendung für Schürzen, Kissenbezüge und Küchentücher, aber sie hortete Adelaides grelle Textilien schubladenweise in ihrem Zimmer. Nicht die Wäschestücke gefielen ihr, sondern die Muster darauf: holländische Mädchen, tanzende Teekessel, schlummernde Mexikaner mit Sombrerohüten. Ihr Begehren ging so weit, dass sie sie aus den Schränken anderer Leute stibitzte, und sie war äußerst erbost darüber gewesen, dass Edie die Kissenbezüge an einen wohltätigen Verein schickte (»Sei nicht albern, Harriet. Was um alles in der Welt willst