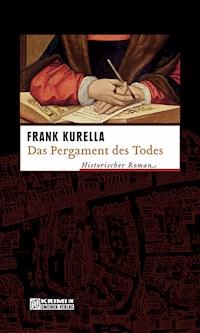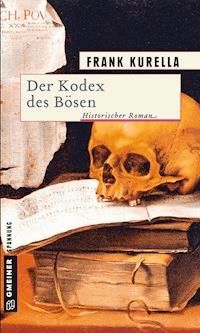
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Neuss 1288. Der zum jungen Mann gereifte Marcus gerät in den Verdacht, die Reliquie des heiligen Quirinus gestohlen zu haben. Mit letzter Kraft raunt ihm der sterbende Priester, der die tatsächlichen Räuber überrascht hat, einige rätselhafte Worte zu. Für Marcus beginnt eine abenteuerliche Flucht, die ihn schließlich mitten in die Schlacht von Worringen und auf die Spur eines unglaublichen Geheimnisses führt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Kurella
Der Kodex des Bösen
Historischer Roman
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Katja Ernst
Herstellung: Susanne Tachlinski
Korrektorat: Claudia Senghaas, Susanne Tachlinski
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes »Vanitas-Stillleben« von Sebastian Stoskopff,
Dieses Buch ist ein Roman, und die darin geschilderten Ereignisse sind größtenteils frei erfunden. In besonderem Maße gilt das für Handlungen und Äußerungen der auftretenden oder erwähnten Personen, auch wenn einige von ihnen nicht der Fantasie des Autors entsprungen sind. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
Prolog
Schloss Burg – im Jahre 1188
»Sagen wir 100 Kölnische Mark, verehrter Arnold.«
»Nur 100? Allein die Ländereien in Himmelgeist und Hongen sind diese Summe wert. Gut, meine Liegenschaften in diesem kleinen Dorf an der Dusel gebe ich Euch notfalls dazu, aber Monheim und Holthausen?« Arnold von Tyvern war den Tränen der Verzweiflung nahe. Graf Engelbert kannte seine finanzielle Misere und schien entschlossen, diese auszunutzen. Auf diese Weise hatte der Graf von Berg in den letzten Jahren sein Territorium Stück für Stück, Parzelle um Parzelle ausgeweitet. Die Grafschaft hatte sich rasch vergrößert, und es war ihm gelungen, unterhalb Kölns bereits bis an den Rhein vorzudringen. Jedoch bisher nur unterhalb Kölns.
Jegliche kriegerische Auseinandersetzungen waren dem Grafen verhasst. Vor allem wegen der damit verbundenen Kosten. Sein Geld für Zukäufe weiterer Ländereien zu verwenden, erschien ihm hingegen wesentlich sinnvoller, und so kam ihm die missliche Lage seines Verwandten sehr gelegen. Arnold von Tyvern war einst ein wohlhabender Mann gewesen. Doch eines Tages hatte er sich im Verborgenen der Alchemie und den magischen Kräften verschrieben. Seitdem war er an den einen oder anderen dubiosen Scharlatan geraten, der ihm sein Geld nur so aus den Taschen gezogen hatte. Anfangs war er mehr zufällig in einem Wirtshaus an einen Kerl geraten, der ihm redegewandt weisgemacht hatte, er könne aus einfachem Sand reines Gold gewinnen. Von Tyvern hatte ihm mit kindlicher Naivität geglaubt, dass er die Frucht seiner Gabe aus rein moralischen Gründen mit ihm teilen würde. Schließlich habe er ja das Talent aus göttlicher Hand empfangen und müsse dieses folglich auch im Sinne göttlicher Nächstenliebe verwenden, hatte der Kerl gesagt. Nachdem er aber eine beträchtliche Summe zur Beschaffung der erforderlichen Zutaten erhalten hatte, war er urplötzlich verschwunden. Auch die folgenden Alchemisten hatten alles andere als die erwünschte Vermehrung seines Vermögens gebracht, und so konzentrierte von Tyvern sein Bestreben schließlich auf das Erlangen ewigen Lebens. Das Einzige, das ihm aus diesen Jahren geblieben war, war eine stattliche Sammlung von Schriftrollen und Manuskripten mit zweifelhaften Zaubersprüchen und wertlosen Prophezeiungen. Seine Taschen und Münztruhen waren hingegen leer.
Aber vielleicht hatte er ja schon durch eine der mysteriösen Zeremonien ewiges Leben erlangt, ohne es zu spüren? Woran sollte er erkennen, ob er nicht ohne die teure Magie schon lange tot wäre? Schließlich lebte er ja noch. So tröstete er sich mit kindlicher Naivität über seine chronische Armut hinweg und sprach sich selbst Mut zu. Erst Jahre später wurde ihm schmerzlich bewusst, dass sich seine Hoffnung auf ewiges Leben nicht erfüllen würde.
»Verehrter Engelbert, so habt ein Einsehen. Wovon soll ich denn leben? Ich habe nicht einmal genug Heller für eine tägliche Ration Brot!«
»Daran soll unser Handel nicht scheitern«, erwiderte der Graf von Berg mit ruhiger Stimme. »Du erhältst neben der großzügigen Summe, die ich bereits nannte, das lebenslange Recht, hier auf Schloss Burg zu leben und zu speisen. – Jedoch mit der Dienerschaft, versteht sich.« Der Graf beobachtete aufmerksam die Miene seines Gegenübers. Würde dieser armselige Kerl nach dem letzten Strohhalm greifen, an dem er sich aus dem finanziellen Sumpf ziehen konnte?
»Nun, ja …«, stammelte dieser und schaute demütig zu Boden.
»Dann ist es also abgemacht?«, fragte der Graf mit fester Stimme.
Von Tyvern überlegte kurz, dann nickte er widerwillig. Verzweiflung und Wut waren auf seinem Gesicht zu erkennen.
»Mein Schreiber wird noch heute den Vertrag aufsetzen. Wendet Euch derweil an den Burgvogt. Er ist bereits über alles informiert und wird Euch in Eure neue Kammer geleiten.« Mit einer gönnerhaften Handbewegung schickte Graf Engelbert den Bezwungenen fort.
Zufrieden setze er sich in den hohen Lehnsessel neben dem Kamin und nahm einen großen Schluck Wein. Zurzeit waren die soeben erworbenen Ländereien und Siedlungsteile zwar noch nicht von bedeutendem Wert, doch mit Wehrtürmen oder gar Befestigungen versehen, würden sie eines Tages ein Bollwerk gegen Übergriffe aus dem Westen bilden. Ein Bollwerk gegen die kurkölnischen Truppen des Erzbischofs oder jeden anderen Angreifer, der aus dieser Richtung über den Rhein vorrücken würde. In seinem tiefsten Inneren spürte er, dass der heutige Handel von großem Nutzen für seine Grafschaft war.
Der erste Tag
Neuss, 100 Jahre später …
Die ersten spärlichen Sonnenstrahlen des Maimorgens tauchten den Turm der Münsterkirche St. Quirin in ein gelblich warmes Licht, als Marcus die Gebrante Gaß hinuntertrottete. Noch etwas verschlafen ging er wie jeden Morgen zum Hafen, um nach einer lohnenden Anstellung für den Tag Ausschau zu halten. Die Schiffer der Lastkähne konnten meist eine starke Hand gebrauchen. Sie brachten vor allem Wein von der Mosel, den oberen Rheingebieten und aus dem Elsass nach Neuss. Von hier aus wurden die Fässer auf dem Landwege nach Flandern gebracht oder gelangten über den Hellweg nach Norden. Auf diese Weise bildete der Weinhandel, neben den sich stetig drehenden Kornmühlen, eine der Säulen, auf der der Reichtum der Stadt beruhte. Doch wesentlichste Quelle blieben die unzähligen Pilger, die nach Neuss kamen und den heiligen Quirinus um seine Führsprache anflehten. Und so waren die sterblichen Überreste des Römers, nicht nur aus religiöser Sicht, ein Segen für die Stadt und ihre Bewohner.
Die schwere körperliche Arbeit im Hafen hatte den Jungen zu einem stattlichen Mann reifen lassen, seit er vor etwa vier Jahren beim Schankwirt Berthold Janssen ein Zuhause gefunden hatte. Gerade im letzten Jahr war er nochmals in die Länge geschossen, sodass er Annehild Janssen, die Wirtin des ›Schwarzen Krug‹, nun gar um einen ganzen Kopf überragte. Fast nichts mehr erinnerte an den knabenhaften Taschendieb, der er noch gewesen war, als die Wirtsleute ihn bei sich aufgenommen hatten. Nur sein langes, weißblondes Haar trug er noch wie an jenem Tag.
Im Gehen rieb sich Marcus den letzten Schlaf aus den Augen. Spät war es gestern Abend geworden. Annehild war schon zu Bett gegangen, und Marcus hatte Berthold noch in der Schenke geholfen, bis die letzten Gäste gegangen waren. Ein paar Männer des Schultheißen hatten in ihrem feuchtfröhlichen Gelage wieder mal kein Ende gefunden. Hubertus Hohenfels, ein ehrgeiziger junger Kerl, hatte wohl etwas zu feiern gehabt. Bestimmt hatte ihm sein Dienstherr, der Stellvertreter des erzbischöflichen Landesfürsten, erneut eine Anerkennung für seine Dienstbeflissenheit zukommen lassen, denn Hubertus gehörte nicht zu den gemütlichen Altgedienten, die hin und wieder ein Auge zudrückten, sondern zu jenen Männern, die für die Anerkennung ihres Vorgesetzten auch einen noch so armen Teufel wegen einer Nichtigkeit an den Pranger brachten. Trotz der Wut, die bei diesen Gedanken in Marcus aufstieg, musste er gähnen. Die langen Abende in der Schenke, an denen er dem Wirt half, und die frühmorgendliche körperliche Arbeit im Hafen zehrten an seinen Kräften. Niemals aber wollte er dieses Leben gegen sein früheres Dasein als armseliger Taschendieb in den Straßen von Neuss eintauschen.
Er war die Aber Strais hinuntergegangen und gerade an der Ecke zur nächsten Gasse angekommen, als ihn das aufgeregte Wiehern zweier Pferde aus seinen Gedanken riss. Es schien vom Münster her über den Freithoff zu schallen. Dann ertönten schwere Hufschläge, die sich rasch entfernten, bevor die frühmorgendliche Stille wieder einsetzte. Neugiergig bog Marcus in die Gasse ein und gelangte geradewegs auf den großen Vorplatz der Münsterkirche. Die plötzliche Stille kam ihm unheimlich vor.
Langsam ging er auf den imposanten Kirchenbau zu. Er war noch gut 30 Schritte entfernt, als plötzlich das Pilgerportal, das an der rechten Seite des Gotteshauses lag, von innen aufgestoßen wurde. Ein Priester stürzte ins Freie. Der Gottesdiener starrte mit weit aufgerissenen Augen in die Richtung des jungen Mannes und taumelte auf ihn zu. Marcus blieb wie angewurzelt stehen. Kurz bevor der Geistliche ihn erreichen konnte, riss dieser die Arme mit einer krampfartigen Bewegung in die Luft, fiel vornüber und blieb regungslos auf dem Pflaster liegen. Erst jetzt lösten sich Marcus’ schreckerstarrte Muskeln. Rasch lief er auf den am Boden Liegenden zu und kniete sich neben ihn. Vorsichtig drehte er den reglosen Körper auf seinen Schoß. Seine Hände und der linke Unterarm fühlten sich mit einmal nass an. Als er den Priester ansah, wusste er warum. Am Hals des Mannes klaffte eine handbreite, stark blutende Wunde. In rhythmischen Stößen strömte das Blut hervor und tränkte den Ausschnitt der Soutane. Auch wenn Marcus kein Medikus war, so erkannte er sofort, dass der bluttriefende Schnitt von einem schweren Dolch oder gar einem Schwert stammen musste. In diesem Augenblick erwachte der Priester aus seiner Ohnmacht und öffnete die Augen. Gott sei Dank, er lebte noch.
Seine wulstigen Lippen begannen zu zittern. Der Mann versuchte zu sprechen. Doch er brachte keinen vernehmbaren Laut hervor. Eilig presste Marcus sein Ohr an die Lippen des Mannes.
»Schrein, Quirinus, Diebe …« Der Verwundete begann leicht zu husten, und Blut spritzte in Marcus’ Ohrmuschel. »Drei …« Der Mann hustete erneut. »Drei Muscheln … Armarius Niko…«, ein heftiges Zucken durchfuhr den Körper des Priesters, bevor er leblos in sich zusammensackte.
Marcus erstarrte. Was war geschehen? Schrein, Quirinus, Diebe? Hatte womöglich jemand die Reliquien des Heiligen aus der Münsterkirche geraubt? Die Reiter! Aber was wollte ihm der Geistliche mit den drei Muscheln und diesem Armarius Niko sagen?
Plötzlich glaubte Marcus ein Geräusch hinter sich gehört zu haben. Er fuhr hoch und blickte über seine rechte Schulter. War da gerade ein Schatten in der Gasse verschwunden, oder spielten ihm die Sinne nur einen Streich?
Er hockte immer noch auf dem Pflaster, den toten Priester auf den Knien, als das Portal des Münsters erneut aufgestoßen wurde. Zwei Diakone traten eilig ins Freie. Sie hatten sich bereits mit gusseisernen Leuchtern bewaffnet und erblickten den über den Leichnam gebeugten jungen Mann.
»Das muss der Kerl sein!«, rief einer der Gottesdiener schrill in die Stille und zeigte mit seinem knochigen Finger auf Marcus. Im gleichen Moment stürzten die beiden auf ihn zu. Offensichtlich hielt man ihn für den Reliquiendieb. Marcus ließ den Toten schlagartig los, und der leblose Körper fiel dumpf auf das Pflaster. Hastig sprang er auf die Beine. Doch wohin sollte er laufen? Ohne eine Antwort auf diese Frage zu haben, drehte er sich um und rannte die Kremer Strais hinab in Richtung Marckt. Hinter ihm ertönte das Klatschen des einfachen Schuhwerks der Kleriker auf dem Pflaster. So schnell er konnte, lief er über den Marckt zur Geim Gaß. Die hastigen Schritte hallten über den menschenleeren Platz und schienen von allen Seiten zu kommen.
Außer Atem bog Marcus in die schmale Verbindungsgasse zur Bruck Strais ein. Der Weg war versperrt. Ausgerechnet hier an der engsten Stelle kam ihm ein Pferdegespann entgegen. Marcus hielt inne und presste seinen Körper an das kalte Mauerwerk. Nicht eine Handbreit Platz blieb ihm, als der Wagen auf seiner Höhe angekommen war. Den Mann auf dem Kutschbock schien dies nicht zu stören, und so setzte er die Fahrt unbeirrt fort. Der beißende Gestank von frisch gegerbten Fellen stieg Marcus in die Nase und raubte ihm fast den Atem. Er begriff jedoch, dass dies die Gelegenheit war, auf die er Sekunden zuvor gehofft hatte. Mit der Linken erwischte er in letzter Sekunde den hinteren Eckholm des vorbeifahrenden Fuhrwerks und schwang sich auf die Ladefläche. Mit einer Geschicklichkeit, die man diesem muskulösen Körper nicht zugetraut hätte, schob er sich unter die Fracht. Der Gestank wurde unerträglich, doch es half nichts. Er musste ihn wohl oder übel ertragen, wenn er nicht den Häschern in die Hände fallen wollte.
Marcus verspürte einen gewaltigen Ruck. Der Wagen hielt abrupt an, und das Pferd scheute.
»Aus dem Weg, Ihr elenden Pfaffen!«, raunzte der Kerl auf dem Kutschbock die beiden Geistlichen an, die gerade die Straßenecke erreicht hatten. Dann schnalzte der Fuhrmann laut mit der Zunge, und das Gespann setzte sich wieder in Bewegung. Marcus vergrub sich noch tiefer in den Fellen und hoffte inständig, dass die Diakone ihn nicht entdecken würden. Das Fuhrwerk bog nach links ab, und zeitgleich erklang wieder das klatschende Geräusch der Bundschuhe. Glücklicherweise entfernte es sich. Die Kirchendiener schienen weiter in Richtung Hafen zu laufen, doch Marcus wagte es nicht, seinen Kopf aus dem vermeintlich sicheren Versteck herauszustrecken.
Schon ein paar Straßen weiter hielt der Wagen erneut. Sie hatten die Ober Pfortz erreicht, die stadtauswärts an der Straße nach Köln lag. Marcus zitterte immer noch am ganzen Leib.
*
»Verrat!« Der Würdenträger war außer sich und tobte wie ein waidwunder Keiler, dem der Spieß des Jägers noch in der Flanke steckte. »Vierteilt den Kerl auf der Stelle!«
»Eure Eminenz, bedenkt den Skandal.« Bruder Ignatius von Heinsberg versuchte Erzbischof Siegfried zu beschwichtigen, der aufgeregt im großen Saal des Palastes auf und ab lief. Ignatius hatte kommen sehen, dass es kein gemütliches Unterfangen sein würde, Siegfried von Westerburg über dessen engsten Vertrauten aufzuklären. Dieser hatte seine Stellung jahrelang zu seinem persönlichen Vorteil genutzt und ihn, den Erzbischof von Köln, ein ums andere Mal hintergangen. Ignatius hatte lange abgewägt, ob es klug sei, den Kirchenfürsten so kurz vor der anstehenden Schlacht mit dieser Angelegenheit zu behelligen. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass der Erzbischof in dieser angespannten Situation nicht Gnade vor Recht ergehen lassen und kurzerhand mit aller Härte durchgreifen würde.
»Die Kölner Bürgerschaft wird sich das Maul zerreißen, und man wird Euch einmal mehr unterstellen, dass Ihr nicht imstande seid, Euren eigenen Hof zu führen. Sie werden den Vorfall womöglich Papst Nikolaus zu Ohren bringen. Bedenkt, der Heilige Vater ist erst seit einigen Monaten im Amt, und so ist es derzeit noch schwer, seine Reaktion auf derartige Anschuldigungen einzuschätzen.«
»Ihr habt recht.« Urplötzlich schlug die Stimmung des Würdenträgers um. Mit einem Mal wirkte er nachdenklich. »Was schlagt Ihr vor, Ignatius?« Erzbischof Siegfried blickte erwartungsvoll auf.
»Nun ja«, der Geistliche schluckte etwas gekünstelt und zog die Stirn in nachdenkliche Falten. »Eine Versetzung scheint mir das rechte Mittel. An einen Ort, wo er Euch von nun an nicht schaden kann.« Der Erzbischof hob interessiert die linke Augenbraue. »Ich hörte jüngst, dass der Abt zu Brauweiler einen Stellvertreter sucht. Bruder Urban wurde erst kürzlich heimgerufen, und so ist die Stelle des Priors derzeit unbesetzt. Darüber hinaus verarmt das Benediktinerkloster zusehends. Es scheint mir daher der rechte Ort zu sein, an dem ein Sünder seine Geld- und Machtgier bereuen kann. Abt Heinrich ist Euch seit Jahren treu ergeben, sodass er Eurem ›Wunsch‹ vorbehaltlos und ohne Widerspruch entsprechen wird.«
Für einen Moment schaute Erzbischof Siegfried zufrieden drein. Urplötzlich schlug seine Nachdenklichkeit wieder in Tobsucht um. »Prior?«, schrie er. »Wir wollen den Kerl nicht belohnen! Diese Aufgabe ist nur etwas für einen meiner treuesten Diener. Bruder Mattäus wird der stellvertretende Abt zu Brauweiler!« Sogleich nahm seine Stimme wieder einen ruhigeren Tonfall an, und ein süffisantes Lächeln huschte über sein Gesicht. Nachdenklich rieb er sich mit dem Zeigefinger die etwas zu lang geratene Nase. »Wir werden Prior Mattäus natürlich nicht allein nach Brauweiler entsenden. Er benötigt gewiss einen persönlichen Schreiber, der ihn, dank seiner Erfahrung, insbesondere bei den lästigen und mühsamen Arbeiten seines neuen Amtes unterstützen kann.«
*
Nach einem kurzen Wortwechsel mit den Wachen der Ober Pfortz setzte das Fuhrwerk seine Fahrt fort. Marcus überlegte, ob er einfach vom fahrenden Wagen springen solle. Doch was würde passieren, wenn ihn der Kutscher bei seinem Fluchtversuch entdecken würde?
Schon kurze Zeit später hörte Marcus entferntes Stimmengewirr und die Geräusche geschäftigen Treibens. Das Lager! Die Leute in den Neusser Gassen erzählten sich schon seit Tagen, dass Truppen vor den Toren aufgezogen waren. Anfänglich hegte man die Sorge, die Stadt würde belagert. Doch bald schon verbreitete sich die Kunde, dass sich dort nur eine Reihe von Grafen und Landesfürsten mit ihren Männern sammelten, die keinerlei kriegerische Pläne die Stadt Neuss betreffend hatten. Wenn sie auch eher nicht in friedlicher Absicht zusammentrafen.
Die Bauern, die in die Stadt kamen, wussten von Luxemburgern, den Männern des Grafen Rainald von Geldern und der Herren von Plettenberg zu berichten. Auch Dietrich ›Luv‹ von Kleve mit seinen Leuten solle dabei sein, erzählte man sich im ›Schwarzen Krug‹. Die schwer bewaffneten Reiter des Erzbischofs Siegfried von Köln hatte Marcus hingegen sogar mit eigenen Augen auf dem Markt der Stadt gesehen. Ganz Eifrige wussten zu berichten, dass die Zahl der streitbaren Männer bereits auf weit über 4.000 Kämpfer angewachsen war.
Unvermittelt hielt das Gespann an. Vorsichtig hob Marcus die stinkenden Felle, sodass er sich durch den entstandenen Spalt umschauen konnte. Seine Vermutung bestätigte sich: Er befand sich inmitten des Lagers. Was würde passieren, wenn die Männer die Felle abladen und ihn hier auf der Ladefläche bemerken würden? Rasch reckte Marcus sich nach der Wagenkante und zog sich aus seinem Versteck. Mit einer Drehung glitt er von der Ladefläche und landete auf den Beinen. Zur gleichen Zeit war der Kutscher vom Bock gestiegen und stand nun neben ihm.
»Kann ich Euch helfen, werter Herr?« Marcus setzte den unschuldigsten Gesichtsausdruck auf, den er zustande brachte.
»Du kannst die Felle vom Wagen schaffen«, entgegnete der Kutscher. »Glaub nicht, dass ich dich hierfür entlohnen werde«, schob er hastig nach. Mit misstrauischem Blick starrte er auf Marcus. Wo war dieser unerwartete Gehilfe nur so plötzlich hergekommen?
Um keinen Verdacht zu erwecken, begann Marcus unverzüglich und ohne ein weiteres Wort mit der Arbeit.
»Leg mir die guten Stücke nicht dort in die Pfützen! Hier drüben ist es trockener.« Mit diesen Worten wandte sich der Klotz von Marcus ab und ging nach vorn, um nach dem Pferd zu sehen.
»He, du!« Marcus spürte plötzlich eine kräftige Hand auf seiner rechten Schulter. »Wenn du abgeladen hast, kannst du das stinkende Zeug zu unseren Zelten schaffen. Dein Herr wird bei dem Wucherpreis, den er von uns für die gammeligen Fetzen verlangt, gewiss nichts dagegen haben, wenn du uns noch ein wenig zur Hand gehst.«
Marcus drehte sich erschrocken um. Vor ihm stand ein hünenhafter Ritter, dessen schmieriger Wappenrock offensichtlich seit Monaten nicht mehr mit Schlagbrett und Wasser in Berührung gekommen war. Der Kerl stank nicht minder als die Felle, die Marcus Stück für Stück vom Wagen zerrte. In seinem breiten Ledergürtel steckte der Schaft eines gewaltigen Morgensterns. Die schwere, mit langen Stacheln versehene Eisenkugel baumelte an einer frisch geölten Kette. Die Waffe schien das Einzige zu sein, was der Mann regelmäßig pflegte.
»Was glotzt du so?«, fuhr der Bewaffnete ihn an. »Mach, dass du fertig wirst. Wir wollen nicht den ganzen Tag auf dich Faulpelz warten müssen.« Dabei versetzte er Marcus eine tüchtige Ohrfeige und ging wortlos davon. Der Getroffene rieb sich die schmerzende Gesichtshälfte, die augenblicklich anschwoll. Verärgert schaute er dem Hünen nach. Hatte er zunächst die Lust verspürt, den Kerl mit ein paar kräftigen Fausthieben zu zeigen, dass er kein kleiner Junge war, mit dem man so umspringen konnte, hatte er sich sogleich darauf besonnen, nicht weiter aufzufallen. Schließlich war er ein vermeintlicher Reliquiendieb und Mörder auf der Flucht. Um eine weitere Auseinandersetzung zu vermeiden, würde er zukünftig einfach einen großen Bogen um den Ritter machen. Er würde ihm schon von Weitem auffallen, dachte Marcus angesichts des ungewöhnlichen Wappenrocks. Waren die meisten schlicht, oft nur einfarbig, so hob sich dieser durch seine besondere Aufteilung von den anderen ab. Der weiße Grund, der sich unter dem Schmutz der Kleidung nur erahnen ließ, war durch einen dunkelroten gezackten Brustring geteilt. Der farbige Streifen war mit einer guten Elle außerordentlich breit.
Nachdem Marcus das letzte Stück von der Ladefläche des Wagens gezogen hatte, machte er sich eilig daran, die ersten Felle in die Richtung zu tragen, in die der Riese verschwunden war. Auch wenn er sich fest vorgenommen hatte, dem Kerl aus dem Weg zu gehen, so musste er die übel riechende Ware zu ihm schaffen, um keine weitere Ohrfeige zu riskieren. Marcus hoffte, dass der Mann auf jede weitere Provokation verzichten würde und ihn unbehelligt seine unerwartete Arbeit verrichten ließe.
Kurze Zeit später erschien ein anderer Ritter am Fuhrwerk. Auf seinem Wappenrock prangte der gleiche rote Streifen, den der Hüne auf seiner Brust getragen hatte. Schon an der Gangart des Recken erkannte der Kutscher von Weitem, was ihm die ordentliche Fahne des Mannes bestätigte, als er nun einen Schritt vor ihm stand. Der Kerl hatte sich offenbar die Zeit mit einigen Bechern Branntwein vertrieben und sich einen ordentlichen Rausch angesoffen, der jeden anständigen Mann aus den Stiefeln gehauen hätte. Laut rülpsend reichte er dem Kutscher ein klimperndes Ledersäckchen. Angewidert drehte dieser den Kopf zur Seite und verstaute den Beutel in seinem Wams, konnte sich jedoch angesichts der üppigen Bezahlung ein breites Grinsen nicht verkneifen.
»Ihr braucht gar nicht so dümmlich zu lächeln!«, fuhr ihn der Recke an. »Glaubt ja nicht, dass wir nicht merken, dass Ihr uns übers Ohr haut.« Er schaute den Kutscher aus rot unterlaufenen Augen grimmig an. Was sollte er machen? Die große Zahl derer, die sich hier vor den Toren Neuss’ mit den letzten Besorgungen eindeckten, hatten die Preise selbst für die schlechteste Qualität in die Höhe getrieben. Weniger vom schlechten Gewissen getrieben als aus Angst vor einer tüchtigen Abreibung, verneigte sich der Kutscher kurz und stieg eilig auf. Gerade als sich der Wagen in Bewegung setzte, hielt der Ritter das Pferd am Zaumzeug zurück. Der Mann auf dem Bock zuckte zusammen.
»Ach ja, bevor Ihr ihn vermisst: Euren Burschen schicke ich Euch nach, sobald er die Felle hinüber zu unseren Zelten geschafft hat«, lallte der Betrunkene und gab das Pferd mit einer wegwerfenden Bewegung wieder frei.
Bursche? Von wem sprach der versoffene Kerl? Doch diese Frage wollte der Kutscher nicht vertiefen. Einen Disput mit diesem Trunkenbold zu riskieren, war nun wirklich nicht nach seinem Geschmack. Rasch wendete er den Wagen und fuhr kopfschüttelnd, aber erleichtert davon.
*
»Brauweiler? Das allein wäre ja nicht das Schlimmste! Aber als Schreiberling?« Die Stimme des Alten überschlug sich vor Erregung, und Speicheltropfen spritzten seinem Gegenüber ins Gesicht. Es war das zweite Mal an diesem Tage, dass Ignatius eine äußerst unangenehme Nachricht überbringen musste. Musste? Oder war es mehr ein Dürfen? Insgeheim gestand er sich ein, dass ihm dies im Falle des ersten Beraters in gewisser Weise Freude bereitete. Er hatte den Alten in seiner rücksichtslosen, eiskalten Art nie gemocht. Ein Schauer des Ekels war ihm jedes Mal über den Rücken gelaufen, wenn dieser mit seinem silberverzierten Stock an ihm vorbeigehumpelt war. Längere Zeit hatte er ihn schon in Verdacht, dass er sein eigenes geldgieriges Spiel hinter den Mauern des erzbischöflichen Palastes trieb, jedoch nie Beweise hierfür gefunden. Häufig hatten zwielichtige Gestalten vorgesprochen, die zur Überraschung aller auch noch zum Legaten vorgelassen werden mussten. Danach zog sich der Alte oft rätselhafterweise zurück.
Wie sehr hatte Ignatius den heutigen Tag herbeigesehnt. Endlich warf Siegfried diesen greisen Schmarotzer aus dem erzbischöflichen Palast. Wie ein toter Aal in der Sommersonne sollte dieser eklige Alte in Brauweiler verrotten! Ignatius’ Ziel, zum ersten Berater aufzusteigen, schien in greifbarer Nähe. Schon bald würde der Erzbischof allein auf seine Worte hören und ihm sein ganzes Vertrauen schenken.
»Ich kann Euch gar nicht sagen, Bruder Lucius, wie sehr ich auf den Erzbischof eingeredet habe, Gnade vor Recht ergehen zu lassen«, heuchelte Ignatius.
»Eure Fürsprache schert mich einen Dreck!« Der Alte rappelte sich mühsam auf und stütze sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf seinen Gehstock. Wenn er nur jünger und nicht so gebrechlich wäre, hätte er diesen Bastard von Erzbischof mit eigenen Händen erwürgt. Diese Schmach würde er ihm heimzahlen, das schwor er sich. Als Schreiber dieses Mattäus, dieses schleimigen Emporkömmlings, würde er auf keinen Fall enden. Schon gar nicht in Brauweiler!
So gut es seine schmerzende Hüfte zuließ, ging er in seiner Kammer auf und ab und überlegte krampfhaft, wie er es anstellen könnte, das Blatt noch zu wenden.
»Eure Abreise ist für den morgigen Tag vorgesehen. Der Erzbischof hat bereits alles veranlasst.« Mit diesen Worten verabschiedete sich Bruder Ignatius und ließ den wütenden Alten zurück.
*
Als Marcus an die Stelle zurückkam, an der die restlichen Felle lagen, war das Fuhrwerk schon lange verschwunden. Zunächst ärgerte er sich, dass er zu Fuß zur Stadt zurückkehren musste. Aber schon im nächsten Augenblick wurde ihm bewusst, dass er nach den Geschehnissen der frühen Morgenstunden gar nicht zurückkehren konnte. Jeder andere Bürger der Stadt hätte den sterbenden Priester in seinen Armen halten können und wäre niemals in Verdacht geraten. Doch ausgerechnet er? Man hatte seine diebische Vergangenheit nicht vergessen, und die Wirtsleute mussten sich manch üble Anfeindung anhören, seit sie Marcus bei sich aufgenommen hatten. Die ›anständigen‹ Neusser, die einfach nicht an seine Verwandlung zu einem rechtschaffenen Kerl glauben wollten, würden ihn für den Reliquiendieb halten. Darüber hinaus hatte seine instinktive Flucht ihren Anschuldigungen schließlich weiteren Nährboden gegeben. Einen gerechten Prozess, in dem er sich verteidigen konnte, würde er als ehemaliger Dieb nicht erwarten können. Wenn es überhaupt zu einer Verhandlung vor dem Schultheißen kam. Dagegen konnte er sich der geballten Wut des Klerus und der Bürgerschaft über den Verlust des Heiligen sicher sein. Neben den bedeutsamen Glaubensaspekten war der heilige Quirinus schließlich eine beachtliche Geldquelle für die Stadt. Jahr für Jahr kamen Tausende Pilger nach Neuss, um ihn um seine Fürsprache bei Gott anzuflehen. Da es sich bei dem Diebesgut um eine heilige Reliquie handelte, würde man Marcus als Dieb und Ketzer gleichermaßen richten, und dies eher heute als morgen.
So gedankenversunken irrte er zwischen den Zelten des riesigen Lagers ziellos umher. Nach einer Weile setzte er sich auf eines der Strohbündel, die hier und da verstreut lagen.
»Zu welcher Grafschaft gehörst du, Rumtreiber? Dein Herr wird dich Faulpelz schon suchen!« Ein stark untersetzter Mann trat gegen das Bündel, auf dem Marcus saß. Erschrocken sprang dieser auf.
»Äh, ich gehöre nicht …«, er stockte und besann sich. »Gewiss, Herr, verzeiht. Ich werde sofort an meine Arbeit zurückkehren.« Er durfte um keinen Preis auffallen. Solange er nicht wusste, wo er eine sichere Zuflucht finden würde, bot ihm das riesige Lager mit seinen unzähligen Männern und Burschen ausreichend Schutz. In den Massen konnte er vorerst untertauchen. Eilig verschwand Marcus zwischen den Zelten.
Von nun an bemühte er sich, so geschäftig wie möglich zu wirken, lief mal hierhin, mal dorthin und betrachtete interessiert die Wappenschilde, die vor den Schlafstätten standen. Zu dumm, dass er von Wappenkunde nun wirklich nichts verstand. Zu gerne hätte er gewusst, woher die Männer kamen, die hier vor den Toren der Stadt Neuss ihr Lager aufgeschlagen hatten. Nur eines hatte er erkannt. Der gelbe Löwe auf blauem Grund: Dies war das Wappen Rainalds I., des Grafen von Geldern. Die Grafschaft Geldern war eine der mächtigsten der Gegend, und einige Leute sagten, Rainald sei darüber hinaus der rechtmäßige Erbe des Herzogtums Limburg. Doch gerade um diese Erbschaft war vor einigen Jahren ein erbitterter Streit entbrannt.
»Dem Brabanter werden wir schon die Hammelbeine lang ziehen!« Vor dem Zelt, an dem Marcus gerade vorbeikam, standen einige Männer in den unterschiedlichsten Wappenröcken. Marcus bog um die Zeltecke und begann, mit einer Forke das Heu umzuschichten, das dort lag. Von hier aus würde er die Ritter belauschen können, ohne weiter aufzufallen. Vielleicht würde er ja endlich erfahren, warum sich Tausende Bewaffnete ausgerechnet vor den Toren Neuss’ versammelt hatten.
»Erzbischof Siegfried hat ganz recht, wir müssen Herzog Johann von Brabant, diesen Erbschleicher, ein für alle Mal in seine Schranken weisen. Die Sache ist ehrenwert und gottgefällig. Schließlich verhilft Erzbischof Siegfried Graf Rainald nur zu seinem Recht als Witwer der Irmgard von Limburg«, fuhr der Mann fort. Marcus stutzte bei diesen Worten. Im ›Schwarzen Krug‹ hatte er die Sache von einer ganz anderen Warte aus gehört. Ein angetrunkener Wanderprediger war eines Abends in die Schenke gekommen und hatte wutentbrannt davon berichtet, dass der Erzbischof von Köln das Limburger Erbe nach dem frühen Tod Irmgards nur an sich reißen wolle, um seine Ländereien, die einem Flickenteppich glichen, zu einem Ganzen zusammenzufügen. Er habe bereits mehr als genug Kirchengelder für seine kriegerischen Auseinandersetzungen verwandt, mit denen er besser die Armut des Volkes beseitigt hätte. Nun bediene er sich auch noch des Grafen von Geldern und seiner Vasallen, um seine machtgierigen Ziele zu erreichen.
»Wenn ich nur daran denke, wer alles nach dem Tod der Herzogin Irmgard Ansprüche auf Limburg erhoben hat, wird mir übel!« Der Dicke, der sehr nah an der Ecke zu Marcus’ Lauschposten stand, drehte sich plötzlich um und spie in das Heu, an dem der hellblonde Heranwachsende sich zu schaffen machte. »Graf Heinrich von Luxemburg und Walram ›der Rote‹ von Valkenburg lenkten indes ein und verzichteten auf das Herzogtum. Gottlob, dass sie heute an unserer Seite stehen, um den Kampf gegen den Brabanter aufzunehmen. Doch Graf Adolf von Berg, der Verräter?«
Auch von diesem Landesfürsten hatte der Wanderprediger gesprochen. Der Graf sei ein Vetter der Limburgerin gewesen, hatte er gesagt, und so wären die Rechte durch die Heirat seiner Nichte Margarethe mit dem Sohn des Herzogs von Brabant an das Haus desselbigen übergegangen.
Marcus’ Gedanken drehten sich angesichts dieses Verwirrspiels und den unterschiedlichen Sichtweisen zu ein und derselben Sache. Was war wahr und was nur simples Gerede? Wie sollte er, ein einfacher Mann aus Neuss, dies unterscheiden können? Unmöglich! Marcus rammte die Forke mit einem Ruck ins Heu und ging von dannen. Zumindest wusste er jetzt, dass es hier um verworrene Machtspiele zwischen dem Erzbischof von Köln und dem Herzog von Brabant im Kampf um das Erbe Limburgs ging. Das musste reichen. Die Wut in den Stimmen der Männer ließ Marcus erahnen, dass es wohl unausweichlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Getreuen beider Seiten kommen würde. Damit wollte er auf keinen Fall etwas zu tun haben – so viel war klar.
*
»Und ich dachte, Ihr wolltet mit mir keine, sagen wir, ›Geschäfte‹ mehr machen? Umso mehr bin ich überrascht, dass Ihr so dringlich nach mir habt schicken lassen.« Trotz seiner devoten Haltung hatte das Lächeln des hageren Mannes etwas Überhebliches. Mit einem Mal lachte er sogar lauthals und richtete sich kerzengerade auf. Doch sein Gegenüber dachte nicht daran, sich von diesem Gehabe beeindrucken zu lassen.
»Schweigt! Wenn es nicht von äußerster Wichtigkeit gewesen wäre, so wäre ich lieber zur Hölle gefahren, als jemals wieder in Eure hässliche Fratze blicken zu müssen.« Bei diesen Worten holte der Alte einen prall gefüllten Ledersack aus der Schatulle, die geöffnet vor ihm stand, und schüttete die Münzen klimpernd auf den Tisch.
Das aufgesetzte Lachen des Mannes verstummte abrupt. Er zog ein schmutziges Tuch aus seinem löchrigen Gambeson und tupfte sich aufgeregt die Stirn. »Und was ist Euch so wichtig, dass eine solch hohe Summe den Besitzer wechseln soll?« Jegliche Überlegenheit des Hageren war verschwunden. Stattdessen blitzte aus seinen Augen nur noch unendliche Geldgier.
Der Alte hingegen genoss die Macht der Münzen und lehnte sich genüsslich in seinem Stuhl zurück. »Wer sagt mir, dass Ihr überhaupt der Richtige für die Aufgabe seid? Ich hege den Verdacht, dass ich mir Eurer Verschwiegenheit nicht mehr sicher sein kann.«
»Oh, nein! Ich habe nie und nimmer mit jemandem über Eure Aufträge gesprochen!« Eilig hob er die rechte Hand zum Schwur. Die Geste wirkte grotesk, da ihm der Zeigefinger fehlte.
»Schwört nicht einen falschen Gotteseid, den Ihr schon bald bereut, wenn Ihr im Feuer des Beelzebubs angekommen seid. Ich war sehr verwundert, als mir mein ärgster Widersacher kürzlich Einzelheiten vortrug, die außer mir nur Ihr wusstet. Einzelheiten, die mit Eurem letzten Auftrag in engem Zusammenhang stehen.«
Der Hagere griff erneut nach seinem Tuch und tupfte nun noch aufgeregter den kalten Schweiß von seiner hohen Stirn.
Ruhig und mit innerer Gelassenheit zählte der Alte ein paar der Münzen ab und stopfte sie in eine kleine Geldkatze aus gelblichem Leder. »Ich will nicht nachtragend sein. Betrachtet dies als Anzahlung«, sprach der Greis mit gnädigem Unterton und warf dem Ausgezehrten das Säckchen zu.
»Anzahlung? Wofür? Was soll ich tun?«
*
Die Dämmerung war hereingebrochen, und die ersten Männer zogen sich bereits in ihre Zelte zurück. In den nächsten Tagen würden sie all ihre Kräfte brauchen. Nach Schlafen stand Marcus nicht der Sinn. Eine Frage nagte ununterbrochen an ihm wie eine Ratte an einem Stück fauligem Fleisch. Eine Frage, in der er bisher noch keinen Schritt weitergekommen war: Wohin sollte er nur gehen? Plötzlich fiel ihm sein Freund Gernot Thelen ein, der auf einem kärglichen Ziegenhof an der Straße nach Büttgen lebte. Seit einigen Jahren waren sie eng verbunden, und Thelen war ihm ein väterlicher Freund geworden, auch wenn sie sich zuletzt nur an den Jahrmarkttagen in der Stadt getroffen hatten. Zu ärgerlich, dass er nicht früher an ihn gedacht hatte. Für heute war es schon zu spät geworden, sich auf den Weg nach Büttgen zu machen. Morgen früh würde er sofort aufbrechen. Er würde dem Ziegenhirten die ganze Geschichte erzählen und war überzeugt, seinem Freund blind vertrauen zu können. Jedoch für diese Nacht musste Marcus sich einen Schlafplatz hier im Lager suchen.
Erst jetzt bemerkte Marcus, dass viele Männer, trotz der einsetzenden Lagerruhe, in ein und dieselbe Richtung eilten wie die Gläubigen zum sonntäglichen Kirchgang. Als er sich umdrehte, um den Vorbeieilenden nachzuschauen, sah er vom Rande des Lagers her einen Feuerschein. Für einen Brand war er, Gott sei Dank, zu schwach. Es musste sich um eine größere Anzahl Fackeln handeln, die dort den Abendhimmel erhellten. Neugierig schloss sich Marcus dem Strom der Männer an und hastete mit ihnen in die Richtung, aus der der warme Lichtschein kam.
Schon wenige Schritte später hörte er die Klänge einer Drehleier, und kurz darauf erreichten sie die erleuchteten Zelte einer Gauklertruppe. Die Spielleute hatten ein kleines Holzpodest errichtet, sodass man dem einsetzenden Treiben selbst aus der letzten Reihe gut folgen konnte. Dies schien auch vonnöten, denn etwa acht Dutzend Männer drängten sich bereits ungeduldig um den Platz. Die Anzahl der Zelte, die sich hinter dem Podest befanden, verriet, dass es sich um eine größere Gruppe Gaukler handeln musste. Die Ärmlichkeit des Lagers ließ hingegen erahnen, dass sie nicht gerade zu den Erfolgreichsten ihres Gewerbes gehörten.
»Tretet näher, verehrte Recken, und lasst Euch befreien vom Trübsal der bevorstehenden Schlacht. Ich, Meister Dominikus von Dobberstein, werde Euch mit meinen Mannen – und natürlich mit unserer holden Weiblichkeit – auch heute wieder in ein Bad der Freude, an einen Hort der Glückseligkeit entführen.«
»Wo ist die Rote?«, brüllte ein offenbar angetrunkener Kerl ungeduldig aus der Menge. Im Halbdunkel erkannte Marcus an der prägnanten Aufteilung des Wappenrocks, dass es sich um einen der Männer handelte, für welche die morgendliche Felllieferung bestimmt gewesen war. Er war nicht allein. Zu fünft standen sie dort breitbeinig im Gedränge.
»Ludolf hat recht! Schafft die Irin her!«
»Oh! Die werten Herren waren wohl auch gestern schon Zeuge der großen Künste meiner Gaukler. Es scheint mir, dass es weniger die Spielleute, als vielmehr die liebreizende Patricia ist, die Euch erneut zu uns kommen lässt?« Bei diesen Worten rollte der Mann auf der Bühne, der noch ärmlicher anmutete als seine Zelte, vielversprechend mit den Augen.
»Wir wollen die Tänzerin sehen!«, riefen nun weitere Männer von der anderen Seite des Halbrunds herüber.
»Geduld, Geduld«, versuchte Dominikus von Dobberstein die fordernde Menge zu beruhigen. »Ich verspreche Euch, die rote Irin wird noch heute Abend für Euch tanzen und Eure Sinne betören! Ja, nicht nur das! Sie wird sich einzig und allein für Euch todesmutig den Messerwürfen des Niko von Kroatien stellen. Doch zuvor habt Ihr die Gelegenheit, verehrte Recken, die Geschicklichkeit des Jacobus van der Keul auf dieser Bühne zu bewundern.« Schwungvoll drehte er sich mit einer imposanten Geste zu einem Vorhang um, der hinter ihm über eine hohe Querstange drapiert war. Auf ein Zeichen Dobbersteins hin erklang Dudelsackspiel, und ein dröhnend rhythmischer Trommelschlag ertönte. Der löchrige Vorhang wurde aufgerissen. Ein blassblonder Jongleur sprang nach vorn auf das Podest. Der Bleiche warf vier Bälle im quirligen Takt in die Höhe. Geschickt fing er sie hinter seinem Rücken auf, um sie sogleich wieder in die Höhe zu schleudern. Einer nach dem anderen flog in die Luft und landete wie magisch angezogen in den Händen des Mannes. Der Rhythmus der Musik wurde schneller, und die Bälle tanzten förmlich zu den Klängen, ohne dass man befürchtete, Jacobus würde auch nur einen fallen lassen. Marcus hatte auf dem Neusser Jahrmarkt schon den einen oder anderen Gaukler behände einige Bälle werfen sehen, doch keiner hätte es mit diesem dort in Sachen Geschicklichkeit aufnehmen können. Die Musik verstummte, und van der Keul riss sich sein Barett vom Kopf. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin verschwanden die Bälle allesamt in seiner Kopfbedeckung, die er sich mit Schwung wieder aufsetzte. Die Männer johlten vor Vergnügen und schienen die rothaarige Tänzerin, die sie eben noch so vehement gefordert hatten, beinahe schon vergessen zu haben. Nur einer nicht. »Was ist mit der Roten, Dobberstein?«, grölte der Angetrunkene nun wieder mit Angriffslust in der Stimme und lockerte dabei sein Schwert geräuschvoll in der Scheide.
»Gewiss, ich habe Euch den Todesmut Patricias versprochen, aber die Zeiten sind schwer und das Brot teuer. So bitt ich Euch zuvor um eine Gabe für uns Spielleute.« Auf dieses Stichwort hin schüttete Jacobus van der Keul eilig die Bälle aus seinem Barett und sprang nach vorn in die Menge. Schnell kamen die Geldkatzen der Männer zum Vorschein, die auf den Auftritt der Schönen nicht länger warten wollten. Flink huschte der Ballkünstler von Mann zu Mann, ohne auch nur einen möglichen Geldgeber auszulassen. Nur von den fünf Recken hielt er sich fern, die breitbeinig und mit grimmiger Miene inmitten der Menschenmasse standen. Zu genau wusste Jacobus, dass er von diesen Burschen eher einen verächtlichen Fußtritt erwarten durfte, als dass er auch nur einen müden Weißpfennig erhielt.
Noch bevor Jacobus seine Sammlung beendet hatte, schleppten zwei Spielleute eine hölzerne Palisade auf das Podest, die sie sorgsam in Stellung brachten.
Das Barett van der Keuls hatte sich ausreichend gefüllt, als Dominikus die Hand hob und der Trommler augenblicklich wieder begann, das Fell seines Instruments zu malträtieren. Ein drahtiger, pechrabenschwarzer Kerl trat durch die Vorhangöffnung. Seine dunklen Augen blitzen unfreundlich in die Menge. In seinen Händen hielt er sechs Dolche, die selbst im fahlen Fackelschein aufblitzten. Die Trommel verstummte, und eine Schalmei ertönte. Marcus hatte diese Art Musik noch nie zuvor gehört. Erst klang sie ruhig und melodiös, doch schon bald wurde sie schneller und schneller. Der Weißblonde ertappte sich dabei, wie sein rechtes Bein im Takt zu wippen begann. Eine Sekunde später blieb er wie angewurzelt stehen, den Mund halb geöffnet. Eine junge Frau trat durch den Vorhang. Sie war kaum älter als Marcus und hatte feuerrotes wallendes Haar. Über ihre zierliche Nase zog sich ein schmaler Streifen Sommersprossen, der ihrem Gesicht etwas Lebenslustiges verlieh. Sie trug ein grasgrünes Leinenkleid, das die Vollkommenheit ihres Körpers trotz seiner Schlichtheit unterstrich und dessen Ausschnitt eine wohlgeformte Brust ansatzweise freigab. Auch hier verzierten Sommersprossen ihre blasse Haut. Marcus spürte, wie sein Mund trocken wurde. Nun verstand er die fordernden Rufe der Männer, auch wenn ihn ihre geifernde Art anwiderte. Mit einem verführerischen Schwung warf die Schöne ihr Haar in den Nacken, und Dominikus von Dobberstein trat hinter sie. Er hielt einen Streifen des gleichen Leinenstoffs in der Hand, wie der, aus dem ihr Kleid gefertigt war, und verband ihr damit die leuchtenden Augen. Langsam führte er sie rückwärts, bis sich ihr Körper an das Holz der Palisade schmiegte. Marcus stockte der Atem, als der finstere Kroate in die Mitte der Bühne trat und Dominikus eilig nach links verschwand. Am liebsten wäre Marcus geradewegs auf die Holzplanken gesprungen und hätte dem Kerl die Dolche entrissen. Sein Verstand sagte ihm, dass er sich lächerlich machen würde und der Kroate sein Handwerk so gut verstehen würde wie Jacobus der Jongleur. Zumindest hoffte Marcus dies und spürte dabei, dass seine Hände schweißnass geworden waren. Der erste Dolch surrte durch die Luft und blieb mit einem dumpfen Schlag direkt neben der schlanken Taille der Schönen im Holz stecken. Am erleichterten Raunen, das nun aus den Reihen der Männer erklang, erkannte Marcus, dass die meisten von ihnen die gleichen Gedanken wie er selbst gehabt haben mussten. Er schämte sich dafür, dass er auf diese Weise einer ihresgleichen war. Schon ertönte der nächste Schlag und riss ihn aus seinen Gedanken. Die Dolchspitze vibrierte neben dem glänzenden Haar der betörenden Patricia. Die Zuschauer hielten wieder den Atem an, und nur der Klang der Trommel durchbrach die Stille des Abends. Drei … vier … fünf … sechs! Marcus atmete hörbar auf, als sich der Kroate, an das Publikum gewandt, verneigte. Mit einer lasziven Geste zog sich die hübsche Irin den Leinenstreifen von den Augen und lächelte in die Menge. Eine heitere Weise erklang, und die Schöne sprang munter wie ein Fohlen davon. Marcus schaute Patricia sehnsüchtig nach. Hatte sie ihm wirklich zugezwinkert, bevor sie hinter dem Vorhang verschwunden war?
*
»Wo bleibt der Kerl nur so lange? Er weiß genau, dass ich ihn brauche, wenn der abendliche Trubel hier wieder losgeht.« Annehild Janssen kannte ihren Mann zur Genüge, um zu wissen, dass es Sorge um Marcus war und nicht Verärgerung über sein Verschwinden, die ihn dazu trieb, in der Schenke auf und ab zu laufen wie ein unruhiges Ferkel, das das Kommen des Fleischers erahnt. Janssen war eben erst vom Hafen zurückgekehrt. Auch dort hatte niemand ihren Zögling heute gesehen.
»Vielleicht ist er einfach nur auf und davon und kehrt in ein paar Tagen munter und vergnügt zurück.« Annehild versuchte ihren Gatten zu beruhigen und legte bei diesen Worten ihre Hand auf die seine. Barsch zog der Wirt seine Pranke zurück.
»Nur so, auf und davon? Du solltest den Jungen zwischenzeitlich besser kennen. Er ist nicht der Tunichtgut, für den du ihn immer noch hältst!«
Annehild bereute ihre Worte und fühlte sich missverstanden. Schließlich hatte sie sich schon vor einiger Zeit eingestehen müssen, dass sie sich in Marcus getäuscht hatte. Gewiss, anfangs hatte sie sich dagegen gewehrt, ihn, einen Taschendieb, bei sich aufzunehmen. Doch nach und nach hatte er sie mit seinem Fleiß bei der täglichen Arbeit überzeugt. Mittlerweile hatte sie den weißblonden Jungen sogar ein wenig lieb gewonnen und machte sich nun nicht minder Sorgen als ihr Gatte.
Der Wirt schien sich kaum mehr beruhigen zu wollen, als sich die Tür zum Schankraum öffnete. Hubertus Hohenfels, der dienstbeflissene Helfer des Schultheißen, kam mit fünf weiteren seiner Männer herein. Statt sich an einen der Tische zu setzen, schritt er mit ernster Miene auf Berthold zu. Die anderen fünf folgten ihm und schauten eher etwas verlegen drein.
»Berthold Janssen?«, fragte Hubertus mit fester Stimme.
Was war in den Kerl gefahren? Hatte er beim gestrigen Gelage den Verstand versoffen? Er kannte den Wirt zur Genüge, als dass er ihn nach seinem Namen fragen musste. »Bist du immer noch betrunken, Hubertus?«
Hohenfels ignorierte die Worte des Wirts und sprach mit eisiger Miene: »Janssen, im Namen des Kurfürsten, unserer Eminenz Erzbischof Siegfried und unserer heiligen Mutter Kirche nehme ich Euch hiermit fest.«
Janssen glaubte seinen Ohren nicht zu trauen. Noch bevor der Verdutze etwas entgegnen konnte, wandte sich der Obere an seine Männer: »Ergreift ihn und schafft ihn hinaus!«
Je zwei der Soldaten packten Berthold zögerlich an seinen muskulösen Armen und schoben ihn vorsichtig in Richtung der Tür. Der fünfte hielt Annehild zurück, der Tränen des Zorns in die Augen schossen.
»Was habt Ihr mit ihm vor? Er hat nie etwas Unrechtes getan.«
»Annehild, es wird sich alles klären. Es ist wegen …«
Weiter kam der Mann nicht, denn Hubertus fiel ihm barsch ins Wort: »Ich glaube nicht, dass der Erzbischof in seinen Entscheidungen der Frau eines Schankwirts Rechenschaft schuldig ist!«
»Ich bin bald wieder zurück«, beschwichtigte Berthold seine Frau und drehte sich noch einmal zu ihr um, bevor ihn die vier hinaus auf die Gebrante Gaß in Richtung Blutturm führten.
*
»Und nun, Männer der ruhmreichen Taten, kommt der berühmte Medikus Flatavio zu Euch. Gewiss hat sich die Kunde herumgesprochen, dass er an so manchem hohen Hof praktiziert und Könige sowie Fürsten von aussichtslosem Leiden befreite. Ob im fernen Konstantinopel, am Heiligen Stuhl zu Rom oder in den Schlachten unserer tapferen Ritter des Kreuzes gegen das Heidenheer des Teufels Saladin. Viele derer, die gesund aus dem Heiligen Land zurückkehrten, verdanken dies ohne Zweifel seiner heilenden Kunst.« Begleitet von diesen Worten des Ruhmes trat ein dürrer Kerl auf die Bretter. Er trug einen langen schwarzen Umhang und einen hohen Hut auf dem kahlen Kopf. »Gott möge es verhüten, doch wer sagt Euch, dass Ihr nicht in der anstehenden Schlacht durch das Schwert eines feigen Feindes hinterrücks verwundet werdet?« Dominikus von Dobberstein beugte sich verschwörerisch zu seinem Publikum hinunter und starrte geheimnisvoll in die Runde. Mit einem Mal war die überschwängliche Freude der Menge dahin, und ein Gefühl der Angst machte sich spürbar breit. »Doch mit der Medizin des Medikus seid ihr im Handumdrehen wieder auf den Beinen und jagt die brabantischen Bastarde in die Flucht.« Schlagartig richtete er sich bei diesen Worten auf und zeigte mit ausgestreckter Hand auf eine große Holztruhe, die von zweien der Musiker nach vorne getragen wurde. Der Medikus öffnete langsam und bedächtig den Deckel und griff in die Truhe. Mit einem Ruck riss er den Arm in die Höhe und streckte ein Fläschchen in den Abendhimmel. Die Männer wichen erschrocken einen Schritt zurück. »Habt keine Furcht und tretet näher! Dies ist das wundersame Mittel, das Euch die Heilung bringen wird. Die Wundermedizin des Medikus Flatavio! Ob ein Reißen in der Schulter, ob eine klaffende Wunde am Arm, ja selbst bei Blut im Stuhl hilft diese Medizin!« Dobberstein ruderte einladend mit den schlaksigen Armen. Skeptisch bewegte sich die Menge langsam wieder nach vorn.
Marcus bemerkte im Augenwinkel einen kleinen Trupp Männer, der sich von rechts auf die Zuschauer zubewegte. Im Schein der Fackel, an der sie nun vorüberschritten, erkannte er Hubertus Hohenfels, der sich suchend umblickte. Instinktiv duckte Marcus sich ein wenig und wich ein paar Schritte nach links aus. Durch die Menschenansammlung hindurch beobachtete er, wie Hohenfels einen der Zuschauer ansprach. Der Mann schüttelte nur den Kopf. Der nächste hingegen schien das Gespräch zu erwidern. Auch die übrigen Bewaffneten, die mit Hubertus gekommen waren, begannen nun mit der Befragung. Marcus machte sich noch ein Stück kleiner und drängte immer weiter seitwärts. Er hatte den äußersten Rand der Menge beinahe erreicht, als einer der Befragten plötzlich in seine Richtung zeigte. Marcus durchfuhr ein eiskalter Schauer. Sie waren gekommen, um ihn in die Stadt zurückzuholen.
Im gleichen Augenblick packte ihn jemand am Arm und zerrte ihn aus dem Gedränge. Erschrocken drehte Marcus sich um und blickte in ein Paar grün funkelnde Augen. »Komm!«, zischte die Irin, die ihr rotes Haar unter einem Kopftuch verborgen hatte. Bevor Marcus etwas erwidern konnte, hatte sie schon ihre zarte Hand auf seinen Mund gelegt. Ein milder Lavendelduft stieg ihm in die Nase. Doch nun war wirklich nicht die Zeit für Träumereien. Rasch zog sie Marcus zwischen den vorderen Zelten der Gaukler hindurch ins Dunkel. Vor einem niedrigen Zelt blieb sie stehen. »Auf einen mehr oder weniger kommt es nun auch nicht mehr an«, flüsterte sie und schob ihn durch die Öffnung ins Innere. Sie verschloss den Eingang der Behausung sorgsam und entschwand so lautlos, wie sie gekommen war.
Der Schreck steckte Marcus immer noch in den Gliedern. Rücklings schob er sich in die Tiefe des Zeltes. Dabei ertastete er vorsichtig die Kisten und Säcke, die sich hier zwischen Stangen und Kanthölzern stapelten. Es musste sich um das Requisiten- oder Vorratslager der Gaukler handeln. Deutlich hörte er den Schlag seines pochenden Herzens.
In dieser Sekunde legte sich ein kalter Arm von hinten um seinen Hals, und Marcus spürte die Spitze eines Dolchs unterhalb seines Kinns.
»Nur ein Laut und du bist tot! Ich steche dich ab wie ein Schwein!«, raunte ihm eine Männerstimme ins Ohr.
Wer war der Kerl, der sich von hinten an ihn herangeschlichen hatte? Dem Klang der Stimme nach zu urteilen, musste es sich um einen jungen Mann handeln, der ihn da bedrohte.
»Du legst dich jetzt flach auf den Bauch und verschränkst die Arme auf dem Rücken«, befahl die Stimme, die unvermittelt schwächer wurde. Fast kraftlos löste sich der Arm, und die Dolchspitze verließ sein Kinn. Marcus spürte eine zitternde Hand in seinem Nacken, die ihn bäuchlings zu Boden drückte. Dann ergriff der Fremde seine Handgelenkte und führte sie auf dem Rücken zusammen. Starr vor Angst lag Marcus da und wagte sich nicht zu rühren. Die Holzstange, auf der sein Oberkörper ruhte, drückte ihm unweigerlich in die Rippen. Jede Sekunde rechnete er damit, dass sich die Klinge des Dolches von hinten in seinen Rücken bohren würde. Doch der tödliche Stoß blieb aus.
In diesem Moment setzte die Musik wieder ein, und die Männer begannen zu johlen. Sie ahnten wohl schon, dass nun die sehnlich erwartete Tanzdarbietung der Schönheit, der Höhepunkt der abendlichen Vorstellung, beginnen würde. Voller Vorfreude starrten sie auf den Stoff des Vorhangs, der nun durch die Luft wirbelte und den Blick auf Patricia freigab. Mit verführerischen Schritten trat die Schöne im Takt der Musik hinaus in den Schein der Fackeln, der ihr Haar noch strahlender glänzen ließ. Mit beiden Händen hatte sie den Rock ergriffen und ihn ein wenig angehoben, sodass er den Blick auf ihre schlanken Fesseln freigab. Die eingängige, fröhliche Musik wurde immer schneller. Das kurze Thema der irischen Melodie schien sich rascher und rascher zu wiederholen, und Patricia hob mit jeder Wiederholung den Rock ein wenig höher. Dabei warf sie den Kopf von links nach rechts, sodass ihr lockiges Haar hin und her flog und die rote Mähne ihr sommersprossiges Gesicht immer wieder für Sekunden freigab. Der untere Saum hatte nun beinahe ihre Knie freigelegt, als ein gellender Ruf die Musik unterbrach: »Sünderin!«
Mit weit aufgerissenen Augen starrte Patricia in die Menge und blieb unvermittelt stehen. Auch die Musik verstummte auf der Stelle.
»Ein wahrer Sündenpfuhl hat sich hier im Lager des Erzbischofs aufgetan. Der Satan hat Einzug gehalten in Eurem Kreis, der zu dieser Stunde die Heiligen um ihre Fürsprache anflehen sollte, auf dass Gott, der Allmächtige, uns zum gerechten Siege führet.« Der neu ernannte Legat des Erzbischofs, Ignatius von Heinsberg, schritt, dicht gefolgt von einigen Klerikern, durch die Menschenmasse. Ein Diakon streckte ein reich verziertes Vortragekreuz in den Abendhimmel und teilte das Halbrund der Männer wie Moses einst das Rote Meer. Das geifernde Johlen verstummte, und selbst die fünf Störenfriede verhielten sich wie artige Knaben. »Bedeckt Euch, Weib, und fordert nicht länger die fleischliche Gier dieser gottesfürchtigen Männer heraus.« Sein ausgestreckter Finger zeigte auf Patricia. Erst jetzt merkte die Irin, dass sie den Rock immer noch geschürzt hielt, und ließ ihn sofort sinken. »Schloss nicht auch Salome, deine Schwester im Geiste, einen Pakt mit dem Bösen und tanzte für Herodes, bevor sie von ihm den Kopf des Johannes forderte? So bist auch du eine Tochter des Satans!«
Dobberstein erkannte gedankenschnell, dass die Lage zu eskalieren drohte, und schob die Verdutzte hastig hinter den Vorhang. Dann wandte er sich beschwichtigend an den aufgebrachten Geistlichen: »Verzeiht, Euer Hochwürden. Es war nicht unsere Absicht, die Männer zu verwirren und auf Abwege zu führen. Vielmehr stand uns der Sinn danach, die Vasallen des Erzbischofs zu zerstreuen, auf dass sie, gestärkt durch unser Tun, in den nächsten Tagen einen großen Sieg für die getreue Mutter Kirche erlangen.« Dabei verbeugte er sich tief und bedeutete seinen Leuten, sich zurückzuziehen. Sekunden später war niemand mehr auf dem Podium zu sehen, und nichts erinnerte an das muntere Treiben, das gerade noch die Gemüter in Wallung gebracht hatte.
»Und Ihr?«, der Legat wandte sich in seinem missionarischen Eifer an die umherstehenden Ritter, die sich um ihr abendliches Vergnügen beraubt sahen. Speichel hatte sich in den Mundwinkeln des Legaten gesammelt und bildete schaumige Bläschen wie Algengischt auf den Wellen einer herannahenden Sturmflut. »Sollten Eure Gaben nicht lieber den Armen gelten, statt diese nichtsnutzigen Wesen zu nähren? Wäre eine Geste der Nächstenliebe an einem Bedürftigen nicht gottgefälliger, als hier diesem heidnischen Treiben zu frönen?« Mit zornerfüllter Miene schaute er dabei von Mann zu Mann, fixierte Augenpaar um Augenpaar. Auch wenn der Kleriker in seiner Argumentation übersehen hatte, dass es sich bei den Spielleuten um die Ärmsten handelte, die das Lager zu bieten hatte, ergriff die Männer eine schuldbewusste Betroffenheit. Da es darüber hinaus nichts mehr zu begaffen gab, trollten sie sich und kehrten zu ihren Zelten zurück.
Der Schauplatz hatte sich bereits gänzlich geleert, als auch der Legat mit seinem Gefolge den ausgemachten Ort der Sünde verließ. Trotz seines klerikalen Zorns, der immer noch in ihm kochte, spürte der Gottesdiener eine Art Zufriedenheit, dem heidnischen Treiben ein Ende bereitet zu haben.
Vor dem Zelt war Totenstille eingekehrt. Nur der schwere Atem des Mannes neben Marcus war noch zu hören. Wer war der Fremde? Hätte er ihn töten wollen, so hätte er nur zustechen brauchen, als er Marcus von hinten gepackt hatte. Diese Schlussfolgerung beruhigte ihn ein wenig. Von Zeit zu Zeit meinte er ein leises Stöhnen zu vernehmen. Ein Stöhnen wie das eines Verwundeten. War dies der Grund, warum der Mann ihn nicht vollends überwältigt hatte? Der Grund, warum sein Arm so kraftlos niedergesunken war?
Noch lange hing Marcus seinen Gedanken und Ängsten nach. Mit einem Sterbenden in seinen Armen hatte der Tag begonnen und mit einem Dolch an der Kehle geendet. Doch hatte dieser Tag nur Grauenhaftes für ihn bereitgehalten? Nein, immer wieder rief er sich das Gesicht der schönen Irin ins Gedächtnis. Konzentriert auf ihre fröhlichen Augen und den Glanz ihres Haares, meinte er beinahe den Lavendelduft zu riechen, den ihr Körper ausgeströmt hatte. Schon im nächsten Augenblick rissen ihn die Worte des sterbenden Priesters aus seinen Träumereien: ›Schrein, Quirinus, Diebe, drei Muscheln, Armarius Niko…‹ Die tiefe Nacht war bereits hereingebrochen, bevor er trotz aller quälenden Gedanken einschlief.
*
Die Schatten rückten noch enger zusammen. »Habt Ihr es endlich gelöst?«, fragte der eine ungeduldig mit drohendem Unterton und hielt den Leuchter höher, sodass der Schein der Kerze das Gesicht seines Gegenübers erhellte.
»Bisher war meine Suche nicht erfolgreich«, entgegnete der andere. »Es ist recht beschwerlich, nur drei Stunden des Nachts suchen zu können. Meint Ihr nicht, dass …«
»Auf keinen Fall! Am Tage könntet Ihr entdeckt werden, und alles war umsonst. Schlagt Euch diesen Gedanken ein für alle Mal aus dem Kopf. Wie mir der Bote heute berichtete, sind bereits zwei Horte des Geistes in unserem Besitz. Der dritte folgt schon in den nächsten Wochen.«
»Und wenn ich letztlich nicht fündig werde und alles umsonst war?«
»Dann möchte ich nicht in Eurer Haut stecken. Ihr glaubt nicht im Ernst, ich wäre dieses Wagnis eingegangen, um am Ende mit leeren Händen dazustehen und schuldbeladen vor den Herrgott zu treten! Ihr habt es mir versprochen und werdet Eure Zusage halten.« Die Ungeduld in seiner Stimme wurde eindringlicher. Einmal mehr bereute der andere, dass er sich in einem Anfall des Leichtsinns offenbart hatte. Zu drückend war die Erkenntnis des Entdeckten geworden, als dass er sie länger für sich hätte behalten können. Die Begehrlichkeit, die er dadurch geweckt hatte, saß ihm nun bleischwer im Nacken, wie ein Gewicht, das die Waagschale unausweichlich herunterdrückt. »Die unumgängliche Geisel der Menschheit, der Krieg, wird Euch eine Galgenfrist gewähren. So werden meine Helfer noch einige Zeit brauchen, die Vorbereitung zu vollenden. Nutzt die Zeit, die Euch verbleibt.« Mit diesen drohenden Worten wandte er sich ab und verließ das nächtliche Treffen. Eilig führte der Zurückgebliebene seine Arbeit fort.
*
Durch die kleine Maueröffnung des Blutturms fiel spärliches Mondlicht ins Innere und ließ die Spuren der ersten Befragung in Janssens Gesicht erkennen. Hatte er zu Beginn alles noch für ein Missverständnis gehalten, so hatten die Schläge, die seine Nase zertrümmerten, jeden Zweifel zerstreut. Ein Geistlicher hatte sie bereits erwartet, als man ihn am Abend in den Blutturm, in das städtische Gefängnis, geführt hatte. Man hatte ihn nach Marcus gefragt und den Worten mit einigen Stockschlägen Nachdruck verliehen. Der Priester hatte stumm in einem der dunklen Winkel gestanden und keine Miene verzogen, als das Verhör mit unerbittlicher Brutalität fortgesetzt wurde. Immer wieder hatte Hubertus Hohenfels unerbittlich zugeschlagen.
Der zweite Tag
Die Sonne war schon lange über dem Lager aufgegangen, als Marcus, vom morgendlichen Treiben geweckt, die Augen aufschlug. Er rieb seinen schmerzenden Rücken und versuchte sich zu orientieren. Hatte er wirklich die ganze Nacht hier eingezwängt zwischen diesen Säcken auf einer Holzstange gelegen? Langsam drehte er sich in der Enge des Zeltes, als ihm die Erinnerung an den gestrigen Abend und das sanfte Lächeln Patricias in den Sinn kamen. Gleichzeitig durchfuhr ihn ein Schreck: Wer war der Mann mit dem Dolch gewesen? Das fast schon vertraute Stöhnen hinter seinem Rücken riss ihn aus den Gedanken. Marcus wandte sich ruckartig um und blickte auf einen in Decken gehüllten Körper, der nicht weit von ihm zwischen einigen Kisten lag. Das Stöhnen klang keineswegs Angst einflößend, nein, eher flehend und schmerzverzerrt. Dennoch kroch Marcus nur zögerlich in die Richtung, aus der die Geräusche zu ihm drangen. Unvermittelt bewegte sich das Bündel, und die Decke gab den Oberkörper eines Ritters frei. Rot unterlaufen stachen seine Augen aus einem kreidebleichen Gesicht heraus, auf dem kleine Schweißtropfen im Sonnenlicht schimmerten. Die schwarzen Locken des Mannes lugten unter einer Art Verband hervor, der provisorisch um den Kopf geschlungen war. Seine schmalen Lippen wirkten trocken und rissig. Aus seinem halb geöffneten Mund drang nun wieder dieses Seufzen. Der rot-schwarze Wappenrock war über und über mit Blut verschmiert. Marcus verstand bei diesem Anblick, warum der Mann am Abend zuvor hinter ihm kraftlos zusammengesunken war. Warum lag dieser Schwerverletzte hier im Vorratszelt zwischen Säcken, Stangen und Kisten, statt auf einem ordentlichen Lager gepflegt zu werden? Marcus fuhr herum, als der Eingang seiner Zuflucht geöffnet und das Innere mit Licht erfüllt wurde.
»Guten Morgen, äh …, wie ist eigentlich dein Name?« Fröhlich wippend streckte sich die rote Lockenmähne Patricias durch den Spalt der Zeltwand, und ein freundliches Lächeln erstrahlte.
»Äh, … Marcus«, antwortete er schüchtern.
»Gut, Marcus. Mein Name, also mein richtiger Name, auf den ich getauft wurde, ist Hildegund, doch mittlerweile nennen mich alle Patty.«
»Du bist keine …?«
Sie lachte hell auf. »Nein, keine Irin, wenn du das fragen wolltest. Es ist nur eine Art Rolle. Die Männer mögen das Unbekannte, das andere. Und so kam Dobberstein eines Tages auf den Gedanken mit ›Patricia‹, der Irin. Wegen meines roten Haars, verstehst du?« Dabei griff sie in ihre zerzauste Mähne und ließ sich eine lockige Strähne verführerisch ins Gesicht fallen. Die Haarspitzen kitzelten sie an der Nase, und sie begann zu kichern.