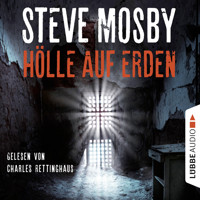12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Nach dem Tod seiner Frau Marie wollte Alex einfach nur vergessen. Lediglich seine Freundin Sarah hielt ihn noch aufrecht. Nun ist sie ermordet worden. Die Polizei hat zwar ihren Mörder, nicht aber ihre Leiche. Die Suche danach führt Alex in erschreckende Abgründe der menschlichen Seele. Detective Kearney geht es nicht anders. Er jagt einen Killer, der Frauen umbringt, indem er sie über Tage hinweg langsam verbluten lässt. Seine Ermittlungen führen Kearney in eine Welt dunkler Begierden, von der er nichts geahnt hatte, in der die üblichen Regeln nicht gelten – und in der das eigene Leben nur das Erste ist, was man verliert …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Ähnliche
Steve Mosby
Der Kreis des Todes
Thriller
Aus dem Englischen von Doris Styron
Knaur e-books
Über dieses Buch
Nach dem Tod seiner Frau Marie wollte Alex einfach nur vergessen. Lediglich seine Freundin Sarah hielt ihn noch aufrecht. Nun ist sie ermordet worden. Die Polizei hat zwar ihren Mörder, nicht aber ihre Leiche. Die Suche danach lässt Alex in erschreckende Abgründe blicken.
Inhaltsübersicht
Für Lynn
Prolog
Zum letzten Mal sah ich meine Frau an einem Januarabend vor zweieinhalb Jahren. Marie war sechsundzwanzig Jahre alt, trug eine schwarze Jacke zu dunkelblauen Jeans, und sie wollte eine Flasche Wein für das Abendessen kaufen, das ich gerade kochte. Sie durchschritt die Küche Richtung Wohnungstür, öffnete sie und ließ dabei lässig die Autoschlüssel hin- und herbaumeln, hielt dann inne und fragte:
»Willst du noch was, soll ich etwas mitbringen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nur, dass du wiederkommst.«
Sie antwortete nicht, aber in ihrem Schweigen lag die Frage:
Bist du sicher, dass du das willst?
Wir hatten zwei schwierige Wochen hinter uns. Seit ich Marie kannte, hatte sie schon immer depressive Phasen gehabt, Zeiten, in denen alles falsch war, was ich sagte oder tat. Dann folgten Tage, in denen sie sich nur immer entschuldigte, sich selbst hasste und fragte, was ich in ihr sah und warum ich bei ihr blieb. Ich wusste nicht, welche der beiden Situationen schwieriger war, aber im Moment befanden wir uns in einem Zwischenstadium. Wir fühlten uns viel besser als in den letzten paar Tagen, aber die Stimmung war immer noch unbehaglich.
Ich schaute sie an, und die Maskenhaftigkeit ihres Gesichts berührte mich schmerzlich. Ich wollte, du könntest sehen, wie schön du bist, dachte ich. Ich wünschte nur, du könntest das sehen. Aber ich zog es vor zu schweigen, weil ich wusste, dass sie diese Worte nicht akzeptieren würde. Sie würden an ihr abprallen, und dass ich nicht zu ihr durchdringen konnte, würde mich nur frustrieren und deprimieren; und das wiederum würde sie noch mehr bedrücken. Manchmal war sie wild entschlossen, nicht geliebt zu werden.
»Sonst nichts«, sagte ich.
Sie nickte, und ihr Gesicht war noch immer ausdruckslos. »Küsschen«, sagte sie.
Ich ließ den Kochlöffel liegen und ging zu ihr hin.
»Soll ich lieber fahren?«
»Nein, schon gut«, lehnte sie ab. »Ich liebe dich.«
Heute kommt es mir vor, als seien diese Worte zu schnell dahingesagt gewesen, aber damals war mir das nicht aufgefallen.
»Ich liebe dich auch.«
Sie schloss die Tür hinter sich. Kurz danach hörte ich, wie sie den Motor anließ und wegfuhr.
Damals war ich ein eher grüblerischer Typ. Ich machte mir oft Sorgen, malte mir alle möglichen verhängnisvollen Situationen aus und ging sie immer wieder durch, bis ich bei der schrecklichsten Version angekommen war. Dann zwang ich mich, sie genau zu durchleuchten. Wann immer Marie spät von der Arbeit heimkam, stellte ich mir vor, dass ihr etwas Entsetzliches zugestoßen sei. Was ist, wenn sie nicht zurückkommt? Je weiter der Minutenzeiger der Küchenuhr vorrückte, desto mehr Horrorvisionen entstanden in meiner Vorstellung. Spätnachts lag ich neben ihr und überlegte, wie es wäre, wenn einer von uns den anderen verlöre.
Ich weiß nicht, warum ich das tat, denn eigentlich war mir nie etwas wirklich Schlimmes zugestoßen. Aber vielleicht war es gerade deshalb so.
An jenem Tag hätte sie nach spätestens zehn Minuten wieder da sein müssen. Der Laden war praktisch um die Ecke, und irgendwie sorgte ich mich überhaupt nicht. Man denkt ja, dass man so etwas vorausahnen müsste, aber in Wirklichkeit ahnt man es eben nicht. Das Essen brutzelte also langsam vor sich hin, ich rührte immer wieder um, stieß den hölzernen Kochlöffel auf den Boden der Pfanne und ahnte nicht, dass meine Welt lautlos untergegangen war, ohne dass ich es bemerkt hatte.
Ich erinnere mich nicht mehr, wann dunkle Gedanken in mir aufstiegen, aber ich weiß noch, dass ich genau vierzig Minuten nach ihrem Weggehen fand: Also, jetzt reicht’s!, und sie auf ihrem Handy anrief.
Ein Polizist meldete sich. Im Hintergrund hörte ich Martinshörner und Verkehrsgeräusche, und da wusste ich sofort, dass diesmal wirklich etwas passiert war. In Krisensituationen übernimmt oft ein Teil unseres Unterbewusstseins das Kommando; während ich mit ihm sprach, war ich fast schockierend ruhig. Erst hinterher, als ich meinen Mantel nahm, wurde mir klar, dass ich kaum ein Wort verstanden hatte von dem, was er sagte, und dass das, was ich aufgenommen hatte, keinen Sinn ergab.
Marie sei auf der Umgehungsstraße, die um den Stadtkern herumführte, von einem Lkw angefahren worden, hatte er gesagt. Ich hatte das so interpretiert, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen war, aber dann ging mir auf, dass sie doch überhaupt nicht in der Nähe der Umgehungsstraße hätte sein dürfen. Und in einem anderen Satz hatte er angedeutet, dass sie nicht in ihrem Wagen gewesen war, als es passierte. Auf dem Polizeirevier informierte man mich später umfassend, und ich begriff, wie diese Einzelheiten zusammenhingen. Sie war gar nicht durch den Lkw umgekommen. Sondern der Sturz aus fünfzehn Metern Höhe von einer Brücke hatte sie getötet. Dort oben hatte man auch ihren Wagen gefunden.
Die Polizei redete immer von dem Sturz, nicht von einem absichtlichen Sprung, aber im Tonfall derjenigen, die damals mit mir sprachen, schwang das Wort doch mit. Ich hörte den missbilligenden Ton heraus und hatte das Gefühl, dass man fand, ich hätte nicht so viel verloren wie andere in ähnlichen Situationen.
Im Allgemeinen gibt es zwei verschiedene Auffassungen zum Selbstmord. Entweder haben die Leute Mitgefühl mit dem Selbstmörder und betrachten seinen Tod als Tragödie, oder sie verurteilen ihn als absolut egoistisches Verhalten. Manche vermischen wohl beides. Ich weiß all das, deshalb fiel es mir leicht, die Einstellung der Polizei zu verstehen. Man sagte mir, der Lkw-Fahrer hätte dabei umkommen können. Tatsächlich würde er sich vielleicht nie mehr von dem erholen, was er an jenem Tag erlebt hatte.
Ich versuchte, Mitgefühl zu empfinden. Aber ich brachte es nicht über mich, so zu denken wie die Allgemeinheit. Ich gab ihr keine Schuld. Ich war nicht wütend auf sie. Und ich hasste sie nicht wegen dem, was sie uns angetan hatte, keine Sekunde lang.
Denn ich erinnerte mich an ihren Gesichtsausdruck, als sie an jenem Tag wegging: voller Bedauern für all das, was sie glaubte, mir angetan zu haben; voller Selbsthass, der sich immer mehr steigerte. Ich erinnere mich an die letzten Worte, die sie mir sagte: Ich liebe dich. Und ich wusste, dass Marie, was immer andere auch denken mochten, nicht im Geringsten egoistisch gehandelt hatte, zumindest nicht, was mich betraf. Wie fehlgeleitet ihre Absichten auch gewesen sein mochten, tat sie das, was ihrer Vorstellung nach das Beste für mich sei. Sie glaubte, mir das Leben zu retten, wo sie es doch völlig zerstörte.
Aber das begriff ich erst sechs Monate später.
Damals war ich gerade dabei, das Haus zu verkaufen, weshalb ich diverse Unterlagen durchgehen musste; ich hatte das eine Weile vor mir hergeschoben, weil es mir widerstrebte, mich damit zu befassen. Dabei entdeckte ich, dass Marie eine zusätzliche Lebensversicherung abgeschlossen hatte, für die sie jeden Monat zwanzig Pfund eingezahlt hatte. Es war unglaublich, aber sie belief sich jetzt auf eine einmalige Zahlung von fast einer halben Million Pfund.
Die Selbstmord-Klausel des Vertrags war nach den ersten zwei Jahren ungültig geworden. Marie hatte zwei Jahre und acht Tage gewartet. So lange im Voraus hatte sie ihre Tat geplant, ohne dass ich davon wusste oder es auch nur ahnte.
Wie gesagt, ich habe ihr das nie vorgeworfen. Ich fand immer, dass es dafür viel lohnendere Zielobjekte gab.
Damals sah ich also meine Frau zum letzten Mal lebend.
Aber es war nicht das letzte Mal, dass ich sie sah.
ERSTER TEIL
1
Ihr Vater spricht zu ihr über den Tod.
Sein Blick ist die ganze Zeit sehr ernst. Seine Augen sehen aus, als wären sie mit einer sauberen roten Linie umrandet.
Sie versucht zu verstehen, aber manchmal schafft sie es nicht, und beide verlieren die Fassung. Der Tod ist ein Ungeheuer, sagt ihr Vater – wie die in den dünnen Märchenbüchern, die in ihrem Zimmer liegen. Wie ein Drache?, fragt sie, aber er schüttelt den Kopf. Er ist größer und viel schrecklicher. Ein Drache kann nur an einem Ort sein, aber der Tod kann überall sein, wo er will. Er stößt kein Feuer aus. Er atmet Traurigkeit.
Sarah sitzt im Schneidersitz in einer Ecke des Sofas, hält ein Kissen umklammert und drückt es an sich. Ihr Vater kauert vor ihr. Es ist Abend, im Zimmer ist es düster. Er streckt die Hand aus und macht eine Geste, als hätte er ein Stückchen Tod aus der Luft gegriffen. Dann löst er die Finger voneinander.
Er hat das alles so genau erklärt, dass Sarah es fallen sieht. Der Tod zieht Kreise, sagt er.
Sie schaut mit zusammengekniffenen Augen die rauhen Teppichfasern an und stellt sich vor, wie sich der Tod in wellenförmigen Kreisen ausbreitet, als hätte man einen Stein ins Wasser geworfen. In einem ihrer Schulbücher gibt es ein Bild, auf dem ein Rettungsboot auf einer Welle schwimmt; die Bootsleute in ihren gelben Jacken halten in der stiebenden Gischt ihre Kapuzen fest. Aber sie muss ja nicht mehr zur Schule gehen.
Der Tod ist ansteckend, Sarah. Das heißt, er verbreitet sich wie eine Krankheit.
Dieses Wissen ängstigt sie am meisten. Denn der Tod hat bei ihnen zu Hause schon einmal zugeschlagen, und wenn man sich anstecken kann wie bei einer Erkältung, dann kann es demnächst einen von ihnen erwischen. Oder beide. Auch ihr Vater scheint das zu fürchten. Deshalb starrt er sie auch so an, und sie starrt zurück. Es ist, als ob die Intensität ihrer Blicke das Monster fernhielte.
Immer bricht ihr Vater den Bann zuerst.
Dann schlurft er davon. Manchmal scheint er frustriert. Einmal hört sie ihn weinen, was ihr noch mehr Angst einjagt, denn Väter weinen doch nicht. Aber ihr Kopf ist genauso voller Todesgedanken wie der ihres Vaters, und sie weiß, dass er ihr nur zu helfen versucht. So wie sie oft miteinander schwierige Sätze gelesen haben, sich geduldig von einem Wort zum nächsten vorarbeiteten, bis sie einen Sinn ergaben. Wenn sie ihn weinen hört, nimmt sie sich vor, sich beim nächsten Mal mehr Mühe zu geben.
Aber es ist schwer, weil sie auch gern weinen würde, jedoch das Gefühl hat, sie sollte das nicht tun. In der vergangenen Woche war sie nachts aufgewacht und hatte geglaubt, in einer Ecke ihres Zimmers ihre Mutter zu sehen, von einem Strahlenkranz umgeben wie eine Heilige. Es war ja nur ein Traum gewesen, aber am nächsten Morgen erzählte sie ihn ihrem Vater, weil sie meinte, er würde gern davon erfahren, und weil sie sich wünschte, er möge sagen, vielleicht sei es Wirklichkeit. Aber er fragte:
Hat sie noch geblutet?
Nein, Daddy, antwortete Sarah. Sie hat gelächelt, wirklich.
Aber statt sich zu freuen, durchsuchte er die Wohnung. Selbst jetzt sucht er noch nach ihr. Er kauert sich vor sein Bett, hebt die Steppdecke, um darunterzuschauen, und spricht dann ins Leere.
Der Tod ist ein Monster, Sarah.
Sie sagt: Aber wie können wir uns gegen ihn wehren?
Das scheint eine sehr wichtige Frage zu sein. Ihr Vater denkt einen Moment darüber nach und beginnt dann zu erklären, so gut er kann. Sie hängt an seinen Lippen.
Es gibt Leute, sagt er, die haben solche Angst vor dem Monster, dass sie versuchen, es zufriedenzustellen.
Wie wenn man zu einem Schläger freundlich ist?, fragt sie. Ja, sagt er, und der Mann, der deine Mutter verletzt hat, war so einer. Aber es gibt Leute, die sich abwenden und weglaufen, weil sie zu große Angst haben, sich dem zu stellen.
Wir dürfen das nicht tun.
Ihr Vater drückt sanft ihre Schulter, damit sie begreift, wie wichtig das ist.
Wir müssen ihm ins Auge sehen. Wir müssen ihn anschauen, verstehst du?
Sie nickt. Aber er hat ihre Frage nicht beantwortet, und jetzt hat sie noch größere Angst als zuvor. Denn es fühlt sich an, als hätte ihr Vater den Kampf schon aufgegeben, er starrt ihr nur immer in die Augen.
Manchmal sieht sie ihn an der Haustür sitzen, wo er durch den Briefschlitz mit Leuten spricht, denen er sagt, es gehe ihm gut und sie sollten weggehen und sie beide in Ruhe lassen. Sie weiß, dass es ihre Tante ist, weil ihr Vater ihr einmal befahl, in den Flur zu kommen und ihr zu sagen, dass alles in Ordnung sei. Aber nie macht er die Tür auf.
Jeden Tag hört Sarah beim Aufwachen, dass er in der Küche auf und ab geht. Die Wohnung riecht nach Zigarettenrauch. Wie blaue Seidentücher hängt er überall, wo ihr Vater war, in der Luft. Morgens, wenn sie noch im Bett liegt, raucht er nur in der Küche. Sie bleibt liegen, bis sie hört, dass das Fenster geöffnet und dann geschlossen wird.
Als sie heute aufwacht, ist es still in der Wohnung.
Eine Stille, die einem in den Ohren dröhnt, wie wenn man sich den Kopf angeschlagen hat; dann hallt es wie eine Glocke. Es ist der Nachhall, den ein Verschwundener hinterlässt.
Sarah schlüpft fast lautlos unter ihrer Decke hervor und schleicht den Flur entlang. Ihr Vater ist nicht in der Küche. Es hängt kein Rauch in der Luft. Die Tür seines Zimmers ist geschlossen. Sie geht darauf zu und klopft leise an. Keine Antwort.
Daddy?
Keine Antwort.
Sie drückt die Klinke hinunter und stößt die Tür auf; sie öffnet sich nur einen winzigen Spalt. Denn dahinter liegt etwas, das sie blockiert und am Aufgehen hindert.
Etwas bringt Sarah schließlich dazu, sich gegen die Tür zu stemmen. Sie begreift, was geschehen ist. Während sie schlief, ist der Tod wieder in ihr Zuhause eingedrungen. Durch den kleinen Spalt kann sie seinen unheilvollen Atem riechen.
Zuerst erstarrt sie und steht regungslos. Dann will sie weglaufen.
Aber sie darf sich nicht abwenden. Mit der ganzen Kraft ihres kleinen Körpers stemmt sich Sarah fester gegen die Tür, denn sie weiß, dass sie es sehen muss.
Sie ist neun Jahre alt.
Und jetzt war sie dreißig.
Das Leben war weitergegangen, aber diese Erinnerungen kamen ihr frischer vor als das, was gestern geschehen war. Sie waren ihr näher. Bildete nicht die Vergangenheit eine Art Schablone für alles, was später folgte? Im Lauf der Zeit fügte man neue Linien hinzu – oder sie wurden ohne eigenes Zutun eingefügt –, aber die alten blieben bestehen, und manchmal hoben sie sich nach und nach deutlicher ab. Man musste sie nur oft genug nachzeichnen.
So kam es, dass das Vermächtnis ihres Vaters, die Entschlossenheit, immer hinzusehen, egal wie schrecklich es sein oder wie schwer es einem fallen mochte, sie nie verlassen hatte. Sondern die Entschlossenheit war gereift und gewachsen und leitete sie immer noch, genauso wie die Gesichtszüge des kleinen Mädchens im Gesicht der erwachsenen Frau noch deutlich erkennbar waren.
Sarah schüttelte den Kopf und faltete dann Alex’ Brief zusammen. Er hatte ihn vor zwei Jahren geschickt, an dem Tag, als er Whitrow verließ, und seitdem hatte sie ihn so oft gelesen, dass das Papier schon ganz abgegriffen war. Manche Passagen kannte sie sogar auswendig. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast, und dass du versucht hast, mir zu helfen. Ich hoffe, du kannst das, was ich tue, verstehen und mir vergeben. Aber sie las ihn trotzdem noch einmal, denn heute schien es wirklich gut zu passen. Heute, zwei Jahre danach, würde auch sie aufbrechen.
Wie immer hatte der Brief ihre Erinnerungen geweckt.
Du hattest recht, hatte er geschrieben. Der Tod zieht Kreise.
Sie steckte den Brief in ihre Tasche.
Den würde sie beim Einpacken jedenfalls nicht vergessen. Über den Rest zu entscheiden, würde ihr schwerer fallen, und dabei blieb ihr keine Zeit mehr.
Draußen vor dem Fenster begann sich der Abend herabzusenken, und das Zimmer kam ihr trostlos und grau vor. Sie schaute auf ihre Uhr. Es war kurz vor sieben, was hieß, dass das Taxi, das sie bestellt hatte, in ein paar Minuten hier sein würde. Und sie hatte die Dinge überhaupt nicht im Griff.
Ohne es zu bemerken, hatte sie angefangen, an ihrem Fingernagel zu knabbern.
Hatte sie alles, was sie brauchte? Die Tasche vor ihrem Bett war nur halbvoll. Sie hatte genug Kleider, um damit auszukommen. Sie sorgte sich mehr wegen all der persönlichen Dinge, ohne die sie nicht leben konnte, die kleinen Geschenke und die Fotos, die an sich unbedeutend, aber mit Erinnerungen verknüpft waren. Man dachte eigentlich nie an solche Dinge, bis man sie vor sich sah oder nach ihnen verlangte.
Sie hatte den größten Teil des Nachmittags damit verbracht, im Haus nach den Dingen zu suchen, die sie mitnehmen wollte. Natürlich regte sich James darüber auf, und sie hatte vorgeschlagen, dass es für sie beide leichter wäre, wenn er eine Weile ausginge. Aber er hatte das abgelehnt. Er saß einfach da und beachtete sie nicht. Tat so, als sei nichts geschehen. Sein Gesichtsausdruck war versteinert, doch merkte man ihm seine Traurigkeit deutlich an, und es konnte sein, dass sie wegen ihrer Schuldgefühle etwas Wichtiges vergessen hatte.
Von unten war ein Klirren zu hören.
Sarah horchte und nagte dabei immer noch an ihrem Fingernagel herum. James spülte wohl das Geschirr – oder vielmehr schleuderte er die Teller extra laut in die Spüle, damit sie es mitbekam. So war er. Noch nie hatte er sich gut ausdrücken können, trotzdem gelang es ihm meistens, rüberzubringen, was er meinte, wenn er nur wollte. Sie hatte sich daran gewöhnt, dass man die jeweilige Variante seiner Wut erfassen und interpretieren musste. Im Moment wollte er sagen:
Verlass mich nicht.
James besaß seine eigene Schablone, deren Linien er zu oft nachgezogen hatte. Seine früheste Erinnerung, hatte er ihr gesagt, sei der Weggang seines Vaters gewesen. Der Mann stieg in sein Auto, um davonzufahren, und James stand weinend daneben und bettelte, er solle nicht gehen. Sein Vater hatte ihn mit sanftem Nachdruck von sich geschoben, damit er die Wagentür schließen konnte.
Wieder ein Klirren.
Es tut mir leid, James.
Gestern Nacht hatte er sie gefragt, ob sie ihn liebe, und sie hatte ja gesagt. Es stimmte. Als er fragte, warum das nicht genüge, wusste sie keine Antwort. Die Frage hatte schon tagelang im Raum gestanden, bevor er sie schließlich aussprach. Und jetzt war sie immer noch da. Sarah hatte fast Angst, hinunterzugehen und jetzt mit ihm konfrontiert zu werden. Aber sie war nie jemand gewesen, der sich abwandte.
Draußen hupte ein Auto – das Taxi war da.
Auf das Hupen folgte von unten unmittelbar ein klirrendes Geräusch. James hatte ein Glas zerbrochen. Entweder es war ihm heruntergefallen, oder er hatte es, was wahrscheinlicher war, zu Boden geschleudert.
Sarah riss sich endlich zusammen, griff entschlossen nach ihrer Tasche und trat auf den Treppenabsatz hinaus. Die Tür zum Gästezimmer stand offen. All ihre Sachen waren hier oben in Schachteln verpackt und standen auf dem Regal. Vielleicht sollte sie sie mitnehmen? Aber sie musste doch endlich einen Schlusspunkt setzen.
Sie hängte sich die Tasche über die Schulter und stieg vorsichtig die schmale Treppe hinunter.
James hatte bereits getrunken. Wahrscheinlich war er inzwischen schon besoffen. Das war nichts Außergewöhnliches, aber heute beunruhigte es sie, weil er unberechenbar und launisch sein konnte. Es hatte noch keine Szene gegeben, es sei denn, man zählte das Schweigen als solche – aber sie befürchtete, dass es dazu kommen würde. Vielleicht würde er sie anflehen, nicht zu gehen. Oh Gott, sie hoffte, dass er es nicht tun würde. An ihrer endgültigen Entscheidung würde das nichts ändern, aber es würde alles für sie beide und vor allem für ihn noch schwerer machen.
Aber irgendwo tief im Innern, meinte Sarah, kapierte er es doch. Er liebte sie eben mehr als irgendetwas sonst und wollte sie nicht missen. Deshalb war es so schwer für ihn, und deshalb würde er sich ihr letzten Endes nicht in den Weg stellen.
Es wird schon glattgehen, sagte sie sich.
Betrunken oder nicht, er würde nicht versuchen, sie aufzuhalten.
2
Es klang wie ein Schuss.
Das Geräusch kam von irgendwo oben und hallte auf dem leeren Platz wider.
Ich blickte hinauf. Natürlich war es nicht wirklich ein Schuss gewesen. Das Geräusch kam von einer alten Frau aus dem dritten Stockwerk. Sie schüttelte in der Spätnachmittagssonne eine verblasste rote Decke aus, von der eine Staubwolke auf mich herabdriftete. Nachdem sie noch einmal mit einem klatschenden Geräusch die Decke geschlenkert hatte, wandte sie mir ihr faltiges Gesicht zu und rief etwas auf Italienisch.
Ich hatte keine Ahnung, was sie meinte, aber sie war offensichtlich nicht gerade begeistert von mir. Vielleicht fragte sie sich, warum ich nicht unten auf dem Markusplatz war wie alle anderen auch, statt auf ihrer Piazza im Weg herumzustehen. Touristen. Es war zwei Jahre her, seit ich England verlassen hatte; die ganze Zeit war ich gereist, dabei tiefbraun geworden, und mein sonnengebleichtes Haar war lang gewachsen. Aber wo ich auch hinkam, wurde ich immer noch sofort als Engländer eingestuft. Sogar bevor ich den Mund aufmachte.
»Dispiace«, sagte ich.
Sie reagierte nicht auf meine Entschuldigung. Ich stand auf und entfernte mich über den Platz. Einige Meter weiter blickte ich zurück und sah die alte Dame mit einem aufgebrachten Scheppern ihren Rollladen herunterlassen.
Und dann herrschte wieder herrliche Stille.
Ich war seit nahezu einer Woche in Venedig. Meistens lief ich einfach allein herum, suchte mir kleine Plätze wie diesen hier aus. Es war das Gleiche, wo immer ich hinkam – ich versuchte, die üblichen Attraktionen zu meiden. Am besten gefiel es mir, die weniger bekannten Viertel auszukundschaften, die kleinen Straßen abseits der Touristenmassen. Tatsächlich war ich ja nicht auf Urlaub hier und deshalb nie darauf aus, Schnappschüsse und Erinnerungen zu sammeln. Es ging mir mehr darum, einen anderen, unverbrauchten Ort zu finden, mich dann eine Weile dort aufzuhalten und mich darin zu verlieren.
Nach ein paar Tagen an einem solchen Ort, wenn ich begann, die Leute und die Wege wiederzuerkennen, meldete sich immer drängender der Wunsch weiterzuziehen. Es war, als hätte ich die Fremdheit der Stadt, in der ich mich aufhielt, aufgebraucht und müsste mir eine neue suchen. Entweder das, oder ich hatte das vage Gefühl, dass langsam ein Schatten von etwas Riesengroßem auf mich fiel, das aus der Ferne auf mich zukam. Jedes Mal, wenn das geschah, packte ich, ohne mich weiter zu besinnen, meinen kleinen Rucksack und verließ die Stadt so bald wie möglich. Bei diesen Gelegenheiten fuhr ich oft besonders weit, obgleich ich begriff, dass ich nicht wirklich verfolgt wurde.
Jetzt verließ ich meine Piazza und atmete die warme Luft ein.
Venedig war von allen Orten, die ich besucht hatte, einer der ersten, der mich zurückzuhalten drohte. Die Stadt gefiel mir sehr, die kleinen schattigen Alleen und die trockenen, versteckten Plätze, die staubigen Bögen und die geheimen Fußwege. Über hundert verschiedene Inseln, durch Wasser getrennt und durch Brücken zu einem Flickenteppich zusammengefügt. Man ging darin spazieren, und alles kam einem wie ein zusammenhängendes Ganzes vor, aber das traf nicht zu. Wenn man zu fest auftrat, knarrte es im Boden der Stadt wie auf dem Deck eines alten Schiffes.
Ich wohnte im nördlichen Teil in einer Art Jugendherberge. Tatsächlich hatte ich noch immer mehr Geld, als ich ausgeben konnte, aber das war der Unterkunftsstandard, nach dem ich mich normalerweise überall umsah. Die Jugendherbergen oder Hostels waren einfach und spartanisch, und mehr brauchte ich nicht, aber zugleich ging es dort auch anonym und ungezwungen zu. Wo immer ich hinkam – ich hatte mich an die gleichen rauhen Laken auf den Betten, die gleichen Duschen, dasselbe Klackern der Poolbillardkugeln gewöhnt, das aus nur unwesentlich unterschiedlichen Spielhallen zu hören war. Die Zimmergenossen wechselten zwar ständig, doch irgendwie war es immer das Gleiche.
Zurzeit teilte ich mir das Zimmer mit Dean, einem Amerikaner. Er reiste mit einer Gruppe von Freunden und hatte in Bezug auf die Unterbringung das Unglückslos gezogen und war übrig geblieben. Er war ein bisschen geschwätzig, aber sonst eigentlich in Ordnung. Die ganze Gruppe reiste mit Rucksack den Sommer über durch Europa und hatte als Ziel Pamplona, wo sie sich von den Stieren jagen lassen wollten. Aus meiner Sicht wären Stiere, die die Straße herunter auf mich zugerannt kommen, ein klarer Hinweis darauf, dass ich mich schnellstmöglich verkrümeln sollte, und da die Veranstaltung außerdem weltberühmt war, konnte ich wirklich keinen Grund dafür sehen, dort hinzufahren.
Aber er war erst neunzehn, und zehn Jahre machen einen großen Unterschied. Vielleicht gehört das zum Jungsein, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Sich an den Tod heranzuschleichen, ihm eine Ohrfeige zu verpassen und dann wegzulaufen und sich unbesiegbar zu fühlen, weil er einen nicht beachtet hat. Die Wahrheit ist, man wird niedergewalzt, wenn es mit dem Sterben ernst wird, ganz egal, wie verdammt schnell man rennt. Aber ich mochte Dean und hoffte, dass die Sache ihm die Art von Selbstbestätigung bescheren würde, die er zu brauchen glaubte.
Als ich zurückkam, war er nicht da. Das Fenster stand etwas offen, ich hörte die Schreie der Möwen, die sich auf der Brise an Land tragen ließen, und witterte die Luft, die den Geruch des Wassers mit sich führte.
Ich griff nach dem kleinen Kleiderstapel, den ich unter dem Bett aufbewahrte, wechselte das T-Shirt und benutzte mein Deo.
Bevor ich mich anzog, betrachtete ich mich in dem schmalen Spiegel an der Tür des Kleiderschranks. Ich sah einen zweiunddreißigjährigen Mann mit langem blondem Haar, Bartstoppeln und gleichmäßiger Bräunung. Durch das einfache Leben war ich überflüssiges Gewicht losgeworden, und mein Körper sah trainiert und stark aus wie ein Strick, der dazu da ist, jeden Tag Lasten zu tragen. Jeder, der früher einmal einen jungen Mann namens Alex Connor kannte, hätte ihn kaum wiedererkannt. Selbst mir kam es vor, als sehe ich einen Fremden vor mir oder das Spiegelbild von jemandem, der nicht wirklich hier war.
Ich schlüpfte in das T-Shirt und ging auf einen Drink hinunter.
Die Halle in diesem Hostel war so, wie ich mir einen Gemeinschaftsraum im Knast vorstelle: Eine hohe Decke, die Wände graubraun gestrichen, und es standen viele schäbige alte Sessel herum. Am einen Ende stand ein Billardtisch und am anderen auf einem Schwenkarm an der Wand ein kleiner Fernseher. Keile hielten die Glastüren zu einem Innenhof offen, der auf einen besonders abwasserreichen Teil des Kanals hinausging. Ich holte mir eine Flasche Eurobier von der Rezeption und ging dann hinein.
Einige Gruppen junger Reisender saßen herum und unterhielten sich. Ein Mädchen fasste mit beiden Händen ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und hielt es von ihrem leuchtend roten Sonnenbrand weg. Alle schienen aufgeregt, gespannt, erwartungsvoll. Es war immer das Gleiche mit den jungen Reisenden, die ich im Lauf der letzten beiden Jahre getroffen hatte. Wenn sie von einem Gebäude sprangen, erwarteten sie, dass in der Nacht vorher ein Sicherheitsnetz gespannt worden war. So wie Deans potenzieller Selbstmord bei der Stierhatz hätte mich das vielleicht ärgern sollen, tat es aber nicht. Ich erinnerte mich, dass ich mich selbst so gefühlt hatte, und jetzt vermisste ich dieses Lebensgefühl. Auf keinen Fall wollte ich den Spielverderber geben und wie ein griesgrämiger Alter am Rand des Spielplatzes stehen und schimpfen.
Ich trat auf den Innenhof hinaus, legte die Ellbogen auf die abblätternde Farbe der Brüstung und sah dem Wasser zu, das sanft an die Seite des Kanals schwappte. Die Abendsonne glänzte auf der dunklen Wasseroberfläche. Alles war ruhig und friedlich, und ich schloss einen Moment die Augen und sog die Atmosphäre in mich auf. Als ich sie wieder aufschlug, klapperte eine makellos schöne Frau mit Sonnenbrille und hohen Absätzen drüben auf dem Kopfsteinpflaster des Gehwegs vorbei. Sie trug eine große viereckige Tasche. Zielstrebig entfernte sie sich. Hinter mir im Raum hörte ich die Leute lachen.
»Wer bist du?«, raunzte eine leicht missmutige Männerstimme neben mir. Ich wandte den Kopf, aber es war niemand da.
Ich trank einen Schluck von meinem Bier und sah zu, wie die Frau ein paar Stufen hochging und um eine Ecke verschwand; vielleicht betrat sie eine ganz andere Welt. Das Lachen hinter mir klang jetzt viel weiter weg als zuvor, als trennten mich nicht nur die Distanz und das Alter von den Leuten da drinnen, sondern etwas Tieferes. Die Traurigkeit senkte sich wie ein grauer Vorhang in meinem Inneren herab.
Es war Zeit weiterzuziehen. Morgen.
Ich ging in den Aufenthaltsraum zurück und hatte vor, eine Flasche Bier mit aufs Zimmer zu nehmen. Vielleicht später auszugehen und etwas zu essen, dann zurückzukommen und zu versuchen, trotz der sich wiederholenden Hits, die dumpf hinter den Wänden dröhnten, zu schlafen. Dann früh aufzubrechen …
Aber stattdessen hielt ich in der Mitte des Raumes plötzlich inne.
Zuerst war ich nicht einmal sicher, warum. Da lief etwas im Fernsehen. Das war mir klar. Aber ich brauchte einen Augenblick, um es zu erkennen und zuzuordnen.
Sarah ist im Fernsehen.
Ein Foto von ihr nahm die linke Seite des Bildschirms ein. Es war eine alte Aufnahme, auf der ich sie fast nicht erkannte. Sie war irgendwo im Freien und kniff im Sonnenlicht die Augen zusammen. Ihr Gesicht mit dem etwas schiefen Lächeln und ihr leuchtend rotes Haar nahmen den größten Teil des Bildes ein, aber ich entdeckte in einer Ecke Gras, und sie lehnte sich an die Schulter von jemandem links hinter ihr.
Auf dem rot unterlegten Spruchband am unteren Bildschirmrand stand:
SEIT FÜNF TAGEN VERMISST; FELD ABGESUCHT
Auf der rechten Seite war das Luftbild eines Feldes zu erkennen. Es schienen Live-Aufnahmen zu sein, die aus einem darüber kreisenden Hubschrauber gemacht wurden. Auf dem Boden darunter war neben einer Hecke ein großes Zelt aufgestellt worden, um das herum sich kleine weiße Gestalten bewegten. Manche durchsuchten das Gras in der Nähe. Es gab keinen Ton dazu.
Ich trat zwischen die Sessel beim Fernseher und blickte auf das Mädchen hinunter, das am nächsten saß.
»Kann man den Ton anstellen?«
»Was?«
»Den Ton?«
Ich versuchte es an der Seite des Apparats. Das billige Plastik quietschte, aber ich fand keine Knöpfe. Ein absurdes Gefühl von Machtlosigkeit ergriff mich.
»Was«, sagte das Mädchen, »kennst du sie?«
Ich wollte antworten, aber dann erschien etwas anderes auf dem Bildschirm.
Auf der rechten Seite sprach jetzt ein Reporter in ein Mikrofon. Hinter ihm sah ich einen Feldweg und ein Tor, vor dem ein Polizist Wache hielt. Und auf der linken Seite war jetzt statt Sarahs Foto ein anderes erschienen.
Es zeigte meinen Bruder James.
3
Vor zweieinhalb Jahren, am Tag von Maries Begräbnis, geschah etwas Seltsames. Ich wachte auf, und absolut alles war in Ordnung. Das dauerte ein paar Sekunden. Dann bemerkte ich das leere Bett neben mir, nahm die Stille im Haus wahr und erinnerte mich, was meine Frau getan hatte.
Kaum hatte ich mich aus dem Bett geschwungen, war ich ganz weit weg von allem. Schon damals hatte ich gelernt, mit den Dingen umzugehen, indem ich mich vor ihnen versteckte oder floh. Ich war nie wie Sarah gewesen, entschlossen, mich den Problemen direkt zu stellen. Sondern ich war immer in Bewegung. Es war, als sei der Druck, der von dem Geschehen ausging, körperlich – wie ein Faustschlag, dem ich ausweichen konnte, wenn ich schnell genug den Kopf einzog. Ein Schlag, der mich zu Boden strecken würde, wenn er mich mit voller Wucht erfasste.
Ich duschte, ging dann hinunter, machte mir einen Kaffee mit einem Schuss Wodka und zog meinen Anzug an. Von elf Uhr an öffnete ich völlig mechanisch die Tür, bat Freunde herein und ließ all die gutgemeinten Worte und das sanfte Schulterklopfen über mich ergehen.
Und dann schlenderte ich irgendwann durch die Küche, trat in den Garten hinaus, scheinbar, um eine Zigarette zu rauchen, und ging einfach weg.
Es fiel mir leichter, als zu erwarten war, weil es fast automatisch ablief. Ich ging einfach los, zuerst langsam, dann schneller, und bis ich das Ende der Straße erreicht hatte, rannte ich, und mein Herz pochte in der Brust.
Ich fühlte mich höllisch aufgekratzt.
Um zwei Uhr, als der Trauergottesdienst beginnen sollte, saß ich im Biergarten eines kleinen Pubs, dem Cockerel. Es war eine verlotterte Kneipe am Arsch der Welt hinter der Grindlea-Siedlung. Der Tag war klar und frisch, kam einem aber irgendwie unbeständig vor. In der Nacht hatte es heftig geregnet, die Tropfen hatten an mein Schlafzimmerfenster geschlagen wie eine Handvoll Steine, und im Rinnstein standen jetzt noch schmutzige Pfützen. Die Luft war noch feucht, und die Welt schien leise zu zittern, als sei sie durchnässt draußen in der Kälte zurückgeblieben.
Ich saß auf einer klapprigen Holzbank und trank ein Bier nach dem anderen, Wodka auf Wodka und beobachtete mit fast professioneller Distanziertheit den Minutenzeiger meiner Uhr.
Der Pfarrer wird ihnen sagen, was für ein wunderbarer Mensch Marie war.
Was ja auch stimmte.
Eine Minute später: Er wird das Wort »Tragödie« nicht auslassen.
Ständig wurde meine Aufmerksamkeit hingezogen zu einem der Häuser gegenüber. Daran flitzten Autos vorbei. Oberflächlich betrachtet war es ein ganz harmloses Gebäude und unterschied sich durch nichts von den Nachbarhäusern. Eine Doppelhaushälfte wie jede andere aus roten Backsteinen, die Vorhänge zugezogen, und von der alten Haustür blätterte die Farbe ab. Der kleine Vorgarten war ungepflegt und schmuddelig, wie Haare, die zu kämmen der Besitzer sich nicht mehr die Mühe machte.
Schließlich war mein Glas wieder leer, und es war Zeit, ein weiteres zu holen. Nachdem ich gezahlt hatte und wieder hinauskam, fand ich Sarah an meinem Tisch sitzend.
Sie hatte langes, leuchtend rotes Haar, ein hübsches Gesicht voller Sommersprossen und trug eine schwarze Jacke zu schwarzer Hose und Bluse. Ich blieb stehen, ging dann hinüber, setzte mich und stellte mein Bier und den Wodka auf den Tisch zwischen uns.
»Ich wusste nicht, dass du kommen würdest«, sagte ich. »Sonst hätte ich dir einen Drink mitgebracht.«
Sie nahm den Wodka.
»Der hier tut’s. Schön, dich zu sehen.«
»Ja«, sagte ich. »So eine Überraschung!«
»Also, prost.«
Sarah hob das Glas und schüttelte sich, nachdem sie einen Schluck genommen hatte.
»Gut. Na ja, es war nicht leicht, dich zu finden, ehrlich gesagt. Ich bin eine Weile herumgefahren. Hab’s in den üblichen Lokalen versucht.«
»Es würde nichts bringen, sich dort zu verstecken.«
Darauf kam zumindest ein bitteres Lächeln. »Gibt’s irgendeinen bestimmten Grund für den Schuppen hier?«
»Wollte nur mal’n Kulissenwechsel.«
»Schön hier.« Sie sah sich skeptisch um und richtete wieder den Blick auf mich. »Die anderen machen sich Sorgen um dich. Ich nehme an, du weißt das.«
»Es geht sie nichts an.«
»Aha. Deine Freunde und die Familie sind also nicht weiter wichtig.«
Ich trank mein Bier und schwieg. Die bittere Wahrheit war, dass meine Freunde und die Familie mir zu dem Zeitpunkt absolut nichts bedeuteten. Aber ich war noch nicht so weit, dass ich das aussprechen konnte. Schließlich war Sarah mich suchen gekommen, und ich hätte wissen müssen, dass sie das tun würde. Es war immer ihre Art gewesen, sich um Menschen zu kümmern, ihnen wieder aufzuhelfen, wenn sie fielen. Wie beschissen ich mich auch fühlte, konnte ich es ihr nicht ins Gesicht sagen, also hielt ich lieber den Mund.
Sarah schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
»J ist wirklich sauer über deine Wegrennerei.«
Darauf auch nur zu antworten, brachte nichts. Als ich am Morgen zu Hause meinen Bruder gesehen hatte, war dies der unangenehmste Moment des Tages gewesen, wenn man den jetzigen mal außer Acht ließ. Es war dumm und ungerecht, aber ich konnte das Gefühl nicht unterdrücken, James freue sich insgeheim, dass Marie tot war. Schließlich war sein kleiner Bruder immer der mit den guten Noten, dem anständigen Beruf und den Freundinnen gewesen, wogegen James nur Strafen für kleinere kriminelle Vergehen – hauptsächlich Schlägereien – und eine Serie abgebrochener Beschäftigungen und Beziehungen gesammelt hatte. Endlich, dachte er wahrscheinlich. Jetzt bist du an der Reihe.
»Aber er hat recht«, sagte Sarah. »Du kannst nicht einfach … weglaufen vor dem, was passiert ist, weißt du. Du musst dich der Sache stellen.«
Erneut schwieg ich.
»Ich wünschte, du würdest mit mir reden, Alex.«
»Was sollte ich denn sagen?«
»Ich weiß nicht. Es ist ja auch schwer für mich. Sie war auch meine Freundin.«
Ich nickte und fühlte mich noch beschissener.
Sarah hatte Marie tatsächlich länger gekannt als ich, und sie waren sehr eng befreundet gewesen. Ich konnte mir vorstellen, dass es ihr sehr nahging, zum Teil aus den gleichen Gründen wie mir und auch wegen Sarahs merkwürdiger Beziehung zum Tod. Ich hatte sie kennengelernt, als sie zu ihrer Tante in Whitrow zog, nachdem ihr Vater sich umgebracht hatte. Wir waren beide zehn Jahre alt. Sogar jetzt, wo ich sie als Erwachsene betrachtete, erkannte ich in ihrem Gesicht immer noch dasselbe kleine Mädchen. Schon damals war ihr diese seltsame Mischung aus Kummer und Entschlossenheit eigen gewesen, als hätte ihr das Leben ein quälendes Problem aufgegeben, das sie mit aller Beharrlichkeit lösen wollte.
Ich wusste nicht, ob es gut oder schlecht war, schon so jung seine Berufung gefunden zu haben. Dieser Tage arbeitete Sarah als Gerichtsreporterin für die Evening Paper, genau das Richtige für sie. Sie hatte sich immer schon verpflichtet gefühlt, sich dem Tod zu stellen und ihn zu verstehen. Man konnte nicht mit etwas fertig werden, indem man sich davon abwandte, meinte sie. Ich bezweifelte nicht, dass sie sich jetzt im Moment mit all den Dingen beschäftigte, vor denen ich mich zu sehr fürchtete, um sie überhaupt in meinen Kopf zu lassen.
Ein bisschen regte sich nun doch mein schlechtes Gewissen wegen meines egoistischen Verhaltens. Aber wenn ich ehrlich war, war mir das alles scheißegal. Meine Frau war gestorben. Konnten mich die Leute nicht verdammt noch mal bitte einfach in Ruhe lassen? »Und du bist auch mein Freund«, sagte Sarah. »Also, sprich mit mir.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Sag mir, was du denkst.«
Ich zuckte mit den Achseln. Meistens wagte ich es nicht, irgendetwas zu denken. Denn wenn ich das tat, kam es mir brandgefährlich vor. Ich stellte mir vor, dass ich allein mitten auf der Straße stünde und so laut schrie, dass alles in sich zusammenfiel. Mein Schrei würde die Blätter von den Bäumen fegen. Er würde die Häuser zum Einsturz bringen und den Staub der Backsteine und Glassplitter meilenweit verstreuen. Würde Straßenlampen zerschmettern und die Vögel vom Himmel stürzen lassen. Und all dies würde zu nichts führen, denn letzten Endes würde ich, wenn ich den Mund zumachte, immer noch da sein.
Ich flüsterte: »Sie fehlt mir.«
Dann senkte ich den Blick und versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Wie schwach ich war. Allein dass ich es laut ausgesprochen hatte, reichte schon aus, meine Entschlossenheit zu untergraben. Ich widerte mich selbst an. Damals wusste ich noch nicht einmal etwas von der Lebensversicherung, aber die Schuldgefühle waren schon übermächtig. Wie hatte ich sie so sehr hängenlassen können? Wieso hatte ich es nicht gewusst?
Sarah legte sanft ihre Hand auf meine.
»Mir auch«, sagte sie.
»Sie fehlt mir so sehr.«
»Aber du musst an den guten Erinnerungen festhalten, Alex. Dort ist Marie jetzt, und du musst versuchen, daran zu denken, wie sie gelächelt hat. Ich weiß, im Moment kommt dir das unmöglich vor, aber du musst daran glauben, dass es nicht immer so sein wird …«
Sie schaute mich an und seufzte.
»Gehen wir, ja?«, schlug sie vor. »Lass uns woandershin gehen.«
»Ich will niemanden sehen.«
»Das brauchst du nicht. Wir gehen einfach zusammen. Du und ich. Ich stelle meinen Wagen irgendwo ab, und wir verschwinden, besaufen uns ordentlich. Reden über irgendwas. Und wenn du nicht willst, dann labere ich dir einfach einen abendfüllenden Monolog an die Backe, und du tust so, als würdest du zuhören.«
Ich musste fast schmunzeln.
»Aber ich lass dich nicht allein, Alex.«
Das stand fest. Ich kannte sie zu gut, als dass ich glauben konnte, es würde mir gelingen, sie jetzt noch abzuschütteln. Sarah glaubte, Tragödien und Trauerfälle seien ansteckend, und sie wollte nicht auch noch mich verlieren.
Ich nickte. »In Ordnung. Ich danke dir.«
»Schon gut«, sagte sie. »Wir sind doch immer füreinander da, oder? So war’s immer. So wird’s immer sein.«
»Ja.«
»Und wenn es andersherum wäre«, sagte sie, »dann wärst du auch für mich da.«
Ich wusste nicht genau, was ich an jenem Tag vorhatte, aber es ist gut möglich, dass Sarah mich gerettet hat. Nicht auf dramatische Art und Weise, sondern im gewöhnlichen, alltäglichen Sinn – indem sie mich fand, als ich strauchelte, mir den Arm um die Schultern legte und beschloss, nicht zuzulassen, dass ich fiel. Und das tat sie immer wieder. Sie hatte die Fähigkeit, hinter die Dinge zu blicken und zu wissen, wann ich sie brauchte; bei diesen Gelegenheiten kam sie vorbei und war für mich da.
Wenn ich zurückblicke, erinnert mich das an einen Schwerverletzten, bei dem ein Freund ausharrt, entschlossen, ihn wach zu halten, bis Hilfe kommt. Na komm, sagt er, bleib bei mir. Wenn ich jetzt zulasse, dass du dich davonmachst, dann kommst du vielleicht nie wieder zurück.
Aber letzten Endes geschah es doch. Sosehr sie sich anstrengte, sie konnte mich nicht endgültig retten.
Ich sah Sarah sechs Monate nach dem Begräbnis zum letzten Mal, kurz zuvor hatte ich von Maries Lebensversicherung erfahren. Es war mitten in der Nacht, und ich war vollkommen besoffen bei ihr aufgetaucht, nur mit einem T-Shirt und Jeans bekleidet, obwohl es wie aus Kübeln schüttete. In dem Moment wusste ich einfach nicht, wo ich sonst hätte hingehen können.
Wenige Wochen später saß ich in meinem Hotelzimmer und schrieb ihr einen Brief. Ich versuchte, es ihr zu erklären. Ich schrieb ihr, dass sie immer recht gehabt hätte – man muss dem Tod entgegentreten, sonst wird er weiter ausholen und einem das Leben zerstören. Ich teilte ihr mit, dass ich nicht ertragen könne, was aus meinem Leben jetzt geworden sei, und dass ich mich daraus zurückziehen und versuchen müsse, einen neuen Alex Connor zu finden. Ich entschuldigte mich bei ihr und hoffte, dass sie mir verzeihen könne.
Morgens brach ich zum Flughafen auf.
Man konnte die vergangenen sechs Monate in einem einzigen Bild zusammenfassen: Die Fingerspitzen meiner besten Freundin tasteten nach mir, aber ich weigerte mich hartnäckig, nach ihrer Hand zu greifen. So entfernten wir uns langsam voneinander – es war traurig –, bis ich den Kontakt zu ihr verlor. Bis ich alle Brücken hinter mir abgebrochen hatte.
4
Als ich den Mann an der Rezeption nach dem Lautstärkeknopf des Fernsehers fragte, zuckte er mit den Schultern. Er funktioniere nur mit Fernbedienung, sagte er, und er wüsste nicht, wo sie geblieben sei.
»Vielleicht hat sie jemand …« Er machte eine Geste, als hätte jemand sie weggeworfen, und ich nahm mir vor, in Zukunft weniger nachsichtig zu sein gegenüber den jungen, unbekümmerten Typen im Aufenthaltsraum.
Ich ging zum Bahnhof um die Ecke. Er war voller frustrierter ausländischer Reisender, junge Männer mit auf die Stirn hochgeschobenen Sonnenbrillen, die mit Handys telefonierten, und Mädchen, die mit zusammengepressten Knien auf dem Gepäck saßen und verloren wirkten.
Am Ende der Bahnhofshalle war ein Zeitungsstand, wo ich eine englische Zeitung kaufte; ich nahm sie mit hinaus und setzte mich auf die oberste Stufe der Eingangstreppe.
Meine Hand zitterte, als ich langsam die Seiten durchblätterte. Ich suchte nach Berichten über das, was geschehen sein könnte. Denn schon zweifelte ich an dem, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Es waren nur ein paar Minuten vergangen, aber das reichte aus, es surreal erscheinen zu lassen.
Das konnte doch gar nicht sein …
Aber auf der fünften Seite wurde ich fündig.
Verdächtiger beschuldigt: Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach Frauenleiche
Von Barry Jenkins
James Connor hat gestanden, seine Freundin getötet zu haben.
Gestern wurde der Zweiunddreißigjährige dem Richter vorgeführt und in U-Haft genommen.
Ihm wird vorgeworfen, seine Freundin Sarah Pepper, dreißig, die mit ihm zur Zeit ihres Todes zusammen in Whitrow wohnte, getötet zu haben.
Vor dem Strafgericht in Whitrow bat die Polizei um Hilfe bei der Suche nach Ms. Peppers Leiche.
Der Ermittlungsleiter, Detective Geoff Hunter, rief mögliche Zeugen wie Spaziergänger und Feldarbeiter auf, verdächtige Beobachtungen in der näheren Umgebung zu melden.
Er erklärte: »Es ist natürlich eine sehr bedrückende Situation für Sarahs Freunde und Familie, und wir benötigen die Mithilfe der Bevölkerung, um sie so schnell wie möglich zu finden.«
Seit Mr. Connor sich am Morgen des 2. Juni an die Polizei wandte, haben Suchtrupps das Gebiet um Whitrow großflächig abgesucht. Der arbeitslose Mann gab an, das Paar habe sich wegen seines Alkoholproblems gestritten, und Ms. Pepper hätte vorgehabt, ihn zu verlassen. Er gestand, sie am ersten Juni in ihrer Wohnung getötet zu haben, konnte sich aber nicht erinnern, wo er ihre Leiche abgelegt hatte.
Ein Taxifahrer aus der Stadt bestätigte, dass er zur Adresse des Paares bestellt wurde, um Ms. Pepper abzuholen. Vor Ort angekommen, sei er jedoch von ihrem Lebensgefährten weggeschickt worden.
Es wird vermutet, dass Ms. Peppers Leiche in einem Waldstück zurückgelassen wurde; sie könnte teilweise von Blättern und Zweigen verdeckt sein.
Detective Hunter sagte: »Wir bitten die Bevölkerung, nach einem Holztor Ausschau zu halten, das sich in einer Trockenmauer befindet. Aufgrund unserer Informationen ist anzunehmen, dass zwei leere Wodkaflaschen in der Nähe liegen könnten.«
Mr. Connor wurde von einem Polizeibeamten in den Gerichtssaal geführt. Er gab Namen und Geburtsdatum an und bestätigte seine Adresse. Es wurde keine Freilassung auf Kaution beantragt.
Ich hob den Blick. Die oberen Stufen vor dem Bahnhofsgebäude waren angenehm schattig, und eine leichte Brise ließ die Seiten der Zeitung rascheln. Das helle, sonnenbeschienene Pflaster unten war voller Menschen. Ich blickte in ihre Richtung, doch nahm ich sie nicht wirklich wahr. Mein Herz hämmerte, und ich sah alles wie durch einen roten pulsierenden Schleier.
Die mit ihm zusammenwohnte, hallten die Worte in meinem Kopf wider.
Die Zeitung war einen Tag alt, dieser Bericht also vom Vortag, als Sarah noch vermisst wurde. Im Fernsehen hatten sie berichtet, sie sei gerade gefunden worden. Das würde in den Zeitungen hier nicht vor übermorgen auftauchen.
Ihre Leiche war gefunden worden, sagte ich mir.
Nicht Sarah. Sarah gab es nicht mehr.
Ich war mir nicht im Klaren, was ich fühlte. Eigentlich keinen Schmerz. Es war dasselbe urplötzliche Gefühl, es einfach nicht glauben zu können, ein Schlag, der einen umhaut; es war irreal, denn ich konnte die Tatsachen nicht fassen. Sarah war tot, und mein Bruder hatte sie umgebracht.
Lächerlich. Das konnte nicht sein.
Aber dann dachte ich weiter darüber nach. In mir stieg eine der frühesten Erinnerungen auf, die ich an meinen Bruder habe. James schreit aus vollem Hals mit hochrotem Gesicht, die Adern an seinem Hals zeichnen sich ab, während er ein Kissen nach meiner Mutter wirft.
Eigentlich klingt das ja relativ harmlos. Es war nur ein Kissen. Aber sie war eine kleine Frau, und das Erschreckende war, dass es für ihn keine Rolle gespielt hätte, was er gerade in der Hand hielt. Das Kissen war in Reichweite gewesen. Hätte er in dem Moment ein Messer in der Hand gehabt, hätte er das stattdessen geworfen.
Ich war damals drei oder vier Jahre alt. Ich weiß noch, dass ich mir die Augen zuhielt und schrie und nur wollte, dass all das verschwand. Meine Muter sagte etwas, James brüllte eine Erwiderung, dann wurde eine Tür zugeknallt. Danach spürte ich, wie meine Mutter den Arm um mich legte und mich an sich zog. Später war sie oben in James’ Zimmer und sprach leise mit ihm. Ich hörte ihn weinen, und vielleicht weinte auch sie.
So war mein Bruder immer gewesen, und so blieb er bis ins Erwachsenenalter. Wenn die Wut ihn packte, verlor er die Beherrschung und schlug zu. Er handelte, ohne nachzudenken, und hinterher entschuldigte er sich.
Ich versuchte also, es mir vorzustellen. James neben Sarahs Leiche hockend, wie er den Wodka in sich hineinschüttete, um den Schmerz und die Zerknirschung über das, was er getan hatte, zu betäuben. Zuerst hatte er wahrscheinlich ihr die Schuld gegeben. Dann, während er immer mehr trank, begann er, in Panik zu geraten, und die Erkenntnis brach über ihn herein, dass er diesmal zu weit gegangen war. Jetzt würde ihm eine Entschuldigung nicht mehr aus der Patsche helfen. Er machte einen törichten Versuch, seine Tat zu vertuschen, wachte aber am nächsten Morgen auf und wusste, dass er es nicht schaffen würde.
So schrecklich diese Erkenntnis auch war: Es war gar nicht so unwahrscheinlich.
Fünf Tage.
Der Gedanke daran schmerzte. So lange schon wurde Sarah vermisst. Die Tage waren vorübergezogen, während sie da gelegen hatte, irgendwo zurückgelassen und vergessen. Ich hatte vor mich hin gelebt ohne die leiseste Ahnung, dass ihr etwas zugestoßen war. Und im Hostel hatte ich die Live-Reportage vom Tatort gesehen. In den neuesten Nachrichten. Was hieß, dass Hunderte von Meilen entfernt die Leiche meiner lieben Freundin unter dem weißen Zelt lag, das ich jetzt gerade auf dem Bildschirm gesehen hatte.
Wenigstens hatte ich es überhaupt mitbekommen. Ich hatte geplant, von Venedig aus weiter südlich in Richtung Rimini zu fahren, möglicherweise eine Fähre zu nehmen. Wenn ich den Bericht heute verpasst hätte, wäre die Meldung, bis ich das nächste Mal fernsah, vielleicht aus den Nachrichten verschwunden gewesen, und ich hätte es nie erfahren.
Und das wäre besser gewesen.
Der Gedanke zwang sich mir förmlich auf.
Einen Augenblick verharrte ich reglos. Ich hörte die Möwen über mir flattern und die Rollkoffer der Reisenden rattern. Normale Leute, die ihr ganz gewöhnliches Leben lebten. Die warme Luft roch nach Meer.
Eigentlich war es keine Stimme, die zu mir sprach, eher ein aus der Panik erwachsendes Gefühl. Wäre es eine Stimme gewesen, hätte sie nach jemand Zupackendem geklungen, der mir empfahl: Es ist vielleicht unschön, aber jetzt kommt es darauf an, alles richtig zu machen. Lass mich diese schwierige Sache in die Hand nehmen. Halt dich raus. Wenn du zurückkommst, habe ich alles erledigt, und du wirst nicht weiter darüber nachdenken müssen.
Diese Leute gehören nicht mehr zu deinem Leben.
Ja. Genauso war es.
Bevor ich wegfuhr, hatte ich in dem Brief an Sarah geschrieben: Im Augenblick weiß ich noch nicht, wohin ich gehen werde. Ich weiß nur, ich muss weg. Das hatte gestimmt. Aber im Lauf der Zeit hatte ich den Bezug zu meinem alten Leben gänzlich verloren. Die Besuche in Internetcafés hatte ich aufgegeben. Aufkommende Schuldgefühle hatte ich einfach verdrängt. Wochenlang, wenn nicht noch länger, hatte ich schon nicht mehr an Sarah gedacht. Den Kontakt verlieren und sich zurückziehen, das kommt einem ganz ähnlich vor, denn es geschieht allmählich, und man beachtet es kaum.
Du willst nicht daran denken, wie schlimm es war.
Blanke Panik regte sich leise in mir. Ich wusste, dass das nicht von ungefähr kam. Denn mit einem Abstand von zwei Jahren vergaß man leicht, wie schlimm etwas gewesen war. Die Zeit vor meinem Aufbruch war so schwierig gewesen, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern wollte. Meine Flucht hatte mich gerettet. Und das Reisen hatte mir seit damals einen kleinen Vorsprung ermöglicht. Wenn ich mich von meinem alten Leben abgewandt hatte, dann war das eine Überlebensstrategie gewesen.
Aber langsam dämmerte mir, dass das Weglaufen nie so richtig funktioniert hatte. Konnte ich ewig so weitermachen? Überall, wo ich hinkam, fand ich nur Leere, die darauf wartete, angefüllt zu werden. Immer noch packte ich nach einigen Tagen meine Sachen und zog weiter. Es war, als würde mich ein etwas längerer Aufenthalt an einem Ort nur mit einer Adresse ausstatten, so dass die Post, die ich zurücklassen wollte, mir dorthin nachgeschickt werden konnte. Wie schmerzlich das auch war, hatte ich es nicht geschafft, über meine Gefühle hinwegzukommen. Sie hatten mich immer verfolgt.
Dagegen hatte ich vielleicht alles andere verloren.
Ich schlug wieder die Zeitung auf. Neben dem Artikel war das gleiche Foto abgedruckt, das im Fernsehen gezeigt worden war, nur diesmal in Schwarzweiß. Sarah sah darauf so arglos aus, fast überrascht. Wie sie den Kopf zur Seite neigte, ihr Lächeln, all das war mir sofort vertraut, war genauso, wie ich sie mir vorgestellt hätte.
Und jetzt erkannte ich, wo das Bild herkam.
Es stammte von einer Jahre zurückliegenden Fahrt in den Lake District. Zu sechst hatten wir uns in ein Wohnmobil gezwängt, das wir für eine Woche gemietet hatten. Marie und ich. Julie und Mike. Und Sarah war mit einem Zufallsbekannten dabei gewesen, der Damian hieß. Wir waren am ersten Tag in Coniston angekommen, und dort entstand dieses Foto. Meine Frau hatte es aufgenommen. Die Schulter im karierten Hemd, an die sich Sarah lehnte, war wohl meine eigene.
Die Erinnerung brachte eine Woge des Schuldgefühls mit sich. Wie hatte ich das vergessen können? Selbst Marie – ich erinnerte mich, dass sie damals meine Hand hielt, als wir in kurzem Abstand hinter den anderen hergingen. Ihre Berührung hatte sich zaghaft angefühlt, aber trotzdem war sie für mich ein Hoffnungszeichen gewesen. In dem Augenblick damals hatte ich sie glücklich gemacht, was immer auch danach passierte.
Eine ganze Weile starrte ich das Bild an und klopfte mein Innenleben auf schmerzhafte Gefühlsregungen ab. Aber es gab keine. Das Einzige, was sich einstellte, war eine schreckliche Traurigkeit, nicht nur weil mir etwas genommen worden war, sondern weil ich danach so vieles freiwillig aufgegeben hatte. Alles, was ich, wie mir jetzt klar war, so sehr vermisste.
Sarah …
Und vor allem erinnerte ich mich daran, wie sehr sie sich angestrengt hatte, mir in den Monaten nach Maries Tod zu helfen. Sie war ständig vorbeigekommen und hatte sich um mich gekümmert, entschlossen, es nicht zuzulassen, dass auch ich verschwand. Und doch hatte ich absichtlich weggeschaut, als sie mich ihrerseits brauchte.
Wir werden immer füreinander da sein.
Ich schloss die Augen.
Wenn es andersherum wäre, dann wärst du auch für mich da.
5
Rebecca Wingate stand nun direkt vor ihm.
Sie trug den schwarzen Hosenanzug, den er vom Foto her kannte; er hob sich klar und deutlich von dem wirbelnden Dunst ab, der sie beide umgab. Eine Haarsträhne hatte sich gelöst und hing wie ein Band neben ihrem Ohr herunter. Er sah, wie sie ängstlich nach links und rechts schielte, als könne sie sich nicht recht erinnern, was in den letzten paar Stunden geschehen war und wo sie sich jetzt befand.
Kearney machte einen Schritt nach vorn.
Er hatte sie gefunden.
»Rebecca«, sagte er. »Jetzt ist alles gut.«
Beim Klang seiner Stimme wandte sie sich um. Da trat die Gestalt hinter ihr aus dem Dunst. Obwohl der Mann ausgemergelt und seine Haut gelblich war und er die dürren Arme eines magersüchtigen Mädchens hatte, bewegte er sich flink und behende. Von hinten legte er den Arm um Rebecca Wingates Hals und riss sie zurück. Sie stieß einen Schrei aus.
Kearney rannte auf die beiden zu. Aber der Mann war ganz unwahrscheinlich stark. Während Rebecca im Nebel verschwand, streckte sie verzweifelt eine Hand nach Kearney aus. Er biss die Zähne zusammen und konzentrierte sich vollkommen auf diese Hand. Als er die Stelle erreicht hatte, wo sie gewesen war, war alles um ihn herum bloß grau, und die Schreie waren so weit weg, dass sie auch nur ein Widerhall in seinem Kopf hätten sein können.