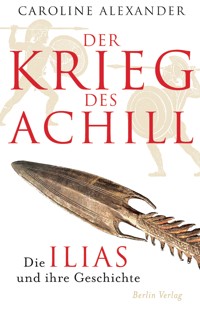
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Schon ihre Bücher über Shackletons Südpolexpedition mit der Endurance und über die Meuterei auf der Bounty behandelten wahrhaft epische Stoffe, doch nun wendet sich Caroline Alexander dem Epos schlechthin zu: der Ilias des Homer, einem der einflussreichsten Kunstwerke, die je geschaffen wurden. Mit einem stupenden Wissen, das auf jahrelangen Recherchen basiert, und ihrer schriftstellerischen Brillanz macht sie den vor bald 3000 Jahren entstandenen Text in einer Weise zugänglich, die ihresgleichen sucht. Nicht nur öffnet sie uns Lesern die Augen für die Fülle an faszinierenden Geschichten, Facetten und Details. Sie liefert auch eine meisterhafte, ja geradezu bewegende Deutung des Geschehens und der Protagonisten, allen voran des zornigen und zutiefst tragischen Helden Achilles und des trojanischen Prinzen Hektor, dessen ebenso mutiger wie chancenloser Zweikampf mit Achill einen der dramatischen Höhepunkte der Ilias darstellt. Für Alexander ist die Ilias in ihrem Kern eine Erzählung über den Krieg mit all seinen verheerenden Begleiterscheinungen und über die existenziellen Fragen des Menschen: über seine Beziehung zu den Göttern und zu seiner Gemeinschaft, zu Ehre, Liebe, Sterblichkeit und Tod. Aus dieser Perspektive entpuppt sich das Epos gerade nicht als Heldengeschichte, als die sie immer wieder gelesen wird, sondern vielmehr als eine ebenso beispiel- wie zeitlose Abrechnung mit der Sinnlosigkeit jeden Krieges. Souverän und mitreißend geschrieben, ist Der Krieg des Achill eine Hommage an einen der bedeutendsten Texte der Weltliteratur, einen Text, der sich mehr denn je als ein Schlüsselwerk menschlicher Erfahrung erweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
CAROLINE ALEXANDER
Die ILIAS und ihre Geschichte
Aus dem Amerikanischenvon Ulrike Bischoff
BERLIN VERLAG
Für Smokey
Ilias 23.77–78
VORWORT
Die Ilias entstand um 750 v. Chr. und ist seitdem ununterbrochen in Umlauf. Passenderweise ist sie bei Herodot, dem »Vater der Geschichtsschreibung«, erstmals namentlich erwähnt. Das Epos wurde von einer Lesergeneration an die nächste weitergegeben, auch wenn in jeder Epoche andere moralische, politische und ästhetische Werte seine Interpretation prägten. Der Grund ist unschwer auszumachen. Die Ilias ist nicht nur eine Dichtung von ausgesprochener Schönheit, sondern in erster Linie und vor allem ein Kriegsepos, das Krieger und Kämpfe zum Thema hat. Ein bedeutender Historiker erklärte: »Wenn wir aus den letzten 5000 Jahren eine beliebige Spanne von hundert Jahren herausnähmen, könnten wir damit rechnen, dass davon durchschnittlich 94 Jahre in einem oder mehreren Teilen der Erde umfangreiche Kriege herrschten.«1 Daher fühlte sich jede Menschheitsgeneration von der Ilias und ihrer Schilderung verheerender Kriegswirkungen angesprochen. Noch heute – vielleicht heute besonders – klingt ihre Botschaft ebenso vertraut wie im frühen Mittelalter. Homers Meisterwerk könnte gegenwärtig wie zu allen Zeiten den Titel tragen: Die Ilias. Ein Epos für unsere Zeit.
Die geisteswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Homer reicht zurück bis zu den Anfängen der Literaturwissenschaften, bis zu den Kommentatoren der alexandrinischen Schule im 4. Jahrhundert v. Chr., und dauert an den meisten westlichen – und einigen nichtwestlichen – Universitäten bis heute an. Tausende von Büchern, Artikeln und Vorlesungen sind über dieses Epos entstanden, mehr als sich auflisten lassen, und eine schier unüberschaubare Fülle geisteswissenschaftlicher Arbeiten hat die Ilias aus jedem erdenklichen Blickwinkel untersucht und analysiert.
In diesem Buch geht es kaum um die Dinge, die diese Forschungen beschäftigt haben, auch wenn es ihre Themen unweigerlich berührt. Dieses Buch untersucht weder die Überlieferung des Homer’schen Textes noch seine Bedeutung für jede vergangene Epoche. Es analysiert nicht den sprachlichen Hintergrund des Epos und ebenso wenig die mündliche Überlieferung, auf der es basiert. Es befasst sich nicht mit formelhaften Wendungen, dem Zeitpunkt der Fertigstellung oder der Frage, ob sich hinter »Homer« eine einzelne Person oder eine Tradition verbirgt. Es behandelt weder das bronzezeitliche Griechenland noch die Kultur der Trojaner oder die Geschichtlichkeit des Trojanischen Krieges. Es geht in diesem Buch vielmehr um das, was Thema der Ilias ist, um das, was sie über den Krieg sagt.
Kapitel 1MARSCHGEPÄCK
Die antike Legende des Trojanischen Krieges ist der Inbegriff des Epos, die meistgefeierte und langlebigste Kriegsgeschichte, die je erzählt wurde. Sie schildert, knapp zusammengefasst, die zehnjährige Belagerung der kleinasiatischen Stadt Troja oder Ilios durch eine Koalition griechischer Truppen, um Helena zurückzuholen, eine griechische Edelfrau von sagenhafter Schönheit, die der trojanische Prinz Paris nach Troja entführt hat. Die Griechen – Achäer genannt – gewinnen schließlich den Krieg: Sie dringen in die befestigte Stadt ein, indem sie ihre besten Männer im Bauch eines riesigen Holzpferds verstecken, das sie als Opfergabe für den Gott Poseidon ausgeben. Nachdem die überlisteten Trojaner das Pferd hinter ihre Mauern gezogen haben, kommen die Achäer in der Nacht aus ihrem Versteck, plündern die Stadt, setzen sie in Brand und töten oder versklaven alle verbliebenen Trojaner.
Die größte je erzählte Kriegsgeschichte erinnert an einen Krieg, der keine Grenzen festlegte, kein Territorium eroberte und niemandem einen Nutzen brachte. Nach vorsichtigen Schätzungen lässt er sich auf die Zeit um 1250 v. Chr. datieren. An seine Geschichte gemahnt die Ilias, eine epische Dichtung, die 500 Jahre später, um 750 v. Chr., entstand und Homer zugeschrieben wird. Homers Ilias ist der einzige Grund, weshalb dieser ergebnislose Feldzug noch heute in Erinnerung ist.
Jahrhundertelang, über die tiefe Kluft zwischen der Bronzezeit und Homers Epoche hinweg, gaben Generationen poetischer Erzähler die Legende des Krieges mündlich weiter. Viele der Episoden, die diese vergessenen Barden in ihren inzwischen verloren gegangenen Dichtungen überlieferten, ignorierte oder verwarf die Ilias. Homers Epos erzählt nichts über so scheinbar wichtige Ereignisse wie die Entführung Helenas, die Musterung und Fahrt der griechischen Flotte, die ersten Kampfhandlungen, das Trojanische Pferd oder die Plünderung und Brandschatzung Trojas.
Stattdessen schildert Homer in den 15 693 Versen der Ilias eine Zeitspanne von etwa zwei Wochen im zehnten und letzten Kriegsjahr, als die Belagerung Trojas sich in einem Stellungskrieg festgefahren hat. Die prägenden dramatischen Ereignisse sind die Beschimpfung des Feldherrn durch den großen achäischen Krieger Achill, der ihn als gewinnsüchtigen, prinzipienlosen Feigling bezeichnet, Achills Rückzug vom Krieg und seine Erklärung, dass kein Krieg und keine Kriegsbeute den Preis seines Lebens wert seien. Homers Ilias schließt nicht etwa mit einem martialischen Triumph, sondern mit Achills verzweifeltem Sichfügen in die Tatsache, dass er in diesem vollkommen sinnlosen Feldzug sein Leben lassen wird.
Zu Homers Zeit waren die Ruinen der einst mächtigen Mauern Trojas an ihrem beherrschenden Standort oberhalb des Hellespont, wie die Dardanellen damals hießen, für Reisende deutlich sichtbar. Die eingehende Beschreibung der Troas, der Region um Troja, in der Ilias lässt vermuten, dass der Dichter sie aus eigener Anschauung kannte. Für Homer und sein Publikum war der Krieg also ein reales, kein mythisches Ereignis. Auch die wichtigsten griechischen Fürstentümer, die in der Ilias als Kriegsteilnehmer genannt sind, existierten tatsächlich. Ihre Ruinen konnte ebenfalls jeder Reisende sehen.
Nüchtern fasste Strabo im 1. Jahrhundert n. Chr. die antike Sicht auf den Trojanischen Krieg zusammen: »Denn es begegnete den damaligen Hellenen so gut als den Barbaren, daß sie während des Feldzugs alles verloren, sowohl was sie zu Hause besaßen, als was sie durch den Feldzug erworben hatten; so daß nach der Zerstörung von Ilion teils die Sieger aus Mangel sich der Räuberei zuwandten, teils noch weit mehr die Besiegten und aus dem Krieg Übriggebliebenen.«1
Die Einschätzung, dass der Trojanische Krieg selbst für die Sieger ein Desaster war, ging auf Homers eindrucksvolle Schilderung zurück. Im Laufe der Jahrhunderte rückte das legendäre Troja jedoch zunehmend in weite, mythische Ferne, und entsprechend änderte sich auch die Sicht auf diesen großen Krieg. In der modernen Welt sorgte die Aufnahme der Ilias in den Kanon elitärer, maskuliner Bildungsbastionen für Ehrfurcht vor ihrer Poesie und »tragischen Vision«; ihre schlichtere Botschaft wurde dabei allerdings übersehen. Stattdessen zog man ihre heroischen Kämpfe und die hehren Worte ihrer Helden heran, um jungen Männern zu vermitteln, wie erstrebenswert es sei, stolz für das eigene Land zu sterben. Das gefährliche Beispiel, das Achill mit seiner verächtlichen Missachtung seines unfähigen Kommandeurs bot, tat man mit einem müden Spötteln ab: Der glänzende Achill habe »in seinem Zelt geschmollt«.
Die Archäologie hat zwar Erkenntnisse über die Stadt Troja und ihre Zeit gewonnen, aber der Trojanische Krieg, dieser schreckliche Flächenbrand, der ganze Nationen in ihren Grundfesten erschütterte, bleibt bis heute rätselhaft. Welche Fakten auch immer ans Licht kommen mögen, sie werden nichts an der unzweideutigen Aussage ändern, die die Ilias über die Bedeutung dieses Krieges trifft. Homer drang tief in die bereits damals lange zurückliegende Geschichte ein und erfasste eine ungeschminkte, bleibende Wahrheit. Sein Epos machte die uralte Erzählung dieses speziellen bronzezeitlichen Krieges zu einer erhabenen und überwältigenden Schilderung der verheerenden Wirkungen aller Kriege zu allen Zeiten.
Nach den Angaben der alten Griechen war der »göttliche Homer« ein Dichter aus Ionien, einer griechisch besiedelten Region an der Westküste Anatoliens (in der heutigen Türkei) und auf den vorgelagerten Inseln. Abgesehen von dieser plausiblen Überlieferung verliert sich seine Identität in der mythischen Vergangenheit; so waren laut einer Quelle sein Vater der Fluss Meles und seine Mutter eine Nymphe.2
Ähnlich im Dunkeln liegen auch die Ursprünge der Ilias. Bestimmte dichterische Merkmale (wie ein komplexes System metrisch hilfreicher Phrasen und zahlreiche wiederkehrende Passagen und Wörter) lassen vermuten, dass hinter der Ilias eine lange Tradition mündlicher Erzählungen stand. Hinweise in der Ilias auf geographische Namen, auf Formen der Bewaffnung und andere Artefakte, die sich mit Funden der modernen Archäologie in Verbindung bringen lassen, sowie sprachwissenschaftliche Belege deuten darauf hin, dass einige ihrer Elemente bis in die Bronzezeit zurückreichen.3 Diese historischen Relikte mischen sich mit Themen, sprachlichen Eigenheiten und Charakteren, die anderen Traditionen entlehnt sind, wobei volkstümliche Erzählungen und nahöstliche Heldensagen besonders ergiebige Quellen darstellen. Manche Bestandteile gehen sogar auf vorgriechische Ursprünge zurück. So lässt sich der Name Helena auf das indoeuropäische *Swelénâ zurückführen, das seinerseits die Wurzel *swel, »Sonne«, »Sonnenschein«, »brennen«, »schwelen« enthält. Ihr Urbild war eine Sonnentochter, deren Entführung ein wiederkehrendes Motiv alter indoeuropäischer Mythen darstellt.4
Manche Merkmale der Ilias lassen zumindest Rückschlüsse auf den Charakter der epischen Überlieferung der Bronzezeit zu, wenn schon nicht auf ihren tatsächlichen Inhalt. In die griechische Bronzezeit gehören etwa der Held Ajax mit seinem auffallenden turmähnlichen Schild und seiner ungeheuren Größe, aber auch der zwanglose Umgang zwischen Göttern und Menschen, Bilder, die Menschen mit Löwen vergleichen, und Helden von geradezu göttlichem Format. Vor allem aber lässt sich erschließen, dass die frühe Überlieferung den Kampf und den Tod in der Schlacht besang.5
Der Weg des Epos lässt sich anhand der Geschichte zweier untergegangener Völker nachvollziehen: der Griechen der Bronzezeit – die bei Homer »Achäer« heißen und die moderne Historiker nach ihrer Hauptsiedlung als »Mykener« bezeichnen – und der Trojaner, ein mit den Hethitern verwandtes Volk in Westanatolien (in der heutigen Türkei).
Die Mykener erlangten im 17. Jahrhundert v. Chr. die Macht auf dem griechischen Festland. Ihre Hochburgen befanden sich zwar hauptsächlich auf der großen südgriechischen Halbinsel Peloponnes, aber als Händler, Seefahrer, Plünderer und Krieger sicherten sie sich bis Mitte des 15. Jahrhunderts v. Chr. die politische und kulturelle Vormachtstellung in der gesamten Ägäis. Goldwaren und andere kostbare Gegenstände, die man bei Ausgrabungen in ihren Gräbern fand, belegen, dass sie ein reiches Volk waren. Ein Teil dieses Reichtums stammte aus regulärem Handel, fragmentarische Hinweise auf mykenische Störenfriede in zeitgenössischen hethitischen Quellen deuten aber darauf hin, dass Banden, wenn nicht gar organisierte Armeen plündernd die anatolische Küste heimsuchten: Solche Beutezüge übers Meer lieferten möglicherweise den dramatischen Stoff früher Epen.6 Die ausgeprägt militaristischen Themen mykenischer Kunstwerke, die Belagerungen, marschierende Krieger und aufbrechende Flotten darstellen, lassen eindeutig erkennen, dass die Mykener ein kriegerisches Volk waren.7
Den Höhepunkt ihres Wohlstands und ihrer Macht erreichten die Mykener von Ende des 14. bis ins 13. Jahrhundert v. Chr. in der »Palastperiode«, benannt nach den großen Palastanlagen, die in dieser Zeit entstanden. Sie befanden sich oft auf strategisch günstigen Anhöhen, waren von massiven Wehranlagen umgeben und dienten zugleich als Festungen und als Hauptsitze einer hoch entwickelten Feudalbürokratie. An einigen Orten fand man Archive aus gebrannten Tontafeln mit frühgriechischen Inschriften in »Linear B«, einer auf Silbenzeichen basierenden Schrift. Diese Tafeln mit ihren schier endlosen Listen von Abgaben, Steuern, Waren, Lagerbeständen und militärischer Ausrüstung vermitteln einen Eindruck von dem Reichtum, Organisationsgrad, militärischen Charakter und blanken Materialismus der herrschenden Gesellschaftsordnung.8 In den Stapeln dieser Linear-B-Tafeln fanden sich keinerlei diplomatische Dokumente, wie sie für andere Gesellschaften der Bronzezeit im Nahen und Mittleren Osten typisch sind, keine Verträge oder Briefwechsel zwischen Gesandtschaften und Herrschern, keine historischen Berichte über Gefechte und Schlachten, keine Gedichte, Gebete oder fragmentarischen Epen – nichts als die sorgfältige, ja pedantische Auflistung von Besitztümern:
Kokalos hat soviel Öl an Eumedes geliefert: 648 Liter Öl.
Ein Schemel, eingelegt mit einem Mann und einem Pferd undeinem Tintenfisch und einem Greif aus Elfenbein.
Ein Schemel, eingelegt mit elfenbeinernen Löwenköpfen und mitAuskehlungen …
Ein Paar Räder mit Bronzereifen, unbrauchbar.
21 Frauen aus Knidos mit ihren 12 Mädchen und 10 Jungen,Gefangene.
Frauen aus Milet.
Und:
To-ro-ja – Frauen aus Troja.9
Wie es dazu kam, dass Frauen aus Troja im Inventar eines mykenischen Palastes auftauchten, lässt sich aus einer einzigen knappen Eintragung nicht erschließen, aber die einfachste Erklärung ist, dass sie wie die Frauen von Knidos und Milet – wie auch jene von Lemnos, Chios und anderen namentlich erwähnten Siedlungen in Anatolien und auf ägäischen Inseln – »Kriegsbeute« waren, um es in der Sprache der Tafeln zu sagen, also Gefangene, die mitgenommen wurden, um als »Näherinnen«, Textilarbeiterinnen, »Badefrauen« und vermutlich auch im Bett ihrer Herren zu dienen.10 Ein Brief, den Hethiterkönig Hattusili III. um 1250 v. Chr., also zur mutmaßlichen Zeit des Trojanischen Krieges, an einen nicht genannten mykenischen König schrieb, lässt das Ausmaß der mykenischen Übergriffe erkennen. Darin ging es um gut 7000 Anatolier, die als Gefangene auf mykenisches Gebiet verschleppt oder durch Anreize zur Umsiedlung veranlasst wurden.11 Einige wenige hethitische Dokumente, der Eintrag auf den Linear-B-Tafeln und eine Fülle mykenischer Töpferwaren, die man in Troja fand, belegen, dass die Mykener auf ihren Reisen – die sie zu Handelszwecken, zu Plünderungen oder zur Kolonisierung an der anatolischen Küste unternahmen – ausgedehnte Kontakte mit den Einwohnern Trojas hatten.12
Die Geschichte Trojas am Eingang des Hellespont (Dardanellen) reicht weiter zurück als die der mykenischen Paläste. Die früheste, sehr kleine Siedlung entstand um 2900 v. Chr. auf einer Anhöhe oberhalb einer sumpfigen und vielleicht von Malaria verseuchten Niederung, die von den beiden Flüssen Simoeis und Skamander durchzogen war.13 Von der Gründung der Siedlung bis zu ihrer Aufgabe annähernd 2000 Jahre später im Jahr 1050 v. Chr. entstanden an dieser Stätte nacheinander sieben Hauptbebauungsschichten.14 Aus der Periode der mykenischen Vorherrschaft in Griechenland stammt die sogenannte Schicht Troja VI (von 1700 bis 1250 v. Chr.). Sie wurde in acht verschiedenen Bauphasen auf den Trümmern der früheren Siedlungen errichtet und weist in Bauweise und Stil erkennbar neuartige Techniken und Elemente auf, die darauf hindeuten, dass ein neues Volk Besitz von dieser alten Stätte ergriffen hatte. Da man von den Luwiern, einem indogermanischen Volk, das mit den mächtigen Hethitern verwandt war, weiß, dass sie sich um diese Zeit in Nordwestanatolien ansiedelten, gelten sie als die wahrscheinlichsten Kandidaten für diese neuen Trojaner.15
Die Palastzitadelle auf dem Hügel wurde wiederaufgebaut und mit leicht abgeschrägten Festungsmauern aus sorgfältig behauenen Kalksteinblöcken ausgestattet. Auf den gut fünf Meter hohen Steinmauern befanden sich Aufbauten aus Lehmziegeln, so dass die Höhe vom Mauerfuß aus Stein bis zur Mauerkrone aus Lehm annähernd neun Meter betrug. An strategisch wichtigen Punkten verstärkten Türme die Festungsanlage, und zu den Toren führten Steinrampen. Diese Details dürfte die epische Überlieferung übermittelt haben, denn die Ilias wusste um die breiten Gassen, Tore und Türme der »gutummauerten« Stadt Troja. Unterhalb der Zitadelle lag eine Unterstadt mit etwa 6000 Einwohnern.16
Zur Blütezeit mykenischer Macht im 14. und 13. Jahrhundert v. Chr. war Troja also eine beträchtliche Siedlung, die von einer Palastzitadelle überragt war und strategisch günstig am Eingang der Dardanellen lag; diese Meerenge kontrollierte wiederum den Zugang zum Marmarameer und damit zum Schwarzen Meer.17 Trojas Einfluss erstreckte sich nicht nur auf die Troas, sondern reichte bis zu Inseln wie Lesbos in der östlichen Ägäis, wo archäologische Funde, vor allem Keramiken (und sogar das Blei in Kupfergeräten), belegen, dass die Bewohner dieser Inseln mindestens seit 3000 v. Chr. die materielle Kultur der Trojaner teilten.18
Trotz alledem war Troja nie mehr als eine Regionalmacht. Die eigentliche Macht lag bei dem großen Hethiterreich, das Kleinasien von seiner Hauptstadt Hattusa (heute Boğazkale in der Zentraltürkei) aus beherrschte. Wie Tontafeln aus den umfangreichen hethitischen Archiven zeigen, war Troja lediglich einer seiner Vasallenstaaten.19 Experten, die diese Archive seit ihrer Entschlüsselung nach Belegen für das »reale« Troja und den Trojanischen Krieg durchforsteten, fanden faszinierende Hinweise, die durch neue Entdeckungen in den letzten Jahren erhärtet wurden. So nimmt man mittlerweile allgemein an, dass ein Hinweis auf Ahhiyawa, das jenseits des Meeres von einem großen König regiert werde, sich auf die Achäer bezieht, wie die Mykener in der Ilias meist genannt werden.20 Inzwischen hat sich auch bestätigt, dass es sich bei dem hethitischen Wilusa um Homers Ilios handelt, genauer »Wilios«, wenn man das ursprüngliche »Digamma«, also den Buchstaben mit dem Lautwert »w«, wieder einfügt.21 In einem Brief, den König Hattusili III. um 1250 v. Chr. an einen nicht namentlich genannten König von Ahhiyawa schrieb, findet sich ein besonders interessanter Hinweis: »in der Frage von Wilusa, über die Feindschaft zwischen uns herrschte …«22 Damit ist nun belegt, dass zumindest in einem Fall ein mykenischer König in eine kriegerische Auseinandersetzung um Ilios verwickelt war.
Bislang hat man in keiner Grabungsschicht Trojas Schriftzeugnisse entdeckt. Das einzige Fundstück mit Schriftzeichen ist ein Siegelstein mit luwischer Inschrift, der in Troja VI ausgegraben wurde.23Über die Frage, wovon Troja lebte und wie es genügend Reichtum anhäufte, um seine imposanten Stadtmauern zu bauen, lassen sich nur Spekulationen anstellen. Die Fülle der Spinnwirteln, die bei den Ausgrabungen zutage kamen, wird als Indiz für eine alteingesessene Textilindustrie ausgelegt, und die in Troja VI gefundenen Pferdeknochen könnten auf Pferdezucht hindeuten: Homer bezeichnet die Trojaner in der Ilias als »pferdebändigend«.24 Besonders aussagekräftig ist der kleine Friedhof aus der späten Bronzezeit, den man in der Nähe des trojanischen Westhafens fand und auf dem etwa ein Viertel der Urnen und Gräber mykenische Objekte enthielten. Da er außerhalb Trojas lag, handelte es sich offenbar um einen Friedhof für fremde Seeleute oder Händler.25 Dagegen gibt es kaum Belege für mykenische Kontakte über den Hellespont und den Bosporus hinaus, was vermuten lässt, dass ihre Handelsbeziehungen nicht weiter als bis Troja reichten. Ob es daran lag, dass die Trojaner die Meerenge aktiv kontrollierten und vielleicht Zölle erhoben, wie es in späteren Epochen der Fall war, oder lediglich daran, dass die kiellosen Schiffe der Bronzezeit sich nur schwer gegen starke Strömungen und Wind segeln ließen, ist nicht zu klären.26
Nach der griechischen Mythologie und epischen Überlieferung brach der Krieg zwischen Griechen und Trojanern aus, als Paris, ein Sohn des trojanischen Königs Priamos, den griechischen König Menelaos von Sparta besuchte, dessen Frau Helena entführte oder verführte – selbst in der Antike herrschten darüber widerstreitende Meinungen – und viele Reichtümer mitnahm. Nichts spricht dagegen, dass diese Überlieferung Teile der historischen Wahrheit widerspiegeln könnte. Da die Inventarlisten auf den Linear-B-Tafeln eindeutig belegen, dass die Mykener bei Beutezügen an der anatolischen Küste Frauen gefangen nahmen, ist es zumindest möglich, dass solche Überfälle auch umgekehrt stattfanden. Die mythische Verbindung der Griechin Helena mit dem Kleinasiaten Paris könnte auch eine vage Erinnerung an eine politisch arrangierte – und vielleicht verübelte – Ehe zwischen einem hethitischen Prinzen und seiner griechischen Braut widerspiegeln.27Andererseits mag der Grund für den »Trojanischen Krieg« auch schlicht kaltblütige Raubgier gewesen sein, wobei eine Serie von Beutezügen romantisch zu dem großen Krieg der Bronzezeit verklärt wurde. Interessant ist, dass frühe mythologische und epische Darstellungen zwei griechische Plünderungen Trojas in zwei aufeinanderfolgenden Generationen schildern und einen fehlgeschlagenen Feldzug in die Region unter der Führung des mykenischen Königs Agamemnon erwähnen.28
Die letzte Phase von Troja VI – Troja VIh – endete 1250 v. Chr., als die Stadt offenbar einer Kombination aus Naturkatastrophe und feindlichem Feuer zum Opfer fiel. Die Bevölkerung blieb am Ort, wenn auch stark dezimiert und erheblich verarmt, und lebte offenbar dicht gedrängt in kleinen Behausungen in der ehemaligen Palastzitadelle: Die herrschende Elite zeigte sich entweder bemerkenswert entgegenkommend gegenüber diesen neuen Bewohnern, oder sie war geflohen und hatte ihren Palast dem einfachen Volk überlassen.
Falls Troja VIh durch eine mykenische Invasion fiel, hatten die Mykener nicht lange Freude an ihrem Sieg. Trotz ihrer eigenen wehrhaften, umsichtig angelegten Festungen mit Wachtürmen und Vorratslagern konnten die Mykener die verheerende Katastrophe nicht verhindern, die ihrer Zivilisation um 1200 v. Chr., also gut eine Generation nach dem Fall Trojas, abrupt ein dramatisches Ende setzte. Über die Gründe dieses Zusammenbruchs gibt es diverse Spekulationen: eine Naturkatastrophe, innere Unruhen, Störungen des Handels, fremde Plünderer. Spätere antike Schriftsteller vertraten die Ansicht, der Trojanische Krieg selbst habe die griechische Welt für solche Verwerfungen anfällig gemacht. Diese Meinung spiegelt sich auch in der Odyssee wider, dem zweiten, späteren Epos, das Homer zugeschrieben wird: Als der Held Odysseus nach dem Krieg in seine Heimat zurückkehrt, stellt er fest, dass Eindringlinge in seiner Abwesenheit seinen Besitz geplündert haben. »Da die Rückkehr der Hellenen aus Ilion sich lange verzögerte, gab es auch viele Unruhen, und es entstanden meistenteils Parteikämpfe in den Städten, die mit Verbannungen und Städtegründungen endeten«, schrieb Thukydides im 5. Jahrhundert v. Chr.29
Wie in Troja kehrten auch im Mykenerreich einige Einwohner in die Trümmer ihrer Häuser zurück, versuchten die verwüsteten Stätten wiederaufzubauen und aus den zerstörten Mauern, Heiligtümern und Vorratsspeichern der Zitadellen zu ergattern, was sie eben konnten. Aber wer die nötigen Mittel hatte, zog fort, wie es auch bei modernen Katastrophen der Fall ist. Die Mykener besaßen zwar in ganz Griechenland dieselbe Kultur, Religion und Sprache, wiesen aber regionale Unterschiede auf, und als ihre Welt zusammenbrach, wählten sie verschiedene Auswege. Die Einwohner Böotiens in Zentralgriechenland und Thessaliens am Nordrand des mykenischen Reiches zogen zumeist nach Osten auf die Insel Lesbos, vermutlich in kleine Siedlungen, die Landsleute bereits früher – vor oder während des Trojanischen Krieges – dort gegründet hatten. Bezeichnenderweise finden sich in der Ilias immer wieder flüchtige Hinweise auf Beutezüge, die Achäer in die Troas und auf die östlichen ägäischen Inseln unternahmen: »›Zwölf Städte von Menschen habe ich schon zerstört mit Schiffen, zu Fuß aber elf, so sage ich, in der starkscholligen Troja‹«, erklärt der griechische Held Achill in einer Passage, die ohne Zweifel an die Eroberungen seines Volkes in dieser Region erinnert.30 Wie Ausgrabungen auf Lesbos zeigen, war die heimische Kultur der Insel ein Ableger jener der Troas – die Mykener siedelten sich also zufällig oder aufgrund einer Ironie des Schicksals in einem Volk an, das mit den Trojanern kulturell verwandt war. Spätere Griechen, die fragmentarische Kenntnisse ihrer postmykenischen Geschichte weitergaben, nannten diese Kolonisten Äolier, nach Äolus, einem Sohn Hellens, des Stammvaters der Hellenen oder Griechen; diesen Namen verwenden auch heutige Historiker.
Die mykenischen Einwanderer ließen ihr Land, ihre Städte und die Gräber ihrer Vorfahren zurück. Als Flüchtlinge nahmen sie von ihrem früheren Leben sicher mit, was sie tragen konnten – Gold und Wertgegenstände, so weit möglich, Kleider, Haushaltsgerät; das ist zumindest anzunehmen, da alle Flüchtlinge es bis heute so halten. Vieles konnten sie jedoch nicht bewahren, und so gingen mit dem Zerfall ihrer Kultur wertvolle Errungenschaften verloren: So verschwand etwa die Fähigkeit, zu lesen und zu schreiben, und entwickelte sich erst wieder an die 500 Jahre später.31
Von allem, was die Flüchtlinge aus ihrer zusammengebrochenen Welt mitnahmen, waren die wichtigsten Elemente zugleich die am wenigsten greifbaren: die Götter, die sie verehrten, die Sprache, die sie sprachen, die Geschichten, die sie erzählten. Hier, in der Region Lesbos, gaben die Menschen Erinnerungen an die verlorene mykenische Heimat in Erzählungen und Gedichten an nachfolgende Generationen weiter: Geschichten über große Städte, reich an Gold, oft verworrene Erinnerungen an geschlagene Schlachten und an Waffen und Rüstungsgegenstände. Ihre Gedichte besangen die Heldentaten von Kriegern, die wie Löwen kämpften und mit Göttern verkehrten, von beliebten Helden wie dem gerissenen Fuchs, der mit seinen schlauen Listen stets die Oberhand über seine Feinde gewann, oder dem halsstarrigen Hünen und seinem Schild, der ihn wie eine Mauer schützte – Helden, die der Welt später unter den Namen »Odysseus« und »Ajax« bekannt wurden.32
Neben solchen gängigen Elementen brachten die Flüchtlinge außerdem Überlieferungen mit, die spezifisch für Thessalien waren. Irgendwann tauchte in der sich entwickelnden Erzählung über Krieger und Kriege ein neuer, faszinierender Charakter auf, ein halb göttlicher Held, der eindeutig mit dem fernen, zerklüfteten Thessalien verbunden war und »Achill« hieß. Die alte martialische Überlieferung übernahm zudem einen spezifischen Konflikt, die Belagerung einer historischen Stadt, deren Ruinen von Lesbos auf dem Seeweg nur eine Tagesreise entfernt am Hellespont in Westanatolien lagen: »Taruisa« in der Sprache der Hethiter, auf Griechisch »Troja«.33
Vermutlich besaßen die Verbündeten Trojas, unter denen die Mykener mittlerweile wohnten, ihre eigenen Geschichten über die Stadt, über ihre Bewohner, ihre Not und ihre Zerstörung. Vereinzelte anatolische Wörter und Ausdrücke in der Ilias zeugen vom Kontakt zwischen Kolonisten und Eroberten.34 Die äolischen Dichter, die mit der epischen Überlieferung betraut waren, hatten ihre eigenen Städte in Trümmern zurückgelassen und sahen nun die Ruinen einer anderen Stadt nur eine Tagesreise entfernt liegen; aus diesem neuen Blickwinkel kamen sie vielleicht zu der Erkenntnis, dass die uralte Geschichte der Zerstörung Trojas untrennbar mit ihrer eigenen verknüpft war.
Das entstehende Epos hatte noch immer entscheidende Entwicklungsstufen vor sich und war Jahrhunderte von seiner Vollendung entfernt. Vermutlich Ende des 10., Anfang des 9. Jahrhunderts v. Chr. griffen Dichter im ionischen Griechenland das äolische Epos auf.35 Die kultivierten, innovativen Ionier erweiterten es um parallele Überlieferungen und machten es sich zu eigen. Trotz der erkennbaren, gut eingebetteten äolischen Spuren ist die Ilias, wie wir sie heute kennen, in ionischem Griechisch verfasst, und die antike Tradition hielt Homer für einen Dichter aus Ionien.36
So sah also die Mischung verschiedener Elemente aus, die epische Dichter in den fünf Jahrhunderten nach dem Zusammenbruch der mykenischen Kultur bis in die Epoche weitergaben, die Historiker als Griechenlands »Dunkles Zeitalter« oder »Eisenzeit« bezeichnen und in der Homer lebte. In dieser Periode, über die nach wie vor wenig bekannt ist, ging die Bevölkerungszahl zurück, und die materielle Kultur erlebte einen Niedergang. Doch trotz der relativen Armut muss das Leben weitergegangen sein, und die Gesellschaft überdauerte nicht nur, sondern blühte letztlich von neuem auf, denn als das »Dunkle Zeitalter« endete, kam eine lebendige neue menschliche Landschaft zum Vorschein. Stadtstaaten waren an die Stelle der feudalen Palastsiedlungen mykenischer Zeit getreten, Expeditionen hatten zur Kolonisierung neuer Landstriche durch griechische Siedler geführt, es gab wieder eine Schrift mit einem aus dem Phönizischen übernommenen Alphabet, und Homers Ilias war entstanden.
Es ist kaum etwas darüber bekannt, wie die Ilias ihre endgültige Form erhielt. Wurde sie diktiert? Geschrieben? Wem wurde sie vorgetragen? Eine Rezitation der gesamten Dichtung dürfte Tage gedauert und sich vielleicht als Unterhaltung für gelegentliche Feste geeignet haben, wahrscheinlich kam das Epos jedoch in Episoden zum Vortrag. In der Odyssee treten zwei Sänger auf, die beide dem Hofstaat von Adelsfamilien angehören und kurze »Lieder« vortragen.37 Einer von ihnen, Demodokos, ist blind, eine Tatsache, aus der sich eine Tradition abgeleitet hat, Homer sei selbst ein blinder Barde gewesen.38 Der kleine, überwiegend – aber keineswegs ausschließlich – männliche Kreis von Aristokraten, vor dem die Sänger in der Odyssee auftreten, ist ein plausibles Vorbild für das Publikum der Ilias.39
Die Ilias setzt ein, als die Truppen der Achäer und der Trojaner nach zehnjährigen Kämpfen in einem Stellungskrieg feststecken. Die unzähligen Kriegsschiffe aus allen Teilen der griechischen Welt liegen unterhalb der befestigten Stadt Troja auf dem Strand, ihre Taue und hölzernen Rümpfe verrotten. Die Soldaten brennen darauf, heimzukehren, wie das Epos unmissverständlich klarmacht.
In den ersten ihrer insgesamt 15 693 Verse schildert die Ilias die Konfrontation zwischen dem Helden Achill und seinem unfähigen Feldherrn Agamemnon, dem König des reichen Mykene. Nach ihrem Streit zieht Achill sich und seine Männer wütend aus dem gemeinsamen Kampf zurück und droht damit, in seine Heimat Thessalien zurückzukehren. Diese Ereignisse spielen sich im Ersten Gesang ab (nach alter Konvention – möglicherweise schon seit Homer – gliedert sich die Ilias in 24 Kapitel oder »Gesänge«)40, und bis zum Achtzehnten Gesang bleibt Achill abwesend. Die Handlung des Epos findet zum größten Teil also ohne ihren Haupthelden statt. Als sein engster Gefährte, Patroklos, von dem trojanischen Helden Hektor getötet wird, greift Achill wieder in den Krieg ein mit dem erklärten Ziel, seinen Freund zu rächen. Das tut er in einem Entscheidungskampf, der mit Hektors Tod endet. Nachdem Achill Patroklos mit allen Ehren beigesetzt hat, kommt Hektors Vater Priamos, der König von Troja, nachts in das griechische Lager und bittet um den Leichnam seines Sohnes. Achill lässt sich erweichen, den Leichnam zu übergeben, und die Trojaner bestatten Hektor. Das Epos endet mit Hektors Beisetzung. Seit der Antike heißt das Epos die Ilias, also »Dichtung über Ilios«, wobei Ilios und Ilium andere Namen für Troja sind (der Titel findet erstmals bei Herodot Erwähnung).41 Bemerkenswert ist, dass sich weder in der griechischen Mythologie noch in der epischen Dichtung Berichte über den Fall einer der griechischen Städte finden – das gesamte Pathos floss gleichsam in den Verlust der kleinasiatischen Stadt Troja.
Homers Epos beschränkt sich auf Ereignisse, die sich in einem sehr kleinen Ausschnitt des zehnjährigen Krieges abspielen. Die Legende umfasste jedoch ein ausgedehntes Geflecht von Nebenhandlungen und zahlreiche Haupt- und Nebenfiguren. Einst erzählten sechs andere Epen, der sogenannte Epische Zyklus, die gesamte Geschichte des Trojanischen Krieges. Sie entstanden zu unterschiedlichen Zeiten, alle wesentlich später als die Ilias, stützten sich aber wie diese auf erheblich ältere gemeinsame Überlieferungen. Die Ilias selbst zeigt eine genaue Kenntnis dieser anderen, möglicherweise konkurrierenden Erzählungen, wenn sie auf Ereignisse und Charaktere anspielt, die eigentlich dort vorkommen. Solche Textstellen lohnen immer eine eingehende Untersuchung, weil sich so traditionelle Elemente aufzeigen lassen, die von der Ilias übernommen oder verworfen wurden, also Schnittstellen, bei denen die Ilias eine bewusste, einschneidende Wahl getroffen hat. Die Epen dieses Zyklus sind schon lange verloren gegangen, erhalten sind lediglich grobe Inhaltsangaben und vereinzelte Fragmente, primär aus einem Kompendium des »nützlichen literarischen Wissens«, das vorsichtigen Annahmen zufolge von einem Philosophen namens Proklus im 5. Jahrhundert n. Chr. verfasst wurde. Aus diesen Zusammenfassungen wissen wir beispielsweise, dass das Epos Kypria von der Vorgeschichte des Trojanischen Krieges handelte und dass die Aithiopis den Tod und die Beisetzung des größten Helden dieses Krieges, Achill, besang. Andere Epen des Zyklus schilderten die Einnahme Trojas durch die Griechen, die Zerstörung Trojas und die Rückkehr der griechischen Veteranen in ihre Heimat.42
Angesichts der Fülle verfügbarer Themen ist es umso auffälliger, dass die Ilias ausgerechnet einen winzigen Splitter aus dem unbedeutendsten Stadium dieses allumfassenden Krieges auswählt: einen Streit zwischen einem Krieger und seinem Kommandeur während der sich hinziehenden Pattsituation der Belagerung. Hinter dieser Wahl stand zweifellos ein wesentlich älterer epischer Gesang, der auf dem bekannten Thema des Zorns, der Rache und der Rückkehr eines gekränkten Kriegers beruhte. Der gewählte Aufbau der Ilias in ihrer vorliegenden Form lenkt die Aufmerksamkeit zwangsläufig auf Achill. Diese epische Erzählung konzentriert sich also weniger auf den Einsatz der Kriegsflotte oder den Fall von Städten als auf die Tragödie des besten Kriegers in Troja, der – wie die Ilias unablässig klarmacht – in einem für ihn sinnlosen Krieg sterben wird.43
Vieles in der Ilias deutet darauf hin, dass Achill ursprünglich ein volkstümlicher Held mit magischen Eigenschaften und Gaben war, die ihn unverwundbar machten, und dass er erst relativ spät in epische Dichtungen Einzug hielt. In der Ilias trägt er unauslöschliche Züge seiner Volksherkunft, ist aber aller magisch-schützenden Kräfte beraubt. Homers Achill ist der sterbliche Sohn der Göttin Thetis und des Helden Peleus, und seine Sterblichkeit ist einer der ruhenden Pole, um die sich das Epos dreht.
Achill ist es, der die Größe der Ilias vermittelt. Seine Reden lösen die entscheidenden Ereignisse aus, seine wütende Herausforderung verleiht dem Epos seine eindrucksvolle Bedeutung. »›Kam ich doch nicht der Troer wegen hierher, der Lanzenstreiter, / Um mit ihnen zu kämpfen, denn sie haben mir nichts angetan‹«, fährt er seinen Feldherrn Agamemnon in der hitzigen Auseinandersetzung zu Beginn des Epos an: »›Sondern dir, du gewaltig Unverschämter! folgten wir, daß du dich freutest.‹«
Nestor, der alte Berater der Achäer, versucht Achill zu zügeln: »›Noch wolle du, Peleus-Sohn, gegen den König streiten / Gewaltsam, da niemals eine nur gleichartige Ehre zusteht / dem stabführenden König, dem Zeus Prangen verliehen.‹«
»›Wirklich! ja! ein Feiger, ein Garnichts würde ich heißen, / Wenn ich in jeder Sache dir wiche, was du auch sagst‹«, erwidert Achill, direkt an Agamemnon gewandt, ohne auf Nestor zu achten. »›Anderen trage dies auf! Mir aber gib keine Weisung, / Denn nicht mehr werde ich dir gehorchen, denke ich!‹«44
Die Ilias nahm eine uralte Überlieferung und nutzte herkömmliche epische Ereignisse und Helden, um die heroische Sicht des Krieges in Zweifel zu ziehen. Hat ein Krieger je das Recht, seinen Kommandeur in Frage zu stellen? Muss er sein Leben für die Sache eines anderen opfern? Wieso wird zugelassen, dass ein katastrophaler Krieg überhaupt anfängt, und wieso kann man ihn nicht beenden, wenn alle Parteien wünschen, er wäre vorüber? Begeht ein Mann Verrat an seiner Familie, wenn er sein Leben für sein Land hingibt? Heißen die Götter das Kriegsgemetzel gut? Kann Ruhm eine Entschädigung für den Tod eines Kriegers sein? Das sind die Fragen, die sich durch die Ilias ziehen – Fragen, die auch tatsächliche Kriege ständig aufwerfen. Und niemand hat diese Fragen im Leben wie auch in der epischen Dichtung besser beantwortet als Homer.
Kapitel 2DIE BEFEHLSKETTE
Den Zorn singe, Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus,
Den verderblichen, der zehntausend Schmerzen über die Achaier brachte
Und viele kraftvolle Seelen dem Hades vorwarf
Von Helden, sie selbst aber zur Beute schuf den Hunden
Und den Vögeln zum Mahl, und es erfüllte sich des Zeus Ratschluß –
Von da beginnend, wo sich zuerst im Streit entzweiten
Der Atreus-Sohn, der Herr der Männer, und der göttliche Achilleus.
Im zehnten Jahr des Krieges gegen Troja stecken die beiden Armeen, Achäer und Trojaner, in einer langwierigen Belagerung fest. Statt Troja zu plündern, gehen die Achäer dazu über, in altbewährter mykenischer Manier auf dem Land- oder Seeweg Städte und Siedlungen der Region zu überfallen.
Das Opfer eines solchen Überfalls wendet sich nun mit inständigen Bitten an die Plünderer. Zur Kriegsbeute, die die Achäer mitgenommen haben, gehört auch Chryseis, die Tochter des Apollopriesters Chryses. Mutig begibt sich der alte Mann mit seinem goldenen Priesterstab in das achäische Lager, bringt »unermeßliche Lösung« mit und fleht zu den Achäern, zu den »beiden Atreus-Söhnen am meisten, den Ordnern der Völker«, also zu Menelaos und Agamemnon.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























