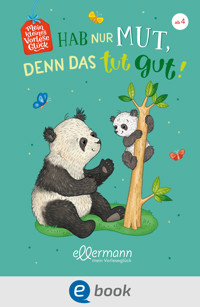Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Leipzig im August 1914: Es herrscht Volksfeststimmung. Der Krieg hat begonnen! Ferdinand und August fahren an die Front, Richtung Frankreich, im Gepäck einen Fotoapparat und eine braune Ledertasche. Berlin im März 1918: Sophie macht sich auf den Weg zu ihrem Jugendfreund Max. Doch der ist kaum wiederzuerkennen. Kriegsverrückt, sagen die Ärzte. Außerdem soll er Beweismittel unterschlagen haben. Irgendein Vorfall an der Front. Es droht das Kriegsgericht. Alles scheint sich um eine braune Ledertasche zu drehen … Elisabeth Zöller erzählt in ihrem neuen Jugendbuch von jungen Menschen, deren Lebenspläne von einer der größten Katastrophen unserer Geschichte durchkreuzt wurden: dem Ersten Weltkrieg.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elisabeth Zöller
Der Krieg ist ein Menschenfresser
Carl Hanser Verlag
Die Abbildungen im Innenteil stammen aus der Sammlung
http://www.europeana1914-1918.eu/de
S. 4: Feldpostkarte, Provinzialbibliothek Amberg im Namen von Michael und Marlen Fischer;
S. 9: Soldbuch mit Durchschuss, Carola Eugster im Namen von Brigitte Tripold;
S. 55: Soldbuch, Provinzialbibliothek Amberg im Namen von Karl Zollbrecht;
S. 107: Carl Punzmanns Kriegstagebücher;
S.149: Tagebuch von Hans Block, Holger Fricke im Namen von Klaus Liebmann;
S. 256 und 268: Meldegängertasche mit Kompass und Feldstecher von Walter Naumann, AntjeKiener;
S. 261/262: Feldpostkarten von Johann Kopf, Provinzialbibliothek Amberg im Namen von Karl Kopf.
ISBN 978-3-446-24551-8
Alle Rechte vorbehalten
© Carl Hanser Verlag München 2014
Umschlag: Manja Hellpap, Berlin © Getty Images
Gestaltung und Satz: Manja Hellpap
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Die im Text durch Fettdruck hervorgehobenen Wörter werden am Ende des Buchs in einem Glossar erklärt.
Für die Verwendung in der Schule sind unter www.elisabeth-zoeller.de Unterrichtsmodelle zu diesem Buch abrufbar.
Nichts ist schwerer
und nichts erfordert mehr Charakter,
als sich in offenem Gegensatz zu
seiner Zeit zu befinden
und laut zu sagen: Nein!
Im Übrigen gilt ja hier derjenige,
der auf den Schmutz hinweist,
für viel gefährlicher als der,
der den Schmutz macht.
Kurt Tucholsky
Die Nachmittagssonne fiel gedämpft durch die rußgeschwärzten Glasfenster des Bahnhofs. Es war ein kalter, aber schöner Tag. Eine Lokomotive stieß pfeifend Dampf aus. Die Geräusche abfahrender und ankommender Züge mischten sich in das Tosen, das wie eine Wolke unter dem Hallendach hing. Zeitungsverkäufer überboten sich mit ihrem Geschrei.Es roch nach verbranntem Schmieröl, nach Kohlenbrand und Staub.
Der Lärm perlte an dem Mädchen in dem blauen Wollkleid ab. Sie trug rote, dicke Fingerhandschuhe, hatte den Jackenkragen bis unter das Kinn geschoben und drängte sich durch den Trubel wehender Mäntel, dunkler Anzüge und verschwommener Gesichter. Sie hielt einen Koffer in der Hand und eine abgenutzte, lederne Umhängetasche hing über der linken Schulter. Ihr Hund wich nicht von ihrer Seite. Sie folgte den Wegweisern, sah auf die Schilder mit Abfahrtszeiten und Ortsnamen und warf einen Blick auf das beleuchtete Zifferblatt der großen Bahnhofsuhr unter dem eisernen Bogen der Dachkonstruktion. Es war zwanzig Minuten nach vier. In einer halben Stunde fuhr ihr Zug – zurück nach Berlin. Das Mädchen fand einen Platz auf einer Holzbank im Wartesaal, kreuzte die Arme und stellte den Koffer zwischen ihre Beine.
Sie kam von jemandem, der ein Recht gehabt hatte, zu erfahren, was an einem ganz gewöhnlichen Tag vor mehr als einem Jahr auf einem Schlachtfeld in Frankreich passiert war.
In ihren Gedanken sah sie immer wieder zwei Soldaten. Der eine, den sie so gut kannte: ein großer Bursche mit neugierigen Augen und dem schönsten Lächeln der Welt. Neben ihm ein zweites Gesicht, ein junger Mann mit schwarzem Haar, dem sie nie begegnet war. Eine glühende Zigarette klebte in seinem Mundwinkel, und er schaffte es trotzdem, breit zu grinsen. Sein feldgrauer Militärmantel war offen. Vor seiner Brust baumelte eine Kamera und eine lederne Kuriertasche hing über seiner Schulter ...
1
In der überhitzten Stadt geschah Unerhörtes. Es summte, brodelte und alles schien in Bewegung geraten. Aus den verstopften, mit Girlanden, Eichenlaub und Fahnen geschmückten Seitenstraßen drängten sich die Menschen auf den Roßplatz. Es war ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch. Der Himmel war wolkenlos blau, die Sonne brannte, die Luft flirrte. Unter ihren kleinen Sonnenschirmen gingen Damen mit großen Hüten mitten durch das fröhliche Treiben.
Es war Krieg. Mobilmachung. Heute war der Ausmarsch der Soldaten, den sich niemand entgehen lassen wollte. Die Militärkapelle spielte, Volksreden wurden gehalten, es gab Freibier und Tanzmusik. Ein einziges Juhu und Hurra. Fiebrig wälzte sich die rufende und singende Menschenmenge durch die Sommerhitze. Marschmusik und Pauken dröhnten von den Häuserwänden zurück. Kirchenglocken läuteten. Ein Schwall aus Freude und Glückseligkeit schlug wie eine riesige Welle brausend über den Köpfen zusammen. Weiter, vorwärts, zum Roßplatz und dann zum Hauptbahnhof drängte alles.
Ferdinand Frenzel hatte von der Morgendämmerung bis tief in die Nacht Plakate mit der Bekanntmachung der Mobilmachung zugeschnitten. Die Lehrlinge der Druckerei am Täubchenweg hatten sie überall in der Stadt an Litfaßsäulen und Wände geklebt. Danach hatte sein Meister ihm freigegeben. Die Druckerei lag gleich um die Ecke vom Roßplatz. Dort erstrahlte die prachtvolle Fassade des Café Bauer. Es hieß seit Kurzem Kaffeehaus Bauer und die ehemaligen Piccadilly-Lichtspiele nebenan waren jetzt die Vaterland-Lichtspiele.
Die Menge strömte so dicht, dass es weder für Ferdinand Frenzel noch für seinen Freund August Zerbe ein Halten gab. Sie rannten, wo es ging, jubelten mit der Menge. Schwammen mit in der Begeisterung.
Sie zogen an der Seite des 10. Königlich Sächsischen Infanterieregiments Nr. 134. An der Spitze ein Oberst zu Pferd. Aber seinetwegen waren sie nicht hier.
»Da ist er!«, schrie Zerbe Ferdinand ins Ohr. »Hannes, Hannes!«
Ferdinand schwenkte die blau-weiße Fahne des VfB Leipzig, tanzte unruhig von einem Bein auf das andere und jubelte sich die Seele aus dem Leib. Und dann sah er, wie der große Mann in der blauen Uniform mit den grünen Schulterstücken die Pickelhaube vom Kopf nahm und sie wie einen gewonnenen Pokal schwenkte. Johannes Schneider, der Torwart der Nationalmannschaft und ihr Fußballheld. Der Turm in der Schlacht. Nun marschierte er unter den Soldaten. Er lachte in ihre Richtung. Er hatte sie tatsächlich gesehen und ihnen zugewinkt. Hannes war ein großer Mann mit großen Händen. Wie gemacht für einen Torwart. Einer, der die Bälle wollte, sich ihnen entgegenwarf und sie unter sich begrub. Wenn er lachte, zitterten die Spitzen seines Schnauzers.
»Ich werd verrückt!«, jubelte August Zerbe und warf sich Ferdinand in die Arme. Sie reckten die Fäuste in den strahlend blauen Himmel und grölten um die Wette: »Paris, Paris, wir fahren nach Paris!« Um sie herum tobte die Menge. Hüte flogen durch die Luft und segelten davon. Ferdinand spürte ein nie da gewesenes Glücksgefühl und hüpfte auf den Fußspitzen, um sich größer zu machen. Alles war gut. Alles war möglich. Er hätte die ganze Welt umarmen können, so glücklich war er. Ferdinand versuchte, August zu folgen, der sich schubsend einen Weg durch die Menge bahnte.
»Hast du ihn noch?«, rief Ferdinand. Zerbe deutete auf seinen Bauch. Er hatte sich ihren Fußball unter das Hemd geschoben und sah ziemlich fett, fast schwanger aus.
»Hannes hat Mittwoch Geburtstag«, brüllte August und seine feuerroten Haare leuchteten mit seinem hochroten Kopf um die Wette. »Hat der ein Glück! Geburtstag unterm Eiffelturm.«
Ferdinand packte ihn an der Schulter und zog ihn zu sich heran. »Pass bloß auf die Kamera auf.«
August lachte und hielt ihm die Kamera, eine Vest Pocket unter die Nase. Er hob den Daumen. Alles im Griff, hieß das. Es war einfach gewaltig. Sie schwenkten die Fahne und drängten sich durch das Spalier der Jubelnden. Sie versuchten dabei, immer auf gleicher Höhe mit ihrem Hannes zu bleiben, der mit Blumen am Gewehr strahlend in den Krieg zog.
Vor etwas weniger als zwei Monaten hatte der Torwart Hannes Schneider nicht so glücklich ausgesehen. 3:2 hatte der VfB Leipzig in Magdeburg gegen Fürth verloren. Es war nicht irgendein Spiel, sondern das Endspiel um die Deutsche Fußballmeisterschaft. Das war eine Schlacht gewesen. 153 Minuten lang hatte der VfB gekämpft und am Ende doch verloren. Aufgekratzt waren sie hingefahren und ernüchtert zurückgekommen. August, Manni, Ferdinand, Kurt, Clemens und ein paar andere waren als Schlachtenbummler unterwegs. Das gehörte sich einfach so, singend und fahnenschwenkend unterwegs zu sein. Bis Magdeburg mit dem Fahrrad war ein Klacks. Für den VfB würden sie auch bis ans Ende der Welt laufen. Schwamm drüber, dachte Ferdinand. Die Vizemeisterschaft des VfB hatte nur einen kleinen Schatten auf sein Glück geworfen. Im nächsten Jahr waren sie wieder dran, das wusste er. Ganz sicher. Sie waren einfach die Besten. Daran würde auch der Krieg nichts ändern.
Als sie endlich bis zum Bahnsteig vorgedrungen waren, drängten sich August und Ferdinand mit der VfB-Fahne und dem Ball an Hannes Schneider heran. Der nahm den Ball in beide Hände, drückte ihn an seine Brust und küsste ihn. Ferdinand stellte sich neben ihn und August knipste. Sechs Fotos, wie der Torwart mit seinen Kameraden in Reih und Glied stand, wie sie ihre Gewehre aufnahmen, ihre Tornister aufschnallten und wie sie die geschmückten Eisenbahnwagen bestiegen und dann aus ihnen herauswinkten. Wie Hannes ihnen aus dem Fenster die Hand reichte und sagte, dass sie verrückt wären.Das sechste Foto knipste ein Kamerad – Hannes mit dem Ball vor der Brust, an seiner Seite Ferdinand und August mit der Fahne des VfB in der Hand.
»Total verrückt!«, schrie August.
Das nächste Foto machte Ferdinand über die Köpfe der Menschen hinweg: unzählige fliegende Hüte und winkende Taschentücher. Dann machte er eins von der Lokomotive. Nächster Halt: Paris. Das war mit weißer Farbe aufgepinselt. Er fotografierte August, wie der plötzlich traurig und sehnsüchtig am Bahnsteig stand und wie ein vergessenes Kind aussah. Das letzte Foto auf der Rolle war ein Versehen, ein Missgeschick. Ferdinand drückte auf den Auslöser, als er angerempelt wurde, und fotografierte seinen Fuß: Eine Stiefelspitze zeigte über die Bahnsteigkante und darunter war – unscharf, grau, schlecht belichtet – nichts weiter zu sehen als Schottersteine und ein Stück schwarz glänzendes Metall.
2
»Kopf hoch, Junge!« Augusts Gesicht glänzte vor Anstrengung. Er schwitzte in der Sommerhitze und kickte den Lederball zwischen seinen Füßen hin und her, spitzelte ihn auf der Fußspitze, ließ ihn über den Spann abrollen. Stoppte ihn mit dem Absatz, um ihn mit voller Wucht gegen die Mauer zu treten. August Zerbe hatte einen Blick für den Ball, stoppte den Abpraller mit der Hacke, täuschte einen Schuss an und umspielte tänzelnd Ferdinand, der lustlos dastand, die Hände in den Hosentaschen, den Kopf gesenkt.
»Was ist, du Flasche? Hast du keine Lust?«, rief August aufmunternd.
»Lass mich in Ruhe«, murmelte Ferdinand.
»Komm schon, du Spielverderber. So sind sie nun mal. Mädchen? Pah! Warum sollte ausgerechnet meine Schwester die Ausnahme sein?« August spuckte aufs Pflaster und schielte nach einer neuen Möglichkeit, wie er Ferdinand zum Mitspielen bewegen könnte.
Aber Ferdinand lehnte nur missmutig an der Ziegelwand.
»So wird das nichts«, sagte August und ging, den Ball in den Händen, auf ihn zu. Er ließ den Ball einmal aufspringen, dann warf er ihn hart an die Wand. Eine Handbreit neben Ferdinands Kopf. August lachte.
»Mann, lass das! Und was soll daran komisch sein?«, fauchte Ferdinand. Augusts Getue fing an, ihm auf die Nerven zu gehen. Er ärgerte sich, dass er versucht hatte, ihn über die Absichten seiner Schwester auszuhorchen.
»Hat sie dir jemals gesagt, dass sie dich liebt?«, fragte August und schmetterte den Ball wieder neben Ferdinands Gesicht.
Ferdinand spürte den Luftzug und hob wütend den Kopf: »Bist du jetzt total bekloppt?«
August ließ den Ball auf einer Fingerspitze tanzen. »Also, was ist? Hat sie?«
»Sie hat gesagt, dass sie mich mag«, sagte Ferdinand zögernd.
»Siehst du! Das sagt sie auch zu ihrem Marmeladenbrötchen.« August grinste.
Wieder klatschte der Ball an die Wand.
»Blödmann!«, fauchte Ferdinand. Er nahm die Hände aus den Taschen und stieß sich von der Mauerwand ab. »Ein bisschen verwickelter ist das schon«, meinte er.
»Verwickelt? Was redest du? Das ist so kompliziert wie ein zweiteiliges Puzzle«, höhnte August.
August Zerbe war Handlungsgehilfe im Laden seines Vaters. Paul und Luise Zerbe, Augusts Eltern, führten ein Kaufhaus für den gehobenen Bedarf in der Peterstraße. Die Lage war perfekt, die Geschäfte liefen glänzend. Nur August hasste den Laden, das Geschäft war ihm zuwider.Neuerdings hatten sie eine Spielwarenabteilung. Ferdinand wusste, wie albern sich August vorkam, wenn er kleine Kinder bedienen musste. Es wäre jetzt sehr leicht gewesen, August in Rage zu bringen und sich dann mit ihm zu prügeln. Aber Ferdinand wollte nicht. Wofür denn auch? Für Annis Treulosigkeit? August war sein Freund.
»Anni geht auf den Abschiedsball mit diesem Schnösel Dunker«,sagte August. »Meine Eltern gehen auch hin. Die machen sich so richtig fein, Mann. Deine Schwester näht Anni das Ballkleid, das weißt du doch. Vater fädelt das mit Anni und Dunker schon passend ein. Dagegen kannst du nichts machen. Das muss doch jetzt mal so langsam in deinen Verstand rieseln.«
Ferdinand schluckte. »Was ist mit dir? Gehst du hin?«
»Kann ich drauf verzichten. Die sind mir zu piekfein.« August lachte leise auf: »Stell dir vor: Dunkers waren bei uns im Laden und haben für ihr Söhnchen eingekauft. Unglaublich viel Zeugs. Das Beste war ein Luxuspicknickkoffer mit echtem Porzellan, silbernem Besteck und Kristallgläsern. So zieht der gnädige Herr in den Krieg. Vater hat sich die Hände gerieben. Das war mehr als ein gewöhnlicher Wochenumsatz. Allein die Damast-Servietten. Das glaubst du nicht! Die Kasse hat ganz schön geklingelt.«
Ferdinand schluckte wieder. Dass Ernst Dunker ein Auge auf Anni geworfen hatte, war eine bekannte Tatsache. Und dass der Druckereibesitzer und Verleger Dunker seinen Sohn im Laden der Zerbes ausstaffierte, dafür konnte August nichts. Geld regiert die Welt. Natürlich hatte er Anni vor ein paar Tagen nach Ernst gefragt, nach dem Fest und nach dem Kleid, das sie extra für diesen Anlass von Maria schneidern ließ. Und sie hatte so getan, als ginge ihn das alles nichts an. Er verstand sie nicht. Er hätte es gerne verstanden. Das Geglitzer und Getue konnte Anni doch unmöglich gefallen.
Aber nein, es gefiel ihr offenbar doch. Ernst Dunker in Uniform und mit einem langen Säbel an der Seite. Er war jetzt Leutnant bei den Ulanen. Ein geschniegeltes, gestriegeltes Jüngelchen.
Ferdinand wäre sofort bereit gewesen, diesem Schnösel den Hals umzudrehen. Aber er wusste auch, wie der Kaufmann Zerbe seine Familienangelegenheiten zu regeln pflegte. Der Kernsatz war: »Anni, du bist uns Gehorsam schuldig, du hast Verantwortung für deine Familie. Du wirst eine gute Partie machen.« Anni hatte es ihm erzählt, und Ferdinand wusste natürlich, dass er keine gute Partie war.
»Ich will weg von zu Hause«, hatte Anni geflüstert. »Ich will frei sein und machen, was ich will.«
Sie hatte aber nicht gesagt, mit wem sie weggehen wollte.
Ferdinand sah zu August hinüber, der versuchte, den Ball in der Luft zu halten. Augusts leuchtend rotes Haar klebte ihm auf der Stirn und das Hemd hing ihm aus der Hose. Die Stiefel waren staubig und vom Balltreten abgestoßen. Sein Grinsen strahlte wie ein blank geputzter Autoscheinwerfer. August war sein allerbester Freund. Er war einer, der es wissen wollte, der etwas vorhatte. Auf dem Fußballplatz und im Leben.
Und er? Der Oberlangweiler Ferdinand? Der ewig Unentschlossene? Er hatte dem Leutnant Ernst Dunker nichts entgegenzusetzen. Der spielte in einer ganz anderen Liga. Jetzt, seit dem 2. August,dem ersten Mobilmachungstag, umschwirrte ihn auch noch die Aura des Helden. Da kam er nicht mit. Für Anni war Ferdinand doch nur ein armer Junge aus der Mietskaserne. Ein Druckergeselle, der sich gerne auf dem Fußballplatz mit anderen armen Jungs um einen Ball raufte.
»Kommst du mit? Nur schauen. Übermorgen? Wenn es so weit ist?« Das konnte August doch wenigstens für ihn tun. Mit ihm hingehen und zugucken, wie Anni mit den Dunkers feierte.
»Du machst mich wahnsinnig.« August warf Ferdinand den Ball zu und verdrehte die Augen.
»Ich meine ja nur«, sagte Ferdinand kleinlaut.
»Warum quälst du dich so?«, fragte August. »Ist doch bald völlige Nebensache. In Frankreich oder in Russland spielt die Musik. Willst du hier versauern?«
»Fängst du schon wieder an?«, fuhr Ferdinand auf. »Ich habe tagelang Plakate geklebt, auf denen steht es schwarz auf weiß: Erst ist der Landsturm dran und dann die Reservisten der Landwehr. Die nehmen uns nicht. Wir sind zu jung. Kapier das doch endlich!«
»Wir könnten es versuchen.« August ließ nicht locker. »Wenigstens versuchen. Wir fahren nach Wurzen oder nach Döbeln, direkt in eine Garnison. Machen uns ein paar Jahre älter, Mann! Wer ist denn hier der Drucker? Papier ist geduldig. Wir müssen es versuchen. Spätestens Weihnachten ist der Krieg vorbei und bis dahin müssen wir dabei gewesen sein.«
»Wir brauchen eine Erlaubnis, schriftlich, von unseren Erzeugern«, entgegnete Ferdinand.
»Die werden schon nichts sagen. Merkst du denn nicht, was in der Stadt los ist? Wer nicht fußkrank ist, meldet sich zum Militär. Wir sind Patrioten. Kriegsfreiwillige. Oder hast du etwa Angst? Vor Hausarrest?« August lachte höhnisch und legte ihm gleichzeitig den Arm um die Schulter. »Mensch, Ferdinand.« Jetzt flüsterte er beinahe. »Alle gehen an die Front. Hast du doch selbst gesagt. In deiner Druckerei sind es zwanzig. Hannes Schneider ist weg. Der halbe VfB ist in Frankreich. Fußball gibt es auch nicht mehr. Da rennen nur noch Halbblinde über den Platz. Es wird noch langweiliger als vorher. Wie willst du das hier aushalten? Noch zwei Wochen und wir beide sind hier alleine. Nein. Du bist dann alleine.«
Ferdinand trottete neben seinem Freund her. Er wollte nicht zugeben, dass er sich nicht traute. Wegen seinem Vater, wegen seiner Mutter. Denn die beiden waren gegen diesen Krieg. Auch wegen Anton und Maria, seinen Geschwistern. Und wegen Anni. Er dachte immer häufiger an Anni. Wenn ihm etwas fehlen würde, dann war sie es. Dieses Gefühl war ihm bisher unbekannt gewesen. Aber es hatte ihn gepackt. Und auch die Stimmung in der Stadt hatte ihn beeindruckt und mitgerissen. Der Gedanke, in den Krieg zu ziehen, hatte etwas Verlockendes, Abenteuerliches.
»Mann, im Krieg können wir was erleben!«, sagte August ganz dicht an seinem Ohr. »Ich gehe. So oder so.«
»Im Krieg kannst du aber auch sterben«, sagte Ferdinand. »Und Sterben ist nicht witzig.«
»Sterben? Sterben ist so ungefähr das Letzte, was ich tun werde«, rief August und lachte.
Ferdinand schwieg, hielt den Ball im Arm und wartete.
August sah ihn ernst an. »Ich will eine Antwort von dir, Ferdinand. Bist du dabei? Oder kneifst du? Lässt du mich hängen? Du kannst dich nicht länger um eine Antwort herumdrücken.«
»Geh erst mit mir zu Dunkers«, beharrte Ferdinand. »Ich will sehen, was da los ist.«
»Und dann?«
»Dann entscheide ich mich.« Ferdinand nahm sein Fahrrad und klemmte den Lederball auf den Gepäckträger. Dann stieg er auf und winkte August zum Abschied zu. Morgen würden sie sich wie immer nach der Arbeit treffen und Fußball spielen.
Irgendwann würde er Augusts Frage nicht mehr ausweichen können. August wollte am liebsten sofort in den Krieg.
Ferdinand fuhr noch einmal in die Druckerei. Die Fotos vom Ausmarsch der Soldaten sollten fertig werden. Besonders die mit Hannes Schneider und dem Ball – darum würden sie ihn auf dem Bolzplatz beneiden.
3
Gegenüber der Haustür lehnte Ferdinand sein Fahrrad an einen Laternenpfahl und nahm den Fußball vom Gepäckträger. Er spürte, dass der Ball allmählich Luft verlor.
»Na Junge? Haste Feierabend?«, sprach ihn jemand von hinten an.
Der hat mir gerade noch gefehlt, dachte Ferdinand und hob grüßend den Kopf. Er hatte jetzt keine Lust auf ein Schwätzchen. Feldwebel Otto Pachulke hielt eine Schnapsflasche im Arm, als ob er sich daran festhielt. Der Kriegsveteran trug eine dunkelgrüne Litewka, die bis zum Gürtel aufgeknöpft war, und eine verschlissene, fleckenübersäte Uniformhose. Pachulke erzählte gerne vom Krieg der Jahre 1870 und 1871, als es mal wieder gegen die Franzosen ging, von den Schlachten Mann gegen Mann und von der Zeit, die er als Besatzungssoldat im Elsass verbracht hatte. Seine besten Jahre,wie er mit funkelnden Augen behauptete. Er hielt begeistert ausschweifende Vorträge über die großen Schlachten: bei Gravelotte, Sedan und Villiers, als es auf des Messers Schneide stand und wie sie dann die Franzosen vor sich hertrieben. Immerhin: Otto Pachulke hatte Paris gesehen.
Der alte Soldat lebte jetzt hauptsächlich von Almosen und Schnaps. Er hauste in einer Kammer im Keller der Mietskaserne.
An einem breiten Brustriemen trug Pachulke eine dunkelbraune Kuriertasche. Das polierte, weiche Leder schimmerte matt, die Schließe glänzte goldfarben. Die Tasche war in einem tadellosen Zustand. Pachulke schien sie Tag und Nacht nicht abzulegen. Ferdinand hatte keine Ahnung, was er darin aufhob.
Jetzt fasste Ferdinand sich mit gestreckter Hand grüßend an die Schläfe, nahm die Schultern zurück und schlug leicht die Hacken zusammen. Er wusste, dass der alte Soldat das mochte. »Wie geht es Ihnen heute, Herr Feldwebel?«, grüßte er zackig.
»Brav, mein Junge, brav«, antwortete Pachulke.
Am Straßenrand gegenüber tuckerte ein Auto im Leerlauf. Der Fahrer saß gelangweilt hinter dem Lenkrad und rauchte. Als Ferdinand ihn grüßte, lächelte der Mann matt herüber. Das Auto war ein Lieferwagen mit Weißwandreifen auf großen Felgen. Chrom blitzte in der Sonne. Der mattschwarze Lack glänzte fett. Auf dem Blech stand in geschwungenen goldenen Buchstaben Maggi Brühwürfel.
Den Fahrer kannte Ferdinand nur vom Sehen, doch er wusste, auf wen der wartete. Und da kam sie auch schon über das Pflaster gestöckelt: Lisa Blumensath, mit schwingenden Hüften und nach Kölnischwasser duftend, die Lippen glutrot gefärbt.
»Eine richtige Schlampe wird das«, hatte seine Mutter ihn oft gewarnt. Ferdinand hatte dann völlig ahnungslos getan. Dabei hatte Lisa Blumensath eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf ihn. Und das, wovor seine Mutter ihn warnte, war bereits geschehen. Oder nicht ganz. Eigentlich nur hastiges Fummeln und Knutschen unter der Kellertreppe oder zwischen den Brombeersträuchern am Bahndamm. Zu mehr war es nicht gekommen, was Ferdinand sehr bedauerte, weil er manchmal davon träumte.
Jetzt sah Lisa Blumensath ihn an und lächelte. Sie blickte scheinbar belustigt auf den schlaffen Ball unter seinem Arm, zog die Augenbrauen hoch und stieß ein kurzes Lachen aus. Sie hielt ihn für ein Muttersöhnchen. Das hatte sie ihm direkt ins Gesicht gesagt. Ferdinand wich ihrem Blick nicht aus. Vielleicht sah er jetzt wirklich lächerlich aus, mit dem Ball unter dem Arm und überhaupt. Er sah zu, wie Lisa die Tür des Lieferwagens öffnete und sich dem Mann hinter dem Steuer an den Hals warf, während sie immer noch Ferdinand ansah.
Ferdinand musste plötzlich an Anni denken. Der Gedanke an Anni Zerbe war ihm hundertmal lieber als das, was Lisa ihm da bot. Anni ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er hatte sie immer gemocht. Sehr sogar. Sie war etwas sehr Konstantes und gleichzeitig Unerreichbares in seinem Leben. Aber was wusste man in seinem Alter schon vom Leben?
Alles!
Anni lachte oft und ihr Lachen war ansteckend. Sie hatte sogar versucht, ihm ein paar Tanzschritte beizubringen. Anni tanzte für ihr Leben gern. Irgendwann hatte sie überrascht festgestellt, dass sie mit Ferdinand unglaublich gut reden konnte. Unglaublich war ihr Lieblingswort. Unglaublich hatte sie gesagt, als Ferdinand den Mut gehabt hatte, sie zu küssen. »Und ich dachte, du Knallkopf hast nur Fußball im Kopf«, hatte sie hinzugefügt, aber mit einem so weichen Ton in ihrer Stimme, dass er völlig dahinschmolz und sie sofort noch mal küsste.
Für Ferdinand änderte dieser Kuss alles, weil er sich verliebte.
Für Anni änderte sich scheinbar nichts. Ernst Dunker blieb ihr Verehrer. Tauchte auf, wann er wollte, führte sie aus und Anni gab keine Antworten auf Ferdinands Fragen.
Doch Ferdinand durfte sie ab und zu küssen und manchmal lagen sie zusammen in Connewitz an der Pleiße gegenüber vom Bootshaus im Gras. Wirklich klug wurde er aus ihr nicht.
In der Nacht dachte er über Anni nach und auch darüber, was August ihm gesagt hatte. Dass es im Leben nicht viele Gelegenheiten gab, in einen richtigen Krieg zu ziehen. Er lag lange wach und starrte an die Decke. Dabei brauchte er den Schlaf. Am nächsten Tag musste er fit sein für die Arbeit in der Druckerei.
Der Punkt war, dass Dunkers Familie eine Druckerei gehörte, während Ferdinand in einer schuftete. Ernst Dunker schien jede Menge Zeit zu haben, die er damit verbrachte, um Anni herumzuschwänzeln. Er war ein aufgeblasener Fatzke. Was mochte Anni nur an dem? Wovor Ferdinand sich wirklich fürchtete, war, dass Anni sich für Ernst entschied und dass er alleine zurückbleiben würde. Das wäre in diesem Sommer so ungefähr das Schlimmste, was passieren konnte.
4
»Pass doch auf, Bengel! Träumst ja mit offenen Augen«, keifte eine Frauenstimme.
Ferdinand drehte sich um.
»Ich habe es eilig, Junge.« Elfriede Prangel hielt ihm den Einkaufskorb unter die Nase. Er trat einen Schritt zur Seite, zog die Mütze vom Kopf und machte ihr lächelnd Platz. Sie wischte sich mit ihrem molligen Unterarm den Schweiß von der Stirn. Sie schnaufte und schob sich das Kopftuch zurecht. »Pass doch auf«, wiederholte sie. »Kein Benehmen, diese jungen Leute. Also zu meiner Zeit ...«
Im Kolonialwarenladen im Souterrain der Mietskaserne mischten sich die Gerüche von Käse, Kartoffeln, Lauch, Muskatnuss und Kernseife und vermengten sich zum Duft der weiten Welt. Ferdinand stellte sich hinter Elfriede Prangel in die Schlange der wartenden Frauen.
»Für zwei Pfennig Zitronenbonbons, bitte«, sagte er, als er an der Reihe war, und klackte die Münzen auf die Theke. Die Witwe Peters hinter dem Ladentisch seufzte und nestelte einen Schlüsselbund aus der Schürzentasche. Ihr mürrisches Gesicht hellte sich nur für einen kurzen Moment auf. Ferdinand wusste, was sie von den Mietskasernenkindern hielt. Alles ungewaschene Gören, die nichts als Scherereien machten und sie bestahlen. Erst kommt das Geld auf den Tisch, war ihre Devise. Sie schloss umständlich die Vitrine ihrer Süßwarenabteilung auf, schraubte den Deckel von einer Bonbonniere und zählte gelb gefärbte Zuckerstücke ab. Ferdinand steckte das spitze Tütchen in die Hosentasche, ein gutes Gefühl.
Draußen auf der Straße war Otto Pachulke längst auf seinem Schemel eingeschlafen. Die warme Sonne schien auf die Ledertasche. Pachulke hielt sie fest an seine Brust gedrückt. Ferdinand konnte nicht widerstehen und ließ seine Fingerspitzen über das weiche Leder gleiten.
Die Haustür stand wie immer weit offen. Eine Wolke aus Bohnerwachs, Essig, scharfen Putzmitteln, nassem Stein, angebrannter Milch und Kohl schlug ihm entgegen. Türen klapperten, Kinder tobten durch die Flure. Die Hausbewohner schienen ihre Unterhaltungen am liebsten durch die geöffneten Fenster, in die sie ein Kissen legten, oder durch geschlossene Türen zu führen.
Auf dem Fensterbrett am zweiten Treppenabsatz saß sein kleiner Bruder Anton und wartete auf ihn. Anton lehnte mit der Schulter an der Wand, hatte den Kopf schräg auf die angewinkelten Knie gelegt und träumte mit offenen Augen. Als er Ferdinand auf der Treppe sah, lächelte er und rutschte ein Stück näher an die Wand. Ferdinand setzte sich neben ihn. Anton ließ seine Füße baumeln.
Ferdinand hielt ihn für einen seltsamen, viel zu dünnen Bengel, an dessen Schultern zwei dürre Ärmchen wie Paddel an einem lecken Boot schlackerten. Sein scheuer Blick schien ständig zu rufen: »Rette mich!«
Ferdinand rettete ihn fast jeden Tag. Es war ein Teil seines Lebens. Er tat, was getan werden musste. Weil nämlich das Leben in der Mietskaserne kein Zuckerschlecken war. Anton war kein Kämpfer und kein Rabauke. Er war ein Eigenbrötler, der gerne zur Schule ging, der alles las, was ihm in die Finger kam, Schönschreiben übte und altkluges Zeug redete. Seine Lehrer mochten ihn so wenig wie seine Mitschüler. Mit dem Schwächling war absolut kein Staat zu machen. Anton konnte nicht einmal strammstehen. Und er zuckte, wenn ihm der Rohrstock über die Hand gezogen wurde. Anton hatte es schwer und unternahm nichts, das zu ändern. Er hatte einen großen Bruder, auf den er sich verlassen konnte. Und der hatte einen echten Lederball, mit dem Anton manchmal mit den Nachbarskindern spielen durfte. Im Gegenzug ließen die Kinder Anton in Ruhe.
Ferdinand legte Anton seinen Arm auf die Schulter. Der seufzte und sah ihn erwartungsvoll an. Ferdinand kramte betont langsam in seiner Hosentasche, ließ das Bonbontütchen knistern. Er drückte Anton die Zitronenbonbons in die Hand und zauberte damit ein Lächeln auf dessen Gesicht. Ferdinand zwinkerte ihm zu und legte den Zeigefinger an die Lippen. Paul Blaschke, der Junge aus der Nachbarwohnung, kam nämlich gerade aus der dritten Etage die Treppe heruntergepoltert. Er hatte etwa ein Dutzend johlender Kinder im Schlepptau, die auf der Treppe herumlümmelten, sich schubsten, knufften und dumme Sprüche machten. Mit trotzig erhobenem Kinn blieb Paul vor Ferdinand stehen.
Ferdinand grinste und stupste Paul die zerbeulte Schiebermütze vom Kopf. »Wie geht’s?«, fragte er ohne jedes Interesse an einer Antwort. Paul wollte nur den Ball. »Komm her«, sagte Ferdinand und winkte ihn mit dem Finger zu sich heran, »ich zeige dir mal was, du Armleuchter.« Er zog Fotos aus der Hemdtasche und hielt sie Paul hin.
»Siehst du, Paul? Hannes Schneider mit meinem Ball«, sagte er stolz.
»Boah!«, machte Paul. »Echt klasse.«
»Hannes hat sich riesig gefreut, dass wir alle am Bahnhof waren«, erzählte Ferdinand. »Jetzt ist er unterwegs nach Paris.«
»Mein Bruder Franz ist auch weg nach Frankreich. Jeder Stoß ein Franzos’, jeder Schuss ein Russ’, hat er gesagt und seinen Kram gepackt. Ich habe jetzt ein eigenes Bett. Von mir aus kann der Krieg ruhig länger dauern.«
Paul trat unruhig von einem Bein aufs andere. Ferdinand ließ ihn zappeln. Paul galt als Raufbold. Kräftig, mit kleinen stämmigen Beinen in kurzen Hosen. Ein blauer Fleck auf dem Oberschenkel, die Knie abgeschürft. In jedem Block gab es einen, der das Sagen hatte. Untereinander hielten sie zusammen und gegeneinander führten sie Kleinkriege. Entschieden wurden die dann auf dem Bolzplatz. Hinter den Häuserblocks dehnte sich das Brachland bis zum Bahndamm, dort hatten sich die Jungs aus den Mietskasernen einen Fußballplatz abgesteckt, aus geklauten Teppichstangen Tore gebaut und das Gras mit ihren Füßen platt getreten.
Ferdinand hätte Paul gerne gefragt, wie Franz Blaschke es angestellt hatte, in den Krieg zu ziehen. Franz war nämlich kaum älter als Ferdinand. Eingezogen wurden nur die älteren Landsturmmänner, die Reservisten.
Er stieß sich von der Fensterbank ab und sagte zu Paul: »Also gut. Ich muss den Ball erst aufpumpen. Bin gleich wieder da.« Schnell sprang er die Stufen zur Wohnung hinauf.
5
Ferdinand schloss die Tür auf und stand sofort im größten Raum der Zweizimmerwohnung. Ein leichtes Klappern und Summen lagen in der Luft. Das Klappern kam von der Nähmaschine. Das Summen steuerte seine Schwester Maria bei. Sie sang beim Nähen. Ferdinand lächelte zufrieden, weil er diese Geräusche mochte. Er streifte die Schuhe von den Füßen und rief: »Hallo, bin da!«
Auf dem eisernen Kochherd blubberte es in einem Kochtopf. Ferdinand rümpfte die Nase. Es roch nach Möhren und Kartoffeln. Sie aßen, was der Schrebergarten hergab. Fleisch war knapp. Obwohl Mutter sich jede erdenkliche Mühe gab. Ohne Fleisch gab es im Topf keine Überraschungen. Doch heute duftete es nach frischem Brot. Mutter buk es selbst. Es gab kein besseres.
Er ließ den Ball fallen und stoppte ihn mit dem Fuß. Die abgetretenen Holzdielen knarrten. Der Boden war schief und der Ball rollte weg.
Maria saß mit glänzenden Lippen an der Nähmaschine. Im Mundwinkel blitzte die Zungenspitze. Ihre Wangen waren leicht gerötet. Das lange kastanienbraune Haar hatte sie sorgsam mit einem blauen Kopftuch bedeckt, das sie im Nacken verknotet hielt. Die Farbe des Tuchs war etwas dunkler als ihre Augenfarbe. Die Blautöne passten gut zueinander. Ferdinand mochte Maria sehr. Er konnte mit ihr über alles reden. Doch wenn sie launisch war, konnten ihre Blicke töten.
Ferdinand ließ Wasser aus dem Kran in ein Glas laufen, goss etwas Himbeersirup hinein und beobachtete, wie sich die Flüssigkeit rosa färbte. Er reichte Maria das Glas.
Sie trank es in einem Zug. Dann stand sie auf, das Glas immer noch in der Hand, und stellte sich ans Fenster. Ferdinand schaute sie an. Sie trug einen Kittel und war barfuß. Ihre Beckenknochen zeichneten sich eckig unter dem Baumwollstoff ab. Sie hatte nichts Rundes oder Molliges und wirkte eher jungenhaft. Sie war schön, aber sie war keine Schönheit. Schönheiten kannte Ferdinand aus der Druckvorlagenherstellung für den Tiefdruck an der Rotationspresse. Unnahbare, mondäne Frauen mit kleinen geschminkten Kussmündern, spitzem Kinn und blasierten Blicken, die kleine Schirme in den Händen balancierten und neben Kerlen standen, die nach einer Menge Geld rochen. Maria war auf ganz andere Weise schön.
Sie schob mit einer raschen Bewegung das Tuch vom Kopf und drehte mit geschlossenen Augen ihr Gesicht ihm zu. In dem Moment sah sie glücklich aus.
»Man sollte hier weggehen«, sagte sie unvermittelt. »Alleine. Ganz weit. Und so lange fortbleiben, bis es keinen Grund mehr gibt, zurückzukommen.«
Plötzlich bollerte jemand gegen die Tür.
»Ja, ja«, rief Ferdinand. Er hatte Paul Blaschke und den Ball völlig vergessen. »Bin gleich so weit!«
Der Ball war ins Nebenzimmer unter sein Bett gerollt, das neben Antons Bett stand. Auf dem Boden lag ein Flickenteppich aus grünen und blauen Streifen. An der Wand gegenüber dem Fenster hing eine Weltkarte. In das kleine Zimmer passten neben Marias Bett gerade noch ein Wäscheschrank aus rissigem Fichtenholz und ein kleiner Tisch mit einer dunkel gebeizten Platte.
Ferdinand fischte den Ball aus der Ecke. Er drehte ihn in der Hand und untersuchte die Nähte. Alles tadellos und dicht. »Weißt du, wo die Ballpumpe ist?«, rief er zur Küche hin.
»Bestimmt da, wo du sie hingelegt hast«, sagte Maria in das Surren der Nähmaschine.
Im Schrank unter der Spüle fand er die Ballpumpe in der Werkzeugkiste. Er schraubte die Nadel in den Pumpenkopf und spuckte auf die Ventilöffnung.
Maria sah ihn strafend an: »Du bist ein Ferkel.«
»Was muss, das muss«, sagte er, stieß die Nadel in das Ventil und pumpte den Ball straff auf. Für heute musste das reichen.
»Ich bin mit Paul im Flur«, rief er Maria zu.
»Warte mal!«, rief Maria. »Die Wäsche muss noch in die Fabrik.Kannst du das tun? Ich packe sie dir in den Wäschekorb. Und Samuelski muss noch bezahlen. Auch für die letzte Woche. Der Zettel liegt im Korb. Sieh zu, dass er dich nicht übers Ohr haut. Und auf dem Rückweg gehst du in den Kurzwarenladen. Ich brauche Nähgarn und Nadeln. Annis Kleid muss fertig werden.«
Maria nähte nicht nur im Stücklohn und in Serie für den Fabrikanten Samuelski. Sie hatte das Schneidern richtig gelernt. Maria hatte Ideen und etwas, was man in der Mietskaserne nicht unbedingt vermutete: Sie hatte Geschmack. Ein Gespür und das »gewisse Etwas«, wie es ihre Mutter nannte.
Auf der Schneiderpuppe hing das Kleid für Anni. Das Abendkleid für Ernst Dunkers Abschiedsball. Und wenn Ferdinand es ansah, verstand er, was Mutter mit dem gewissen Etwas meinte. Den Stoff hatten Anni und Maria gemeinsam ausgesucht: nachtblau und schimmernd, als wären Tausende Sterne eingewebt. Aber bei dem Schnitt ließ Maria sich nicht hineinreden. »Vertrau mir, Anni«, hatte sie gesagt. »Du wirst die Schönste auf dem Ball sein. Dafür werde ich sorgen.«
Ferdinand sah das Kleid an, und mit einem Mal wusste er: Er liebte Anni. Vorsichtig berührte er mit der Hand den glatten blauen Stoff und strich zärtlich die Kontur ihres Körpers nach. Er spürte,dass seine Sehnsucht immer unerträglicher wurde. Was ihm am meisten zu schaffen machte, war seine eigene Unentschlossenheit, sein dauerndes Zögern. Alles war in Bewegung, nur er war wie gelähmt. Hatte er den richtigen Moment verpasst?
Alle anderen schienen genau zu wissen, wo es langging. Ihm fiel Franz Blaschke ein, der Muskelprotz, der Draufgänger. Er stellte sich vor, wie Franz pfeifend in den Krieg zog. Ferdinand fragte sich, wie der lebenslustige Franz Blaschke so ein Dunker-Problem gelöst hätte. Der hätte nicht lange gefackelt. Franz war einer wie August Zerbe. Die waren jederzeit zum Zupacken bereit. Und dann war die Sache ein Kinderspiel.
Sein Blick wechselte von der Schneiderpuppe zu dem Jungen im Spiegel an der Tür. Das war er: groß und gut aussehend. Wenn er sich im Spiegel ansah, gefiel ihm besonders sein Lächeln. Die lange schwarze Hose aus Leinen, der Gürtel, der sie bei seinen schmalen Hüften hielt, das gestreifte, kragenlose Hemd, das Maria ihm genäht hatte.
»Gut«, murmelte er und strich sich die Haarsträhne aus dem Gesicht, »gut, dass ich nicht eitel bin.«
»Hast du etwas gesagt?« Marias Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Sie stellte den Wäschekorb für Samuelski auf den Tisch und fragte: »Was ist los?«
»Nichts«, antwortete er.
Maria lächelte und schwieg. Es war dieses Ich-weiß-alles-Schweigen. Dieses Schweigen mochte er nicht. Aber ihre warme Stimme und ihre lieben Augen mochte er.
»Anton muss mal an die Luft«, sagte Maria. »Den ganzen Tag hockt er hier drinnen. Er hat Angst vor dem Trubel da draußen. Nimm ihn bitte mit.«
»Mach ich«, sagte Ferdinand.
Über ihnen polterte es. Ein Stuhl schrappte über den Boden. Es klirrte, als würden leere Flaschen umfallen und wegrollen. Eine undeutliche Stimme krakeelte.
Maria drehte sich um und sah mit verschränkten Armen zur Decke. »Der Schlafbursche von der alten Peschke ist ein widerlicher Kerl.«
»Macht er dir Ärger?«, fragte Ferdinand.
Sie blitzte ihn an. Wütend, gnadenlos und spöttisch zugleich. Ferdinand musste lächeln. Er hatte schon jetzt Mitleid mit dem armen Kerl da oben und mit jedem anderen auch. Jetzt musste er nur noch aufpassen, dass ihr Gesichtsausdruck ihn nicht verfolgte.
»Eine Stunde, Freundchen, keine Minute länger. Ist das klar?«, sagte Ferdinand und musterte Paul Blaschke streng. Der riss den Ball aus dem Wäschekorb und schon war der ganze Trupp Kinder polternd und johlend durch das Treppenhaus in den Innenhof verschwunden.
»Und du, Anton?«, fragte Ferdinand. »Immer noch keine Lust, mitzuspielen?«
»Nö«, sagte Anton. »Fußball ist blöd.«
»Du kommst schon noch dahinter«, sagte Ferdinand und lachte. »Fußball ist das Größte!«
»Das stimmt nicht«, rief Anton mit fester Stimme. »Der Krieg und der Kaiser sind das Größte. Und Deutschland.«
Im Innenhof klatschte das Leder an die Wand. Irgendwo wurde ein Fenster aufgerissen und eine Stimme brüllte: »Ruhe!« Die Jungs im Hof lachten.
Anton griff in die knisternde Bonbontüte.
»Lass das mal Vater nicht hören«, sagte Ferdinand.
Aus den Augenwinkeln sah Anton zu Ferdinand herüber: »Du musst auch in den Krieg«, sagte er zögernd. »Vielleicht wirst du totgeschossen.«
»Red keinen Quatsch«, sagte Ferdinand. »Komm lieber mit nach draußen, du Stubenhocker.«
Er nahm den Wäschekorb und ging die Treppe hinunter.
Anton lief dicht hinter ihm her, die Bonbontüte in der Hand. »Wenn ich die Augen zumache, kann ich die Welt ausmachen«, sagte er.
Ferdinand konterte. »Wenn du die Augen zumachst, fällst du die Treppe runter!«
»Ich meine ja nur«, maulte Anton.
6
Am Abend zeigte Ferdinand seiner Mutter die Fotos vom Roßplatz und Hauptbahnhof. Er hielt die Bilder nah an die Petroleumlampe. Im Nebenzimmer schliefen schon Maria und Anton.
Durch das offene Fenster drang mit der dumpfen Hitze der Straße immer noch ein unruhiges Rumoren bis in den dritten Stock. Ein Gewitter würde guttun. So ein richtiger Wolkenbruch mit Blitz und Donner. Mit Regen, Sturm und allem, was zu einem richtigen Unwetter gehörte.
Ferdinand hielt seiner Mutter die Bilder hin. Auf zweien stand er neben dem Torwart. Seine Mutter strich ihm über das Haar. »Gut siehst du aus.« Und nach einem Zögern fügte sie lächelnd hinzu: »Charmant siehst du aus. Das ist das richtige Wort.« Dann fragte sie mit sanfter Stimme: »Und der Soldat? Ist das euer Torwart, Johannes Schneider?«
»Ja, Mama. Für den Fußball tut Hannes alles.«
»Alles für den Fußball?«, wiederholte sie. »Er sieht aus, als wollte er alles für die Preußen tun.« Sie mochte die Preußen nicht, mochte keine Marschmusik und keine Uniformen. Auch nicht die des Königreichs Sachsen. Das fing schon beim Briefträger an.
»Wir brauchen keinen Krieg. Ich bin nur kurz in der Stadt gewesen. Die waren alle wie besoffen. Vom Bier oder von der Begeisterung, ich weiß es nicht. Die fielen reihenweise aus der Kneipe direkt in den Rinnstein. Du warst auf dem Roßplatz?«, fragte sie ohne Begeisterung in der Stimme.
»Ja, Mama. Es war ganz schön was los«, erzählte Ferdinand. »Überall sind die Reservisten unterwegs. In der Kongresshalle in Pfaffendorf sind sie einquartiert und im Prinzessinnengarten. Aus unserer Druckerei sind fast zwanzig Mann eingezogen. Dabei wissen wir vor Arbeit nicht, wohin.«
»Gut, dass du noch kein Reservist bist«, meinte seine Mutter nur.
Ferdinand nahm die Fotos vom Tisch und schob sie wieder in seine Hemdtasche.
»Nächstes Jahr, Mama. Nächstes Jahr muss ich hin.« Er seufzte, weil er wusste, wie sehr seine Mutter dagegen war.
»Dann ist der Krieg schon vorbei. Das sagen alle. Sogar die Preußen. Und ich hoffe, sie haben diesmal recht.« Sie legte ihm die Hand in den Nacken und beugte sich zu ihm hinunter. Ferdinand zog abwehrend die Schulter hoch. Aber er lächelte und hatte das Gefühl, dass auch sie lächelte.
Schritte polterten auf dem Korridor. Da fiel auch schon die Tür ins Schloss. Vater warf wortlos die Schirmmütze und ein zerlesenes Exemplar der Leipziger Volkszeitung auf den Tisch. Dann krachte seine Faust auf die Tischplatte. Eine Tasse hüpfte hoch, und Ferdinand bückte sich blitzschnell, fing sie auf, knapp über den Bodenfliesen. Mutter schloss das Fenster und scheuchte mit der Hand Anton, der erschrocken im Türrahmen stand, zurück ins Bett.
»Meine Güte, Gustav«, flüsterte sie, »sei doch leise. Anton muss schlafen.«
»Wie kann man da leise sein! Wie kann man da an Schlafen denken?« Gustav Frenzels Stimme klang aufgewühlt. Er setzte sich und sagte: »Du musst entschuldigen, aber mir wird übel, wenn ich das alles sehe.«
Ferdinand stand auf und legte ihm die Hand auf die Schulter.
Vater schnaufte und nickte.
Ferdinand holte zwei Flaschen Bier aus der Abstellkammer und stellte sie zusammen mit einem Glas für seine Mutter auf den Küchentisch. Dann ging er ins Nebenzimmer und legte sich zu Anton aufs Bett.
»Lass die Tür offen«, murmelte Anton. »Ich will hören, was Papa erzählt.«
»Du sollst schlafen«, sagte Ferdinand. »Wenn du nicht schläfst, hörst du auf zu wachsen und bleibst ein Zwerg.«
»Quatsch«, sagte Anton. »Wenn ich nicht schlafe, bin ich müde. Sonst nichts. Aber wenn ich nicht zuhöre, was Papa erzählt, muss ich dumm sterben.«
»Ist doch egal«, kam Marias schläfrige Stimme aus dem Bett unterm Fenster. »Dann hältst du wenigstens deine Klappe.«
»Sie ist immer so gemein zu mir«, murmelte Anton.
»Ich kann da nichts machen«, sagte Ferdinand. »Du musst schon selbst mit Maria auskommen.«
»Man kann immer was machen«, flüsterte Anton. Seine Stimme klang trotzig, als er Ferdinand den Rücken zudrehte.
Maria wälzte sich unruhig auf der Matratze. Sie atmete laut. Die Sprungfedern quietschten. Er schloss die Augen und hörte seinen Eltern zu. In der Küche machte eine Bierflasche plopp und dann gluckerte es in ein Glas.
»Der Krieg nützt einzig und allein den Herrschenden«, erklärte Gustav Frenzel drüben in der Küche. »Er ist für die Kapitalisten unentbehrlich. Es geht um Weltmärkte und nicht um einen toten Thronfolger, diesen Habsburger. Der Krieg führt die kleinen Leute,die sich morgen gegen die herrschende Klasse wenden könnten, auf die Schlachtfelder, wo sie sich gegenseitig niedermetzeln.«
Sein Vater wählte seine Worte bedächtig wie ein Lehrer. Wie ein Oberlehrer, fand Ferdinand. Er hörte Mutter seufzen und musste lächeln. Wenn Vater in Fahrt kam, war er nicht zu bremsen. Aber diesmal blieb es bei einem Raunen und Flüstern.
»Glaube mir, Helga«, hörte er seinen Vater irgendwann sagen, »die Militaristen würden ziemlich nervös werden, wenn die Arbeiter die Verschiedenheit ihrer Sprachen und Uniformen durchschauen und sich verbrüdern würden.«
»Was sind Mili..., Mili-Dingsda?«, fragte Anton leise.
»Psst!«, machte Ferdinand. »Das sind Kriegstreiber. Ich erkläre es dir morgen. Schlaf jetzt.«
Sein Vater stand auf und seine Schritte ließen die Fußboden dielen knarren. Er ging in der Küche auf und ab.
»Setz dich hin, Gustav. Du machst mich ganz nervös«, flüsterte Mutter.
»Ich war in der Redaktion der Leipziger«, sagte Vater. »Die arbeiten jetzt unter Kriegsrecht. Verschärfte Zensur. Das Papier ist kontingentiert. Dreißig Leute sind einberufen worden. Eugen Prager lässt dich schön grüßen. Du sollst noch mal über die Stelle als Redaktionssekretärin nachdenken, die er dir angeboten hat. Seit du damals die Artikel für ihn bearbeitet hast, hält er große Stücke auf dich. Sie kaufen dir auch eine Schreibmaschine.«
Mutter lachte: »Ich dachte, er hätte sich nur einen Spaß mit mir gemacht. Aber ich überlege es mir.«
»In der Redaktion können sie jeden klugen Kopf gebrauchen«, fuhr Vater fort. »Eugen rechnet fest mit dir. Wir sind hier in Leipzig. Das ist immer noch die Stadt von Wilhelm und Karl Liebknecht. Die Gewerkschaften hier sind gegen den Militarismus und gegen die Rolle, die die SPD im Reichstag spielt! Die Reichstagsfraktion hat für die Kriegskredite