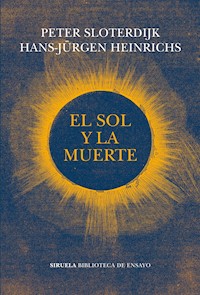16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Hans-Jürgen Heinrichs ist ein Weltreisender mit umfassendem Wissen über europäische und außereuropäische Kulturen. Sein Unterwegssein ist eine nicht endende Suche, die das eigene Leben meint, um die Wahrheit über die eigene Geschichte herauszufinden, wahrer als eine Autobiographie. Von Jugend auf sucht er das Glück der Begegnung – in Europa, Afrika, im Vorderen Orient und im Pazifischen Raum. Ebenso setzt er sich mit den künstlerischen Entwürfen in Literatur, Film, Theater und Philosophie auseinander; immer nach Spuren suchend, auch als Begründer des Qumran Verlags, in dem er neue Entwicklungen in der französischen Ethnologie, Psychoanalyse und Literatur im deutschsprachigen Raum bekannt macht.
»Der kürzeste Weg führt um die Welt« erzählt von unvorhersehbaren, oft geheimnisumwitterten, glück- und schreckerfüllten Pfaden, die zum Verstehen der Menschen und der Welt führen sollen, allen Widerständen zum Trotz. Seine oft von Zufällen und anderen als den vorgesehenen Wegen geleiteten Reisen führen Hans-Jürgen Heinrichs durch die syrische Wüste, den Nil hinunter Richtung Sudan, zu den Bergen der Nuba, an deren Leben er teilhat; und er erlebt noch legendäre Städte wie Timbuktu oder Agadez. Die Freundschaft mit Ethnologen oder Ethnopoeten wie Hubert Fichte, Paul Parin und Fritz Morgenthaler begleitet ihn dabei.
Hans-Jürgen Heinrichs versteht Leben als die hohe Kunst der Anverwandlung an ein inneres Bild, das andere Menschen in uns hinterlassen und auf diese Weise, im schreibenden Erinnern, weiterleben. Es sind viele Namen darunter – das zentrale Kapitel „Eine Liebe in Rom“ erzählt von Ingeborg Bachmann, vom filmischen Austausch mit Jean-Marie Straub, Danièle Huillet und Pierre Clément sowie von den Musik-Gesprächen mit Hans Werner Henze. Und immer wieder ist es der Kosmos von Paris, in dem Hans-Jürgen Heinrichs zu lebensweisenden Begegnungen findet – mit Michel Leiris, Nathalie Sarraute oder Peter Handke, mit dem ihn Poesie und Leidenschaft verbinden.
„Für mich war das Zur-Welt-Kommen ein philosophisches Abenteuer und eine Abenteuerreise gleichermaßen. Die Stationen reihten sich wie Perlen an einer Schnur.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Hans-Jürgen Heinrichs ist ein Weltreisender mit umfassendem Wissen über europäische und außereuropäische Kulturen. Sein Unterwegssein ist eine nicht endende Suche, die das eigene Leben meint, um die Wahrheit über die eigene Geschichte herauszufinden, wahrer als eine Autobiographie. Von Jugend auf sucht er das Glück der Begegnung – in Europa, Afrika, im Vorderen Orient und im Pazifischen Raum. Ebenso setzt er sich mit den künstlerischen Entwürfen in Literatur, Film, Theater und Philosophie auseinander; immer nach Spuren suchend, auch als Begründer des Qumran Verlags, in dem er neue Entwicklungen in der französischen Ethnologie, Psychoanalyse und Literatur im deutschsprachigen Raum bekannt macht.
»Der kürzeste Weg führt um die Welt« erzählt von unvorhersehbaren, oft geheimnisumwitterten, glück- und schreckerfüllten Pfaden, die zum Verstehen der Menschen und der Welt führen sollen, allen Widerständen zum Trotz. Seine oft von Zufällen und anderen als den vorgesehenen Wegen geleiteten Reisen führen Hans-Jürgen Heinrichs durch die syrische Wüste, den Nil hinunter Richtung Sudan, zu den Bergen der Nuba, an deren Leben er teilhat; und er erlebt noch legendäre Städte wie Timbuktu oder Agadez. Die Freundschaft mit Ethnologen oder Ethnopoeten wie Hubert Fichte, Paul Parin und Fritz Morgenthaler begleitet ihn dabei.
Hans-Jürgen Heinrichs versteht Leben als die hohe Kunst der Anverwandlung an ein inneres Bild, das andere Menschen in uns hinterlassen und auf diese Weise, im schreibenden Erinnern, weiterleben. Es sind viele Namen darunter – das zentrale Kapitel »Eine Liebe in Rom« erzählt von Ingeborg Bachmann, vom filmischen Austausch mit Jean-Marie Straub, Danièle Huillet und Pierre Clément sowie von den Musik-Gesprächen mit Hans Werner Henze. Und immer wieder ist es der Kosmos von Paris, in dem Hans-Jürgen Heinrichs zu lebensweisenden Begegnungen findet – mit Michel Leiris, Nathalie Sarraute oder Peter Handke, mit dem ihn Poesie und Leidenschaft verbinden.
»Für mich war das Zur-Welt-Kommen ein philosophisches Abenteuer und eine Abenteuerreise gleichermaßen. Die Stationen reihten sich wie Perlen an einer Schnur.«
Über Hans-Jürgen Heinrichs
Hans-Jürgen Heinrichs, geb. 1945, freier Schriftsteller und Ethnologe mit ausgedehnten Reisen in Afrika, im Vorderen Orient und Pazifik, lebte lange Zeit in Spanien, Amsterdam, Rom und Paris, und wohnt seit 2008 in Berlin. Er ist Autor eines breiten kulturtheoretischen Werks. 1980 gründete er den Qumran Verlag für Ethnologie und Kunst, Frankfurt am Main/Paris, der maßgebliche Werke aus der Ethnologie, dem Strukturalismus und der Psychoanalyse (u.a. von Michel Leiris, Victor Segalen, Leonora Carrington, Michel Butor, Hubert Fichte, Gisela von Wysocki) einer deutschen Leserschaft erschloss.
Hans-Jürgen Heinrichs
Der kürzeste Weg führt um die Welt
MAN MUSS SEINE VERGANGENHEITEN IN SICH VERSÖHNEN.
DAVID BOWIE
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Cover
Informationen zum Buch
Der Mann, der aus dem Fenster stieg: Vorrede von Durs Grünbein
Erste Szenen – Vom Glück sich zu begegnen: und vom Unglück sich zu verfehlen
Welt erobern: Vom Abenteuer des Unterwegsseins
Reise-Begleiter
Mit Udo Lindenberg: Bis ans Ende der Welt
Mehrstimmig von Europa erzählen: Auf der Suche nach einer lebbaren Zukunft
Eine Liebe in Rom: Ingeborg Bachmann, Literatur und Film
Marino/Rom: Hans Werner Henze und die Musik
Istanbul/Rom: Artischocken, poetisch
Nachspiel in Berlin: »Böhmen liegt am Meer« und »Der Sand aus den Urnen«
Paris. Michel Leiris und Francis Bacons Mantel: Literatur, Kunst und Ethnologie
Michel Leiris: Versteckspielen im Tagebuch
Mit Michel Foucault und Nathalie Sarraute: In den Falten der Worte
Kosmos Paris
Paris und Anderswo. Peter Handke: Poesie und Leidenschaft
Cap Verde am Berliner Lietzenseepark: Liebende als die letzten tollkühnen Reisenden
Nachspiel in Paris: Bonjour, I am Donald Sutherland
Nachwort aus gegebenem Anlass
Anmerkungen
Die Andere Bibliothek
Impressum
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
299
300
301
302
303
305
306
307
308
309
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
477
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Der Mann, der aus dem Fenster stieg: Vorrede von Durs Grünbein
Erste Szenen – Vom Glück sich zu begegnen: und vom Unglück sich zu verfehlen
Welt erobern: Vom Abenteuer des Unterwegsseins
Reise-Begleiter
Mit Udo Lindenberg: Bis ans Ende der Welt
Mehrstimmig von Europa erzählen: Auf der Suche nach einer lebbaren Zukunft
Eine Liebe in Rom: Ingeborg Bachmann, Literatur und Film
Marino/Rom: Hans Werner Henze und die Musik
Istanbul/Rom: Artischocken, poetisch
Nachspiel in Berlin: »Böhmen liegt am Meer« und »Der Sand aus den Urnen«
Paris. Michel Leiris und Francis Bacons Mantel: Literatur, Kunst und Ethnologie
Michel Leiris: Versteckspielen im Tagebuch
Mit Michel Foucault und Nathalie Sarraute: In den Falten der Worte
Kosmos Paris
Paris und Anderswo. Peter Handke: Poesie und Leidenschaft
Cap Verde am Berliner Lietzenseepark: Liebende als die letzten tollkühnen Reisenden
Nachspiel in Paris: Bonjour, I am Donald Sutherland
Nachwort aus gegebenem Anlass
Anmerkungen
Die Andere Bibliothek
Impressum
DER MANN, DER AUS DEM FENSTER STIEGVORREDE VON DURS GRÜNBEIN
Wir waren uns noch nie zuvor begegnet, und dann genügten ein paar wenige Erkennungsworte und es schien, als sei man seit Jahren schon miteinander bekannt. Ein beunruhigender Effekt: Wenn es mit rechten Dingen zugeht, tasten sich Fremde, erst recht, wenn der Altersunterschied doch erheblich ist, erst einmal ab, bevor ein Vertrauen entsteht, am Anfang war mir das etwas unheimlich. Aber nicht so bei Hans-Jürgen Heinrichs, das lässt sein Stil der Menschenumarmung nicht zu. Da war einer, der die seltene Gabe besaß, sofort ins Gespräch einzusteigen, wie man es als Leser gern umstandslos macht, plötzlich ist man schon mittendrin in der Lektüre. Aber ein Buch ist etwas anderes, hier ist man allein mit der Schrift und hütet sogleich eifersüchtig den Schatz, der nur für einen selber bestimmt scheint und den man im besten Fall nie wieder hergibt. Mit ihm war alles anders: Er kam, sah und nahm ein, und plötzlich war man in ein Gespräch verstrickt, das nie mehr enden würde, das spürte man.
Was war da geschehen, konnte der Mann etwa Gedanken lesen? War hier so etwas wie psychische Magie im Spiel, die alle Distanziertheit beiseite zauberte, einen unmerklich aufschloss und zum Reden brachte? Das vorliegende Buch, der Lebensbericht dieses Mannes, gibt ein paar Antworten auf die Frage. Schon sein Titel umreißt das Programm wie eine Verheißung: »Der kürzeste Weg führt um die Welt«.
Von den ersten Zeilen an führt es den Leser auf die Wege geheimnisvoller Freundschaften und hinaus in die weite Welt eines manisch Reisenden, eines nach Begegnungen hungernden Menschen. Da ist einer unterwegs als Bote, der seinen Gesprächspartnern Kunde bringt von den anderen Abgeschiedenen auf ihren Inseln inmitten der Öffentlichkeit. Gäbe es den Beruf des Leuchtturm-Inspektors, eines Spezialisten, der die Küsten bereist, um die Hüter der Leuchtfeuer mit Informationen übereinander und von ihren Standorten zu versorgen, der Weltreisende Heinrichs wäre sein erster Anwärter. Hier schreibt ein Empathiker, ein unbedingt zur Einfühlung Begabter, der mit dem Fieber des Ethnographen in die Biographien von Künstlern und Schriftstellern vordringt wie in fremde Kulturen und abgeschiedene Orte. Ein Stenograph, den Berühmtheit so wenig abschreckt wie Entrücktheit und hoheitsvolle Isolation, für den die Schutzwälle der Reserviertheit, der Charakterpanzerung so wenig gelten wie Sprachbarrieren oder die Anstrengungen, sich in physisch oder psychisch unverträglichen Klimazonen zu bewegen. Sein Zugangscode ist die gründliche Recherche, sein Trick (wenn das Wort nicht so hässlich wäre) die Mimikry an das Andere und die Anderen. Er geht dieselben Wege, die das Subjekt seiner Begierde ging, lernt Städte und Landschaften so gründlich kennen wie sie, hat alles gelesen, was sie schrieben und dachten.
Sogleich zur Sache zu kommen, den anderen zu behandeln wie einen Altbekannten, ist in Künstlerkreisen, erst recht unter Theaterleuten nicht unüblich, Hans-Jürgen Heinrichs aber treibt diese Kunst bis zum Äußersten. Er verliert keine Zeit mit der Annäherung, für ihn scheint es keine Peripherien zu geben, alles wird sofort Mittelpunkt, heimisches Gelände. Es gilt für ihn, was er einmal über einen dieser Stammesfürsten und seine autonome Künstlerexistenz sagt, den in Paris lebenden Schreib-Eremiten Paul Nizon, er entfalte »seine Poetik im Wechselspiel von Gehen und Schreiben, von Sprache und Leben«. In solcher fortwährenden Verschränkung operiert auch der Forschergeist des Autors dieser Aufzeichnungen. So wird ihm zum Beispiel Paris zum Kosmos einer Weltmetropole, deren Arrondissements er sich systematisch erwandert auf den Spuren jener Kosmonauten, mit denen er innerlich in fortwährendem Funkverkehr steht: Versprengte Pioniere ihrer je eigenen Mission, Denker und Dichter wie Michel Foucault, E. M. Cioran, Claude Lévi-Strauss, Michel Leiris, Jorge Semprun, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett, Marc Augé, Peter Handke oder eben Paul Nizon. Das ist seine Methode: Er sucht diese seltenen Vögel an ihren Lieblingsorten und Arbeitsplätzen auf, knüpft an Gespräche an, die er seit Jahren mit ihnen geführt hat, überprüft ihren Lebensentwurf wie ein Feldforscher, der sich vom Stammesleben seiner Schützlinge im Amazonasurwald mit eigenen Augen ein Bild macht. Der ethnologische Blick ist sein Rüstzeug. Er spricht über sie, als handelte es sich tatsächlich um Vertreter von Indianerstämmen, deren Dasein vom Aussterben bedroht ist und deren Zeugnisse man bewahren muss, bevor sie und ihre Werke dereinst untergehen in der allgemeinen Massenkultur. Der Verdacht, es mit Paradiesvögeln zu tun zu haben, muss ihn schon früh verlockt haben.
Einer der Nebeneffekte dieser emphatischen Identifikation mit den stets Bedrohten ist dann auch die ganz persönliche Verstrickung. Übertragung nennt man das in der Sprache der Psychoanalyse. Und solche Projizierung von Wünschen und Rollenerwartungen auf den Analytiker war unter den Seelenärzten aus der Schule Sigmund Freuds ein Tabu. Hier kommt wieder das Unheimliche in den Annäherungen dieses Autors ins Spiel. Ich weiß noch, wie ich manchmal zurückschreckte vor seiner überraschenden Verständnisinnigkeit – mich lieber entzog und dann doch seinen Nachfragen öffnete.
Die Indiskretion als Triumph im Spiel mit den Hütern der Diskretion ist ein Geschenk an den Leser. Schafft er es, fragt er sich, den Tresor dieser Biographien zu öffnen? Und Heinrichs Lebensroman, der kürzeste Weg zum Verstehen der ihm so hochinteressanten, ungewöhnlichen Menschen, führt uns in Gebiete, die vor ihm keiner betreten hat. Wir sind dabei, wenn die Diven, die Künstler, die Philosophen, allesamt vertieft in das Versteckspiel mit sich selbst, sich plötzlich öffnen. Um das herauszufordern, musste der Autor sich oft verwandeln. Ganz Ethnologe, zog er alle Register, um sich dem Gegenüber in den Farben der eigenen Erwartungen zu präsentieren. Nicht nur, dass er alles gelesen und im Bildgedächtnis gespeichert hatte, was diese Schwierigen je gemalt, geschrieben oder verfilmt hatten, nicht nur, dass er sich mit großem Aufwand in ihre Nähe brachte, detektivisch ihr Umfeld erkundete, er ging so weit, dass er sich ihnen auch in der Bekleidung, im Tonfall, in den Gewohnheiten, in den Speisevorlieben anpasste, in allen notwendigen Accessoires, auch darin seine Vorbilder kopierend, um diesen Leuten das Gefühl einer wundersamen Vertrautheit zu vermitteln. Man stelle sich einen Menschen vor, der immerfort mit der Anverwandlung von Besonderheiten der von ihm verehrten Dichter, Denker und Theatraliker beschäftigt ist – was für ein Lebenskonzept. Auch wenn er nur vor den verschlossenen Türen der abgöttisch Bewunderten stand, tief in der Nacht, arbeitete die Phantasie in ihm weiter und produzierte, nein reproduzierte Bilder von ihrem Leben. Dabei wusste er sich immer auf sicherem Terrain. Denn erstens funktionierten diese Leute auch nicht so anders als er, und zweitens waren sie doch selber alle nur Amateure in einem Feld (dem der Kulturdeutung, der Übersetzung von Lebensformen in Text, Bild oder Film), das er als studierter Ethnologe mit einer gewissen Methodik anging – aber das durfte er ihnen natürlich nie sagen. Sie waren die leidenschaftlich, oft auch zutraulich Agierenden, er war der Fragesteller auf dem Beobachterstandpunkt, der längst sein Netzwerk geknüpft hatte und wandernd von einem zum anderen streifte. Ich stelle mir sein Adressbuch vor mit den unsichtbaren Verbindungslinien, die ihn quer durch Europa und darüber hinaus führten. Sein Geschenk waren die Anekdoten, mit denen er diese Einzelgänger gegenseitig versorgte. »Es gab viele Tage«, heißt es, »an denen ich vollkommen sicher war, alle Personen und Figuren meines Lebens in ein Gespräch miteinander verwickeln zu können.«
Elfriede Jelinek, die manisch Produzierende, erfährt von ihm zwei, drei Geheimnisse, die nur er über Ingeborg Bachmann weiß. Und Peter Handke, den er einmal, in ungewohnter Schärfe, einen Liebesräuber nennt, muss von ihm hören, wie knapp er mit dem Leben davongekommen ist. Denn es gab eine Zeit, da träumte der Erzähler davon, den Egomanen, der ihm die Freundin ausgespannt hatte, kurzerhand zu erschießen.
Ein Höhepunkt in dieser nicht mehr ganz wissenschaftlichen Einlassung auf seinen Gegenstand war die Affäre mit der Dichterin Ingeborg Bachmann in Rom. In diesem längsten der Kapitel, könnte man sagen, lässt unser Gewährsmann für einmal die Zügel schießen. Aber er war noch jung und noch längst nicht so weltenkundig und bei seinem Thema. »Eine Liebe in Rom« schildert uns die Begegnung mit einer Verzweifelten. Das war die Frau, die sich aus der Dichtung zurückgezogen hatte. Die geschrieben hatte »ein Böhme, ein Vagant, der nichts hat, den nichts hält …« In dem viel Jüngeren trifft sie auf eine jüngere Variante ihrer selbst im anderen Geschlecht, den Seelenfreund, nach dem sie sich immer gesehnt hat. Eine rührende Romanze entspinnt sich in jenen Jahren der Bitterkeit, als die Bachmann längst jeden Glauben an die Möglichkeit einer Liebesbeziehung verloren hatte. Versuch der Erinnerung an eine geträumte Intensität: Er erzählt von einem Rettungsschwimmer, der die Erschöpfte an ein gemeinsames Ufer zu retten versucht. Die Seiten, nicht zufällig die dialogreichsten, nehmen den breitesten Raum ein, Filmszenen der siebziger Jahre blitzen hier auf. Man hat den Eindruck, als habe die traurige, von ihren Geistern getriebene Frau hier einen späten Frühling erlebt. Und das nach den berühmt-berüchtigten Affären mit Paul Celan und Max Frisch, aus denen sie, wie alle Welt weiß, als Geschlagene hervorging. Für die Bachmann-Biographen tut sich hier ein unbekanntes Kapitel auf mit vielerlei neuen sprechenden Details, die das Bild der von so vielen Männern enttäuschten Poetessa um einige Aspekte bereichern. Von der Intimität, auch Koketterie dieser Schilderungen mag der Leser stellenweise unsicher berührt sein, aber was die beiden da erlebt haben, zeigt auch den Autor in einer anderen Façon, in der ganzen Unschuld seiner großen Gefühle. Und das ist, was dieses Buch ausmacht: Heinrichs scheut sich nie, seinen Emotionen freien Lauf zu lassen. Damit, und das sei als Warnung gesagt, fällt das Buch aus dem ironischen Mainstream unserer Zeit heraus. Denn hier geht einer aufs Ganze, beinah schlafwandlerisch nähert er sich den Namhaften, wild entschlossen, sie alle persönlich kennenzulernen, unbekümmert um seine eigene Namenlosigkeit. Er wird ihre Wege kreuzen, wird seine Geschichte mit ihnen erleben, das steht ihm auf der Stirn geschrieben.
Wie aber fing das alles an? Am Anfang stand die Flucht, ein Grundmotiv in der Familie. Die Mutter war eine aus dem Treck der Ostflüchtlinge, aus Danzig geflohen damals am Kriegsende, als vierzehn Millionen Deutsche nach dem Desaster der Hitleraggression ihre Heimat verloren. Nicht viel hat gefehlt, und sie wäre an Bord der »Wilhelm Gustloff« gelangt, dann hätte dieser Lebensfilm, bevor er beginnen konnte, durch ein russisches U-Boot sein vorzeitiges Ende gefunden. Hans-Jürgen Heinrichs hat Glück gehabt, er kommt 1945 auf der sicheren Seite des nachher geteilten Landes zur Welt in Wetzlar, der Stadt, die Goethe mit seinem Werther-Roman in der Weltliteratur verortet hat. Eine Jugend am Rhein zwischen Wiesbaden und Ingelheim schließt sich an. Zur Urszene wird ihm der Sprung aus dem Fenster seines Gymnasiums, unter dem Gekicher der Mitschüler, die seine Kühnheit bewundern – so wie der Leser dem weiteren Lebensweg dieses geborenen Homo fugiens zunächst verwundert, dann mit wachsender Bewunderung folgt. Sein Leben, das teilt sich von der ersten Seite an mit, ist der Stoff, aus dem die Abenteuerromane gemacht sind. Ein Mensch verlässt, wie wir alle von der Schule gelangweilt, das Klassenzimmer durchs Fenster – und findet sich eines Tages in Bagdad wieder und in Ostafrika, in den Bergen der Nuba, an der Seite von Leni Riefenstahl. So etwa könnte man den Lebensentwurf des Abenteurers Heinrichs kurzfassen. Oder wie es im Märchen der Brüder Grimm heißt: Von einem, der auszog – nein, nicht das Fürchten zu lernen, sondern die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Denn Furcht scheint dieser Mann aus der deutschen Provinz nie gekannt zu haben, er ist einfach immer nur seinen Träumereien hinterhergereist. Am Ende wird daraus ein sehr deutscher Lebensweg: der eines zur Neugier Entschlossenen, nur hat er sich, so scheint es, im Jahrhundert geirrt. Ein gewisser Faust kommt einem in den Sinn, Vorname Heinrich, und trug nicht auch der Entdecker des alten Troja denselben?
Mit dem Moped macht er sich auf nach Paris, ein Schwärmer für die Filmhelden der Nouvelle Vague: So wie sie will er leben. Überhaupt eifert er Idolen nach, denen in den Büchern, die er verinnerlicht hat, und denen in den Filmen und Songs, die eine ganze Generation prägten, like a rolling stone. Film und Theater und die Seminare der Philosophen und Ethnologen sind dann die nächsten Stationen. Immer wieder überkommt ihn beim Studium das Reisefieber, und er steigt aus, verlässt die Luft der stickigen Seminarräume, schwimmt sich frei. Es ist das Leben eines Getriebenen, von der Liebe und von den Fernen Angezogenen. So heißt es dann, im Jargon des Weltreisenden, der gerade erst nach Mali vorgedrungen war: »Einmal wollte ich mit Kamelen wieder zurück nach Niger …«
Man fragt sich, wie er zwischen den immer weiter ausgreifenden Expeditionen über mehrere Kontinente hinweg die Zeit für ein Studium fand. Aber es herrschten andere Freiheiten damals, auch akademische Spielräume, die einem Grenzgänger zwischen den Fächern und den Erdteilen zugutekamen. Er studiert Germanistik, Theaterwissenschaften, Philosophie und Ethnologie in Köln und Rom, acht Jahre braucht es, bis er, wieder daheim, an der Universität Bremen im Fach Sozialpsychologie promoviert. »Neue Modelle in den Humanwissenschaften«, der Titel seiner Abschlussarbeit, erinnert in seiner interdisziplinären Kühnheit an die Projekte der Brüder Humboldt. Noch einmal der Kosmos, noch einmal das große Ganze der Weltkulturen. Von solcher Sehnsucht ist alles geprägt, was diesen seltsamen Sucher antrieb und immer weiter hinaustrieb aus seinen angestammten Verhältnissen. Es muss eine besondere Begabung sein, die einen Menschen dazu bestimmt, sich dem Zufall zu überlassen und die Grenzen und Ordnungssysteme seiner Zeit zu überwinden und zu durchkreuzen. Es gibt nicht viele, die das Zeug dazu haben. Bruce Chatwin war einer von ihnen. Hans-Jürgen Heinrichs gehört, wenn er denn irgendwo hingehört, in diese Klasse.
Man könnte den publizistischen Abenteuerweg dieses Völker- und Menschenkundlers nachlesen und würde auf einige interessante Titel stoßen. Man könnte auch den Übersetzer, den Dichter, den Essayisten, Verleger und Dialogpartner kennenlernen. Legendär in den achtziger Jahren war der Qumran Verlag für Ethnologie und Kunst, seine Zentrale, von deren Publikationen wir damals alle profitierten wie von den leicht in die Tasche zu steckenden Bändchen der Merve-Reihe, die eine Zeit lang jeder bei sich trug, der sich als Intellektueller fühlte. Man müsste begreifen, wen man hier vor sich hat: den deutschen Herausgeber der Schriften einiger der wichtigsten Ethno- und Soziologietheoretiker des zwanzigsten Jahrhunderts, Autoren wie Victor Segalen, Alfred Métraux, Michel Leiris, aber auch von Grundlagentexten zur Psychoanalyse, Kunstgeschichte und Literatur. Dann hätte man das ganze geistige Programm dieses Mannes auf dem Schirm, seine DNA. Ich muss sagen, ich verdanke ihm vieles. Kein Wunder, dass manche der Autoren, die ihn geprägt haben, nun auch in seinem Lebensbericht auftauchen, Leute wie Michel Butor, Francis Bacon oder sein großer Lehrmeister Fritz Morgenthaler. Von ihm handeln einige der schönsten Passagen des Buches.
Sagen wir so: Als er begriffen hatte, dass die Literatur ein riesiger Spielraum der Freiheit sein kann, das größte Projekt der Welterkundung überhaupt, schreibt er einen Abschlussbericht, seine »Literaturtheorie zwischen Kunst und Wissenschaft« – und befreit sich aus allen akademischen Zwängen. Von nun an war klar: Da war einer, der die Welt mit den Augen der Schriftsteller sehen wollte, er folgte den Pfaden der Dichter. Vermutlich hat uns das irgendwann zusammengeführt, in einer Whiskybar in Berlin, eines Nachts in Rom an einem Restaurant-Tisch gegenüber vom Kolosseum und wer weiß noch wo. Mich, den Streuner um die ewig gleichen Hundeecken, und ihn, den Mann, den es im Laufe seines Lebens bis auf die Osterinsel verschlagen hatte, nach Feuerland, in die Syrische Wüste, die Archipele des Südpazifiks und bis ins innerste Afrika. Mir blieb nur das bisschen Draußen, die Kälte der Städte, ein Stück Fußgängerzone nachts, wo die Vertriebenen umherirrten, mir blieben die Momentaufnahmen der großen Migration. Ihm eilte der Ruf des Reisenden voraus, eines manischen Unterwegsmenschen, der auf dem Weg nach draußen, an die entlegensten Orte der Erde, schließlich im Innersten, bei sich selbst angelangt war. Das Abenteuer der Sprache als eine Expedition nach innen, in den Schwarzen Kontinent der Psyche und des noch nie zuvor Wahrgenommenen – davon war er beseelt.
Hans-Jürgen Heinrichs, so lernte ich ihn kennen, war ein Pionier in der Kunst des dialogischen Denkens. Ein Mann scheinbar ohne Eigenschaften, der als Regisseur die Eigenheiten der anderen hervorkitzelte. Hier war ein Autor am Werk, der die Fremdanalyse als Selbstanalyse auf die Spitze trieb – was manche seiner Gesprächspartner ihm niemals dankten. Von den Kränkungen ist hin und wieder die Rede. Und doch waren sie alle von seiner entwaffnenden Eindringlichkeit, seinem Auftauchen in ihren Biographien, die er mitschrieb, seiner Zuneigung, seiner Selbstlosigkeit verführt, wenn ich es recht sehe. Er brachte sie alle zum Reden, das war sein Geschick. Ein Leben unterwegs zwischen Menschen und Büchern, Büchern und Menschen, ein Leben, das einem Suchbefehl folgte. Man ist erstaunt, wenn man liest, wie mächtig auf einen Menschen des Jahrgangs 45 noch immer die Fernstenliebe (im Sinne Nietzsches) wirkte. War die Welt nicht schon völlig entzaubert und mit ihr alle Zeitgenossen? Nicht so für einen wie ihn. Hoch anzurechnen ist ihm sein Nachfragen gegen alle Widerstände, sein Sprung über alle Gräben und jede Eitelkeit, seine Kunst des Zunahetretens und der Überwindung von Grenzen. Davon handelt dieses Buch.
ERSTE SZENEN VOM GLÜCK SICH ZU BEGEGNENUND VOM UNGLÜCK SICH ZU VERFEHLEN
Ein mit der Welt des Films bestens vertrauter Mann soll einmal alles darangesetzt haben, Ingmar Bergman und Woody Allen miteinander bekannt zu machen. Es kam auch tatsächlich zu einer Begegnung, die allerdings, so heißt es, zu einem veritablen Desaster geriet. Sie hatten sich wohl nichts zu sagen, und ihre Blicke rutschten ab vom Gesichtsfeld des Gegenübers und landeten im Nirgendwo. Die beiden Großmeister des szenischen Blicks vermochten in gefilmten Szenen allen Begegnungen eine ganz besondere Gestalt zu verleihen; in der von ihnen selbst handelnden Szene aber erwiesen sie sich als Gefangene ihres Lebens. Dabei waren die Voraussetzungen eher günstig gewesen, hätten sie doch zum Beispiel stundenlang, auf Augenhöhe, über technische Details wie die Hell-Dunkel-Ausleuchtung von Szenen, über Fragen der Kameraführung und der Schnitttechnik sich austauschen können. Sie ergriffen die Chance nicht.
In einer Variante der Geschichte heißt es, Woody Allen habe selbst das Treffen herbeigeführt. Und sie hätten äußerst angeregt die ganze Nacht über geplaudert, Ingmar Bergman habe sogar einen angsterfüllten Traum offenbart. Liv Ullmann allerdings erinnert sich nur an ein bedrückendes Schweigen. Ich weiß nicht, mit welchen Gesten und Grußformeln die beiden sich verabschiedeten. Am Ende wortlos? Waren sie einander nicht ebenbürtig? Aber in welchem Sinn? Lebenserfahren oder künstlerisch? In welchem Augenblick gewann das Trennende die Oberhand?
So saß ich eines Tages in einem Pariser Restaurant von schlichter Eleganz an der Place Dauphine, in unmittelbarer Nähe der Rue Dauphine, in der ich, im Haus mit der Nummer 34, eine Ein-Zimmer-Mansarde gemietet hatte, in der man an wagemutigen Tagen durch die Fensterluke aufs Schieferdach steigen und den Panorama-Blick über die ganze Stadt hinweg genießen konnte. Zur einen Seite unmittelbar vor mir die Place de Furstenberg, zur anderen Seite die Place Dauphine. Beide Plätze waren für mich tägliche Durchgangsorte, die mir wie eine Verlängerung meines knapp Zwanzig-Quadratmeter-Ess-Schreib-Schlaf-Raumes vorkamen. An manchen Tagen verweilte ich aber auch hier und dort, ging in einen Laden, setzte mich auf eine Bank oder aufs Pflaster oder kehrte, so wie heute, in diesem Restaurant ein.
Auf dem Tisch am Fenster hatte ich neben dem Wein- und Wasserglas, dem Besteck und der Serviette die mitgebrachten Bücher und ein Heft ausgebreitet. Da mich der Ober wiedererkannte, arrangierte er ohne Murren, fast liebevoll, das Brotkörbchen, die Wasser- und die Weinflasche, später auch noch einen Beilagenteller, um meine eher restaurantfremden Mitbringsel herum.
Ohne dass dies den Genuss der Ravioli-Pasta und des Weins eingeschränkt hätte, sogar ganz im Gegenteil, hatte ich damit angefangen, mir Notizen zu dem Buch eines in Frankreich sehr geschätzten, ja verehrten Schriftstellers und Chansonniers zu machen, der zeitweise so populär gewesen war, dass man ihn, wenn er irgendwo anrief und seinen Namen etwas undeutlich aussprach, fragte: »Jacques Prévert, so wie der Dichter?«
Ich wollte einen Text von ihm, der erstmals 1936 verlegt worden war, auf Deutsch unter dem Titel BEFEHLSVERWEIGERUNG herausbringen, eine Art Prosagedicht, das mich von den ersten Zeilen an in Bann gezogen hatte – in seiner direkten, um keine Tabus sich scherenden, ebenso szenischen wie poetischen Sprache. Prévert hatte ganz entscheidend das intellektuelle und künstlerische Flair von Saint-Germain mitbestimmt. In den Keller-Studios und Cafés sangen Juliette Gréco und viele andere, berühmt gewordene Sänger seine Texte. Seine Poesie eroberte das große Publikum, von dem er einmal sagte, es sei eigentlich sein Co-Autor; die Poesie halte sich überall auf, sie sei ein anderer Name für das, was man Leben nennt. Leben verstanden Prévert, viele Künstler und Schriftsteller als ein pulsierendes, von Revolte und Aufbegehren erfülltes, glühendes Leben. Wenn sie von der Nähe zum Volk sprachen, war das mit der Phantasie einer weltoffenen Gemeinschaft, fern von Dogmen, verknüpft.
Nur einen Tisch von mir entfernt speisten ein Mann und eine Frau, die ich kaum anzuschauen wagte, zumindest nicht länger als ein paar Sekunden, und dann eher verstohlen. Von ihnen, ihrer Physiognomie und der Art und Weise, wie sie einander zugewandt waren, ging eine beispiellose Intensität aus. Ich geriet in den permanenten Zwiespalt, mich ihrer (zumindest nahm ich es so wahr) geheimnisumwitterten Präsenz zu erfreuen und sich ihr doch nicht gewachsen zu fühlen, nicht Teil ihrer Welt zu sein.
Natürlich hatte ich inzwischen in ihnen – ihre Gesichter waren doch längst schon zu Kultursymbolen und -insignien geworden – zwei der aufregendsten Schauspieler und Sänger jener Jahre erkannt. Augenblicklich sah ich in ihnen, in dieser unmittelbaren situativen Nähe, noch viel mehr als nur DARSTELLER. Es kam mir vor, als seien die Musik, der Film, das Theater und die Bühne selbst im Raum leibhaftig gegenwärtig. Sie anzuschauen bedeutete, sich in die Zuschauerräume der Theater dieser Welt zu versetzen und einen vielleicht heimlichen Blick hinter die Bühne zu werfen, teilzuhaben an ihrer Nervosität vor dem Auftritt, sie in Landhäusern und Hotels mit all den anderen, die Gegenwart prägenden Künstlern, Schriftstellern und Regisseuren zusammen zu sehen. Und natürlich auch auf den politischen und kulturellen Bühnen, zum Beispiel in Moskau, wo er, Yves Montand, 1956 im Luschniki-Stadion gesungen hatte. Nach der russischen Invasion in die Tschechoslowakei endete Montands Verbundenheit mit dem Kommunismus.
Vor mir zogen all die Bilder vorüber, die von den politischen Idealisierungen und Enttäuschungen, von Heldenverehrungen und den Stürzen der Denkmäler von Machthabern seit den 1968er Jahren erzählten; Bilder aus der Ferne angeschaut. Mir gegenüber aber saßen Zeitzeugen und Mitgestalter weitestreichender Räume der Weltgeschichte – und der Kunst.
Wie hätte ich ihn und sie ansprechen können? Mit welcher Legitimation? Schamerfüllt wäre ich auf der Stelle im Holzboden des Restaurants versunken. Ich sah mich sogar schon, wie ich zwischen zwei Dielen hindurchrutschte. Also aß, trank, las, schrieb ich weiter.
Einmal blickte ich auf, eigentlich nur, um einem vage ins Auge gefassten Gedanken unbeirrt zu folgen, und sah, ins Leere blickend, wie der Mann sein Glas (das er gerade in die Hand genommen hatte, um mit seiner Begleiterin anzustoßen) noch ein wenig höher, und in meine Richtung weisend, hob. Ich griff hastig nach dem meinen, erwiderte den Gruß und war über alle Maßen verwundert, dass mein Glas beim Absetzen nicht zersprang.
Sofort vertiefte ich mich wieder in mein Buch und mein Schreibheft, so wie es Kinder tun, wenn sie nach einer winzigen Überschreitung nur, zum Beispiel einem Jungen oder einem Mädchen einen ersten Kuss gegeben zu haben, unmittelbar weglaufen.
Ich war auf den letzten Seiten von Jacques Préverts Band PAROLES (in dem die BEFEHLSVERWEIGERUNG von 1972 wieder aufgenommen worden war) angelangt und hatte, glücklich, das Buch zur Seite gelegt, unabsichtlich oder unbewusst willentlich so, dass Autor und Titel zu meinen Nachbarn hinwiesen. Es dauerte gar nicht lange, da richteten sie, geradezu synchron, das Wort an mich und sagten, es freue sie sehr, dass ich Prévert lese, und fragten, wie ich auf seine Texte gestoßen sei. Zögerlich, stockend begann ich zu erzählen, erst einmal von meiner Begeisterung für die Surrealisten und ebenso für die Abweichler. »Mögen Sie sich an unseren Tisch setzen?«, unterbrachen sie mich. Das Gespräch entfaltete dann seine Spannung gerade aus dem Gefälle zwischen uns, ihrer viel größeren Lebenserfahrung und Souveränität und meinem Unwissen. Es war mir auch entgangen, dass Yves Montand schon 1946/47 Gedichte von Prévert gesungen hatte und dass im Laufe der Zeit Prévert, Montand, Simone Signoret und Jorge Semprun (der später sogar Montands Biograph werden sollte) enge Freunde geworden waren. Im Grunde habe er es Prévert zu verdanken, sagte Montand und fasste dabei liebevoll nach Simone Signorets Arm, dass er ihr begegnet sei.
Ich war jemand, der sich nur erst in die Literatur einzulesen, in den Film und das Theater einzusehen, in die Musik einzuhören und ins Leben einzuleben begonnen hatte. Und doch war ich als einer, der im Restaurant – für nahezu alle eher befremdlich – geschrieben und gelesen hatte (und zudem Jacques Prévert!), ein augenblickshafter Teil ihrer Wirklichkeit geworden, hatte das Szenario an diesem Abend in diesem Restaurant ein winziges Stück erweitert. So waren die Welten, die uns trennten, bedeutungslos für die Begegnung geworden. Ja, im Gegenteil, die Freude am Austausch war aus der Differenz zwischen uns situativ entstanden. Kaum wiederholbar.
Das hätte sich ein anderes Mal so auch im Café de Flore ereignen können, als ich an einem Tisch mit einem Philosophen und einer Schriftstellerin (die sich ein Leben lang mit Sie ansprachen) saß. Es war allerdings eine Begegnung, die nicht zufällig zustande gekommen war – was sich auch als ein Makel erweisen sollte –, sondern sich der Vermittlung eines gemeinsamen Freundes verdankte. Es gab, so stellte sich schnell heraus, zu wenig begehbare Brücken, über die man leichtfüßig hätte gehen können. Auch unternahmen die beiden Berühmtheiten nichts, um die eherne Größe ihrer Namen für einen Augenblick einzutauschen gegen die Haltung ungeschützter Neugierde einem Menschen gegenüber, der nicht mehr als seine Leidenschaft für das Denken, Schreiben und Reisen in die Waagschale zu werfen hatte. Noch deutlicher als zuvor sah ich in ihnen große Denker, Vor-Denker und Sprecher, die schon – stets auf Einladung politisch und kulturell Mächtiger – die ganze Welt bereist hatten, während ich mir nur Ausschnitte der Fremde auf eigene Faust zu erobern versucht hatte. Wo hätten sich unsere Wege kreuzen sollen, ob auf Reisen oder jetzt im Sprechen über das Reisen?
Schön war der Abschied, als ich sagte, ich hätte mir als Schüler von erspartem Geld sein Buch LA NAUSÉE in weinrotes Leder einbinden lassen. Da legte sich kurz ein Glänzen auf das Gesicht des Philosophen, der sich so gerne auch als Schriftsteller sah.
Diese Szene noch vor Augen, folgte ich eines Tages der Einladung einer Bekannten, mit ihr ins siebte Arrondissement zu Georg Stefan Troller zu gehen, mit dem sie befreundet war. »Er wird dir gefallen. Und du vielleicht auch ihm.« – »Wer weiß das schon. Bin gerade, nach einem letzten Erlebnis im Flore, eher skeptisch!« – »Erzähl ihm unbedingt von deiner Rapallo-Reise zu Ezra Pound, über den er einen Film gedreht hat.« – »Begegnet bin ich ihm freilich dort, wo er gelebt hatte, nicht. Ich fuhr aber weiter nach Venedig. Vielleicht erzähle ich nachher noch davon. Mal sehn.«
Wie auch bei der Spurensuche in Lissabon und Triest, als ich den Wegen von Fernando Pessoa und James Joyce folgte und mir in den alten, am Meer gelegenen Begegnungsorten vieler Kulturen die ganz und gar singulären Lebenswelten der beiden Dichter vorstellte, so reiste ich einmal auch nach Rapallo und Venedig, um mir die Welt Ezra Pounds vorzustellen, die Welt eines Sprachmagiers, dem exemplarische poetische Verdichtungen und Konstellationen gelungen waren und der sich doch in beklommen machende Irrwege bei der Deutung von Mussolinis Faschismus verstrickt hatte. In dessen Rede vom 6. Oktober 1934 fühlte er sich an den Bildhauer Constantin Brancusi und an »Steinquader, denen kein Makel anhaftet« (Canto 45) erinnert. In Rapallo soll er, 1944, seine letzte schriftliche Notiz gemacht haben: »Nein, das Geld ist nicht die Wurzel des Übels. Die Wurzel ist Habgier …«
Es war nicht so, dass ich von dem Glauben besessen gewesen wäre, durch das Aufsuchen von Orten, an denen Schriftsteller lebten, die Spurensuche in ihren Werken auf irgendeine Weise ersetzen zu können. Es waren vielleicht nur ergänzende Landschaftsbilder und deren Farben, die ich suchte – Anstöße für die eigenen Imaginationen und Assoziationen, zum Beispiel in Pounds Rapallo, durch die Stadt und die Landschaft gehend, noch einmal seine hagere Gestalt und die Züge seines mythisch anmutenden Gesichts zu sehen und in seiner Stimme den Sänger der CANTOS zu hören.
Ich studierte zur Zeit dieser Reise noch, hatte wenig Geld, trampte überallhin. Ich war dann schon in Südfrankreich gelandet, hatte Marseille und Nizza hinter mir gelassen, vor mir lag eine teils kurvenreiche Strecke Richtung Italia, Richtung Genua. Von einer Fahrt mit dem Bus – nachdem mich Autos immer nur kurze Strecken mitgenommen hatten – war ich aber schließlich so genervt, dass ich mich wieder an den Straßenrand stellte. Da hielt, nach vielen Stunden, in unmittelbarer Nähe ein roter Rennwagen, tatsächlich ein Ferrari, wie unschwer zu erkennen war. Der Fahrer wollte aber nur urinieren, bevor es auf seine Rennstrecke ging. Meiner Frage, ob er mich mitnehmen könne, begegnete er zuerst schroff abweisend, ließ sich dann aber doch auf ein kurzes Frage-Antwort-Spiel ein, kritzelte auf einen Zettel, dass er keinerlei Verantwortung übernehme. Ich unterschrieb und zwängte mich in den Wagen. Die Überholspur, auf der er fast durchweg, selbst in Kurven, fuhr, versuchte ich mir als einen Wanderweg auf der Insel Bora Bora vorzustellen. Irgendwann stoppte er, bat mich auszusteigen, es sei ihm doch zu riskant, mich an Bord zu haben, Genua hatten wir schon hinter uns gelassen. Die weitere Strecke nach Rapallo ging ich zu Fuß, aber in des Canto-Dichters Welt vorzudringen (die er sich 1925 mit seiner Frau erschaffen hatte, er in einer Dachterrassenwohnung, Olga Rudge in einer kleinen Wohnung oberhalb von Rapallo), blieb mir verwehrt.
»Du musst die Geschichte Troller unbedingt erzählen.« – »Wozu dieses Misslingen wiedergeben? Den Irrsinn einer selbstmörderischen Fahrt und eine Nicht-Ankunft?« – »Die darin liegende Absurdität wird ihm gefallen. Er wird bestimmt eine ganze Reihe viel absurderer Geschichten erzählen. Auch Hintergrundgeschichten seiner (ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren) Porträtfilme, ob mit Orson Welles und Romy Schneider oder den Modemachern, obwohl er nichts mit deren Arbeit am Hut hatte.«
Zum Glück war meine Reise ja nicht bei Rapallo zu Ende gewesen. »Zum Glück?«
Ich nahm verquere Wege durch die Emilia Romagna, mit einem längeren Aufenthalt in Parma, und landete schließlich in Venedig, wohin Ezra Pound nach den grauenerfüllten sechs Monaten in dem eisernen Käfig des amerikanischen Straflagers bei Pisa gezogen war. Dem Venedig-Aufenthalt vorausgegangen waren noch seine Zeit auf der Brunnenburg unterhalb des Dorfes und Aufenthalte in Rapallo und Rom. Inzwischen war er entmündigt worden – und verstört. Meine Begegnung mit ihm (der einmal gesagt haben soll, alles sei umsonst gewesen) vollendete sich, in höchstmöglicher Verdichtung, als Nach-Begegnung mit dem am 1. November 1972 verstorbenen Dichter auf der Friedhofsinsel San Michele.
Auf den letzten Metern zu Georg Stefan Trollers weiträumiger Wohnung im obersten Stock (ich sage, oberster Stock, da ich immer noch den weiten Blick über die Dächer von Paris zu erinnern glaube) spielte ich tatsächlich mit dem Gedanken, ihn darauf anzusprechen, ob er sich vielleicht schon einmal oder gar ganz oft gefragt habe, was es eigentlich mit den Nicht- und den Nach-Begegnungen auf sich habe. Zu sehr berührt war ich von diesem Mann und seinen Bekenntnissen zur Lebenslust (die sich in seinem Gesicht widerspiegelte im Wechsel mit Einsamkeit und Verlorenheit), als dass ich mich jetzt, nach vierzig Jahren, trauen würde, den Gesprächsverlauf noch wiederzugeben. Aus Szenen und Geschichten setzt sich das Bild zusammen, das mir von ihm geblieben ist.
Einmal mehr bin ich überwältigt, wenn ich heute, im Februar 2020, da er 98 Jahre alt geworden ist, sehe, dass er sich immer noch daran erfreut, wie er einst lebenstrunken neben Leonard Cohen, Yves Montand, Melina Mercuri oder einer Schönen am Strand von Cannes posierte. Erstaunlich der ungebrochen scheinende Wille zum Leben, den viele der wegen ihrer Herkunft Verachteten und zum Tode Verurteilten aufzubringen in der Lage waren. Zum Beispiel auf extreme Weise Ephraim Kishon. Nie vergessen werde ich, wie er mir davon erzählte, dass er sich in Augenblicken eines unaushaltbaren Erzitterns Reden von Hitler und Goebbels anhörte, so lange, bis sich das Bild des erlebten Grauens in Satire verwandelte und er laut loslachte, ein Lachen in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Todesschrei. Selbst in seinem Haus in der Schweiz, in das er mich eingeladen hatte, und sogar in seinem Swimmingpool hatte er eine Anlage installiert, von der er mir einen Verschnitt von Hitler und Goebbels vorspielte.
Auf dem Rückweg von Georg Stefan Trollers Wohnung schlug ich meiner Begleiterin vor, in ein jüdisches Restaurant (das berühmte »Jo Goldenberg« in der Rue des Rosiers im Marais) zu gehen. Ich erzählte ihr, wie ich – gerade erst zurückgekehrt von einem Aufenthalt in Mali, Niger und Tschad – noch am selben Abend einer verehrten Dichterin in dem indischen Restaurant »Tausendundeine Nacht« einen über drei Meter langen Schal (wenn ich ihn in der Vorstellung jetzt nicht länger mache, als er tatsächlich war) schenkte, den sie sogleich liebevoll berührte, als der damalige Direktor der Deutschen Bank in das Restaurant trat und sich einen Tisch von uns entfernt niederließ, was sie veranlasste, augenblicklich ihr gesamtes Gesicht, die Augen ausgenommen, zu verhüllen, da sie und ihr Mann den Herrn Direktor am nächsten Abend bei sich zu Hause zum Abendessen eingeladen hatten. Sie befürchtete, der Bankdirektor könne bei ihrem Mann unangenehme Fragen stellen.
Dieser Herr also, der sie beim Abendessen am nächsten Tag aufs Herzlichste umarmen sollte, wie mir die Dichterin einen Tag später erzählte, hatte die ganze Zeit über im indischen »Tausendundeine Nacht« so unverhohlen missmutig zu ihr herübergeschaut, dass man seine Gedanken lesen konnte, die darum kreisten, dass es doch höchst unangenehm und lästig sei, einer voll verschleierten Frau aus der arabischen Welt in Frankfurt-Sachsenhausen gegenübersitzen zu müssen. Ihm erschien die streng muslimische Identität der Frau derart unzweifelhaft, dass sie sich am nächsten Abend sogar einige kleine Spielereien erlauben konnte, um ihn zu verunsichern, was natürlich nicht gelang. Zu fest eingemauert war seine Gleichsetzung von Verschleierung und Muslimin, dass er sich in ihr keine deutsche Frau vorstellen konnte. Er wusste gar nicht, welches Glück ihm entgangen war, die Gastgeberin schon vor dem gemeinsamen Abendessen hier als inszenierte Tuareg-Frau zu umarmen. Das so nahe Glück der Begegnung hatte er verscheucht. Es blieb das ihm unbewusste Unglück des Verfehlens.
✯
Eine Zeit lang glaubte ich in den unterschiedlichsten Frauen, die mir auf der Straße oder in Metro-Stationen begegneten, meine vor langer Zeit verstorbene Freundin Maria wiederzuerkennen. In wildfremden Gesichtern und Körpern – sogar in eher voluminösen – sah ich sie, dieses gazellenartige Wesen. Manche Frauen wandten sich augenblicklich von mir ab oder schauten mich eher misstrauisch an. Weil sie sich von meinen Blicken belästigt fühlten? Mich störte es nicht weiter und ich hielt fest an meiner Freude über die unerwartete Begegnung.
Natürlich wünschte ich mir, die geschaute (vermeintliche) Maria würde meine Blicke erwidern. Ich stellte mir vor, dass sie an sich selbst die Konturen des Gesichts meiner geliebten Maria nachzeichnen würde, so, wie es einmal ein Mädchen getan hatte, als es beim Anschauen eines Porträts die Umrisse des fremden Gesichts an ihrem eigenen nachgezogen hatte, so lange, bis es sich in dem gemalten Bild erkannte. Höchst verwunderlich mag es erscheinen, da das Mädchen doch erst sechs oder sieben Jahre alt gewesen war und es sich bei dem Porträtierten um einen älteren Herrn, einen Dichter und Ethnologen handelte.
Nicht weniger verwunderlich ging es in einer Szene zu, in der die eher unschuldige, ganz der Jugend und dem zukünftigen Leben zugewandte Patricia, gespielt von Jean Seberg, am Ende des Films AUSSER ATEM sich so über die Lippen streift, wie es der leichtlebige Gauner Jean-Paul Belmondo zu tun pflegte, den sie gerade verpfiffen hatte und der vor ihren Augen von der Polizei erschossen wurde.
Ist nicht ein jedes Leben eines der Anverwandlungen an ein inneres Bild, das Menschen in uns hinterlassen haben und auf diese Weise weiterleben? Leibhaftig zugegen sind? Nicht länger sind sie dann ein Gegenüber. Vielmehr ein In-(uns)-Bild.
Von Anverwandlungen – man möge sie auch Metamorphosen nennen –, vom Weiterleben anderer Gesichter und Figuren, aber auch von heute vielleicht verblassten oder gerade wieder neu aufgegriffenen und verlängerten Zeitströmungen und Theorien, von inzwischen beschädigten oder bedrohten Naturen und Kulturen erzähle ich. Und von den zumeist unvorhersehbaren, oft geheimnisumwitterten, glück- und oft genug schreckerfüllten Wegen, die zu einem Verstehen der Menschen und der Welt führen sollten, allen Widerständen und Verhinderungen zum Trotz.
Die Reise beginnt.
Auf dem Arm der Mutter.
Auf dieser Reise, die das Leben meint und umfasst, gibt es besonders markante Schnittstellen, an denen verheißungsvolles Sich-Begegnen einen Anlauf nimmt, dann aber versandet oder nicht über den Augenblick hinauskommt. Mehr Resonanz war, so mag man sich trösten, nicht vorgesehen im uneinsehbaren Plan.
Ein solch verheißungsvolles Sich-Begegnen nahm einmal seinen Ausgang auf der Schwelle einer Wohnung im Pariser Marais. Mit der Geschichte, die dies erzählt, wird das Buch enden. Der Schauspieler Donald Sutherland war tatsächlich zum Eintreten bereit gewesen, hatte schon da, vis-à-vis, gestanden und sich, von weit herkommend, in den verwinkelten Gassen seinen Weg gebahnt und ein freudiges Hallo mir zugerufen.
Trotz ihrer Einzigartigkeit waren Donald Sutherland oder der Regisseur Franco Brocani, für den ich Schauplätze für seine Filme ausfindig machen sollte, immer auch vorläufige Entwürfe einer Figur, die auf eine andere, weiterführende verwies. Auf sie schaue ich wie auf mein Leben: verwundert.
✯
Seinen Weg gesucht hatte sich das Unterwegssein in den Echoräumen der Kulturen in Europa und außerhalb Europas.
Zu Anfang des Jahres 2020 flackerte dann nicht nur in meinem Leben der Gedanke ans Reisen oft nur noch kraftlos auf. Wenn auch unmittelbar verschont von der verordneten Stubenhocker-Existenz, schaue ich doch wehmütig der Stagnation zu. Wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten erscheint mir da die einst erfahrene und exzessiv gelebte Freiheit, Welten zu erobern. Es war eine den Gefahren auf fremdem Terrain zuweilen abgetrotzte Freiheit. Heroisch empfand ich dies in keinem Augenblick, glaubte ich doch nichts anderes zu tun, als meine Neugierde geographisch und kulturell auszuweiten. Wenn ich dann zum Beispiel in der Syrischen Wüste nicht mehr genügend Wasser für die nächsten Tage hatte, erlebte ich dies als eine nur mich betreffende und sich nur in mein Leben einfügende Notlage, die für niemand sonst von Interesse war. Freilich geriet ich auch in gewaltsam ausgefochtene Konflikte und war bedroht von Krankheiten unterschiedlichster Ausmaße – was meine singuläre Verantwortung überstieg.
Die katastrophische Entwicklung der Pandemie scheint gelegentlich die einmal erlebten Gefahren auf einzelne, verstreute Situationen und lokale Ereignisorte zusammenschrumpfen zu lassen und sie ihrer komplexen Dichte zu berauben. Verwoben ist die Teilhabe des Reisenden an der unabhängig von ihm sich ereignenden Gefahr mit der Möglichkeit, dass das Rettende auch in seinem Leben zur Entfaltung kommt.
Mit jeder Wortfolge, die ich in diesen Tagen in Zeitungen und Zeitschriften lese, im Fernsehen und im Radio sehe oder höre oder die mir Freunde aus den Sehnsuchtsländern und -orten schicken, sehe ich, selbst wenn sie von ganz anderem handeln, Hinweise auf das jetzt Drohende. Rom, Venedig und Paris sind innerhalb von Wochen in unerreichbare Ferne gerückt, eingehüllt in Szenarien eines großen, oft unvorstellbaren Leids, das die gloire universelle, in der sie einmal erstrahlten, vergessen machen könnte. Nur die Wege über die alten Filme, die Musik, das Theater, die Literatur beider Länder sind weiterhin in Freiheit zu beschreiten – allerdings begleitet von den täglichen Bildern der Todesgefahr und des eingetretenen Todes.
Als die Rettung vieler Infizierter in Gefahr geriet, wurde von Ärzten die Situation beschrieben, in der sie vor die Entscheidung gestellt werden könnten, einem alten Menschen das zu seinem Überleben notwendige Beatmungsgerät abzunehmen und einem jüngeren, ebenfalls lebensgefährlich Erkrankten zu überlassen. In einer einzigen Szene sah sich die gesamte Zivilisation mit den Grundfesten ihrer Ethik konfrontiert.
In einem vergleichsweise bedeutungslosen Fall setzte sich auch einst eine am Rande der Welt und der Zeit lebende Gemeinschaft mit der Frage nach Leben und Tod im grundsätzlichen Sinn auseinander. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten die Ainu auf Hokkaido ein fest ins soziale Leben integriertes, unumstößliches Ritual: Die zum Zeitpunkt der Geburt eines Kindes älteste Person in der Gemeinschaft wurde gebeten (und falls sie dem nicht nachkam, mit Nachdruck aufgefordert), den Platz für den Neuankömmling zu räumen und sich zum Sterben in die Einsamkeit zurückzuziehen. Eines Tages aber hinderte ein junger, schmerzerfüllter Mann seine dem Leben noch von ganzem Herzen zugewandte Mutter daran, den Weg in die eisige Landschaft des Todes anzutreten. Nie zuvor hatte es jemand gewagt, sich dem Ritual zu widersetzen. Die Gemeinschaft hatte lange schon, stelle ich mir vor, insgeheim diesen Augenblick tief empfundener Humanität herbeigesehnt und mit großer Erleichterung die zum Gesetz erhobene Tradition aufgegeben. Man hatte sie seelisch, religiös und sozial hinter sich gelassen.
✯
Welche Sprachen werden wir erfinden: für das Gespräch miteinander? Erschließen wir uns bislang verborgene Gedankengänge, Diskurse und Assoziationsketten? Und auch Poesien mit einer nur ihnen eigenen Präzision; Poesien, die uns ermöglichen, das uns seit Anfang 2020 in Haft nehmende Bedrohliche in Sprache verdichtet darzustellen?
Wie werden wir eines Tages auf das Jahr 2020 zurückblicken? Und haben dann die Wissenschaft, die Literatur und die Künste gehalten, was wir von ihnen erwarteten?
Meine Geburt fiel in eine Zeit, in der auch gerade eine Zivilisation zerbrochen war. Und als ich in den 1970er Jahren unentwegt aufbrach, um lebbare Gegenwelten zu entdecken, war auch jedes Mal das Europa, in das ich zurückkehrte, ein in vielerlei Hinsicht (politisch, sozial und kulturell) grundlegend verändertes. Und bei jeder neuerlichen Reise, vor allem in den Nahen Osten und in die Länder Afrikas, sah ich mich konfrontiert mit dem Zerfall der Traditionen, mit Konflikten und Kriegen, deren Ausmaße man noch nicht abschätzen konnte.
So ist der Titel dieses Buches DER KÜRZESTE WEG FÜHRT UM DIE WELT auch um diesen Nachsatz zu ergänzen: »… und führt, auf ebenso unbekannten Wegen, zurück in ein immer wieder neu zu erschließendes, zu gestaltendes und zu erzählendes Europa.«
WELT EROBERNVOM ABENTEUER DES UNTERWEGSSEINS
Die Kindheit war ein Stückwerk. Die Jugend versuchte, die Teile zu verknüpfen. Für vieles gab es noch keine Sprache, und doch schienen sich die Geschichten schon auf eine Erzählebene einzuschwingen. In Großbuchstaben stand da geschrieben: Aufbruch, ein Wort, das sich auch als Unterwegssein lesen ließ.
Weg von Hier, hin zu einem recht vagen Dort, das irgendwo auf dem Weg um die Welt angesiedelt war. Vielleicht führte ja am Ende der kürzeste Weg zum eigenen Leben.
Die ferne Kindheit und Jugend und ihre Ablagerungen in der Gegenwart waren und sind weiterhin ineinander verwoben. Erst nachträglich zum Erlebten offenbaren sich deren Bedeutungen und können erzählt werden. Das Erzählen selbst macht das Erfahrene zuallererst wirklich, im Sinne von »So kann es gewesen sein, so kann es sich zugetragen haben, gegen mich oder für mich«.
Da gab es zum Beispiel das Unikum eines bäurischen Apparats, den der Junge für die Schweine zu heizen hatte und der ihn oft genug ausschloss vom Spiel mit den Freunden. Da gab es aber auch ein nicht weniger seltsames Gerät, das der genialische Schriftsteller und Denker Oswald Wiener für uns beide geheizt hatte. Die Glut des gusseisernen Ofens öffnete den Weg zu einem Spiel, das man nicht Kindheitsdrama, sondern Denken und Schreiben nennt. Gut, es lagen einige Jahre zwischen dem Niederdrückenden und dem Erhebenden. Aber nicht die zeitliche Differenz ist entscheidend, sondern wie sich beide Geschehnisse ineinanderfügen und wie sie aus einer dem Kind abgewandten Welt eine ihm zugewandte machen.
So geschichtet und verknotet sehe ich auch meine Reisen. An ihrem Anfang stand die Flucht. Ein Unterwegssein aus Not. Die Tragödie ließ sich aber – wie unerwartet! – verwandeln in ein Füllhorn an Absurditäten, zum Beispiel als ich, der ehemals im Leib der Mutter Geflüchtete, eines Tages im Lastwagen eines Irakers gelandet war, der immer wieder fünf Wörter wiederholte: Alemania, Adenauer, Magirus Deutz, Hitler, Autobahn.
Tag und Nacht waren die Fenster des Wagens geöffnet. Der Sand hatte sich in alle Poren des Reisenden, der längst jede Orientierung verloren hatte, ausgebreitet. Gefühle waren einer (ihm unbekannten) Gleichgültigkeit gewichen. Sie half ihm dabei, das Rattern des Wagens, den Sand und die Kälte in der Nacht, die Hitze am Tag, den Hunger und den Durst am Tag und in der Nacht zu ertragen. Er wusste nicht, warum der Mann die Steine durch die Wüste fuhr. Und er wird es nie erfahren.
Der Lust am Reisen ist es egal. Was weiterhin insistierte, war die Frage: Wann war diese unerschrockene Lust entstanden, und welche wohlwollenden Gegenfiguren zu den Schreckfiguren der Kindheit hatten eine solche Wandlung allererst ermöglicht?
Das Unterwegssein ließ sich feiern mit Menschen, deren Lebensform das Nomade-Sein war. Auf zu den Tuareg in die Sahelzone und in die Sahara. Immer wieder. Nicht mit Traktoren. Sondern zu Fuß und auf Kamelen. Und es gesellten sich Freunde im Geiste hinzu. Natürlich Bruce Chatwin. Auch in Künstlern und Schriftstellern erkannte ich Nomaden in der offenen Welt der Gedanken, der Worte und Klänge.
Einen von ihnen wählte ich zu einem ganz besonderen Zuhörer, der die Zeile »Born to be wild« gedichtet und vertont hatte. Es war Udo Lindenberg, dem ich von den großen Liebhabern der Fremdheit erzählte, die er sehen konnte, wenn er – das versuchte ich ihm einzureden – durch ein Fernrohr in seinem Hotel Atlantic schaute: ob Hubert Fichte und Roger Willemsen oder Victor Segalen, Michel Leiris oder Paul Parin und Fritz Morgenthaler.
Wie aber sollten sich meine Erzählungen von den Aufbrüchen in der Kindheit und Jugend und die sie überlagernden Erprobungen anderer Lebensformen und Weltentwürfe zu einer in sich geschlossenen Form fügen? Aber war das überhaupt anzustreben? Stünde das Spätere nicht eigenartig freischwebend im Raum, ohne die sich zuallererst ausprobierende Tonlage? Holprig beginnt das Leben.
Mögen einem Einzelheiten zuerst als überflüssig vorkommen, können sie sich gerade in ihrem unscheinbaren Erscheinungsbild als bedeutsam erweisen: die Schnürsenkelverknotungen eines Theater-Regisseurs, die wilde, am Augenblick orientierte Arbeit eines Film-Regisseurs, der Goldreif meiner Mutter, den sie trug, wenn sie für andere Leute putzte, und den ich in einem Köcher aufbewahre, den eine alte Nuba-Frau um den Bauch eines Ochsen verknotet hatte, wenn sie in sumpfiges Gelände ritt und ich ihr hinterher. Bedeutsame Szene bei der Suche nach den Lebensspuren des am Geschehen Teilhabenden? Oder auch, auf Umwegen, für einen daran gänzlich Unbeteiligten?
Dem Nebensächlichen eigen ist, dass es im Verborgenen wirkt. Zum Vorteil oder zum Nachteil. Vielleicht gibt jede der im Folgenden erzählten Geschichten Aspekte einer möglichen Antwort frei, einer Antwort, die sich vom Singulären meines Lebens auf das Singuläre eines mir unbekannten Einzelnen, zum Beispiel den Leser, auswirkt. Hinüberschwappt. Vielleicht ist es ja so, wie der Autor zu glauben geneigt ist, dass dem Individuellsten die größte Chance eingeschrieben ist, Potentiale des Allgemeinen zu offenbaren. In Bewegung zu setzen.
✯
An Gepäck kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich eine Tasche mit Kleinkram und etwas zu essen. Die Höchstgeschwindigkeit des Mopeds betrug knapp dreißig Stundenkilometer. Die erste Nacht – Rheinland-Pfalz lag hinter mir – verbrachte ich auf einem Feld, nahm einen Strohballen als Unterlage und zwei weitere für eine Art Spitzdach. Heute, über fünfzig Jahre später, stelle ich mir das ungläubige Kopfschütteln des Komponisten Hans Werner Henze vor, wenn ich ihm von dieser Nacht im Sommer 1968 erzählt hätte. In aller Frühe brach ich wieder auf.
Am dritten Tag wurde es hektisch auf den Straßen. Irgendwann muss ich auf einem Autobahn-Zubringer gelandet sein und wurde von den Autos und Lastwagen geradezu verfolgt. Ich fuhr aber in Paris ein, in die Metropole der Phantasien und Sehnsüchte. Sah die Metros und die Busse, die Dächer, von denen die Film-Szenen mit Jean-Paul Belmondo erzählten. Sah ihn vor mir, wie er sich genüsslich über die Oberlippe strich, dabei im rechten Mundwinkel eine Zigarette geparkt hatte, die er, wenn ihm danach war, anzündete und mit ihr schon sehr rasch wieder die nächste zum Glühen brachte. Wahrscheinlich dachte ich: So also macht man das. Und wenn er Patricia zurief »Mailand Genua Rom«, stellte ich mir vor, es ihm gleichzutun, wie auch immer die nächste Schöne in Paris heißen sollte. Wie aber konnte ich seine Lügen und Tricksereien in Einklang bringen mit meiner Vorstellung vom Leben? Er war ein Star, aber an seinem Drehbuch gab es noch einiges zu verbessern. Sollte ich tatsächlich vorgeführt bekommen, dass die Frau den Mann mehr liebt, wenn sie weiß, dass er von der Polizei gesucht wird, und ihn verpfeift, um zuzusehen, wie er erschossen wird, und er im Sterben noch Grimassen zieht und ihr sagt, sie sei zum Kotzen?
Ohne Umwege war ich direkt ins Quartier St. Denis gegangen. Noch Jahre später glaubte ich, den süßlich-fauligen Geruch des überall herumliegenden Mülls in der Nase zu spüren. Auf eine verborgene, vielleicht auch abwegige Weise trug früher ein solcher Geruch zum sinnlichen Erleben der Welt bei.
Der Plastikmüll jedoch, die Baumarktreste und Computerteile, die heute ganze Kolonnen von Abfalltonnen und Wagen füllen, bieten den Sinnen nichts Verdorbenes mehr an. Die Männer, die jetzt die Müllautos vor sich herschieben, sehen aus, als gingen sie neben sich. Sie wirken unbeteiligt und so, als wollten sie sagen: Verwechselt uns bloß nicht mit denen, die ihr Müllmänner nennt. Auch wir möchten, dass unsere Kinder stolz auf uns sein können und sich mit unserem Geld das geilste Smartphone und die noch cooleren Turnschuhe von Nike kaufen. Dieser Job, der heute den Ärmsten der Armen in Afrika und Lateinamerika ein vergiftetes Überleben sichert, bündelt einige der Hoffnungen, die auf ein besseres Leben und eine Zukunft für die Kids gerichtet sind.
Früher gab es noch Mülltonnen, die man über die Pflastersteine rollte. Mit den viel zu großen Handschuhen steckte man eine Hand in den Griff, der in der Mitte des Deckels angebracht war, winkelte die Tonne etwas an, und los ging’s raus auf die Straße, durch einen Hof, wo die Kinder spielten und die Frauen schwatzten. Am Wagen angelangt, schob man die Tonne in eine Halterung, inspizierte kurz den Inhalt, bevor man den gelben Knopf mit der Aufschrift Hoch drückte, und schon vermischten sich verdorbene Essensreste und Verpackungen in der Trommel des Wagens. Man gab dem Fahrer, ein König in seinem Führerhaus, der niemals auch nur ein Wort sagte, ein Zeichen, er fuhr ein paar Meter weiter, und wir schwärmten wieder aus in die Höfe, manchmal auch in die Keller. Wir, das waren Ali, »der Türke