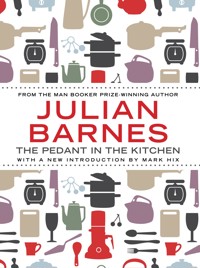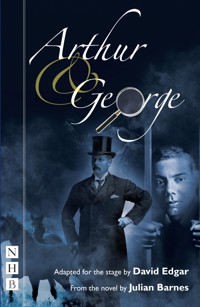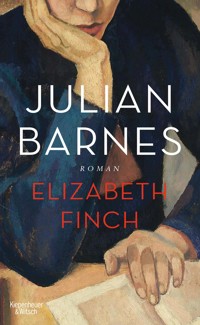9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In »Der Lärm der Zeit« wird das von Repressionen geprägte Leben von Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch in meisterhafter Knappheit dargestellt – ein großartiger Künstlerroman, der die Frage der Integrität stellt und traurige Aktualität genießt. Im Mai 1937 wartet ein Mann jede Nacht neben dem Fahrstuhl seiner Leningrader Wohnung darauf, dass Stalins Schergen kommen und ihn abholen. Der Mann ist der Komponist Schostakowitsch, und er wartet am Lift, um seiner Familie den Anblick seiner Verhaftung zu ersparen. Die Gunst der Mächtigen zu erlangen, hat zwei Seiten: Stalin, der sich plötzlich für seine Musik zu interessieren scheint, verlässt noch in der Pause die Aufführung seiner Oper »Lady Macbeth von Mzensk«. Fortan ist Schostakowitsch ein zum Abschuss freigegebener Mann. Durch Glück entgeht er der Säuberung, doch was bedeutet es für einen Künstler, keine Entscheidung frei treffen zu können? In welchem Verhältnis stehen Kunst und Unterdrückung, Diktatur und Kreativität zueinander, und ist es verwerflich, wenn man sich der Macht beugt, um künstlerisch arbeiten zu können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Julian Barnes
Der Lärm der Zeit
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter »Flauberts Papagei«, »Eine Geschichte der Welt in 10 1/2 Kapiteln«, »Lebensstufen«. Für seinen Roman »Vom Ende einer Geschichte« wurde er mit dem Man Booker Award ausgezeichnet. Julian Barnes lebt in London.
Gertraude Krueger, geboren 1949, lebt als freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E.L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Im Mai 1937 wartet ein Mann jede Nacht neben dem Fahrstuhl seiner Leningrader Wohnung darauf, dass Stalins Schergen kommen und ihn abholen. Der Mann ist der Komponist Schostakowitsch, und er wartet am Lift, um seiner Familie den Anblick seiner Verhaftung zu ersparen. Die Gunst der Mächtigen zu erlangen, hat zwei Seiten: Stalin, der sich plötzlich für seine Musik zu interessieren scheint, verlässt noch in der Pause die Aufführung seiner Oper »Lady Macbeth von Mzensk«. Fortan ist Schostakowitsch ein zum Abschuss freigegebener Mann. Durch Glück entgeht er der Säuberung, doch was bedeutet es für einen Künstler, keine Entscheidung frei treffen zu können? In welchem Verhältnis stehen Kunst und Unterdrückung, Diktatur und Kreativität zueinander, und ist es verwerflich, wenn man sich der Macht beugt, um künstlerisch arbeiten zu können? Im neuen Roman von Julian Barnes wird das von Repressionen geprägte Leben von Schostakowitsch in meisterhafter Knappheit dargestellt – ein großartiger Künstlerroman, der die Frage der Integrität stellt und traurige Aktualität genießt.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Einleitung
Eins - Auf der Treppe
Zwei - Im Flugzeug
Drei - Im Auto
Anmerkung des Autors
Für Pat
Einer zum Hören
Einer zum Erinnern
Und einer zum Trinken.
Volksmund
Es geschah mitten im Krieg auf einem Bahnsteig, so flach und staubig wie die endlose Ebene ringsum. Der wartende Zug war vor zwei Tagen von Moskau nach Osten abgefahren und würde noch weitere zwei oder drei Tage unterwegs sein, je nach Kohlevorrat und Truppenbewegungen. Es war kurz nach Sonnenaufgang, aber der Mann – in Wirklichkeit nur ein halber Mann – stieß sich schon auf einem flachen Rollbrett mit hölzernen Rädern an die Wagen der Polsterklasse heran. Steuern ließ sich das Gefährt nur, wenn man es vorne herumriss, und um nicht umzukippen, hatte der Mann ein Seil unter dem Brett hindurchgezogen und oben mit seiner Hose verschlungen. Die Hände des Mannes waren mit schmutzigen Stoffstreifen verbunden und seine Haut war vom Betteln auf Straßen und Bahnhöfen verhärtet.
Sein Vater hatte den vorigen Krieg überlebt. Der Dorfpope hatte ihn gesegnet, und dann war er in den Kampf für Zar und Vaterland gezogen. Als er zurückkam, gab es keinen Popen und keinen Zaren mehr, und sein Vaterland war nicht mehr dasselbe. Seine Frau hatte aufgeschrien, als sie sah, was der Krieg ihrem Mann angetan hatte. Jetzt herrschte wieder Krieg, und derselbe Eindringling war wieder da, nur die Namen hatten sich geändert: die Namen auf beiden Seiten. Aber sonst hatte sich nichts verändert: Junge Männer wurden noch immer von Geschützen zerfetzt, dann von Chirurgen grob in Stücke geschnitten. Ihm hatte man die Beine in einem Feldlazarett unter zerborstenen Bäumen abgenommen. Alles im Dienst einer großen Sache, genau wie beim vorigen Mal. Ihm war das scheißegal. Sollten andere darüber streiten; er wollte nur einen Tag nach dem anderen überstehen. Er war jetzt eine einzige Überlebenstechnik. Ab einem bestimmten Punkt wurde das aus jedem Menschen: eine Überlebenstechnik.
Einige Fahrgäste waren ausgestiegen, um etwas staubige Luft zu schnappen, andere drückten das Gesicht an die Abteilfenster. Beim Näherkommen grölte der Bettler immer ein zotiges Kasernenhoflied. Manchmal warfen ihm die Fahrgäste zum Lohn für diese Darbietung ein, zwei Kopeken zu; andere bezahlten ihn, damit er sich trollte. Manche warfen die Münzen absichtlich so, dass sie auf die Kante fielen und wegrollten, und dann lachten sie, wenn er die Fäuste auf den Beton des Bahnsteigs schlug, um den Münzen nachzujagen. Das konnte andere dazu bewegen, ihm aus Mitleid oder Scham das Geld direkter zuzustecken. Er sah nur Finger, Münzen und Mantelärmel, und Beleidigungen prallten an ihm ab. Das war der, der trank.
Die beiden Reisenden standen in der Polsterklasse am Fenster und versuchten zu erraten, wo sie waren und wie lange sie hier wohl aufgehalten würden: Minuten, Stunden, vielleicht den ganzen Tag. Informationen gab es nicht, und sie hüteten sich, Fragen zu stellen. Wer sich – selbst als Fahrgast – nach Zugbewegungen erkundigte, galt leicht als Saboteur. Die Männer waren über dreißig und somit alt genug, um solche Lektionen gelernt zu haben. Der, der hörte, war eine dünne, nervöse Erscheinung mit Brille; um Hals und Handgelenke trug er Amulette aus Knoblauch. Der Name seines Reisegefährten ist nicht überliefert, obwohl es der war, der sich erinnerte.
Das Rollbrett mit dem halben Mann ratterte jetzt auf sie zu. Fröhliche Verse über die Vergewaltigung eines Dorfmädchens wurden zu ihnen hinaufgebrüllt. Der Sänger hielt inne und zeigte auf seinen offenen Mund. Als Antwort hielt der Mann mit Brille eine Wodkaflasche hoch. Es war eine unnötige Höflichkeitsgeste. Wann hätte ein Bettler je Wodka abgelehnt? Gleich darauf standen die beiden Passagiere bei ihm auf dem Bahnsteig.
So waren sie denn zu dritt, die traditionelle Zahl zum Wodkatrinken. Der mit der Brille hielt weiter die Flasche in der Hand, sein Gefährte drei Gläser. Diese wurden annähernd gleich gefüllt, die beiden Reisenden deuteten eine Verbeugung an und brachten den üblichen Trinkspruch auf die Gesundheit aus. Als sie anstießen, neigte der Nervöse den Kopf zur Seite – wobei kurz die Morgensonne in seinen Brillengläsern aufblitzte – und murmelte eine Bemerkung; sein Freund lachte. Dann kippten sie den Wodka hinunter. Der Bettler hielt sein Glas hoch, um sich nachschenken zu lassen. Sie gossen ihm noch etwas ein, nahmen ihm das Glas ab und stiegen wieder in den Zug. Dankbar für die Dosis Alkohol, die seinen verstümmelten Körper durchströmte, rollte sich der Bettler an die nächste Gruppe von Fahrgästen heran. Als die beiden Männer wieder auf ihren Plätzen saßen, hatte der, der hörte, schon fast vergessen, was er vorhin gesagt hatte. Doch der, der sich erinnerte, fing gerade erst an mit dem Erinnern.
EinsAuf der Treppe
Er wusste nur eins: Dies war die schlimmste Zeit.
Er stand schon seit drei Stunden am Aufzug. Er rauchte seine fünfte Zigarette und seine Gedanken zuckten hierhin und dorthin.
Gesichter, Namen, Erinnerungen. Torfsoden, die schwer in seiner Hand lagen. Schwedische Wasservögel, die über seinem Kopf flatterten. Felder voller Sonnenblumen. Der Geruch von Nelkenöl. Der warme, süße Geruch von Nita, wenn sie vom Tennisplatz kam. Von einer hohen Stirn triefender Schweiß. Gesichter, Namen.
Auch die Gesichter und Namen von Toten.
Er hätte sich aus der Wohnung einen Stuhl mitbringen können. Aber vor lauter Nervosität wäre er ohnehin stehen geblieben. Und es hätte ziemlich exzentrisch ausgesehen, im Sitzen auf den Fahrstuhl zu warten.
In diese Lage war er aus heiterem Himmel gekommen, dabei war sie vollkommen logisch. Wie das übrige Leben. Wie sexuelles Begehren, zum Beispiel. Das kam auch aus heiterem Himmel, dabei war es vollkommen logisch.
Er versuchte, weiter an Nita zu denken, aber seine Gedanken gehorchten ihm nicht. Sie waren wie die Schmeißfliegen, lärmend und promiskuitiv, und sie landeten natürlich auf Tanja. Dann aber schwirrten sie zu diesem anderen Mädchen ab, dieser Rosalija. Errötete er bei der Erinnerung an sie, oder war er insgeheim stolz auf diese irrwitzige Episode?
Die Protektion des Marschalls – auch sie war aus heiterem Himmel gekommen, dabei war sie vollkommen logisch. Ob das auch für das Schicksal des Marschalls galt?
Jurgensens freundliches bärtiges Gesicht, und damit auch die Erinnerung an die Hand seiner Mutter, die sich zornig um sein Handgelenk krallte. Und sein Vater, sein gutmütiger, liebenswerter, unpraktischer Vater, der am Klavier stand und »Die Chrysanthemen im Garten sind längst schon verblüht« sang.
Die Kakofonie der Geräusche in seinem Kopf. Die Stimme seines Vaters, die Walzer und Polkas, die er selbst gespielt hatte, während er um Nita warb, vier Signale aus einer Fabriksirene in fis, Hunde, deren Gebell einen unsicheren Fagottisten übertönte, ein Aufruhr von Schlagzeug und Blechbläsern unter einer gepanzerten Regierungsloge.
Diese Geräusche wurden durch eins aus der wirklichen Welt unterbrochen: das jähe Surren und Fauchen der Fahrstuhlanlage. Jetzt zuckte sein Fuß und stieß den kleinen Koffer an seiner Seite um. Er wartete, auf einmal bar jeder Erinnerung, nur von Angst erfüllt. Dann hielt der Fahrstuhl auf einer unteren Etage, und sein Verstand setzte wieder ein. Er stellte den Koffer auf und spürte, wie sich der Inhalt leise verschob. Was bewirkte, dass seine Gedanken zu der Geschichte von Prokofjews Pyjama sprangen.
Nein, nicht wie Schmeißfliegen. Eher wie diese Mücken in Anapa. Die hier und dort landeten und Blut saugten.
Er hatte geglaubt, wenn er hier stehe, könne er über seine Gedanken gebieten. Doch jetzt, ganz allein in der Nacht, schienen seine Gedanken über ihn zu gebieten. Nun, man kann seinem Schicksal nicht entgehen, wie uns der Dichter versichert. Und seinen Gedanken auch nicht.
Er erinnerte sich an die Schmerzen in der Nacht, bevor man ihm den Blinddarm herausgenommen hatte. Zweiundzwanzig Mal erbrochen, eine Krankenschwester mit allen Flüchen bedacht, die er nur kannte, dann einen Freund angefleht, den Milizionär zu holen, auf dass der ihn erschieße und seinem Leiden ein Ende setze. Der soll reinkommen und mich erschießen und den Schmerzen ein Ende setzen, hatte er gebettelt. Aber der Freund hatte ihm die Hilfe verweigert.
Jetzt brauchte er keinen Freund und keinen Milizionär. Es boten sich schon genug andere an.
Das alles hat, erklärte er seinen Gedanken, genau am Morgen des 28. Januar 1936 begonnen, auf dem Bahnhof von Archangelsk. Nein, erwiderten seine Gedanken, nichts beginnt einfach so an einem bestimmten Datum und einem bestimmten Ort. Das alles hat an vielen Orten und zu vielen verschiedenen Zeiten begonnen, von denen einige sogar vor deiner Geburt liegen, in fremden Ländern und in den Köpfen anderer Leute.
Und danach, egal, was jetzt geschah, würde das alles genau so weitergehen, an anderen Orten und in den Köpfen anderer Leute.
Er dachte an Zigaretten: Schachteln von Kasbek, Belomor, Herzegowina Flor. An einen Mann, der den Tabak aus einem halben Dutzend Papirossy in seine Pfeife stopfte und den Schreibtisch mit Pappröhrchen und Papier vermüllte.
Könnte es, selbst jetzt noch, wieder in Ordnung gebracht, rückgängig gemacht, revidiert werden? Er kannte die Antwort. Wie der Arzt bei Gogol über die Wiederherstellung der Nase sagte: »Natürlich lässt sie sich wieder befestigen, aber ich versichere Ihnen, dann wird es noch schlimmer für Sie.«
Er dachte an Sakrewski und das Große Haus und wer dort jetzt an Sakrewskis Stelle sitzen mochte. Irgendwer hatte ihn bestimmt ersetzt. An Sakrewskis herrschte nie Mangel, nicht in dieser Welt, so wie sie eingerichtet war. Wenn einmal das Paradies erreicht wäre, in ziemlich genau 200.000.000.000 Jahren, gäbe es vielleicht keinen Bedarf mehr an Sakrewskis.
Bisweilen weigerte sich sein Kopf zu glauben, was da vor sich ging. Das kann nicht sein, weil es das gar nicht geben darf, wie der Major sagte, als er die Giraffe sah. Aber es konnte, und es durfte.
Schicksal. Das war nur ein großes Wort für etwas, was man nicht ändern konnte. Wenn das Leben »Also« sagte, dann nickte man und nannte es Schicksal. Also war es sein Schicksal gewesen, dass er Dmitri Dmitrijewitsch hieß. Das war nicht zu ändern. Natürlich hatte er keine Erinnerung an seine eigene Taufe, sah aber keinen Grund, an der Wahrheit der Geschichte zu zweifeln. Die ganze Familie hatte sich im Arbeitszimmer seines Vaters um ein transportables Taufbecken versammelt. Der Pope kam und fragte seine Eltern, welchen Namen sie für das Neugeborene ausgesucht hätten. Jaroslaw, sagten sie. Jaroslaw? Damit war der Pope nicht einverstanden. Er sagte, das sei ein höchst ungewöhnlicher Name. Er sagte, Kinder mit ungewöhnlichen Namen würden in der Schule gehänselt und verspottet: Nein, nein, sie könnten den Jungen nicht Jaroslaw nennen. Sein Vater und seine Mutter waren verblüfft über diesen offenen Widerstand, wollten aber kein Ärgernis erregen. Was schlagen Sie denn vor?, fragten sie. Geben Sie ihm einen gewöhnlichen Namen, sagte der Pope: Dmitri, zum Beispiel. Sein Vater wandte ein, er heiße selbst schon Dmitri, und Jaroslaw Dmitrijewitsch klinge doch viel besser als Dmitri Dmitrijewitsch. Aber der Pope war anderer Meinung. Also wurde er Dmitri Dmitrijewitsch.
Was lag schon an einem Namen? Er war in St. Petersburg geboren, erst in Petrograd, dann in Leningrad aufgewachsen. Oder in St. Leninsburg, wie er gern sagte. Was lag schon an einem Namen?
Er war 31 Jahre alt. Seine Frau Nita lag wenige Meter entfernt bei ihrem gemeinsamen Töchterchen Galina. Galja war ein Jahr alt. In letzter Zeit schien Stabilität in sein Leben gekommen zu sein. Er hatte diesen Teil nie einfach gefunden. Er empfand starke Gefühle, hatte aber nie gelernt, sie auszudrücken. Selbst bei einem Fußballspiel kam es selten vor, dass er brüllte und aus sich herausging wie alle anderen; er begnügte sich mit ruhigen Kommentaren zum Können – oder mangelnden Können – eines Spielers. Für manche war das die typische zugeknöpfte Steifheit eines Leningraders, aber er wusste, dass er darüber hinaus – oder darunter verborgen – ein schüchterner und ängstlicher Mensch war. Und bei Frauen schwankte er, wenn er seine Schüchternheit einmal verloren hatte, zwischen unsinniger Begeisterung und taumelnder Verzweiflung. Es war, als schlüge sein Metronom immer den falschen Takt.
Dennoch war endlich eine gewisse Regelmäßigkeit in sein Leben eingekehrt und damit auch der richtige Taktschlag. Nur dass jetzt alles wieder instabil geworden war. Instabil: Das war mehr als ein Euphemismus.
Der Handkoffer an seinem Bein rief ihm in Erinnerung, dass er früher einmal von zu Hause weglaufen wollte. Wie alt war er da gewesen? Sieben oder acht, vielleicht. Und hatte er einen kleinen Koffer dabeigehabt? Wahrscheinlich nicht – sonst wäre seine Mutter sofort in Wut geraten. Es war ein Sommer in Irinowka, wo sein Vater als Gutsverwalter arbeitete. Jurgensen war für das Handwerkliche zuständig. Baute und reparierte, löste Probleme auf eine Art, die ein Kind verstehen konnte. Gab ihm nie Anweisungen, sondern ließ ihn einfach zuschauen, wie aus einem Stück Holz ein Dolch oder eine Pfeife wurde. Gab ihm ein Stück frisch gestochenen Torf und ließ ihn daran riechen.
Er hatte sehr an Jurgensen gehangen. Wenn er sich über etwas ärgerte, was häufig vorkam, sagte er darum immer: »Na schön, dann ziehe ich eben zu Jurgensen.« Eines Morgens, noch im Bett, hatte er das zum ersten Mal an diesem Tag angedroht oder versprochen. Aber dieses eine Mal reichte seiner Mutter schon. Zieh dich an, dann bring ich dich hin, erwiderte sie. Er nahm die Herausforderung an – nein, er hatte keine Zeit zum Packen –, Sofja Wassiljewna fasste ihn am Handgelenk, und sie machten sich über das Feld zu Jurgensens Wohnung auf. Anfangs wollte er seine Drohung tapfer wahrmachen und schritt wacker neben seiner Mutter einher. Doch dann ließ er die Füße schleifen, und allmählich entglitt sein Handgelenk, dann die ganze Hand dem mütterlichen Griff. Damals dachte er, er habe sich selbst losgemacht, aber jetzt gestand er sich ein, dass seine Mutter ihn, Finger für Finger, hatte gehen lassen, bis er frei war. Nicht frei, um zu Jurgensen zu ziehen, sondern frei, um umzukehren, in Tränen auszubrechen und nach Hause zu rennen.
Hände, entgleitende Hände, greifende Hände. Als Kind hatte er sich vor den Toten gefürchtet – hatte gefürchtet, dass sie aus ihren Gräbern steigen und ihn ergreifen, hinunterziehen in die kalte, schwarze Erde, die ihm Mund und Augen verschließen würde. Diese Furcht war langsam verschwunden, weil sich die Hände der Lebenden als noch furchterregender erwiesen hatten. Den Prostituierten von Petrograd waren seine Jugend und Unschuld egal gewesen. Je schwieriger die Zeiten, desto gieriger die Hände. Streckten sich aus und wollten sich deinen Schwanz, dein Brot, deine Freunde, deine Familie, deine Lebensgrundlage, deine Existenz holen. Ebenso wie Prostituierte hatten ihm auch Pförtner Angst gemacht. Und Polizisten, egal, wie sie sich nannten.
Aber es gab auch die umgekehrte Angst: der schützenden Hand zu entgleiten, die über dich gehalten wurde.
Marschall Tuchatschewski hatte eine schützende Hand über ihn gehalten. Viele Jahre lang. Bis zu dem Tag, an dem er den Schweiß von der hohen Stirn des Marschalls triefen sah. Ein großes weißes Taschentuch wischte und tupfte, und er wusste, er war nicht mehr sicher.
Der Marschall war der weltläufigste Mann, dem er je begegnet war. Er war Russlands berühmtester Militärstratege: Die Zeitungen nannten ihn den »Roten Napoleon«. Zudem Musikliebhaber und Hobby-Geigenbauer; ein geistig aufgeschlossener, abwägender Mensch, der Diskussionen über Romane liebte. In den zehn Jahren ihrer Bekanntschaft hatte er Tuchatschewski oft nach Einbruch der Dunkelheit in seiner Marschallsuniform durch Moskau und Leningrad streifen sehen, halb dienstlich, halb privat, das Angenehme mit dem Politischen verbindend; er redete und argumentierte, aß und trank, ließ deutlich erkennen, dass er auch Augen für Ballerinas hatte. Er erläuterte gern, dass die Franzosen ihn einmal in das Geheimnis eingeweiht hatten, wie man Champagner trinkt, ohne jemals einen Kater zu bekommen.
Er selbst würde nie so weltgewandt sein. Dazu fehlte ihm das Selbstbewusstsein, vielleicht auch das Interesse. Er mochte keine komplizierten Speisen und vertrug Alkohol nicht sehr gut. Früher als Student, als alles umgedacht und umgestaltet wurde, bevor die Partei vollständig die Kontrolle übernahm, hatte er sich wie die meisten anderen Studenten weltläufiger gegeben, als es seinen Kenntnissen entsprach. Zum Beispiel musste, da nun die alten Sitten für immer über Bord geworfen waren, in sexuellen Fragen umgedacht werden, und so hatte jemand die »Glas-Wasser-Theorie« aufgestellt. Der Geschlechtsakt, hatten jugendliche Schlaumeier behauptet, sei nichts anderes, als ein Glas Wasser zu trinken: Wenn man Durst hat, trinkt man, und wenn man Begehren verspürt, dann hat man Sex. Er hatte nichts gegen dieses Prinzip gehabt, obwohl es doch davon ausging, dass Frauen ebenso die Freiheit hatten zu begehren wie begehrt zu werden. Für manche traf das zu, für andere nicht. Aber die Analogie stimmte nur begrenzt. Ein Glas Wasser war keine Herzensangelegenheit.
Und außerdem war da schon Tanja in sein Leben getreten.
Hinter seinen regelmäßigen Ankündigungen, zu Jurgensen zu ziehen, vermuteten seine Eltern vielleicht ein Auflehnen gegen die Einschränkungen, die ihm die Familie – oder gar die Kindheit selbst – auferlegte. Wenn er jetzt darüber nachdachte, kamen ihm Zweifel. Etwas an diesem Sommerhaus auf dem Gut Irinowka war seltsam – zutiefst verkehrt – gewesen. Wie jedes Kind hielt er alles für normal, bis er erfuhr, dass dem nicht so war. Darum merkte er erst, als er die Erwachsenen darüber reden – und lachen – hörte, dass die Proportionen im Haus nicht stimmten. Die Zimmer waren riesig, die Fenster dagegen sehr klein. So hatte ein Zimmer von fünfzig Quadratmetern womöglich nur ein einziges winziges Fensterchen. Die Erwachsenen meinten, die Handwerker hätten beim Bau die Maße durcheinandergebracht, Meter mit Zentimetern verwechselt und umgekehrt. Aber die Wirkung, hatte man sie einmal wahrgenommen, war für einen Jungen verstörend. Das Haus war wie geschaffen für die düstersten Träume. Vielleicht wollte er davor davonlaufen.
Sie holten einen immer mitten in der Nacht. Also legte er sich, um nicht im Schlafanzug aus der Wohnung gezerrt zu werden oder sich notgedrungen vor einem verächtlich ungerührten NKWD-Mann anzuziehen, lieber voll bekleidet ins Bett, oben auf die Decke, einen fertig gepackten kleinen Koffer neben sich auf dem Boden. Er schlief kaum, lag da und stellte sich das Schlimmste vor, was sich ein Mensch nur vorstellen kann. Seine Unruhe ließ auch Nita keinen Schlaf finden. Beide lagen da und täuschten etwas vor; täuschten auch vor, sie würden die panische Angst des anderen nicht hören oder riechen. In einem seiner immer wiederkehrenden beklemmenden Wachträume malte er sich aus, der NKWD würde sich Galja greifen und sie – wenn sie Glück hatte – in ein spezielles Waisenhaus für die Kinder von Staatsfeinden stecken. Dort würde sie einen neuen Namen und eine neue Lebensgeschichte bekommen; dort würde man eine vorbildliche Sowjetbürgerin aus ihr machen, eine kleine Sonnenblume, das Gesicht zu der großen Sonne erhoben, die sich Stalin nannte. Darum verbrachte er diese zwangsläufig schlaflosen Stunden jetzt draußen auf der Treppe beim Aufzug. Nita forderte beharrlich, sie sollten ihre womöglich letzte gemeinsame Nacht Seite an Seite verbringen. Aber aus diesem Streit war ausnahmsweise er als Sieger hervorgegangen.
In seiner ersten Nacht am Aufzug hatte er beschlossen, nicht zu rauchen. In seinem Koffer lagen drei Schachteln Kasbek, und die würde er brauchen, wenn sein Verhör begänne. Und für die Haft, falls die als Nächstes käme. In den ersten beiden Nächten blieb er bei seinem Entschluss. Dann kam ihm der Gedanke: Und wenn sie nun seine Zigaretten konfiszierten, sobald er im Großen Haus wäre? Oder wenn es gar kein Verhör gäbe, oder nur ein ganz kurzes? Vielleicht würden sie ihm nur ein Blatt Papier vorlegen und ihm befehlen, es zu unterschreiben. Und wenn nun … Weiter kamen seine Gedanken nicht. Aber in jedem dieser Fälle wären seine Zigaretten verschwendet.
Also sah er keinen Grund, warum er nicht rauchen sollte.
Also rauchte er.
Er betrachtete die Kasbek zwischen seinen Fingern. Malko hatte einmal mitfühlend, ja geradezu bewundernd bemerkt, seine Hände seien klein und »nicht die eines Pianisten«. Malko hatte auch, weniger bewundernd, zu ihm gesagt, er übe nicht genug. Das kam darauf an, was man unter »genug« verstand. Er übte so viel wie nötig. Malko sollte bei seiner Partitur und seinem Taktstock bleiben.
Er war sechzehn gewesen und in einem Sanatorium auf der Krim, wo er sich von der Tuberkulose erholte. Tanja und er waren gleich alt und exakt am selben Tag geboren, mit einem kleinen Unterschied: Sein Geburtstag war am 25. September »neuen Stils«, ihrer am 25. September »alten Stils«. Diese faktische Synchronizität bestärkte ihre Beziehung; mit anderen Worten, sie waren füreinander bestimmt. Tatjana Gliwenko mit den kurz geschnittenen Haaren, ebenso lebenshungrig wie er. Es war eine erste Liebe, scheinbar unkompliziert und doch schicksalhaft. Seine Schwester Marusja, die ihn begleitete und beaufsichtigte, plauderte der Mutter alles aus. Sofja Wassiljewna warnte ihren Sohn postwendend vor diesem unbekannten Mädchen, vor dieser Beziehung – ja, vor jeglicher Beziehung. Als Antwort legte er seiner Mutter mit der ganzen Großspurigkeit eines Sechzehnjährigen die Prinzipien der freien Liebe dar. Dass jeder Mensch die Freiheit haben müsse zu lieben, wie er wolle; dass die körperliche Liebe nicht von Dauer sei; dass beide Geschlechter absolut gleich seien; dass die Ehe als Institution abgeschafft gehöre, doch wenn sie in der Praxis fortbestehe, habe die Frau jedes Recht auf eine Affäre, wenn es sie danach verlange, und falls sie dann die Scheidung wünsche, müsse der Mann das akzeptieren und die Schuld auf sich nehmen; doch dass, bei alledem und trotz alledem, die Kinder heilig seien.
Seine Mutter ging nicht auf diese hochmütige und scheinheilige Erklärung des Lebens ein. Und Tanja und er wurden ohnehin getrennt, kaum dass sie sich kennengelernt hatten. Sie kehrte nach Moskau zurück, er mit Marusja nach Petrograd. Aber er schrieb Tanja fortwährend Briefe, sie besuchten einander, und er widmete ihr sein erstes Klaviertrio. Seine Mutter war weiterhin dagegen. Und dann, drei Jahre später, verbrachten sie endlich diese gemeinsamen Wochen im Kaukasus. Da waren sie beide neunzehn und ohne Begleitung, und er hatte bei Konzerten in Charkow gerade dreihundert Rubel verdient. Diese gemeinsamen Wochen in Anapa … das schien so lange her zu sein. Nun, es war lange her – es lag über ein Drittel seines Lebens zurück.
Also hatte das alles ganz genau am Morgen des 28. Januar 1936 in Archangelsk begonnen. Er war eingeladen worden, sein erstes Klavierkonzert mit dem dortigen Orchester unter Viktor Kubatzki aufzuführen; auch seine neue Cellosonate hatten sie zusammen gespielt. Alles war gut gelaufen. Am nächsten Morgen ging er zum Bahnhof und kaufte sich die Prawda. Er warf einen kurzen Blick auf die Titelseite, dann blätterte er zu den nächsten beiden Seiten weiter. Es war, wie er später sagte, der denkwürdigste Tag seines Lebens. Und ein Datum, das er jedes Jahr im Kalender anstrich, bis zu seinem Tod.
Allerdings beginnt – wie sein Gehirn hartnäckig widersprach – nie etwas genau dann und dort. Es begann an verschiedenen Orten und in verschiedenen Köpfen. Vielleicht war sein eigener Ruhm der wahre Ausgangspunkt. Oder seine Oper. Oder es war Stalin, der ja unfehlbar und daher für alles verantwortlich war. Oder es wurde von einer simplen Kleinigkeit wie der Sitzordnung eines Orchesters verursacht. Ja, letztendlich war das vielleicht die beste Sichtweise: ein Komponist, der erst denunziert und gedemütigt, später verhaftet und erschossen wird, und alles wegen der Sitzordnung eines Orchesters.
Wenn alles anderswo und in den Köpfen anderer Leute begonnen hatte, dann konnte er vielleicht Shakespeare die Schuld geben, weil der Macbeth geschrieben hatte. Oder Leskow, weil der das Drama zu Lady Macbeth von Mzensk russifiziert hatte. Nein, nichts dergleichen. Es war selbstverständlich seine eigene Schuld, weil er das anstößige Stück geschrieben hatte. Es war die Schuld seiner Oper, weil die so viel Erfolg hatte – im In- und Ausland –, dass der Kreml neugierig geworden war. Es war Stalins Schuld, weil der den Leitartikel in der Prawda veranlasst und abgesegnet, vielleicht sogar selbst geschrieben hatte: Es gab genügend grammatische Fehler darin, um auf die Feder eines Mannes hinzudeuten, dessen Fehler nie korrigiert werden durften. Es war auch Stalins Schuld, allein schon, weil er sich für einen Kunstförderer und Kunstkenner hielt. Bekanntlich versäumte er keine Vorstellung von Boris Godunowim Bolschoi Theater. Fast ebenso groß war seine Begeisterung für Fürst Igor und Rimski-Korsakows Sadko. Warum sollte Stalin sich diese umjubelte neue Oper Lady Macbeth von Mzensk nicht anhören wollen?
Also erhielt der Komponist den Befehl, am 26. Januar 1936 einer Aufführung seines eigenen Werks beizuwohnen. Genosse Stalin werde da sein, ebenso die Genossen Molotow, Mikojan und Schdanow. Sie nahmen in der Regierungsloge Platz. Die unglücklicherweise direkt über dem Schlagzeug und den Blechbläsern lag. Gruppen, denen die Partitur von Lady Macbeth von Mzensk keine Sittsamkeit und Bescheidenheit auferlegte.
Er erinnerte sich, dass er aus der Intendantenloge, wo er saß, zur Regierungsloge hinübergeschaut hatte. Stalin war hinter einem kleinen Vorhang verborgen, eine abwesende und doch anwesende Persönlichkeit, der sich die anderen ehrenwerten Genossen immer wieder kriecherisch zuwandten, wohl wissend, dass sie selbst unter Beobachtung standen. Unter diesen Bedingungen waren Dirigent wie Orchester verständlicherweise nervös. Im Zwischenspiel vor Katerinas Hochzeit fühlten sich die Bläser plötzlich berufen, lauter zu spielen, als er es notiert hatte. Und dann verbreitete sich das wie ein Virus durch alle Gruppen hindurch. Falls der Dirigent es bemerkte, war er machtlos. Das Orchester wurde lauter und lauter; und wann immer Schlagzeug und Blech fortissimo unter der Loge dröhnten – laut genug, um Fensterscheiben zerspringen zu lassen –, zuckten die Genossen Mikojan und Schdanow theatralisch zusammen, wandten sich der Gestalt hinter dem Vorhang zu und machten spöttische Bemerkungen. Als das Publikum am Anfang des vierten Akts zur Regierungsloge hochschaute, fand es sie verlassen.
Nach der Vorstellung hatte er seine Aktentasche genommen, war auf direktem Weg zum Nordbahnhof gegangen und in den Zug nach Archangelsk gestiegen. Er erinnerte sich noch an den Gedanken, dass die Regierungsloge extra mit Stahlplatten gepanzert war, um die dort Sitzenden vor einem Mordanschlag zu schützen. Dass die Intendantenloge aber nicht so gesichert war. Er war noch keine dreißig, und seine Frau war im fünften Monat schwanger.
1936: Schaltjahre waren ihm immer suspekt gewesen. Wie viele andere glaubte er, dass sie Unglück brächten.
Wieder war die Fahrstuhlanlage zu hören. Als er merkte, dass der Aufzug über den vierten Stock hinausgefahren war, nahm er seinen Koffer und hielt ihn in der Hand. Er wartete darauf, dass sich die Türen öffneten, auf den Anblick einer Uniform, ein Nicken des Erkennens, und dann würden ausgestreckte Hände nach ihm greifen und eine Faust sich um sein Handgelenk klammern. Was ganz unnötig wäre, schließlich wollte er so schnell wie möglich mit ihnen mitkommen, sie vom Haus wegbringen, weg von seiner Frau und seinem Kind.
Dann gingen die Fahrstuhltüren auf, und es war ein Nachbar mit einem anderen Nicken des Erkennens, das bewusst nichts verriet – nicht einmal Erstaunen darüber, ihn zu so später Stunde ausgehen zu sehen. Als Antwort neigte er den Kopf, betrat den Aufzug, drückte aufs Geratewohl einen Knopf, fuhr einige Stockwerke hinunter, wartete ein paar Minuten, dann fuhr er wieder hinauf in den fünften Stock, wo er ausstieg und erneut seine Wache aufnahm. Das geschah nicht zum ersten Mal, und das Muster blieb immer gleich. Es wurde nie ein Wort gewechselt, weil Worte gefährlich waren. Immerhin war es gerade noch möglich, dass er aussah wie ein Mann, der von seiner Frau Nacht für Nacht demütigend hinausgeworfen wurde, oder wie ein Mann, der wankelmütig Nacht für Nacht seine Frau verließ und dann zurückkehrte. Wahrscheinlicher aber war, dass er genau so aussah wie das, was er war: ein Mann, der wie hundert andere in der Stadt Nacht für Nacht auf seine Verhaftung wartete.
Vor Jahren, ganze Lebensalter entfernt, damals im letzten Jahrhundert, als seine Mutter am Institut für adelige Fräulein in Irkutsk ausgebildet worden war, hatte sie mit zwei anderen Mädchen vor Nikolai II., damals noch Zarewitsch, die Mazurka aus Ein Leben für den Zaren getanzt. In der Sowjetunion konnte Glinkas Oper natürlich nicht aufgeführt werden, selbst wenn ihr Thema – das moralisch lehrreiche Thema eines armen Bauern, der sein Leben für einen großen Führer hingibt – Stalin vielleicht gefallen hätte. »Ein Tanz für den Zaren«: Er fragte sich, ob Sakrewski das wusste. In der alten Zeit konnte ein Kind für die Sünden seines Vaters oder auch seiner Mutter bezahlen. Heute, in der fortschrittlichsten Gesellschaft auf Erden, konnten die Eltern für die Sünden des Kindes bezahlen, zusammen mit Onkeln, Tanten, Vettern, angeheirateten Verwandten, Kollegen, Freunden und selbst dem Mann, der dich gedankenlos anlächelte, wenn er um drei Uhr morgens aus dem Aufzug stieg. Das Vergeltungssystem war ungemein verbessert worden und jetzt sehr viel umfassender als früher.