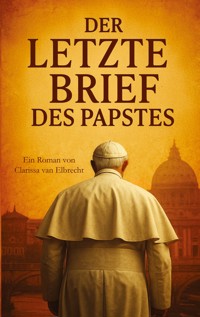
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Orte, an denen das Schweigen nicht die Abwesenheit von Wahrheit ist - sondern ihr Schutz. Nach der Bekanntgabe des Todes von Papst Gregor XIX. beginnt in den stillen Gängen der Kurie etwas zu flüstern. Und nur einer hört hin: ein Novize, ehemaliger Jurist, der versucht, seine Schuld in der Stille zu begraben. Ein Brief bleibt zurück - handgeschrieben, verstörend, wahr. Ein Schattenorden, der in keiner Chronik steht. Ein Kreis. Ein Schwert. Ein brennendes Buch. Je tiefer der Novize in die verborgenen Strukturen des Vatikans vordringt, desto näher kommt ihm das, wovor er geflohen ist. Immer stärker drängt das Vergangene zurück, doch mit jeder neuen Erkenntnis geht zugleich etwas an Gewissheit verloren. Was, wenn nicht alles, was stirbt, je wirklich gelebt hat? Und was, wenn das Schweigen der Kirche nicht Leere ist - sondern Methode? "Der letzte Brief des Papstes" ist ein literarischer Thriller im Gewand eines spirituellen Romans. Dabei geht es nicht um Dogmen. Nicht um Sünde. Sondern um Erinnerung. Und um das, was verloren geht, wenn alle schweigen. Was als Suche beginnt, wird zu einer Reise durch Schuld, Institution und das Unaussprechliche. Poetisch. Dunkel. Erschütternd. Denn auch das Verborgene spricht. Nur leiser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für alle. Gegen das Schweigen.
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1: EIN BRIEF OHNE ABSENDER
KAPITEL 2: DER TOD
KAPITEL 3: SANCTA NOCTIS
KAPITEL 4: DIE KRYPTA
KAPITEL 5: DAS KONKLAVE
KAPITEL 6: DER SCHATTENORDEN
KAPITEL 9: DER ANDERE NOVIZE
KAPITEL 10: DAS GRAB IST LEER
KAPITEL 11: DAS PROTOKOLL XIII
KAPITEL 12: DIE SCHWARZE LISTE
KAPITEL 13: DER TEMPEL IN FLORENZ
KAPITEL 14: SCHULD
KAPITEL 15: DER NEUE PAPST
KAPITEL 16: DIE BEICHTE
EPILOG: DAS LICHT IN DER DUNKELHEIT
KAPITEL 1 EIN BRIEF OHNE ABSENDER
Ich erinnere mich an den Morgen, an dem der Brief kam,
als wäre er ein Schnitt durch mein Leben gewesen.
Kein grelles Ereignis, kein Paukenschlag.
Eher das lautlose Umkippen einer inneren Ordnung,
ein kaum merklicher Riss in der Stille,
der plötzlich alles beschwerte.
Er lag auf meinem Pult. Zwischen Psalter und Tintenfass.
Genau dort, wo ich gewöhnlich meine Notizen
zu den liturgischen Lektüren sammelte.
Ein Brief.
Keine Aufschrift. Kein Siegel. Kein Absender.
Nur ein schwer gefaltetes Stück Pergament, das sich in der
Hand fremd anfühlte, fast zu dicht, als trüge es mehr als bloß
Worte. Ich wusste auf den ersten Blick: Dies war nicht wie die
anderen Mitteilungen, keine administrative Zuweisung,
keine Mahnung aus dem Noviziat.
Es war kein offizielles Dokument. Und doch war es hier.
Im Herzen des Vatikans. Auf meinem Tisch.
Als hätte es das Recht, dort zu sein.
Ich zögerte.
Nicht aus Angst. Aus dem Gefühl,
dass der Brief mich bereits gelesen hatte.
Ich bin kein gewöhnlicher Novize. Ich war es nie.
Ich kam spät – nicht als Suchender,
sondern als einer, der geflohen war.
Ein abgeschlossenes Jurastudium.
Ein Verfahren, das nie offiziell mit mir verbunden wurde.
Und ein Fehler, dessen Name sich meinem Gewissen entzog.
All das begleitete mich wie ein Schatten,
der nicht wich – selbst dort nicht,
wo man gelernt hatte, in Stille zu treten.
Ich öffnete den Brief.
Langsam. Bedächtig.
Und dennoch mit einem inneren Beben,
das ich mir selbst nicht eingestand.
Nur ein einziger Satz stand darin.
In alter, fast ehrfürchtig gezogener Tinte:
„Nicht alles, was stirbt, war je lebendig.“
Ich weiß nicht, warum dieser Satz mich so traf.
Vielleicht war es meine Erschöpfung. Vielleicht das Licht.
Vielleicht etwas in mir, das endlich einen Anlass brauchte,
um aufzustehen.
Ich las ihn dreimal.
Dann legte ich das Pergament zur Seite und starrte in das
Licht, das durch die hohen Fenster fiel.
Staub wirbelte darin auf – stumme Gedanken im Sonnenlicht.
Die Glocken schlugen zur Terz.
Ich wusste:
Das war kein Zufall.
Es war ein Ruf.
Ein Rätsel.
Oder eine Warnung.
Ich ging in den hortus silentii, den Garten der Stille –
ein Innenhof, eingefasst von hohen Mauern,
über denen nur zur Mittagsstunde das Licht stand.
Dort wuchsen Rosmarinbüsche, Weinranken,
ein einzelner Olivenbaum, an dessen Pflanzung
sich niemand mehr erinnerte.
Es war ein Ort für das Gebet. Oder das, was in unseren
Reihen noch als inneres Sprechen mit Gott galt.
Ich saß auf der steinernen Bank, weiß vom Licht, ausgezehrt
von den Jahren. Der Brief lag gefaltet in meiner Brusttasche –
über dem Herzen, das sich noch immer nicht beruhigt hatte.
Nicht wegen der Worte.
Sondern wegen der Stimme,
die zwischen ihnen zu liegen schien.
Da war ein Echo in mir. Ein leiser Abdruck, ein Flimmern im
Gedächtnis – als hätte ich diesen Satz schon einmal gehört,
gesehen oder geträumt. Ich wusste nicht, wann. Nicht, wo.
Ich war vier Monate im Vatikan, als dieser Brief kam.
Vier Monate unter Männern, die mir in ihren Blicken kein
Vertrauen entgegenbrachten. Ich war älter als die meisten.
Und anders. Mein Wissen um Gesetz und Verhandlung
war mir eine zweite Haut – aber keine, die wärmte.
Ich hatte Urteile geschrieben, keine Evangelien gelesen.
Ich wusste, wie man lügt, ohne zu sprechen –
und wie man recht behält, ohne zu glauben.
Der Wechsel war radikal gewesen.
Vom Gerichtssaal zur Kapelle.
Vom Strafmaß zur Messe.
Ich war nicht hier, weil ich berufen war.
Ich war hier, weil mir draußen nichts geblieben war.
Und doch hatte ich gehofft, in der Ordnung dieses Ortes einen
Frieden zu finden, den ich nie gekannt hatte.
Dieser Brief jedoch – diese sieben Worte – waren kein
Friedensangebot. Sie waren ein Riss in der Mauer.
Und irgendwo dahinter lauerte etwas,
das nicht vergessen werden wollte.
- - - - - - -
Am Abend desselben Tages fand ich keine Ruhe.
Ich lag auf meinem Bett, die Hände gefaltet auf der Decke –
wie es uns gelehrt wurde.
Doch meine Gedanken hielten sich nicht an das Ritual.
Der Brief war verschwunden.
Ich hatte ihn im Psalter abgelegt, zwischen die Seiten des
Matthäusevangeliums, Kapitel 10, Vers 27: „Was ich euch
sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was ihr ins Ohr
geflüstert hört, das verkündigt auf den Dächern.“
Als ich später danach griff, war er fort.
Ich durchsuchte das Buch, meinen Schreibtisch, selbst die
kleine Truhe unter meinem Bett, in der ich zwei vergilbte
Fotos und einen Brief meiner Mutter aufbewahrte. Nichts.
Hatte jemand ihn genommen?
Oder sollte ich glauben, dass er nie da gewesen war?
Ich sprach mit niemandem. Nicht mit meinem Beichtvater.
Nicht mit Bruder Thomas, dessen Freundlichkeit stets
zu rund war, um wahr zu sein.
- - - - - - -
In der Nacht träumte ich. Keine Bilder. Nur Geräusche.
Flüstern hinter Mauern.
Papier, das verbrannte.
Schritte, die nicht zu mir gehörten.
Und immer wieder der Satz – gesprochen mit einer Stimme,
die wie meine eigene klang, nur älter:
„Nicht alles, was stirbt, war je lebendig.“
Ich erwachte vor der Laudes. Schweißgebadet.
Die Stirn gegen das kalte Holz des Bettes gelehnt.
Draußen war es noch dunkel.
- - - - - - -
Der Himmel über dem Vatikan war an diesem Morgen
wolkenlos – und dennoch ohne Klarheit. Eine jener lautlosen
Himmelsweiten, unter denen das Licht selbst zögerlich scheint.
Ich nahm meinen Platz in der dritten Reihe der Kapelle ein.
Die Matutin begann. Ich sprach die Psalmen mit – laut,
langsam, wie ein Schüler, der fürchtet, durchschaut zu werden.
Doch ich hörte mich selbst nicht.
Nur den Ton meiner Stimme, gedämpft, fremd – wie durch
Wasser. Alles in mir war auf einen anderen Klang abgestimmt:
den der Stille zwischen den Worten.
Der Prior sprach über das Schweigen Gottes
in den Nächten der Seele.
Ich hörte zu. Und wusste zugleich:
Diese Worte waren nicht für uns bestimmt.
Vielleicht waren sie es nie gewesen.
- - - - - - -
Nach der Messe blieb ich sitzen. Die Hände auf den Knien.
Den Blick gesenkt.
Mein Atem war ruhig.
Mein Inneres ein Kreis aus Fragen,
die sich nie berührten,
aber auch nie vergingen.
Warum dieser Brief?
Warum ich?
Und vor allem – wer wusste davon?
Ein ehemaliger Kollege hatte mir einmal gesagt:
„Es gibt Orte, an denen das Schweigen nicht die Abwesenheit
von Wahrheit ist – sondern ihr Schutz.“
Damals hielt ich das für kluge Rhetorik.
- - - - - - -
Ich verbrachte den restlichen Vormittag in der Bibliothek des
Collegio. Nicht in den vorderen Räumen, wo Dogmatik und
Liturgie katalogisiert nebeneinander standen. Sondern
im hinteren Teil – dort, wo die alten Folianten ruhten,
in staubigem Leder gebunden, mit Seiten,
die nach Eisen und Haut rochen.
Ich hatte kein Ziel. Kein Suchwort. Nur ein Gefühl –
als wäre ich nicht auf der Suche, sondern selbst gesucht.
Ich ließ meine Finger über die Buchrücken gleiten.
Dann zog ich einen Band aus dem Regal. Kein Titel.
Nur dunkles, glattgegriffenes Kalbsleder.
An den Kanten leicht abgeschabt.
Ich schlug ihn auf. Und erstarrte.
Auf der Innenseite – handschriftlich eingetragen –
stand derselbe Satz:
„Nicht alles, was stirbt, war je lebendig.“
Nicht dieselbe Handschrift. Nicht dieselbe Tinte.
Aber dieselben Worte.
Ich blätterte weiter. Das Buch war eine Sammlung von
Fragmenten, Zitaten, Gedanken – ein loses Netz,
das sich nicht erklären wollte.
Keine Quellen. Keine Chronologie. Nur Stimmen, die
einander kommentierten, widersprachen, verdichteten.
Ich las lange.
Doch immer wieder kehrte ich zurück zur ersten Seite.
Dieser Satz – er war kein Zitat.
Er war ein Zeichen.
Und ich war nicht der Erste, der es gesehen hatte.
Ich stellte den Band zurück – nicht aus Pflicht,
sondern aus Scheu.
Es fühlte sich nicht an, als hätte ich gelesen, sondern
gelauscht. Als hätte ich durch eine Tür gesehen,
die nie für mich gedacht war.
Auf dem Rückweg begegnete ich Bruder Thomas im Gang.
Er war einer dieser Männer, deren Präsenz sich nie ganz aus
dem Raum zurückzog. Schlank, wach, die Stimme stets halb
verschluckt, als sei jedes Wort eine Konzession.
Er sah mich an, sein Blick verweilte einen Moment zu lange.
Ich nickte ihm zu, er erwiderte die Geste kaum merklich –
doch seine Augen folgten mir,
selbst als ich längst an ihm vorüber war.
Ich kehrte in meine Kammer zurück, setzte mich an den
Tisch. Die Stunden vergingen. Ich versuchte zu lesen –
ein Paulusbrief, einige lateinische Wendungen –,
doch alles entglitt mir. Ich war leer und übervoll zugleich.
Ich zog ein leeres Blatt hervor.
Die Feder lag bereit. Die Tinte schimmerte schwarz.
Ich wollte schreiben. Einen Gedanken. Eine Ahnung.
Etwas festhalten.
Aber meine Hand blieb ruhig.
Was hätte ich schreiben sollen?
Dass ich einen Brief empfangen hatte,
den nun niemand mehr finden konnte?
Dass derselbe Satz in einem Buch stand, das in keinem
Verzeichnis geführt wurde und genau dort lag,
wo es niemand sucht?
Dass ich mich verfolgt fühlte – von Gedanken, von Blicken,
von einer Struktur, die keine Namen trug?
Ich lehnte mich zurück.
Über mir in der Decke: ein Riss.
Fein, wie eine kaum sichtbare Narbe.
Ich hatte ihn nie bemerkt.
Doch heute war er da –
deutlich, beinahe fordernd.
Und ich fragte mich, wie viele Dinge schon längst hier waren,
die ich nie gesehen hatte.
Dinge, die nur sichtbar wurden,
wenn man bereit war, sie zu sehen.
Oder wenn jemand wollte, dass man sie sah.
- - - - - - -
In der Nacht wuchs die Unruhe. Ich konnte nicht schlafen.
Die Schatten in meiner Kammer waren tiefer, dichter, und
selbst das Ticken der alten Uhr wurde zum Pochen
eines Herzens, das nicht zur Ruhe kam.
Ich stand auf, öffnete das Fenster. Die Nacht über Rom war
klar, aber kühl. Die Stadt schien fern, fast unwirklich.
Und doch wusste ich: Irgendetwas dort draußen sah mich an.
Ich setzte mich an den Schreibtisch, nahm die Feder,
tauchte sie in die Tinte – und schrieb:
„Nicht alles, was stirbt, war je lebendig.“
Der Satz fiel schwer aufs Papier.
Fast so, als gehörte er nicht mir.
Ich schrieb weiter – über das Schweigen, das schützt,
über das Wissen, das eine Last ist, über das Verborgene,
das nicht verborgen bleiben will.
Ich schrieb, bis die Feder trocken war.
Dann schlief ich ein – nicht aus Ruhe,
sondern aus Erschöpfung.
- - - - - - -
Am Morgen fand ich erneut einen Brief auf meinem Tisch.
Keine Adresse. Kein Siegel.
Nur eine Karte, aus schwerem, handgeschnittenem Papier.
In schwungvoller Handschrift stand darauf:
„Wer schweigt, lebt länger.
Aber wer spricht, lebt weiter.“
Ich hielt die Karte lange in der Hand. Spürte das Gewicht.
Den Atem zwischen den Zeilen.
Und wusste: Ich hatte keine Wahl mehr.
Die Tage danach vergingen in einer Art Nebel – Routine auf
der Oberfläche, Unruhe darunter.
Ich bewegte mich durch Gebete, Mahlzeiten, Gespräche
wie durch ein fremdes Stück, in dem ich eine Rolle spielte,
die ich nicht selbst geschrieben hatte.
Ich begann, die Schatten zu lesen.
Nicht die offensichtlichen – die sich in dunklen Ecken
sammelten – sondern die dazwischen:
Andeutungen in Blicken, Flüstern in Gängen,
Schweigen, das mehr sagte als Worte.
Ein Name fiel mir immer wieder ins Ohr.
Camerlengo.
Nicht als Titel, sondern als Chiffre.
Von ihm wurde nicht gesprochen.
Es wurde über ihn getuschelt. Seine Rolle, so hörte ich,
würde größer werden, als man glauben mochte.
Ich begann, Notizen zu machen. Keine Tagebucheinträge.
Nur Gedanken – flüchtige Sätze auf losen Blättern,
die ich in der Einfassung meines Bettrahmens versteckte.
Ich lernte, dass Schweigen mehr bedeutet als Unterwerfung.
Es ist ein Werkzeug. Eine Waffe. Eine Währung.
- - - - - - -
Einmal sah ich ihn.
Aus der Ferne.
Den Camerlengo.
Er sprach mit einem alten Mann, dessen Augen hinter dickem
Glas verborgen lagen. Ihre Gesten waren kaum mehr als
Andeutungen. Und doch lag in diesem Gespräch eine Schwere,
die kein Wort tragen konnte.
Ich wusste:
Ich hatte es mit einer Welt zu tun,
die mich längst betrachtete.
Und die ich doch kaum verstand.
- - - - - - -
Eines Abends, als die Sonne hinter den Kuppeln versank
und die Gänge sich in Dunkel kleideten, wurde ich gerufen.
Kein offizieller Befehl. Nur ein leiser Hinweis,
von Bruder Thomas geflüstert: „Man erwartet dich.“
Ich folgte dem Gang bis zu einem Raum,
den ich nur vom Vorübergehen kannte. Fensterlos.
Kaum größer als meine Kammer.
Ein Mann wartete dort. Sein Gesicht lag halb im Schatten,
die Stimme weich, kontrolliert.
Er überreichte mir ein Buch.
Kein Titel. Kein Name.
Nur ein Siegel auf dem Einband:
ein Kreis, durchdrungen von einem Schwert,
umgeben von Flammen.
„Sancta Noctis“, sagte er.
„Ein Bund, der im Verborgenen waltet.“
Dann verschwand er.
Ich blieb zurück – mit dem Buch in den Händen,
dessen Gewicht mehr war als bloße Materie.
Ich schlug es auf. Die Seiten waren leer.
Bis auf eine.
„Wer das Dunkel fürchtet,
hat nie das Licht gesehen.“
Ich schloss das Buch.
Und wusste: Ich war nicht mehr nur Novize.
Ich war ein Teil von etwas, das älter war als mein Glaube.
Und größer als mein Mut.
- - - - - - -
In den Tagen danach veränderte sich mein Blick auf die Welt.
Die Gänge, durch die ich täglich schritt – vormals vertraut,
beinahe monoton – begannen, neue Wege zu tragen.
Oder vielleicht war ich es, der anders sah.
Ich beobachtete genauer: nicht nur das, was Menschen taten,
sondern das, was sie vermieden.
Die Gespräche, die verstummten, wenn ich näher trat.
Die Hände, die sich zu lange an den Falten ihrer Kutten
hielten. Die Augen, die zu flackern begannen,
wenn der Name des Camerlengos fiel.
Ich begann, die Dinge nicht mehr nur zu sehen –
ich begann, sie zu deuten.
„Sancta Noctis.“
Ein Orden? Ein Schwur? Eine Idee?
Ich hörte von nächtlichen Versammlungen. Von Dokumenten,
die nicht in den offiziellen Archiven lagen. Von einer Linie,
die sich nicht durch Zeit, sondern durch Schweigen zog.
Ein Schattenorden, so alt wie der Vatikan selbst.
Ich war kein Zeuge mehr.
Ich war – ob gewollt oder nicht – ein Mitwisser.
- - - - - - -
An einem späten Herbstabend stand ich vor der kleinen
Kapelle des Heiligen Hieronymus. Sie war selten besucht,
verborgen zwischen zwei Gebäuden,
deren Funktion niemand mir je erklärt hatte.
Ich trat ein.
Drinnen war es kühl. Still. Die Fresken blätterten von den
Wänden, und in der Apsis war das Antlitz des Heiligen kaum
mehr zu erkennen. Ich setzte mich in die zweite Bankreihe.
Dort begann ich zu schreiben. Nicht laut. Nicht sichtbar.
In Gedanken.
Kein Geständnis.
Keine Rechtfertigung.
Ein Protokoll.
Meines.
- - - - - - -
Die Nächte wurden länger. Nicht weil die Dunkelheit zunahm,
sondern weil die Zeit sich dehnte. Schlaf kam selten, und
wenn, dann trug er mich in Träume, die nicht meine waren.
Einmal, in einer dieser Nächte, klopfte es leise an meiner Tür.
Kein weiteres Geräusch folgte. Nur ein Flüstern, das sich nicht
greifen ließ. Als ich öffnete, war niemand da.
Nur der Mondschein fiel durch den Türspalt.
Am nächsten Morgen: eine neue Karte.
Schweres Papier. Rote Tinte.
„Wer schweigt, lebt länger.
Aber wer spricht, lebt weiter.“
Zum zweiten Mal.
Diesmal nicht wie eine Drohung.
Eher wie eine Erinnerung.
- - - - - - -
Ich begann, mich zurückzuziehen. Nicht aus Angst, sondern
um besser zu sehen. In der Reduktion lag Klarheit.
Einmal wurde ich zu einem Treffen gebeten – heimlich,
in einem Raum, der offiziell nicht existierte.
Dort saßen Männer in dunklen Gewändern.
Ihre Gesichter müde, ihre Stimmen vorsichtig.
Es ging um Pflichten. Um Erbe. Um die Möglichkeit, dass der
Tod des Papstes mehr sei als eine Frage des Alters.
Ich sprach nicht.
Aber ich hörte.
Und ich begriff: Ich wusste bereits zu viel,
um wieder unwissend zu sein.
- - - - - - -
Nach diesem Treffen kehrte ich zurück in meine Kammer.
Die Luft war schwer. Die Nacht hatte sich über Rom gelegt
wie ein Mantel.
Ich schlug das Buch auf, das mir übergeben worden war
Zwischen den leeren Seiten – eine neue.
Fein geschrieben:
„Schweigen ist die Pflicht der Schwachen.
Wer sprechen darf, trägt die Verantwortung.“
Ich fühlte mich nicht stark. Nicht würdig. Nicht bereit.
Aber ich verstand: Ich konnte nicht länger nur empfangen.
Ich musste erwidern.
Ich setzte mich.
Nahm Papier und Tinte.
Und begann zu schreiben.
Nicht, um zu erklären. Nicht, um zu beweisen.
Sondern um zu fragen:
Wie viel Wahrheit kann ein Mensch ertragen?
Wie viel Schweigen braucht eine Institution, um zu überleben?
Und wer bezahlt den Preis,
wenn das Verborgene sichtbar wird?
- - - - - - -
Der Himmel über Rom war grau, als ich am nächsten Morgen
erwachte. Ein feiner Regen hatte die Dächer benetzt,
der Vatikan wirkte stiller als sonst, beinahe beklommen.
Ich stand am Fenster, das Licht fiel über das aufgeschlagene
Buch, das auf meinem Tisch lag.
Auf der letzten Seite stand,
was ich in der Nacht geschrieben hatte:
„Nicht alles, was stirbt, war je lebendig.“
Ich schloss das Buch.
Und wusste:
Ein Ruf war an mich ergangen.
Und ich hatte geantwortet.
KAPITEL 2 DER TOD
Er starb, während ich in der Sakristei kniete und versuchte,
nicht an meine Vergangenheit zu denken.
Nicht, dass das Beten mich beruhigt hätte. Ich hatte nie
wirklich gelernt, wie man betet. Ich wiederholte Worte, die
nicht die meinen waren, Formeln, die nach Trost klangen, aber
keinen boten. Und doch war da etwas in ihrem Rhythmus –
eine Ordnung, die das Innere im Zaum hielt,
ein Gerüst aus Klang gegen das Chaos dahinter.
Vielleicht war es der Wind, der plötzlich nachließ. Vielleicht
das entfernte, metallische Geräusch, als schlösse sich eine Tür
mit großer Langsamkeit. Oder vielleicht war es mein eigenes
Herz, das anders schlug – als wüsste es bereits, was kam.
Die Glocken schwiegen.
Noch.
Ich erhob mich langsam, nicht aus Absicht, sondern aus
Eingebung. Das Licht im Raum war fahl, als hätte sich der
Tag noch nicht entschieden, ob er beginnen wollte. Und doch:
Etwas hatte sich verändert. Noch bevor der Novize den Raum
betrat, sah ich es im Staub über den Bücherregalen, in der Art,
wie das Kreuz seinen Schatten warf – schräger als sonst,
als hätte sich die Welt leise geneigt.
Er war jung, der Novize. Und zu blass. Er trat ein, als glaubte
er selbst nicht an das, was er überbringen sollte.
In seiner Hand: ein Blatt Pergament.
Ich nahm es entgegen, ohne ihn anzusehen.
Der Bogen war ungeöffnet,
doch ich wusste bereits, was darin stand.
„Seine Heiligkeit, Papst Gregor XIX., ist heute früh
im Herrn entschlafen. Die Kirche trauert in Stille.“
Ich las es einmal. Dann noch einmal. Nicht, um es zu
begreifen – sondern um zu prüfen, ob es mich berührte.
Es tat es nicht.
Keine Trauer. Keine Erleichterung.
Nur ein leerer Raum in mir, in dem das Wissen saß
wie ein stiller Gast, den man nicht eingeladen hatte –
aber duldet.
Der Papst war tot.
Und in mir regte sich nur ein leiser Gedanke:
Das war nicht das Ende. Es war der Auftakt.
- - - - - - -
Ich trat hinaus auf den Gang, der zum inneren Trakt führte.
Der Stein unter meinen Sohlen war kalt. Die Luft unbewegt.
Nichts an diesem Ort war je wirklich tot – und doch schien
heute alles angehalten, als lauschte selbst die Architektur.
Ich kannte diese Gänge.
Ihren Klang. Das Echo der Schritte,
das leise Knarren des Gebälks,
das Murmeln aus fernen Kapellen.
Heute: nichts.
Nur das summende Atmen der Lampen. Und das Knacken
meines eigenen Nackens, als ich ihn spannte.
Der Tod hatte den Vatikan nicht überrascht.
Aber er hatte ihn entblößt.
Als hätte jemand gewusst, dass er nicht überrascht –
sondern beruhigen sollte.
Ich wandte mich nach Osten, Richtung Sala Clementina. Dort,
das wusste ich, würde man ihn aufgebahrt haben – wie es
das Protokoll verlangte: feierlich, unnahbar, vom Weihrauch
umhüllt wie von einem heiligen Nebel.
Als ich die Halle betrat, war alles bereits vorbereitet.
Der Katafalk stand im Zentrum. Schwarz.
Von Lichtkegeln nur angedeutet, nicht beleuchtet.
Er lag da wie geschnitzt. Zu ruhig. Zu vollkommen.
Die Soutane makellos weiß. Der Fischerring auf der rechten
Hand glänzte. Die Hände gefaltet. Eine Geste des Friedens,
die mir immer mehr wie ein Siegel des Schweigens erschien.
Ich trat nicht näher. Ich stand in der dritten Reihe –
dort, wo die Namenlosen stehen.
Und doch fiel mein Blick unweigerlich auf ihn.
Auf das Gesicht.
Auf die Haut unter dem linken Ohr.
Ein Schnitt.
Kaum sichtbar. Winzig. Aber zu präzise. Nicht die Spur eines
natürlichen Verfalls. Keine Regung der Zeit. Kein Fehler.
Ein Zeichen.
In meinem Magen zog sich etwas zusammen.
Nicht Angst – Erinnerung.
Er war nicht gestorben.
Er war hingelegt worden.
Nicht beigesetzt – arrangiert.
Ich hätte wegsehen sollen.
Alle anderen taten es. Kein Kardinal, kein Zeremoniar, nicht
einmal die wenigen Nonnen, die wie Statuen am Rande der
Halle knieten, blickten genau hin. Sie sahen – ja –,
aber sie prüften nicht. Sie trauerten nach Vorschrift.
Ihre Andacht war ein Ritus.
Und der Ritus duldet keine Fragen.
Aber ich blieb stehen. Starrte. Auf diesen winzigen Schnitt.
Auf die Unrichtigkeit im Bild, das unantastbar erscheinen
sollte. Auf die makellose Inszenierung eines Körpers,
der schweigen musste.
Und da spürte ich ihn.
Einen Blick.
Er kam von der Seite.
Der Camerlengo.
Nicht frontal. Nicht offen. Er sprach mit einem anderen, eine
schemenhafte Figur im Halbdunkel. Doch seine Augen –
sie ruhten auf mir. Fest. Still. Ohne Hast. Ohne Scheu.
Wie ein Messer,
das nicht mehr gezogen werden muss, um zu verletzen.
Ich erwiderte den Blick nicht. Ich senkte den Kopf, trat aus
der Reihe, drehte mich ab, als sei mir plötzlich etwas entfallen.
Ich ging.
Nicht zur Zelle. Nicht zur Bibliothek,
wo ich hätte verschwinden können zwischen Manuskripten
und staubigen Pulten.
Ich ging in die Sakristei.
Nicht, weil ich etwas suchte –
sondern, weil ich hoffte, dass der Ort noch wusste,
was ich vergessen hatte.
Ich war gekommen, um mich zu sammeln – vielleicht.
Oder um mich zu erinnern.
Aber der Raum fühlte sich nicht mehr an wie früher.
Kälter. Verdichteter.
Nicht wie ein Ort – wie ein Widerstand.
Ich wusste nicht, warum ich dort stand.
Ich wandte mich zur Seite, instinktiv.
Mein Blick fiel auf die steinerne Wand zwischen dem
Weihwasserstein und dem Schrank.
Ich war hundertmal daran vorbeigegangen.
Aber diesmal sah ich ihn: einen Riss.
Kaum sichtbar. Aber mit einer Tiefe, die nicht natürlich war.
Ich kniete mich hin, langsam.
Tastete mit den Fingern über den glatten Stein.
Da war er.
Ein kleiner Spalt, trocken.
Kein Luftzug – aber etwas darin war anders.
Nachgebend.
Ich drückte.
Nicht fest – eher wie jemand, der weiß, dass er etwas berührt,
das nicht berührt werden soll.
Ein Segment des Steins bewegte sich.
Nicht laut – nur ein dumpfes Klicken.
Dann öffnete sich ein Hohlraum – schwarz, staubig, blind.
Darin: ein einziger Gegenstand.
Ein Schlüssel.
Kein Etikett. Kein Zettel.
Nur ein kurzer Stiel, schwer, mit eingeritztem Zahn.
Und dort – kaum erkennbar, aber mit bloßem Finger fühlbar:
XIII
Ich schloss meine Finger darum, verbarg ihn in der Faust, und
trat hinaus – nicht durch den Hauptgang. Sondern durch den
alten Versorgungsflur, den nur Bedienstete und Eingeweihte
benutzten.
Die Lampen flackerten. Der Putz war abgesplittert.
Hier schien die Zeit weniger kontrolliert.
Ich ging tiefer. Immer tiefer.
Und dann stand ich davor.
Eine Tür.
Eisen. Rostig. Kein Griff. Nur ein Schlüsselloch.
Ich führte den Schlüssel ein.
Langsam.
Er passte.
Ein Klicken. Kein Laut.
Die Tür öffnete sich.
Dahinter: Dunkelheit.
Und eine Kälte, die nicht von der Luft kam.
Ich trat ein.
Und wusste: Wenn ich zurückkehre – wenn überhaupt –,
werde ich nicht derselbe sein.
- - - - - - -
Die Stufen führten spiralförmig nach unten. Ohne Geländer
Der Stein war unregelmäßig,
glattgetreten von Jahrhunderten,
die keiner zählte.
Ich zählte nicht mit.
Der Gang mündete in einen Raum unter der Sakristei.
Alt.
Still.
Karg.
Leer.
Als sei er nicht gebaut, sondern im Gestein gefunden worden.
Man misst diesen Ort nicht in Schritten. Nur im Atem.
Niemand hatte ihn je erwähnt.
Vielleicht, weil er keinen Namen hatte.
Kein Altar. Keine Inschrift. Nur eine Truhe.
Tief im Boden eingelassen, als wäre sie gewachsen.
Dunkles Holz. Metallbeschläge. Kein Siegel. Kein Schloss.
Nur eine Einkerbung.
Ich zögerte.
Nicht aus Angst. Sondern aus Achtung.
Die Stille hier war nicht leer. Sie war gefüllt. Mit Erinnerung.





























