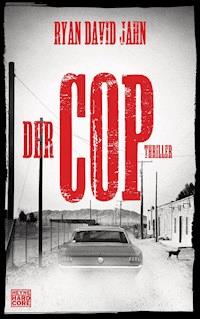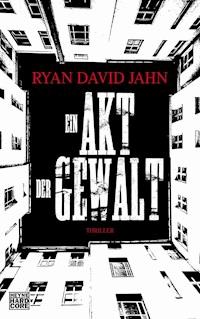3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Epos voller Lügen, Verrat und verlorener Moral
Los Angeles. Zwei Morde in derselben Nacht bringen den Unterweltboss James Manning in Bedrängnis. Ein Sündenbock muss her. Eugene Dahl, ein einfacher Mann, der morgens Milch ausliefert und abends Barhocker wärmt, ist zur falschen Zeit am falschen Ort. Doch er weigert sich, zum Spielball des organisierten Verbrechens zu werden. Um seine Haut zu retten, wird er Dinge tun müssen, die weit schlimmer sind als alles, was man ihm vorwirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 623
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Los Angeles, 1952: In einer kühlen Aprilnacht erschießt der dreizehnjährige Sandy Duncan mit einer selbstgebastelten Pistole seinen Stiefvater und ritzt ihm ein Symbol aus einem Comicheft in die Stirn. Bezirksstaatsanwalt Seymour Markley hofft auf einen Karrieresprung, wenn es ihm gelingt, die Tat mit dem Unterweltboss James Manning in Verbindung zu bringen. Doch der ist ein Meister darin, andere über die Klinge springen zu lassen. Je mehr Menschen in die Sache mit hineingezogen werden, desto weiter eskaliert die Gewalt.
Der Autor
Ryan David Jahn wuchs in Arizona, Texas und Kalifornien auf. Mit sechzehn Jahren verließ er die Schule, um in einem Plattenladen zu arbeiten. Seit 2004 schreibt er als Drehbuchautor für Film und Fernsehen. Für seinen ersten Roman Ein Akt der Gewalt wurde er mit dem renommierten Debut Dagger Award ausgezeichnet.
www.ryandavidjahn.com
Lieferbare Titel
Ein Akt der Gewalt – Der Cop – Die zweite Haut
RYAN DAVID JAHN
DER LETZTEMORGEN
Thriller
Aus dem Amerikanischenvon Teja Schwaner
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe
The Last Tomorrow
erschien 2012 bei Macmillan, London
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das kompletteHardcore-Programm, den monatlichen Newslettersowie unser halbjährlich erscheinendes CORE-Magazinmit Themen rund um das Hardcore-Universum.
Weitere News unter facebook.com/heyne.hardcore
Copyright © 2012 by Ryan David Jahn
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Babette Mock
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Thinkstock / iStock / decisiveimages
Satz: Schaber Datentechnik, Wels
ISBN: 978-3-641-13425-9
www.heyne-hardcore.de
Für Will Atkins&für Mary –
ihre Jas haben mein Leben auf sehrunterschiedliche Weise verändert.
Should the wide world roll away
Leaving black terror
Limitless night,
Nor God, nor man, nor place to stand
Would be to me essential
If thou and thy white arms were there
And the fall to doom a long way.
Stephen Crane
Don’t threaten me with love, baby.
Let’s just go walking in the rain.
Billie Holiday
KEIN ZURÜCK
Eins
Seht euch diesen Jungen an, wie er da auf der Bettkante sitzt. Seine Füße berühren nicht den Boden. Er trägt nichts am Leib als weiße Socken und Unterhosen. Ansonsten ist seine schmale Gestalt nackt. Die Socken hängen an seinen Füßen wie kleine leere Säcke. Die Stirnfransen, von seiner Mutter mit der Schere gestutzt, fallen ungleichmäßig über die Augenbrauen. Eine verschorfte Wunde entstellt seine Unterlippe, und seine Oberlippe ist rissig, weil er vor lauter Nervosität ständig an ihr leckt. Die schmalen Schultern lässt er hängen, die Wirbelsäule führt wie eine Knochenleiter seinen blassen sommersprossigen Rücken hinauf. Er blickt auf seinen Schoß. Dort ruhen seine Hände. Zwischen den Handflächen hält er wie ein Heiligtum eine kleine selbst gebastelte Pistole.
Sein Stiefvater hält seine Waffe irgendwo unter Verschluss, aber die Munition bewahrt er in seiner Sockenschublade auf. Der Junge, Sandy, hat sie ganz zufällig gefunden. Er stöberte im Schlafzimmer seiner Mutter und seines Stiefvaters nach ein paar Geldstücken, denn er wollte ins Kino gehen und eine Tüte Popcorn essen. Aber statt Kleingeld fand er die Patronen. Sie lagen in einer kleinen Pappschachtel. Er nahm sich nur drei, denn er dachte, damit würde er davonkommen. Bis jetzt hat es geklappt.
Zwei Wochen sind vergangen.
Während der ersten paar Tage trug Sandy die Patronen in der Tasche seiner wollenen Schulhose mit sich umher, und sobald er auch nur einen Moment allein war, holte er sie hervor und inspizierte sie. Mehrmals ging er in der Schule auf die Toilette und schloss sich in einer der grün angestrichenen Kabinen ein, damit er sie in der Hand halten und betrachten konnte. Sie fühlten sich in der Hand schwerer an als in der Tasche. Bedeutsamer.
Er stellte sich vor, in der Lage zu sein, seinen Stiefvater zu erschießen. Dadurch wäre allem ein Ende gemacht. Er müsste keine Angst mehr haben, nicht in seinem eigenen Zuhause. Dann wäre dieser Mann, der so tat, als könne er seinen Dad ersetzen, weg. Dieser Mann, den er hasste und der ganz bestimmt auch ihn hasste, wäre weg.
Er hatte nicht die Absicht, diese Fantasievorstellung in die Tat umzusetzen. Anfangs nicht. Er hatte Dutzende anderer Wunschträume gehabt, und aus ihnen war nichts geworden. Jedenfalls nicht bis zum letzten Sommer, als er sich vorgestellt hatte, seinen Stiefvater zu erstechen, und dabei die Wut an einer Katze ausgelassen hatte. Später tat es ihm leid, das kleine Ding getötet zu haben, aber während er es tat, hatte er nur an diesen Mann gedacht, den er verabscheute. Nein, er hatte überhaupt nicht gedacht. Aber auch damals war er weit davon entfernt, seinen Stiefvater tatsächlich zu erstechen. Sogar mit einem Messer fühlte er sich schwach und klein. Und das tut er immer noch. Er fühlt sich wie ein jämmerlicher Feigling.
Immer wenn er von der Schule nach Hause kommt, immer wenn er durch die Eingangstür tritt, verkrampft sich sein Magen vor Angst und Abscheu. Er geht gleich in sein Zimmer, hofft, sein Stiefvater sieht und hört ihn nicht, hofft, wie ein Gespenst vorüberhuschen zu können. Er versteckt sich bis zum Abendessen, macht seine Hausaufgaben und liest in seinen Comics. Beim Essen sitzt er stocksteif da, isst, ohne ein Wort zu sagen außer Bitte und Danke, isst trotz Magendrücken und versucht, lautlos zu kauen. Niemals würde er seine Ellbogen auf den Tisch stützen. Als er letztes Mal so unachtsam war, hat ihm sein Stiefvater die Gabel in den Handrücken gestoßen. Später hörte er, wie Neil seiner Mutter sagte, er habe nicht die Absicht gehabt, den Jungen zu verletzen, sondern nur erreichen wollen, dass er bei Tisch Manieren zeige. Dabei lachte er. Doch was auch immer sein Stiefvater im Sinn gehabt haben mochte, Sandy konnte seine Hand tagelang nicht gebrauchen. Die kleinen Löcher färbten sich schwarz, und die umgebende Haut wurde rot. Die Hand schwoll an und schmerzte so heftig, dass er nicht einmal den Bleistift halten konnte.
Schon bald erwischte er sich dabei, dass er überlegte, wie er an eine Schusswaffe kommen könne. Er stöberte nach der Waffe seines Stiefvaters, fand sie aber nicht, nicht einmal einen Safe, in dem sie hätte weggeschlossen sein können. Er brach in zwei Häuser weiter unten an der Straße ein, während er in der Schule hätte sein müssen, aber auch danach stand er mit leeren Händen da. Er hatte keine Ahnung, was er noch tun sollte. Der Wunschtraum, der eben begonnen hatte, reale Gestalt anzunehmen, drohte zu platzen, sich in Luft aufzulösen.
Dann kam ihm der Gedanke, selbst eine Schusswaffe zu basteln.
Vergangenes Jahr hatte sein Freund Nathan eine Schrotpatrone gefunden. Sie waren daraufhin in Nathans Garage gegangen, hatten die Patrone im Schraubstock seines Vaters festgeklemmt und mit dem abgerundeten Ende eines Schlosserhammers bearbeitet. Sie explodierte, stanzte ein Dutzend Löcher in das Garagentor und riss schartige Holzstücke heraus. Spitze Splitter ragten nach vorn aus der Tür, und das kreisrunde Loch, das die Kugeln gerissen hatten, war größer als ein Essteller. Faszinierend, aber auch furchterregend. Nathan bekam eine Woche Hausarrest und durfte nicht mehr mit Sandy spielen. Seine Eltern behaupteten, Sandy übe schlechten Einfluss aus. Sie sagten, Sandy habe ihm den Ärger eingebrockt. Es war Nathans Idee gewesen, aber so war es ja immer.
Er wird in der Schule von den anderen Kindern geärgert. Lehrer geben ihm einen Klaps auf den Hinterkopf, wenn es doch sein Nachbar war, der tuschelte. Wenn er einen Laden betritt, wird er so gut wie immer vom Besitzer angeranzt. Manchmal, weil er in einem Comic geschmökert hat, ohne ihn anschließend zu kaufen, manchmal völlig grundlos. Einfach, weil er da ist und so aussieht, als könne man an ihm besonders gut seine Wut ablassen. Die Leute mögen seinen Anblick nicht. Menschen, denen er zufällig auf der Straße begegnet, finden Vorwände, ihn anzugiften – zum Beispiel, wenn er ihnen aus Versehen auf den Fuß tritt oder sie anrempelt, weil er so eilig zur Schule rennt.
Sein Stiefvater ist – ganz klar – der schlimmste von allen.
Sandys Mutter hat ihm gesagt, er sei ein Blitzableiter. Manche Leute, hat sie gesagt, haben einfach Gesichter zum Reinschlagen. Und zu denen gehörst du, Sandy. Warum, weiß ich auch nicht. Aber deswegen musst du besonders hart im Nehmen sein. Du musst auf der Hut sein, und du musst tough sein.
Aber er hat es satt, tough zu sein. Und ein Blitzableiter ist er auch nicht. Nein, er ist ein Gefäß. Die ungestüme Kraft fließt nicht durch ihn hindurch und wird in den Erdboden geleitet, ohne Schaden anzurichten; er ist von der Gewalt erfüllt, die jetzt überbordet. Er spürt, dass sie aus ihm hervorsprudelt wie eine kochende Flüssigkeit.
Er weiß, dass er in die Hölle kommen wird. Als er elf Jahre alt war, erschien ein Priester namens Billy Graham in der Stadt und hielt in einem großen Zelt am Washington Boulevard Erweckungstreffen ab. Seine Mutter nahm Sandy eines Abends nach dem Essen zu einem dieser Treffen mit. Er hörte viel von der Hölle, und dieses Gerede ging ihm nicht aus dem Sinn. Deswegen weiß er, dass er dort landen wird, aber es stört ihn nicht. Nicht einen einzigen Tag kann er noch mit seinem Stiefvater zusammenleben.
Um die Pistole zu bauen, faltete Sandy eine Straßenkarte so lange, bis sie sich bequem als Griff verwenden ließ. Da sie bereits gefaltet war, musste sie nur noch zweimal geknickt werden, bis sie die richtige Größe hatte. Zuerst faltete er sie der Länge nach, danach umgekehrt. Sie wurde als Griff überraschend robust. Er legte die Antenne in den Knick des letzten Falzes und befestigte sie mit Klebeband. Anschließend konnte er, selbst wenn er es gewollt hätte, die Antenne nicht mehr aus dem Griff ziehen.
Danach ließ er sein Werk ein paar Tage ruhen. Es sah durchaus nach einer Schusswaffe aus, und die Patronen, die er seinem Stiefvater entwendet hatte, passten ganz prima in den Lauf. Aber er hatte nicht die geringste Ahnung, wie er die selbst gebastelte Waffe hätte abfeuern können.
Das Problem bestand darin, dass seine Fingerfertigkeit zur Ausführung seiner Geistesblitze nicht reichte. Alle seine Einfälle erwiesen sich als viel zu kompliziert.
Dann aber, als er auf der anderen Seite von Bunker Hill aus seiner Schleuder Steine auf Bierdosen schoss, kam er auf die Lösung. Er zerschnitt ein Gummiband, führte es durch das Loch einer metallenen Unterlegscheibe und befestigte die beiden Enden am Griff der Waffe, sodass er nur die Unterlegscheibe zurückziehen und dann loslassen musste, damit sie gegen das hintere Ende der Patrone prallte und ein Schuss abgefeuert wurde.
Päng.
Bei den ersten beiden Versuchen traf er seinen Knöchel, die Scheibe prallte hart gegen den Knochen, und beim zweiten Mal floss sogar Blut, aber beim dritten Anlauf klappte es. Der Knall war nicht annähernd so laut, wie er angenommen hatte: kein krachendes Päng, sondern nur ein leises Puff. Die Kugel schlug ein Loch in den Zimmerboden, und die leere Hülse wurde hinten an der Waffe ausgeworfen und traf ihn am rechten Arm. Seine Mutter kam herein und fragte, was ist das für ein Krach, den ich gerade gehört habe, und er sagte, ich weiß auch nicht, Mom, und sie sagte, komisch, ich hätte schwören können, was gehört zu haben, und blieb dann einen Augenblick in der Tür stehen. Sie sah ihn argwöhnisch an, und er dachte, dass sie wohl Bescheid wusste, vielleicht sogar den Pulverdampf gerochen hatte. Doch sie sagte nichts. Und kurz darauf ermahnte sie ihn nur, sich zum Essen die Hände zu waschen, denn in einer Viertelstunde sei es so weit. Er sagte okay. Sie drehte sich um und ging hinaus.
Sein Arm schmerzt immer noch, so als hätte jemand ihn zu fest gepackt, aber Sandy achtet nicht darauf. Es war ihm gelungen, eine Waffe zu basteln, die funktionierte und ihm nicht in der Hand explodierte. Zwei Patronen hat er noch. Er hat vor, eine davon noch heute Abend zu benutzen – sobald sein Stiefvater aus der Kneipe nach Hause kommt. Er sieht zur Uhr auf dem Nachttisch.
Sie erwidert seinen Blick.
Und sagt tick … tick … tick.
Es ist gerade erst kurz nach zwölf Uhr mittags. Seine Mom fängt abends zu arbeiten an und kommt erst Stunden später nach Hause. Er hat also Zeit. Solange Neil früh aus der Kneipe nach Hause kommt, was er ja oft tut, und wie immer betrunken ist, und solange Sandy nicht die Nerven verliert, müsste er es hinkriegen können. Er weiß, dass er es kann.
Er wartet nur, bis sein Stiefvater schläft, geht zu ihm, zielt und …
Ja.
Zwei
Teddy Stuart blickt über den filzbezogenen Spieltisch auf den pickligen Dreckskerl, der die Karten gibt. Leere schwarze Augen und hohle Wangen. Das Gesicht blass bis auf rosa Akne am Kinn und auf der Stirn. Das fettige, seit mindestens einer Woche nicht gewaschene Haar nach hinten gekämmt und angeklatscht. Wie alle Dealer hier trägt er ein weißes Hemd mit Ärmelhaltern, eine Weste und eine schwarze Fliege. Im Gegensatz zu den meisten Dealern ist dieser hier ein cleverer Trickser. Da ist sich Teddy sicher. Der kleine Mistkerl hat ihn fünfmal nacheinander bei Blättern unter vierzehn besiegt, und deswegen musste er einfach getrickst haben.
Nichts hasst Terry mehr, als richtig gut zu spielen und trotzdem zu verlieren. Er weiß, dass es Glücksspiel heißt, aber verdammt noch mal: Das Pech tritt einem doch nicht fünfmal hintereinander in die Eier. Das machen nur andere Menschen, nur Menschen sind so kaltherzig. Der glückliche Zufall trifft willkürlich.
Er war mit einer Lieferung für »The Man« nach Los Angeles gekommen, und statt ein bisschen Dampf ablassen zu dürfen nach der Reise quer durchs Land, vom Atlantik zum Pazifik, und dem Stress, einen Aktenkoffer übergeben zu müssen, in dem sich mehr Geld befand, als er – obwohl gut bezahlt – in den vergangenen zehn Jahren verdient hatte, muss er tatsächlich diesem pickligen Kerl gegenübersitzen, der nicht viel älter ist als die Kackwurst, die er heute Morgen zwischen den Arschbacken rausgedrückt hat, und erleben, wie der kleine Scheißkerl ihn verarscht, ohne die Miene zu verziehen.
Zwei weitere Spieler sitzen noch am Tisch, links und rechts von ihm.
Teddy atmet seufzend aus und betrachtet seine Karten. Herzsechs und Kreuzsieben. Rot und schwarz. Dreizehn.
Die Lady zu seiner Rechten hat siebzehn und lässt sich eine Karte geben. Sie kriegt die Herzacht. Seine Herzacht. Dieses dämliche Miststück sammelt immer wieder die Karten ein, die für ihn bestimmt sind.
»Wenn du mich noch mal fickst …«
Er beißt die Zähne zusammen und wischt sich mit der linken Handfläche über den Mund. Er schließt die Augen, versucht ruhig zu bleiben. Er öffnet die Augen und klopft mit einem schmutzigen, abgekauten Fingernagel auf den Tisch.
Der Dealer legt Kreuzneun.
»Du elender Drecksack«, sagt Teddy und streckt die Hand aus, um den Kerl zu packen. Am Kragen will er ihn runterziehen und seine arrogante Fresse auf den Tisch knallen. Aber der Junge ist schnell – schneller jedenfalls als Teddy. Er weicht aus, lässt sich nicht erwischen, und als Nächstes spürt Teddy den Doppellauf einer abgesägten Schrotflinte an der Stirn, hallo, sieht so aus, als würde dein Hirn gleich zur Hintertür rausspritzen, und die beiden anderen Spieler sind aufgesprungen und machen einige Schritte rückwärts.
»Ich denke, es wird Zeit, dass du verschwindest, mein Freund.«
»Du mieser kleiner Falschspieler, weißt du eigentlich, wer ich bin?«
»Mir egal, und wenn dein Name Jesus Humphrey Christ wäre – verpiss dich, Mann.«
»Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst.«
»Mit Theodore Stuart, einem Zahlenjongleur von James ›The Man‹ Manning, der meint, dass er, bloß weil er für einen einflussreichen Mann arbeitet, selbst auch jemand Wichtiges ist. Aber dein Boss ist an dieser Küste keine so große Nummer, wie du zu denken scheinst. Und selbst wenn er es wäre – du bist nicht er. Ich seh nur einen fetten, versoffenen Kerl vor mir, der vielleicht gerade noch sein Geld zählen kann, bevor es ihm durch die Finger rinnt.« Er leckt sich die Lippen. »Also, dieses Gespräch ist ja mächtig interessant, aber ich hab hier einen Job zu erledigen, und das heißt, du verschwindest jetzt besser. Und zwar plötzlich.«
»Weg mit der Waffe!«
Teddy weiß, der Abend ist vorbei, weiß, er muss hier abziehen, aber etwas in ihm weigert sich, klein beizugeben, solange der Dealer ihn mit der Waffe bedroht. Diesen kleinen Sieg will er sich gönnen. Er wird hier hinausgehen und noch einen Rest Würde mitnehmen. Er wird hier nicht mit hängenden Schultern gehen, den Blick zu Boden und auf die Füße gesenkt, die ihn schleppend hinaustragen in die Nacht. So voller Selbsthass wird er hier nicht verschwinden. Der Kerl wird die Waffe wegnehmen, oder Teddy wird sich nicht rühren. Nicht einen Zentimeter.
Nicht einen verfluchten Zentimeter.
»Nein.«
»Nimm die Waffe weg und ich gehe.«
»Du wirst sowieso gehen, Kumpel. Ich bin’s schließlich, der hier den Finger am Abzug dieser Waffe hat.«
Der Eigentümer des Ladens, Herb Boykin, in maßgeschneidertem Anzug und mit handbemalter Krawatte, mustert sie von der anderen Seite des Raums. Teddy sieht ihn über die Schulter des Dealers. Sieht, dass er beide Hände in den Taschen hat, konsterniert dreinschaut und sich leicht nach hinten lehnt. Sieht, dass er sich auf die Lippe beißt. Sieht, wie er sich vorbeugt. Sieht, dass er auf sie zukommt.
»Was geht hier vor, Francis?«, fragt Boykin, als er neben ihnen steht.
»Für Mister Stuart ist es längst Schlafenszeit.«
»Du machst die anderen Besucher nervös.«
»Sagen Sie ihnen, sie können beruhigt sein. Ich treffe nur das, worauf ich ziele.« Das sagt er, ohne Teddy aus den Augen zu lassen. Dann fügt er hinzu: »Wirst du jetzt gehen, Kumpel?«
»Nimm die Waffe weg!«
»Mach dich davon, und ich lass dich in Ruhe.«
»Schrotflinten neigen zu einer gewissen … äh … Streuung, Francis.«
»Die Mündung kitzelt seine Stirn, Sir. Ich werde ihn bestimmt nicht verfehlen.«
Teddy spürt Tränen aufsteigen. Fünfzig Jahre alt, und da kommen ihm die Tränen bei einem Streit mit so einem Typen, der kaum aus der Highschool ist. Doch er weigert sich, in diesem Kampf völlig unterzugehen. Er weigert sich, gedemütigt davonzuschleichen. Er blinzelt. Seine Augen brennen. Er weiß, dass sie sich röten, und das macht ihn zornig. Wie kann der kleine Scheißer es wagen, so mit ihm umzugehen? Wie kann er es wagen? Er presst den Kopf gegen die Gewehrläufe, bis es schmerzt, will, dass es schmerzt, will mehr Wut spüren und weniger Erniedrigung.
»Drückst du nun ab oder nimmst du das Gewehr weg?«, sagt er. »Du hast die Wahl.«
»Nimm die Waffe weg, Francis. Mister Stuart will gehen.«
Der Kerl zögert, aber schließlich gehorcht er.
»So ist es recht, Boy«, sagt Teddy. »Immer schön tun, was die Erwachsenen sagen.«
Der Kerl zuckt zusammen, als er »Boy« genannt wird, und murmelt, dass er nun echt kein kleiner Negerboy sei. Gut. Wenigstens ist es dem Kerl unter die Haut gegangen. Zwar lässt der Druck nicht nach, der auf seinem Magen lastet und auch die ganze Anspannung löst sich nicht, aber es ist trotzdem gut. Wenigstens etwas.
Er steht auf und richtet seine Krawatte. Er lässt den Blick durch den großen Raum schweifen. Die meisten Besucher sehen ihn stumm an. Einige von ihnen erkennt er. Auf ihren blassen Gesichtern spiegelt sich das amüsierte Entsetzen, das sie so sprachlos gemacht hat. Er spürt, dass sich wieder Tränen in seinen Augenwinkeln sammeln wollen, aber er verweigert sich ihnen, blinzelt sie fort.
»Ich bin sicher, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt hat, Mister Stuart«, sagt Herb Boykin. »Ich glaube wirklich, es ist das Beste, wenn Sie sich für heute Abend verabschieden, aber Sie sind jederzeit wieder willkommen. Am Schalter warten Chips im Wert von fünfzig Dollar auf Sie.«
»Ich werde nie wieder herkommen, Sie dämlicher Arsch. Was hier passiert ist, war kein Missverständnis. Ihr Dealer spielt falsch. Er ist ein Betrüger. Und das färbt auf Sie ab. Auf Sie und diesen Laden hier. Also, fickt euch. Fickt euch!«
Er zieht einen Mundvoll Rotze hoch und spuckt ihn Boykin ins Gesicht. Der Speichel rinnt an der Wange des Mannes hinunter wie Eischnee.
Boykin holt ein Taschentuch hervor und wischt die Spucke ab. Dann sieht er an Teddy vorbei und nickt. Teddy dreht sich um und sieht gerade noch, dass ein großer Schwarzer zwei Schritte auf ihn zu macht und einen Schlagstock schwingt. Kurz darauf ein greller Schein, als würde er direkt in die Sonne sehen. Dann ist alles schwarz.
Es gibt keinen Übergang, nur ein Klick. Wie von einem Lichtschalter.
Drei
1
Scheinwerfer lassen die Fensterscheiben von Sandys Zimmer aufleuchten, als ein Fahrzeug in die Straße einbiegt. Es fährt von der Ecke aus die Steigung hinauf und hält an. Die Bremsen quietschen. Der Motor erstirbt, dreht die letzten paar Male immer langsamer, wie ein Spielzeugauto, dessen Federwerk aufgibt. Schließlich verstummt er. Eine Autotür öffnet sich knarrend, wird zugeschlagen. Schritte nähern sich der Vordertür, Schlüssel klappern, und die Tür schwingt auf. Kurz darauf wird sie geschlossen. Dann hört man, dass ein Riegel vorgeschoben wird. Schlüssel werden auf dem verschrammten Tisch bei der Eingangstür abgelegt. Schuhe werden von den Füßen geschleudert und landen einer nach dem anderen mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden. Tapsende Schritte entfernen sich. Wasser läuft in der Küche. Die Rohre seufzen. Ein Glas wird gefüllt. Stille. Ein Glas wird auf dem Küchentresen abgestellt. Bodendielen knarren. Das Sofa ächzt.
Danach fünf Minuten Stille, die laut in Sandys Ohren hallt, so wie ein Tinnitus.
Schließlich beginnt das Schnarchen. Sein Stiefvater ist eingeschlafen. Bald wird er ewig schlafen.
Sandy stemmt sich vom Bett auf.
Der Teppich fühlt sich unter seinen Fußsohlen seltsam an, grob und unnatürlich und unangenehm. Er legt die Waffe beiseite, um sich anzuziehen. Sein Stiefvater schläft. Er wird bestimmt nicht aufstehen, nach ihm sehen und sich fragen, warum zum Teufel er sich mitten in der Nacht angezogen hat. Hast wohl wieder ’ne Dummheit vor? Was soll das? Antworte mir, du kleiner Scheißer, zuck nicht nur die Achseln und zieh eine blöde Fresse. Also, was hast du angestellt? Warum bist du angezogen? Sein Stiefvater schläft, und Sandy möchte angekleidet sein, wenn er ausführt, was er vorhat.
Unbekleidet fühlt er sich angreifbar.
Nachdem er Hose und T-Shirt angezogen hat, holt er die Patronen aus dem Schuhkarton unter dem Bett und steckt eine in die Tasche. Die andere schiebt er hinten in seine selbst gebastelte Waffe. Er geht zur Schlafzimmertür. Dort bleibt er eine Weile stehen – mit klopfendem Herzen und schweißnassen Händen. Er leckt sich über die Lippen.
In seinem Kopf herrscht Chaos, die Gedanken rasen auf ihn ein, überschlagen sich. Tu es nicht, du musst es tun. Und wenn Mom nach Hause kommt? Und wenn er aufwacht, was dann? Was ist, wenn Mom nach Hause kommt? Tu es nicht. Wenn er aufwacht und dich mit deiner Pistole sieht, wird er sie dir wegnehmen und dich damit töten. Du musst es tun, tu es nicht, zieh dich einfach wieder aus, geh ins Bett und schlaf. Geh einfach ins Bett und schlaf. Ist das Sicherste. Wenn er aufwacht, was dann? Manchmal hast du doch schöne Träume. Wenn du jetzt schläfst, vielleicht hast du schöne Träume. Tu es nicht, tu es nicht, du musst es tun, auf jeden Fall, du musst, nein …
Er tritt in den schmalen Flur hinaus. Er geht ihn entlang. Er hat das Gefühl, als zwängten die Wände ihn immer weiter ein. Dann hat er den Flur hinter sich gelassen und befindet sich im Wohnzimmer. Die Waffe hält er umklammert. Fest umklammert.
Er hat Angst.
Als er weitergeht, geschieht etwas Eigenartiges:
Man stelle sich ein einstöckiges Haus mit blau gestrichener Holzverkleidung und grauen Bitumenziegeln auf dem Dach vor. Man stelle sich vor, wie es im Dunkel der Nacht dasteht, die Fenster knallgelbe Rechtecke, die jedem, der vorbeigeht, Zimmer für Zimmer preisgeben. Im Esszimmer plärrt ein Plattenspieler, klingt, als liefe die Schallplatte rückwärts. Aus dem Radio im vorderen Schlafzimmer ertönt eine aufgeregte Stimme, die jedoch nicht zu verstehen ist, weil es den Silben offenbar nicht gelingen will, sich zu zusammenhängenden Worten zu fügen. In der Küche wimmert ein Hund wie ein Baby, und auf dem Korridor bellt ein Baby wie verrückt.
So sieht es hinter Sandys Stirn aus, als er losgeht.
Aber mit jedem Schritt wird ein weiteres Zimmer in diesem Fantasiehaus dunkel. Mit jedem Schritt wird es in einem weiteren Zimmer still. Jeder Schritt ist wie ein Schalter, der einen Teil seines Denkvermögens lahmlegt, bis es in seinem Kopf so still und dunkel und ruhig ist wie zwischen zwei Herzschlägen und er vor seinem Stiefvater steht. Alles andere als dieser Augenblick gehört in die Welt des Traums. Alles andere als dieser Augenblick hat zu existieren aufgehört.
Nur ein Fenster ist noch erleuchtet, und vom Gehsteig aus sieht Sandy sich durch dieses Fenster. Er hebt die selbst gebastelte Pistole und richtet sie auf die linke Schläfe seines schlafenden Stiefvaters.
Sein Stiefvater: hingelümmelt aufs Sofa, das alte durchgesessene Sofa mit dem kratzigen Polsterbezug, einen Arm schlaff auf den dicken Bauch gebettet, den anderen nach unten hängend, die Knöchel auf dem Teppich, die Handfläche geöffnet, als bettelte er um Kleingeld. Dem flachen nasalen Schnarchen, das er beim Einatmen durch die Nase hören lässt, folgt ein Säuseln wie von einer Brise, die in der Ferne durch eine Bergschlucht weht.
Bis auf diese Töne – Stille.
Alle anderen Geräusche gelöscht. An ihrer Stelle eine eigentümliche Ruhe.
Aber etwas naht. Wie ein Zug, den man ahnt, bevor man ihn hört, ein Vibrieren auf der Haut. Etwas kommt.
Es nimmt seinen Lauf. Er spürt nicht einmal, dass er es tut. Es kommt ihm vor, als sei er nur eine Marionette und jemand anders kontrolliere ihn. Jemand anders zieht die Fäden, aber es nimmt seinen Lauf, und bald wird es zu Ende gebracht sein.
Sandy sieht sich zu, wie er die Waffe hebt. Sieht, dass er die Unterlegscheibe zurückzieht. Sieht, wie sich das Gummiband spannt. Beobachtet, dass sich dessen Farbe leicht verändert, eine hellere Beigefärbung annimmt, je dünner und straffer das Gummi wird.
Er sieht sich dabei zu, wie er loslässt.
Es ist nichts dabei. Die Finger lösen sich um Millimeter voneinander, und die metallene Unterlegscheibe springt zwischen ihnen hervor.
Die Waffe gibt ein gedämpftes Paff von sich. Die leere Patronenhülse wird hinten hinausgeschleudert und trifft Sandys Hals. Der Kopf seines Stiefvaters knickt nach rechts weg. Dann setzt er sich auf, sein Stiefvater setzt sich auf, schwankt betrunken, lässt Sandy an eine Boje denken, die auf dem Wasser schaukelt … schaukelt … schaukelt.
Der Schuss scheint Sandy wieder zu sich gebracht zu haben, jedenfalls ist er jetzt wieder da – hallo, alter Freund, ist schon viel zu lange her – und steht keinen Meter von seinem Stiefvater entfernt. Sein erster Gedanke ist, dass es nicht geklappt hat. Die Waffe hat nicht richtig funktioniert. Hätte sie funktioniert, wäre sein Stiefvater jetzt tot. Aber er ist nicht tot. Er sitzt auf dem Sofa. Er hebt den Kopf. Er sieht Sandy an. Er sagt: »Was … was ist passiert?«
Blut rinnt seitlich an seinem Gesicht hinunter.
Sandy öffnet den Mund, um ihm zu antworten, aber ihm fehlen die Worte.
2
Er sieht seinen Stiefvater an. Sein Stiefvater erwidert den Blick. Die Waffe hängt in Sandys kleiner Faust. Blut rinnt seitlich am Gesicht seines Stiefvaters hinunter. Sein linkes Auge füllt sich mit Blut. Das Loch an seiner Schläfe ist schwarz. Man könnte es leicht mit einem Bleistiftradiergummi stopfen. Das wär’s dann, Sir, alles erledigt, lassen Sie sich am Empfang die Rechnung geben. Sein Stiefvater blinzelt. Eine Blutträne rollt aus dem linken Auge über seine Wange.
Er wiederholt seine Frage. »Was … ist passiert?«
Sandy starrt nur stumm.
»O Gott«, sagt sein Stiefvater.
Er beugt sich vor, stützt die Arme auf die Knie, glotzt auf den Teppich zwischen seinen Füßen. Sein von Schweiß verfilztes Haar hängt in Büscheln herunter. Oben auf seinem Kopf glänzt eine kahle Stelle, ein Halbkreis Kopfhaut ungefähr so groß wie ein Silberdollar, und ein roter Pickel leuchtet gleich hinter dem Haaransatz. Blut tropft jetzt von seiner Schläfe auf den Unterschenkel. Blut tropft auf den Teppich. Er scheint es nicht zu bemerken.
»Scheiße«, sagt er. »Ich muss mehr getrunken haben, als ich … mehr, als ich … mehr, als ich …«
Er spuckt zwischen die Füße. Der lange Speichelstrang reicht fast dreißig Zentimeter, bevor er abreißt und auf den Boden klatscht.
»Ich glaub, mir wird übel«, sagt er.
Sandy zwingt sich dazu, da stehen zu bleiben, wo er sich befindet, und die zweite Patrone einzulegen. Sein Herz klopft aufgeregt, und schon jetzt, bevor es zu Ende gebracht ist, wünscht er sich, er hätte auf seine Zweifel gehört. Er hätte das hier niemals tun dürfen.
Am liebsten würde er sich umdrehen und davonrennen. Er könnte fortlaufen und niemals zurückkehren. Dann bräuchte er das hier nicht zu Ende zu bringen. Er könnte einfach fortgehen und wie ein Hobo leben. Neil würde er nie wiedersehen müssen. Er würde das hier nicht zu Ende bringen müssen und auch Neil niemals wiedersehen. Das hätte er gleich tun sollen. Bestimmt fände sich ein älterer Hobo, der ihn ins Tagelöhnerleben einführen würde. Vielleicht findet sich dort auch sein wahrer Vater, der auf Güterzügen durch die Lande trampt, immer mal wieder einen Tag arbeitet und irgendwo in einem Hobo-Lager Bohnen über einem offenen Feuer kocht. Könnte doch sein, dass sein wahrer Vater ihm über den Weg läuft. Sie würden einander auf der Stelle erkennen, und sein Vater würde sagen, dass es ihm leidtäte, sich davongemacht zu haben, und er würde ihn in das Hobo-Leben einführen und ihm von seinen Abenteuern erzählen. Das könnte er doch machen, anstelle von dem hier. Das könnte er tun, und es wäre okay. Alles wäre prima. Alles wäre toll.
Mit zitternder Hand richtet er die Waffe auf den kahlen Fleck oben auf Neils Kopf. Er schließt die Augen. Neil wird gleich aufblicken und ihm Einhalt gebieten.
Jetzt gleich. Jetzt gleich.
Sandy öffnet die Augen. Der Mann sitzt noch immer da, in sich zusammengesunken, und betrachtet den dunklen Speichelfleck auf dem Teppich. Sabber hängt ihm von den Lippen. Er riecht seltsam, irgendwie faulig süß, wie Obst, das in der Hitze des Sommers zu lange in seiner Schale auf dem Tisch gestanden hat. So riecht er immer, wenn er getrunken hat. Sandy hat gelernt, bei diesem süßen Gärungsgeruch an Gewaltausbrüche zu denken, daran, geschlagen zu werden.
Tränen strömen ihm übers Gesicht.
»Du hättest nicht so fies sein sollen«, sagt er.
Sein Stiefvater hebt jetzt langsam den Blick, zu spät, und lallt: »Wa…«
Aber das ist auch alles, was er noch fertigkriegt.
Vier
1
Als Teddy aufwacht, liegt er bäuchlings auf dem Parkplatz. Er rollt sich zur Seite, setzt sich auf, betastet sein Gesicht. Kiesbröckchen kleben an seiner Wange. Er streift sie ab, und sie fallen zu Boden.
Anfangs packen ihn Verwirrung und hilflose Traurigkeit, als sei er aus einem Albtraum erwacht, an den er sich so recht nicht erinnern kann – nur konturenlose unschöne Bilder und ein Geräusch wie von einem Gartentor, das an rostigen Angeln pendelt –, aber bald weichen diese Gefühle der Wut, die ihn packt, als ihm wieder einfällt, was geschehen ist, wie sehr man ihn gedemütigt hat.
Er blickt nach rechts und sieht ein schwarzes Coupé, das über ihm aufragt. Er greift nach oben und packt den Türgriff. Zieht sich hoch, bis er steht. Schwankt ein wenig, bis er das Gleichgewicht gefunden hat. Wirft einen Blick auf seine Kleidung. Der Anzug ist ruiniert. Völlig verdreckt. An seiner Weste fehlt ein Knopf, und eine Jackentasche ist fast ganz abgerissen.
Er spürt dumpf pochende Kopfschmerzen.
Er betastet seine Schläfe und fühlt eine Blutkruste. Stechender Schmerz durchfährt ihn.
Dieser picklige kleine Dreckskerl.
Teddy wird es ihn büßen lassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Er wird nicht hinnehmen, dass ihn jemand so behandelt. Er hat in den vergangenen zehn Jahren zu viel durchgestanden, um sich das, was heute Abend geschehen ist, einfach so gefallen zu lassen, ohne es denen heimzuzahlen.
Dazu hat er viel zu viel durchgestanden.
2
Vor einem Jahrzehnt war Teddy ein einfacher Buchhalter in New Jersey gewesen. Er hatte sich im Laufe der Jahre den Ruf erworben, Zahlen frisieren zu können und es, wenn erforderlich, auch zu tun. Das lockte gelegentlich Menschen in sein Büro, deren Absichten etwas außerhalb der Legalität lagen. Aber es handelte sich nur um kleine Fische. Griechische Feinkosthändler, die wollten, dass ihre Steuern nur ein Bruchteil ihres Einkommens widerspiegelten, Cops, die bei Razzien Drogen mitgehen ließen, sie später auf der Straße weiterverkauften und das Geld investieren wollten, ohne schief angesehen zu werden. Solche Sachen eben. Er hatte niemals damit gerechnet, dass eines Tages The Man höchstpersönlich durch die schmutzfleckige Eingangstür seines kleinen Mietbüros marschieren würde. Aber genau das geschah. Er kam herein und setzte sich Teddy gegenüber, kratzte an seinem Hals wie an der Pelle einer speckfaltigen Presswurst und sagte: »Ich denke, wir könnten womöglich ins Geschäft kommen, du und ich.«
Zuerst erledigte Teddy die Steuergeschichten für ein paar ganz legale Geschäftsunternehmen, die The Man führte – einen Autohandel in Newark, eine Schreibwarenhandlung in Hoboken, durch deren Kasse wohl mehr Bares rausgeschleust wurde, als fiskalisch zulässig war. Manchmal kam es vor, dass die Zahlen selbst nicht so genau sagen wollten, was man von ihnen zu hören wünschte. Aber Teddy war clever und brachte dem Algebra das Bauchreden bei, schaffte es, die Zahlen sagen zu lassen, was er hören wollte. Und er dachte sich nichts bei den vielfältigen Wünschen, die The Man an ihn stellte.
Und so geschah es, dass die Wünsche immer anspruchsvoller wurden und Teddy erfüllte, was gewünscht wurde. Er sagte sich, es ist doch kein so großes Ding, nicht schlimmer als das, was ich eh schon gemacht habe. Und jetzt, ein Jahrzehnt später, macht er Dinge, auf die er sich bei jenem ersten Zusammentreffen niemals eingelassen hätte.
Teddy stieg die Leiter hinunter, wie es jeder andere auch getan hätte: Sprosse um Sprosse.
Jetzt weiß er von den Geschäften, die The Man betreibt, genau so viel wie The Man selbst, und das bedeutet natürlich, dass er keine Chance hat, die Verbindung mit ihm zu kappen. Zu diesem Zeitpunkt ist es allein der Tod, der ihre Beziehung beenden kann. Entweder Teddys oder The Mans.
Aber Teddy weiß, wer eher dran glauben muss.
3
Trotz aller kursierenden Geschichten über die Rücksichtslosigkeit von The Man brauchte Teddy sehr lange, bis er diese Seite des Mannes erkannte. The Man war leise. Man musste sich ihm entgegenbeugen, wenn man hören wollte, was er sagte. Und er sprach mit sanfter Stimme, als wolle er ein eingeschüchtertes Tier beruhigen. Er redete nur, wenn er etwas Bestimmtes zu sagen hatte, und sobald es ausgesprochen war, standen seine Kiefer wieder still. Er konnte manchmal sogar schüchtern wirken. Aber die Geschichten, die Terry über ihn zu hören bekam, erzählten von einem wahren Monster, von einem, der dir schon beim geringsten Verstoß beide Beine brach und mit einem Beil den Schädel spaltete, wenn er argwöhnte, dass du dir Schlimmeres erlaubt hattest, einem, der deine Leiche auf der Kühlerhaube des Autos deiner Mutter ablegte, wenn du krepiert warst, ohne dich für das zu entschuldigen, was du seiner Ansicht nach getan hattest. Und wenn er damit durch war, wusch er seine Hände in Blut und ging in sein bevorzugtes Steakhaus, setzte sich in seine Ecknische (die immer für ihn freigehalten wurde, egal wie voll der Laden war) und gönnte sich ein Rib-Eye-Steak mit jeder Menge Meerrettich, einer Ofenkartoffel samt Beilagen, zwei Portionen Rahmspinat, zwei Stücken Apfelkuchen, überbacken mit Käse. Und zum Schluss ein Glas Scotch. Am Wochenende, wenn er nicht in seiner Stadtwohnung blieb, fuhr er raus nach Shrewsbury und schlief wie ein Baby in seinem großen bequemen Bett, verwöhnt von der Körperwärme seiner treuen Ehefrau, die anscheinend an der Ostküste die einzige Person war, die keine Ahnung hatte, womit ihr Mann seinen Lebensunterhalt verdiente und wie er das 400-Quadratmeter-Haus und die häufigen Urlaubsreisen finanzierte.
Anfangs war Teddy überzeugt, dass die Geschichten, die sich um The Man rankten, nur Facetten des Mythos waren, der sich im Laufe von zwanzig – jetzt bereits dreißig – Geschäftsjahren um ihn entfaltet hatte. Natürlich war seine Arbeit nicht ohne eine gehörige Portion Härte zu bewältigen, aber Teddy konnte die Geschichten, die man sich über ihn erzählte, unmöglich glauben. Kein menschliches Wesen wäre fähig, solche Dinge zu tun.
Aber es hat sich einiges geändert, seit Teddy diese Geschichten zum ersten Mal gehört hat. Unter anderem ist er gar nicht mehr so überzeugt davon, dass es sich bei The Man tatsächlich um einen Menschen handelt.
In den Jahren, seit Teddy die ersten Geschichten über The Man gehört hatte, ist er Zeuge von Gräueltaten geworden, wie nicht einmal Goya sie sich hätte träumen lassen. Selbst wenn manche Geschichten, die er gehört hat, womöglich nicht wahr sind, weiß er jetzt, dass andere Geschichten, ähnliche und schlimmere, auf jeden Fall der Wahrheit entsprechen.
Aber trotz allem, was er miterlebt hat, bleibt er immer nur ein Buchhalter. Ein korrupter Buchhalter, klar. Er frisiert Zahlen, hilft, schmutziges Geld zu waschen, liefert Barkredite aus und erläutert Rückzahlungskonditionen bei Leuten, deren Namen schon sehr bald in Todesanzeigen zu lesen sind. Aber bis jetzt hat er noch keinen Tropfen Blut an den Händen.
Er glaubt jedoch, dass er seine Lektion gelernt hat, was innerlich unbeteiligte Gewalt angeht. Und daher meint er zu wissen, worauf er sich einlässt, als er das Messer aus seiner Jackentasche zieht, es mit dem Daumen aufklappt und in der abendlichen Dunkelheit auf den pickligen Kerl wartet. Was seine Selbsteinschätzung betrifft, irrt er natürlich, und er liegt auch falsch in der Beurteilung der Fähigkeit, am eigenen Handeln innerlich unbeteiligt zu bleiben, aber das kann er nicht wissen.
Denn sonst würde er nicht tun, was er tut.
4
Er steht auf dem dunklen Parkplatz, das Messer fest in der Faust, und beobachtet die rot gestrichene metallene Hintertür. Das Messer war ein Geburtstagsgeschenk von seiner Exfrau. Er trägt es seit Jahren bei sich. Er hat häufig mit gefährlichen Leuten zu tun, skrupellosen Leuten, Leuten, die Schwäche als Einladung sehen, Leuten, deren erster Impuls ist, zu vernichten. Zwar hat er bisher noch niemanden mit dem Messer verletzt, aber er hat die Klinge schon mehr als einmal dazu benutzt, sich aus einer heiklen Situation herauszulavieren. Mag sein, dass er kurz danach schweißgebadet und am ganzen Körper zitternd vorm Toilettenbecken kniete, aber geschafft hat er es immer.
Eins jedenfalls gilt, wenn du für The Man arbeitest: Die Typen, die etwas gegen ihn haben, sich aber fürchten, es direkt mit ihm aufzunehmen, machen sich vor, mächtig tough zu sein, wenn sie stattdessen dich ins Visier nehmen. Das ist auch heute Abend der Fall. Davon ist er überzeugt.
Er denkt daran, wie der Kerl ihn vorgeführt hat. Er denkt daran, wie der Kerl es geschafft hat, dass er sich dämlich und schwach vorkam. Er duldet es nicht, dämlich und schwach zu wirken. Ein Mann beweist sich durch sein Verhalten in schwierigen Situationen. Wenn jemand auf dich losgeht und du nur daliegst, bist du nichts als ein Fußabtreter. Geschaffen dafür, mit Füßen getreten zu werden. Schon bald werden andere die Fußspuren auf deinem Rücken wahrnehmen und dasselbe tun. Schon tritt sich der Pfad breit. Nein, wenn jemand auf dich losgeht, dann hältst du ihn auf. Und zwar mit aller Gewalt. Du bist kein Fußabtreter und du lässt nicht auf dir herumtrampeln.
Teddy wartet lange.
Ab und zu falscher Alarm. Ein Betrunkener stolpert gegen seinen Wagen. Jemand kommt mit einem Müllbeutel, um ihn in der Seitengasse in eine Tonne zu werfen. Ein Straßenköter. Während des Wartens ebben seine Wut und das Gefühl der Demütigung ab. Er spielt mit dem Gedanken, einfach wegzufahren, und täte er das, würden sich so manche Dinge anders entwickeln, nicht nur für ihn, sondern für viele Leute – denn seine Handlungen und die Handlungen eines kleinen Jungen namens Sanford Duncan in fünfzehn Meilen Entfernung werden das Leben diverser Menschen beeinflussen, die ihnen niemals begegnen. Aber immer wenn er erwägt, einfach zu gehen, in sein Hotel zurückzufahren und etwas zu schlafen, fällt ihm wieder ein, was dort drinnen geschehen ist, und die Flut der Emotionen überspült ihn von Neuem.
Als sich schließlich die rote Tür öffnet, ist es der Typ.
In Gedanken weigert sich Teddy, ihn beim Namen zu nennen. Er kann gar keinen Namen besitzen, denn nur, was einen Namen hat, verdient es auch zu leben. Für Teddy ist er nichts als ein Typ.
Der greift jetzt in die Tasche und zieht ein Etui hervor. Er fingert eine schmale Zigarette heraus und steckt sie sich zwischen die Lippen. Er zündet sie mit einem Streichholz an. Er hält sie zusammengepresst zwischen Zeigefinger und Daumen, nimmt einen tiefen Zug und hält den Rauch eine Weile in der Lunge zurück, bevor er ihn hektisch hustend in einer Wolke wieder ausstößt.
Der Geruch wird Teddy vom Windhauch zugetragen. Der Typ raucht einen Joint.
Teddy steht im hinteren Teil des Parkplatzes im Dunkeln und lässt ihn in Ruhe rauchen. Er sieht dabei zu. Die fettige Stirn. Die Akneflecken. Wieder und wieder hat dieser Mistkerl ihn schamlos beim Kartengeben betrogen. Ihn gedemütigt, als er ihn deswegen zur Rede stellte. Dieser kleine Scheißer. Dieser nichtsnutzige kleine …
Hitze steigt ihm ins Gesicht. Salzwasser brennt im Auge.
Er tritt aus dem Dunkel hervor und steuert zielbewusst über den schwarzen Asphalt auf den Typen zu. Seine Schritte sind lang und fest. Tränen laufen ihm übers Gesicht.
Als Teddy sich nähert, sieht der Typ auf, verbirgt gleichzeitig seinen Joint hinter dem Rücken und sagt: »Es ist nicht, was Sie …« Aber dann erkennt er Teddy und verstummt. Als er wieder spricht, hat sich sein Tonfall verändert. »Du«, sagt er.
»Ja, ich, du respektloser kleiner Mistkerl. Du verdammtes Stück Schei…«
Unkontrolliert holt er im weiten Bogen mit der Klinge aus. Der Kerl sieht das Messer kommen und dreht sich weg. Die Klinge schlitzt ihm hinten auf der linken Schulter das Shirt auf. Anfangs sieht es so aus, als habe Teddy den Mann unter dem Shirt verfehlt. Der Stoff hängt in zwei Fetzen von der Schulter wie schlaffe Segel in der Flaute. Doch dann fließt das Blut. Offenbar stellt sich damit auch der Schmerz ein, denn Teddy sieht, wie sich das Gesicht des Typen verzerrt. Er greift nach der blutenden Wunde. Seine Augen weiten sich und glitzern. Einen Moment lang – ein drei-, höchstens viermaliges Ticken der Uhr – besteht die Chance, dass Teddy sich selbst Einhalt gebieten kann. Ihn packt das Mitgefühl. Er spürt den Schmerz, der sich auf dem Gesicht des anderen abzeichnet, so intensiv, als sei es sein eigener. Beinahe weicht er zurück und verschwindet im Dunkeln. Mit einer Entschuldigung auf den Lippen.
Aber da wird die Leidensmiene des Typs zu einer wütenden Fratze.
»Du fettes Schwein«, sagt er. »Du hast ja keine Ahnung, in was für eine Scheiße du getreten bist.«
Der Typ greift hinunter an seinen Stiefel.
Teddy weiß, dass er ihn aufhalten muss. Der Typ hat dort eine Waffe versteckt. Eine einschüssige Pistole. Ein Messer. Irgendwas. Was auch immer es sein mag, eins ist klar: Teddy muss zu Ende bringen, was er angezettelt hat. Er holt mit dem Messer aus, trifft den Arm, der zum Stiefel greift, und schlitzt ihn auf. Aus der tiefen Schnittwunde ergießt sich ein Blutschwall. Er holt nochmals aus, und das Gesicht klafft auf, die linke Wange, sodass ein weißer Knochen sichtbar wird. Ein freigelegtes Halloween-Skelett. Und noch mal schwingt er sein Messer. Mit einem Gurgeln wie aus einem verstopften Ausguss öffnet sich die Kehle, und dann steht er über diesem bewegungslosen Etwas, das sich eben noch bewegt hat, das eben noch ein Mensch gewesen ist.
In Terry herrscht nur noch Bedauern. All die Wut und das Gefühl der Erniedrigung, die ihn erfüllten, als er sich dem Typen näherte und zum ersten Mal ausholte, sind verschwunden. Es scheint so lange her zu sein, dass er dies hier begonnen hat. Kann es tatsächlich sein, dass seit seinem ersten Schritt weniger als eine Minute vergangen ist? Er kommt sich vor wie eine gänzlich andere Person als die, die hinten auf dem Parkplatz gestanden hat, nichts als Übles im Sinn.
Wer war diese Person?
5
Er lässt das blutige Messer fallen. Es scheppert auf dem Asphalt, bis es neben der Leiche des jungen Typen still daliegt. Er greift hinunter, berührt das Gesicht des Toten und ruft leise seinen Namen: »Francis«, sagt er. »Francis … bist du okay?«
Natürlich ist er nicht okay, und er wird auch nie wieder okay sein.
Teddy blickt auf seine Hand. Blut klebt daran, viel Blut. Auf seinem Jackenärmel ist weniger Blut zu sehen, nur ein paar verstreute Spritzer sind haften geblieben. Im Licht des Dreiviertelmondes sieht das Blut schwarz aus. Seine Mutter hatte ihm einmal gesagt, dass man Blutflecken sofort mit Seife und kaltem Wasser abreiben müsse, um sie zu entfernen. Das war damals gewesen, als jemand ihm auf dem Weg von der Schule nach Hause einen Boxhieb auf die Nase versetzt und seine Bonbons geklaut hatte. Seine Hemdbrust war voller Blut, aber seine Mutter hatte es geschafft, die Flecken zu entfernen, indem sie das Hemd im Waschzuber geschrubbt hatte. Anschließend trug er das Hemd sehr gern, weil es ihm zu sagen schien, dass es den Boxhieb auf die Nase nie gegeben hatte. Wenn doch, wo war das Blut geblieben?
Doch manche Flecken lassen sich weder mit kaltem noch mit heißem Wasser entfernen.
Er wendet sich von der Leiche und der Blutlache ab, die sich unter ihr sammelt. Wäre er in der Lage, klare Gedanken zu fassen, würde er jetzt das Messer aufheben, zu seinem Wagen gehen und zurück ins Hotel fahren, wo er sich säubern und die blutige Kleidung loswerden könnte. Er würde sich frisch machen, in die Bar gehen und mit jemandem ins Gespräch kommen, der ihm eventuell ein Alibi zu geben bereit wäre, irgendeinem Trunkenbold, dem es an Zeitgefühl mangelte. Ja, Officer, der hat den ganzen Abend mit mir getrunken. Aber er denkt nicht klar. Die innerlich unbeteiligte Gewalt, zu der er fähig zu sein meinte, existierte nicht. Diese Gewalt entstand aus Wut und Angst. Und das bezeugt der Tatort.
Er lässt das Messer liegen, wo es ist.
Er macht ruckartige Schritte wie ein Roboter, wie ein Mann, der an Syphilis in fortgeschrittenem Stadium leidet. Er überquert den Parkplatz, geht die Seitengasse entlang in Richtung Sunset Boulevard. Er steht nahe an der Straße und sieht die Autos an sich vorüberfahren. Er setzt sich. Weitere Autos brausen vorbei. Farbstreifen: grün blau schwarz. Dann fährt eins nicht vorbei. Es wird langsamer und steuert den Straßenrand direkt vor ihm an. Anfangs kann er es nicht deutlich erkennen, weil die Scheinwerfer ihn blenden. Dann hält es, und er sieht, dass es sich um einen Streifenwagen des Los Angeles County handelt. Ein Deputy Sheriff sitzt am Steuer, ein junger Mann mit hellbraunem Haar und einem Schnurrbart wie Errol Flynn. Er sieht Teddy an und fragt, ob alles in Ordnung sei.
»Ich glaube, ich habe gerade jemanden umgebracht«, sagt Teddy. Er sieht noch mal auf seine Hand. »Könnten Sie … könnten Sie ihm sagen, dass es mir leidtut?«
Fünf
1
Candice steht auf dem Parkplatz hinter dem Nachtclub, in dem sie arbeitet, an der Ecke Venice und Hauser, etwas nordwestlich von Sugar Hill. Hier wohnen die betuchten Neger. Sie sind nach und nach in diese Gegend gezogen und haben während der Großen Depression die Hypotheken klammer Ölbarone und entgleister Eisenbahnmagnaten übernommen. Die nördliche Grenze des Viertels, der Washington Boulevard, gilt immer noch als eine Art Äquatorlinie der Rassentrennung, südlich derer hauptsächlich Farbige wohnen. Der Nachtclub ist geschlossen, und es herrscht Stille. Stimmengewirr und Lachen, die hier vor Kurzem noch von ausgelassenem Leben und Treiben gezeugt hatten, sind nur noch trunkene Erinnerungen, und die Leuchtschrift – die normalerweise aus sechs Straßenblocks Entfernung in jeder Richtung zu sehen ist und dem Club seinen Namen Sugar Cube gibt – ist jetzt dunkel wie die Nacht. Bis auf zwei Autos ist der Parkplatz, auf dem Candice steht, leer. An einem lehnt sie, eine blonde Frau mit rot verschmierten Lippen, eingedrehten Locken und in einem Kleid, das bei Frauen in fast jedem anderen Beruf für einen Skandal gesorgt hätte.
Sie arbeitet als B-Girl, flirtet mit den Männern, animiert sie dazu, ihr gepanschte Drinks zu Höchstpreisen zu spendieren. Eine Hand auf dem Knie. Ein Kuss auf den Mundwinkel. Ein verführerischer Blick. Der Job ist manchmal schwierig. Du musst über blöde Witze lachen. Du darfst nicht zurückschrecken, wenn jemand eine Knoblauchfahne hat. Du kriegst grüne und blaue Zehen, weil ein paar ungeschickte Typen dir auf der Tanzfläche die Füße platt treten.
Und die Kerle grapschen dich an. Manchmal werden sie auch gewalttätig.
Mehr als einmal ist sie auf diesem Parkplatz von betrunkenen Typen belästigt worden, die auf das aus waren, was sie ihnen nicht geben wollte – auch nicht für Geld.
Männer sind Tiere. Du musst vor ihnen auf der Hut sein. Du musst sie heiß machen, sie hoffen lassen, dass sie vielleicht das bekommen, was sich unterm Rock versteckt, ohne sie je in dem Glauben zu wiegen, es sei ein Versprechen. Wenn du es zu weit kommen lässt, wird es gefährlich.
Die Tatsache, dass einige der Mädels tatsächlich ihren Preis haben, macht es nur schlimmer. Oben ist eine Garderobe, und es vergeht kaum ein Abend, ohne dass Candice mit ansieht, wie Männer am Schlips hinaufgezerrt werden wie gehorsame Welpen an ihren Leinen.
Nur ein einziges Mal konnte sie einen Angreifer nicht im Zaum halten. Auf diesem Parkplatz hier hatte er sie zerschunden und blutend zurückgelassen, nicht mehr als fünf Meter von der Stelle entfernt, an der sie jetzt steht, hatte ihr den gesamten Verdienst des Abends abgenommen, sie bespuckt und Fotze und Nutte genannt.
Anschließend sah sie zwei Wochen lang aus, als hätte sie mehrere Runden gegen Rocky Marciano durchgestanden, und obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten konnte, eine Auszeit zu nehmen, blieb sie zu Hause, bis die Prellungen verheilt waren. Als sie wieder zu Arbeit ging, erwies sich schon der Gedanke, nach draußen in die Dunkelheit zu gehen, als traumatisch. Allein brachte sie es nicht fertig. Am ersten Tag ihrer Rückkehr bemühte sie sich, stark zu sein und eine mutige Miene aufzusetzen, aber schon auf halbem Weg zum Auto fing sie zu zittern und zu weinen an. Sie konnte keinen weiteren Schritt in die Dunkelheit setzen, sondern stand nur wie gelähmt da, bis eines der anderen Mädchen sie sah und zu ihrem Auto brachte.
Es dauerte Monate, bis sie wieder allein nach hier draußen kommen konnte.
Sie ist jetzt vorsichtiger und achtsamer. Männer sind Tiere. Und sie hat einen Jungen aufzuziehen, einen Jungen, dessen Vater bereits auf und davon ist. Sie will nicht, dass er auch noch seine Mutter verliert. Sie möchte, dass ihm ein wenig Unschuld so lange wie möglich erhalten bleibt.
Sie zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug und sieht zur Hintertür des Sugar Cube. Vivian hatte gesagt, es würde nur eine Minute dauern, sie müsse nur schnell auf die Toilette, aber inzwischen ist es bestimmt eine Viertelstunde her, und Candice ist für die kühle Nachtluft nicht richtig angezogen.
Sie blickt hinauf zum Mond, der hinter einem Vorhang leichter Wolken schimmert, und merkt, dass sie langsam ärgerlich wird. Nicht etwa auf den Mond oder auf Vivian, sondern auf ihren Mann Neil, der wahrscheinlich in ihrem kleinen baufälligen Haus in Bunker Hill auf dem Sofa schläft. Wieder einmal hat er sie versetzt. Nach Feierabend – er leitet die Poststelle eines Bürogebäudes in der Innenstadt – springt er oft in eine Straßenbahn und fährt hierher zum Nachtclub, sagt hallo, ich wollte nur dein hübsches Gesicht sehen und bleib auch nur ein paar Minuten. Aber aus den Minuten werden Stunden, und wenn er endlich zur Tür hinausfindet, fahren die Straßenbahnen nicht mehr. Also, was macht er? Manchmal schnappt er sich ein Taxi, aber viel zu oft torkelt er zum Auto, fährt damit nach Hause, sackt aufs Sofa und schläft betrunken ein, ohne zu merken, dass er sie wieder einmal ohne fahrbaren Untersatz zurückgelassen hat. Das passiert mindestens einmal die Woche, gewöhnlich nach einem hektischen Samstagabend, wenn sie besonders müde ist, wenn ihre Füße sie umbringen, wenn sie einmal zu viel von einem Mistkerl angegrapscht worden ist und sich nichts anderes wünscht als die Geborgenheit in ihrem Bett.
Trotz seiner Fehler und der Art, wie er mit ihrem Sohn umspringt, liegt ihr etwas an Neil, aber manchmal möchte sie ihn einfach erwürgen. Er kann so gedankenlos sein, und sämtliche Entschuldigungen, die sie morgen hören wird, bedeuten ihr jetzt nichts und werden ihr auch morgen nicht viel bedeuten.
Endlich stößt Vivian die Hintertür auf und schwankt ihr über den Parkplatz entgegen. Sie sagt, es täte ihr leid, sie hätte aus Heath noch Geld leiern müssen.
»Geld wofür?«
»Leland hat vor ein paar Wochen was für ihn gemacht und mich gebeten, das Geld zu kassieren.«
Candice nickt, zieht noch einmal an ihrer Zigarette, bietet sie Vivian an. Die quetscht sie zwischen zwei Finger, saugt den letzten Rauch heraus und schnippt die Kippe auf den Asphalt. Beim Aufprall stieben orange Funken in die Höhe wie bei einem Miniaturfeuerwerk – präsentiert für Ameisen und Käfer. Dann wird es dunkel.
»Wo ist er eigentlich in letzter Zeit gewesen?«
»Leland?«
Sie nickt.
»Hatte letzte Woche einen Film, fünf volle Arbeitstage.«
»Ja?«
»Zwölf Stunden am Tag und das jeden Tag.«
»Und war’s eine Sprechrolle?«
»Diesmal nicht. Aber vielleicht bald. Kommt darauf an, wie man sich mit den Produzenten stellt. Hat weniger mit Talent zu tun als damit, die richtigen Leute zu kennen.Komm jetzt.« Candice zieht am Türgriff. »Sonst frier ich noch unten zu.«
Sie steigen ins Auto, und Vivian lässt den Motor an.
»Du musst wegen Neil was unternehmen. Echt mies, wie er dich andauernd versetzt.«
»Er meint es nicht so.«
»Wenn es nur einmal passiert wäre, könnte ich es glauben.«
Candice zuckt die Achseln. Vivian lenkt den Wagen vom Parkplatz und auf die Straße. Dabei dreht sie den Kopf zum Fenster auf der Beifahrerseite und blickt hinaus auf die Stadt. Ihr Atem lässt die Scheibe beschlagen.
Sie mag diesen Teil der Nacht. Die Bars haben geschlossen, und die Nachteulen sind nach Hause verschwunden, einschließlich der Mexikaner in ihren Zoot-Suits und der Jazzfans mit ihrem Negerslang. Aber noch ist es selbst für die ersten Frühaufsteher zu früh, ihre Vordertüren aufzustoßen. Die Stadt liegt still und stumm, geheimnisvoll wie ein Ei vor dem Schlüpfen. Man könnte fast vergessen, dass sie vor langer Zeit unterteilt und stückweise verkauft wurde. Man könnte fast vergessen, dass die Gauner in den Villen residieren und die ehrlichen Menschen in armseligen Verschlägen. Man könnte fast vergessen, dass überall gewaltsame Rassenunruhen wüten, von den Spielen der Hollywood Stars im Wrigley Field Stadion bis zu brennenden Kreuzen in den Gärten von Negern, die es wagten, Häuser in weißen Wohnvierteln zu kaufen. Man könnte fast vergessen, dass Gangster mit berühmten Filmstars dinieren und auf Zeitungsfotos grinsen, während anständige und schwer arbeitende Menschen namenlos ins Grab gehen.
ENDE DER LESEPROBE