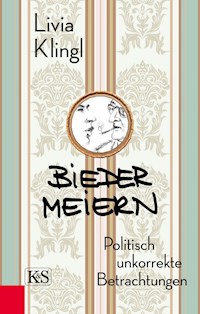Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Karl Schmied, 62, ist verliebt. In Sonja aus Moldawien. Weil die Zukunft verheißungsvoll ist, schaut der Boulevardjournalist und studierte Historiker auch in die Vergangenheit zurück. Aus kleinen Verhältnissen stammend, hat er etwas aus sich und seinem Leben gemacht. Mit vielen Veränderungen im Land ist er durchaus zufrieden, aber dass man keinen "Mohr im Hemd" mehr bestellen darf und gleichgeschlechtliche Paare jetzt auch noch heiraten wollen, geht ihm dann doch zu weit. EU, Migranten, Flüchtlinge, Roboterisierung, Social Media, die Krise der Politik und der Zeitungen: Karl Schmied sieht schwarz für die Zukunft. In seinem kleinen Kosmos fühlt er sich durchaus wohl. Bis zwei unerwartete Nachrichten sein sorgfältig zurechtgezimmertes Selbstbild krachend zum Einsturz bringen – worauf der vermeintlich Besonnene zu einem drastischen Mittel greift. Mit spitzer Feder und hintersinnigem Witz taucht Livia Klingl in ihrem ersten Roman tief in die österreichische Seele ein. Sie schickt Karl Schmied auf eine Reise durch das Gestern, das Heute und das zu erwartende Morgen und blickt hinter die Fassade eines Menschen, der wie so viele andere auch das Gefühl hat, aus dieser unberechenbaren Zeit gefallen zu sein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Livia Klingl
DER LÜGENPRESSER
Roman
www.kremayr-scheriau.at
eISBN 978-3-218-01118-1
Copyright © 2018 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus
Unter Verwendung einer Grafik von shutterstock.com/udra11
Satz und typografische Gestaltung: Sophie Gudenus
Für Ing. Oskar Hans Klingl, 1908–2000
Inhalt
Montag
IN DER FRÜH, ZU HAUSE IM BETT
Dienstag
MITTAGS, IM GRÜNEN PRATER
Mittwoch
AM FRÜHEN ABEND, IM GASTGARTEN
Donnerstag
AM SPÄTEN ABEND, ALLEIN AN DER THEKE IM GASTHAUS
Freitag
VORMITTAGS, IM REDAKTIONSBÜRO
AUF DER TOILETTE
IM REDAKTIONSBÜRO
IM BÜRO DES ONLINE-CHEFS
Montag
IN DER FRÜH, ZU HAUSE IM BETT
Niemals hätte ich mir das früher vorstellen können, aber jetzt weiß ich es. Das sind keine kitschigen, aber nie wahr werdenden Erzählungen aus Frauenromanen und ihren erst recht kitschigen Verfilmungen im deutschen Fernsehen, bei denen ich sofort wegschalten muss, weil dieses Gesülze hält ja kein Mensch aus. Jedenfalls kein Mann. Nein, das gibt es wirklich, dieses Ankommen, Sich-zu-Hause-Fühlen, diese beglückende Zweisamkeit, die Romantik, die Zärtlichkeit, dieses Einander-Wollen!
Ich erkenne mich kaum wieder! Dass ich einmal im Bett liegen und jemandem anderen am Kopfpolster nachspüren würde, noch einen Hauch vom Duft der anderen Person festhalten möchte, hätte ich nie im Leben von mir selber gedacht. Aber jetzt liege ich hier in den zernudelten Laken, auf denen wir die vergangenen Stunden verbracht haben, aneinandergekuschelt wie zwei schlafende Kätzchen.
Sonjas leicht vom Schweiß der Nacht verschwitzte Bettdecke habe ich an meinen Körper und zwischen meine Beine gepresst, meinen Kopf auf ihrem Polster, die Nase eingetaucht wie in ein Parfümflakon, damit ich noch die letzten Reste von ihr erschnüffeln kann von dort, wo eben noch ihr dichtes, lockiges Haar gelegen ist.
Der Spruch stimmt also doch, dass man Dinge loslassen, weglassen, aber vor allem zulassen muss. Zulassen, was für ein seltsam doppeldeutiger Begriff! Man kann das Herz zu lassen und damit nichts an sich heranlassen. Oder man kann etwas zulassen und damit das Herz öffnen, so wie mir das passiert ist. Diese deutsche Sprache mit ihren zehntausenden Wörtern hat schon seltsame Eigenheiten! Bei Zulassen ist mir das bisher nie aufgefallen, dass es das Öffnen und zugleich sein Gegenteil, das Verschließen bedeutet. Mein Lieblingsbeispiel für die Unlogik war ja immer „unwirsch“, eine Verneinung von etwas, das es in seiner Bejahung im Sprachgebrauch überhaupt nicht gibt. Im Duden gibt es „wirsch“ sehr wohl. Und es heißt absurderweise dasselbe wie unwirsch.
Sonja, was für ein schöner, warmer Name! Ich mag ihr Haar so sehr! Es ist immer gepflegt, ihre Locken glänzen wie poliert. Man will andauernd drüberfahren über diese kupferfarbene Mähne, sie in den Fingern halten, ihr Apfelshampoo riechen, sich in ihrem Haar verlieren wie überhaupt in der ganzen Frau. Wahrscheinlich gibt mir dieses Haar so sehr das Gefühl, als wäre ich endlich zu Hause, weil es mich in meine Kindheit zurückversetzt. Angeblich ist die ja prägend fürs ganze restliche Leben, besonders die Gerüche. Und der Geschmack von Essen. Und Musik natürlich auch.
Mit der Musik hatte ich Glück. Denn kaum war ich der Kindheit entwachsen, verdrängten die Beatles und die Stones dieses ländlich-liebliche österreichische Ziehharmonika- und Geigengesäusel und das Marschmusik-Umtata wenigstens aus dem damals sensationellen, neu gegründeten Radiosender Ö3. Das kann sich ja heute kein Mensch mehr vorstellen, was das für uns Junge bedeutet hat! Da hat sich ein Fenster zur Welt aufgetan in diesem muffigen Wien!
Für mich war Ö3 eine Erlösung, für die Mutter gar nicht. „Dreh die Negermusik leiser!“, hat sie mit fader Regelmäßigkeit in Richtung meines Zimmers gekeppelt, weil sie den „langhaaraten Engländern“ und all der anderen „Wumm-Wumm-Musik“ absolut nichts abgewinnen konnte. „Nur Wumm-Wumm!“, hat sie gesagt. „Und was soll das für ein Text sein, yeah, yeah, yellow submarine?“, hat sie die Pilzköpfe nachgeäfft und deren Refrain kritisiert, als wären die Refrains der deutschen Schlager zwingend sinnstiftender. Uns Jungen haben die Engländer gefallen. Für mich waren sie überhaupt das erste Zeichen, dass der alte Nachkriegsmief aus dem faden Österreich langsam verschwinden und sich neue, freiere Lebensweisen bis zu uns nach Wien-Landstraße durchschlagen würden.
Die Mutter ist eben ganz anders aufgewachsen, in einem Österreich, das es ja gar nicht gab. In der Ostmark haben sie die Leute mit patriotischem Zeug betrommelt und wenn es hoch herging mit Walzerklängen. Die „Lili Marleen“ mit ihrem für mich bis heute so berührenden „Vor der Laterne, vor dem großen Tor“, das die schöne Marlene Dietrich berühmt gemacht hat, hat die Mutter erst nach dem Krieg so richtig kennengelernt, mehr oder weniger zeitgleich mit mir. Weil die Lili Marleen galt unter den Nazis eine Zeit lang sogar als „wehrzersetzend“, das haben ja nur der Wehrmachtssender Belgrad und dann die alliierten Sender für die Soldaten gespielt, die voller Heimweh waren. Und solche Sender hat man bei meinen Großeltern nie gehört. Die waren zwar nicht gerade fanatische Nazis, aber Mitläufer waren sie schon, wie fast alle damals.
Von den Großeltern weiß ich so gut wie gar nichts. Der Opa war Uhrmacher. Der ist stets im Hinterzimmer von seinem kleinen Laden gesessen, mit einer Lupe aufs rechte Auge gepresst, und hat gekrümmt wie ein alter Ast Uhrwerke repariert. Geredet hat der nicht viel, schon gar nicht über die Politik oder die Kriegszeit. Die Oma war Hausfrau. Immer hatte sie so ein ärmelloses, geblümtes Hauskleid an. „Das schont das andere Gewand. Das bleibt dann länger gut“, hat sie gesagt und die Achseln gezuckt über die bescheidenen Verhältnisse, in denen sie leben musste. Sie war aus Böhmen, aber deutschsprachig, keine Tschechin. Geredet hat sie ansonsten kaum je, nur gelächelt, jedenfalls mich angelächelt. Und sie hat sehr gute böhmische Süßspeisen fabriziert. Mohnnudeln hat sie am liebsten gemacht und manchmal auch Milchreis mit Zimt obendrauf.
Zimt hat weihnachtliche Stimmung erzeugt. Wenn ich mir heute vorstelle, wie ich mich als Kind über die drei, vier Mandarinen zum Nikolo gefreut habe, das versteht ein junger Mensch ja gar nicht mehr! Das ganze Jahr über gab es keine Mandarinen oder Orangen und auch an Zitronen kann ich mich nicht erinnern. Nur im Advent hat es für uns Zitrusfrüchte gegeben. Die Mutter hat mir zum Nikolo immer ein rotes Sackerl hergerichtet, da waren Mandarinen drinnen, Erdnüsse und ein Schoko-Nikolo. Für uns Kinder waren das damals ganz tolle Geschenke. Wenn man das heutzutage einem Kind erzählen würde, das täte einen anschauen, als spräche man vom ärmsten Dorf in Afrika.
Die Lieblingssendung von der Mutter im Radio war der Heinz Conrads. „Griaß eich die Madln, servas die Buam“, ich hör’s bis heute, wie er damals jeden Sonntagmorgen die Hörer begrüßt hat. Dann den Kranken Mut zugesprochen und dann ging es los mit den raunzigen Heurigenliedern und den anderen Wienerliedern, wo es dauernd ums Sterben geht. Irgendwann hat mir ein Sprachforscher, ein sehr fähiger Autodidakt, erzählt, dass es in Wien 50 Wörter und Umschreibungen für den Tod gibt, so viele wie in keiner anderen Sprache. Von „er hat die Patschen g’streckt“ über „er schaut sich die Erdäpfel von unten an“ bis zu meinem absoluten Favoriten „er hat den 71er g’nommen“.
Als ich das neulich beim Kaffee den jüngeren Kollegen erzählt habe, haben die nur geschaut wie ein Autobus und nichts verstanden. „Na, was ist der 71er?“, habe ich um Antwort heischend gefragt. Aber es kam nichts. „Eine Straßenbahn! Und wo führt die hin, diese Straßenbahn?“ Große Augen haben’s gemacht. „Na? Zum Zentralfriedhof fährt diese Straßenbahn!“, habe ich selbst die Antwort gegeben, im Tonfall eines Lehrers für geistig Minderbemittelte. Komisch, was die Jungen alles nicht mehr wissen heutzutage. Jung und Alt verstehen einander nicht nur wegen des Altersunterschieds nicht, sondern auch wegen der schönen wienerischen Sprache, die ausstirbt, genauso wie die Wiener Kaffeehäuser, wo es eben nicht chillig, sondern gemütlich ist.
Beim Wort chillig gehe ich ja innerlich die Wände hoch. Was für ein dämliches Wort! Wie wohlig klingt doch faulenzen oder abschalten oder entspannen! Aber, um ehrlich zu sein, nicht alles ist so blödsinnig, was die Jungen mit der Sprache anstellen. Fernschimmeln, zum Beispiel, finde sogar ich witzig. Natürlich musste ich mir den Begriff erst erklären lassen von der Sally. Die mischt uns Alte ganz schön auf in der Zeitung mit ihren Ideen und ihrer Sicht auf die Welt und auch mit ihrem Neusprech. „Fernschimmeln, das ist, wenn du nicht in deinem üblichen Lokal abhängst, sondern anderswo“, hat sie mir erklärt und sich wie immer ein bisserl mokiert über mich alten Knochen. „Und abhängen tut nicht nur das Rindfleisch beim Fleischhauer, gell, sondern auch der Mensch. Capito?“
Vom Heinz Conrads hat die Sally sicher noch nie gehört. Ich war ja noch ein Bub, als der berühmt wurde, und ich kann mich erinnern, dass ich bei einem seiner ständig gesungenen Lieder, dem „Schuster Pockerl“, immer feuchte Augen gekriegt habe. Die Mutter auch. Der „Schuster Pockerl“ war wohl das Symbol schlechthin für diejenigen, die die Politiker heute die „kleinen Leute“ nennen. Arm und fleißig war er, der Pockerl. Auf seinem Schusterschemel hockend hat er unermüdlich auf die Schuhe gehämmert, die ihm die ärmliche Kundschaft gebracht hat, zum Sohlen Aufdoppeln. Der Schuster Pockerl hat nicht geraunzt, vom Leben nichts verlangt, er war ein fleißiger, bescheidener, stiller Mann. Und eines Tages hat er mit seinem Hammer das letzte Mal auf einen Schuh geklopft, ist von seinem Schemel gekippt und war tot.
Heutzutage sind die kleinen Leute nicht mehr stumm. Heute lassen sie sich nichts mehr gefallen, heute begehren sie auf. Jetzt haben wir die Wutbürger und die Schreihälse und die, die „denen da oben“, dem „Establishment“ und der „Hautevolee“ nichts mehr durchgehen lassen wollen. Ich finde das gut, dass sich die Leute nicht mehr wie Untertanen benehmen. Wir haben den alten österreichischen Bauernstaat abgeschüttelt. Aber jetzt schlägt das Pendel ein bisserl zu weit in die andere Richtung aus. Was die Leute fordern, ist manchmal schon besorgniserregend, jedenfalls für einen moderaten Menschen wie mich. Und für einen Historiker, wie ich einer bin, erst recht. Das richtige Maß ist in unserer Gesellschaft verloren gegangen. So etwas hat in früheren Zeiten noch nie zu etwas Gutem geführt.
Aber was geht es mich an? Mir geht es gut, richtig gut. Ich verdiene wirklich ordentlich. Ich habe die billige Wohnung von der Mutter, die ist fast zu groß für mich. Relativ ruhig ist sie auch, jedenfalls dann, wenn der Serbe von gegenüber nicht seine Frau niederbrüllt und die Araber im Erdgeschoß keine Gäste haben und herumschreien wie am Basar in Kairo. Wenigstens kann ihr kleiner Abdullah ordentlich Deutsch, wenn seine Eltern schon so kulturfremd angezogen sind mit ihren bodenlangen Gewändern und mit ihrem Glitzervorhang mit Rüschen vor dem Doppelfenster. Aber gut, das geht mich nichts an. Ich kann ja wegschauen, wenn mir der Geschmack von denen nicht passt.
Hach, wie gerne hätte ich die Sonja noch neben mir liegen! Dann würde ich an ihrem Haar riechen wie an einem teuren Parfüm. Wenn die Mutter ihre Haare frisch gewaschen hatte, dann habe ich mich immer gut gefühlt als Kind. Da war ein Gefühl der Geborgenheit da, ein Zuhausesein, geschützt in den eigenen vier Wänden. Geschützt vor dem oft doch einigermaßen bedrohlichen Draußen.
Richtige Badezimmer hatten damals die wenigsten, da gehörten wir schon zu den Privilegierten mit unserem von der Küche mit diesem leicht stinkigen Plastikvorhang abgetrennten Badezimmerchen mit Waschbecken und einer ordentlichen Wanne, nicht so einer Sitzbadewanne, in der man nur kauern konnte. Die meisten hatten damals in Wien gar kein Bad und oft nur ein Gangklo und man ist sich bei Eiseskälte oder nachts auf dem Weg zur Notdurft am Gang begegnet, das weiß ich aus Erzählungen von Leuten, denen es schlechter ging als uns. Wir hatten ein eigenes Klo, sogar mit Fenster auf den Gang, sodass man lüften konnte. Den Gang haben wir Balkon genannt. Eigentlich war er eine Pawlatschen, ein Gang vom Stiegenhaus zur Wohnung. Breit genug für einen Sessel, einen schmalen Tisch und ein paar Blumentöpfe.
In denen hatten wir im Sommer Petersilie, Schnittlauch und Tomaten. Es gab ja damals nicht viel, da war man mit den Erträgen vom Balkon schon sehr gut bedient. Ein frisches Schnittlauchbrot, das war eine Delikatesse.
Das Brot heutzutage ist ja nichts wert, jedenfalls nicht das aus dem Supermarkt. Keine Kruste, kein Geschmack, weich wie ein Schwamm, nach drei Tagen zum Wegschmeißen. Mit den Semmeln ist es noch viel ärger. Die sind schon weich wie das amerikanische Zeug für die Hamburger, noch ehe du aus dem Supermarkt draußen bist. Schon seltsam, da gibt es hunderttausend Hygieneregeln und Kontrollen in den Geschäften, aber das Zeug schmeckt immer öfter nach nichts. Tomaten schauen zwar großartig aus, aber mit geschlossenen Augen hat man keine Ahnung, was man da zu sich nimmt.
In unserem Haus gibt es bis heute in jedem Stockwerk eine Bassena. Aber die sind alle hinter Holzwänden versteckt, und verwendet hat die, seit ich denken kann, niemand mehr. Nicht einmal die Messerschleifer, die damals einmal im Monat gekommen sind, sich im Hof aufgepflanzt haben und „Messer, Scheren, Hacken, schleiiiiifen!“ gerufen haben. Dann sind die Leute hinunter in den Hof und haben alles schleifen lassen, was man schleifen lassen konnte. „Zigeuner sind das“, haben sie im Haus hinter dem Rücken der Messerschleifer getuschelt. „Da musst aufpassen wie ein Haftlmacher, dass nix wegkommt!“
Witzig, was einem alles einfällt, wenn man im Bett liegt und noch ein bisserl Zeit hat, ehe man raus muss. Manchmal sind auch Fremde in den Hof gekommen mit einem Leiterwagen und haben die Bewohner mit dem Ruf „Hadern!“ angelockt. Dann haben die Leute alles hinuntergebracht, was sie nicht mehr brauchen konnten, vor allem Hadern, also alte Kleider, aber auch Hausrat, meistens, wenn jemand gestorben war und eine Wohnung ausgemistet werden musste. Da kommt sicher das Schimpfwort Haderlump her, aber das kennt ja heute auch kaum noch jemand.
Ein normaler Haushalt hatte ja nichts zu verschenken und auch kaum je etwas wegzuwerfen, wir hatten ja wirklich nicht viel und auf das Wenige haben wir geachtet, bis es zerfallen ist. Es war alles irgendwie viel kostbarer als heute, sogar jeder Naturbesen und jedes Blechschauferl. War aber trotzdem eine schöne Zeit damals. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir irgendetwas wirklich abgegangen wäre, nicht einmal Taschengeld, denn das bekam ja sonst auch niemand, den ich damals gekannt habe.
Vielleicht sehe ich diese Zeit aber auch nur so rosarot, weil ich verliebt bin. Und weil es meine Kindheit und meine Jugendzeit war. Da ist man bald einmal zufrieden mit dem Leben. Da kennt man ja noch nichts anderes, kennt den Neid nicht und nicht diese schreckliche Eigenschaft des Menschen, nie zufrieden zu sein mit dem, was er hat. Das ist heute leider ganz anders. Da wissen schon Zweijährige, wie man mit der Fernbedienung umgeht und wischen mit ihren winzigen Fingern auf den Screens herum, als wären sie mit dem technischen Zeug auf die Welt gekommen, von dem man alle Augenblicke ein neues Modell braucht.
Und alle wollen das, oder fast alle. Nur ich nicht. Ich bleib’ bei meinem alten Handy, bis es den Geist aufgibt. Weil die Werbung mit ihren Verlockungen vom endlos neuen Glitzerklumpert prallt an mir ab, gegen die bin ich absolut immun. Warum sollte ich auch all den Schmarren kaufen, den die Wirtschaft erzeugt, nur damit sie neuen Schmarren erzeugen kann, den ich dann wieder kaufen muss, damit das Wirtschaftswerkl funktioniert? Nicht mit mir, ich bin ja kein Trottel!
Mit den neuen Handys können die mich ganz besonders gern haben, weil ich bin ja beinahe sozialtot. Auch dieses Wort habe ich von der Sally gelernt. „Sozialtot, Karl, bist du nicht ganz“, hat sie mir erst vor ein paar Tagen einen Hauch Moderne attestiert. „Weil du bist ja angemeldet auf Facebook und auf Twitter. Folglich bist du nicht sozialtot, sondern nur sozialstumm, sozusagen. Sozialtot bist du, wenn du die Social Media ganz verweigerst. Und du liest ja auf denen heimlich herum.“
Da fällt mir dieses Kind ein, das ich kürzlich im Museum gesehen habe. Das konnte kaum gehen, wurde vom Vater am Arm getragen und hat krähend auf ein Bild mit Segelbooten gezeigt. Als der Mann endlich hingegangen ist zu dem Gemälde, hat dieses winzige Kind mit seinem Zeigefinger herumgewischt, weil es offenbar dachte, es könnte die Boote verschieben. Ich habe nicht gewusst, ob ich lachen soll oder traurig sein darüber, dass ich in einer Wisch-und-weg-Gesellschaft gelandet bin. Am irrsten ist dieses Wisch-und-weg bei Tinder. Auch das habe ich natürlich durch die Sally kennengelernt. Sie hat mir diese Sex-Partnerbörse auf ihrem Handy gezeigt. „Schau, das geht ganz einfach: Wenn mir einer gefällt, wische ich nach rechts. Und wenn er mir nicht gefällt, nach links und schwupps, ist er im Nirwana gelandet.“ – „Und das findest du okay, jemanden einfach in den Mistkübel zu wischen?“, habe ich sie verdutzt gefragt. „Wieso nicht, der macht mit mir ja das Gleiche!“, hat sie lachend gesagt.
Bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr jung bin! Alle in meinem Alter, mit denen ich rede, sagen, sie hatten eigentlich eine schöne Kindheit. Aufgenähte Flecken auf den zerrissenen Hosen, keine Plastikspielsachen, kaum Kinderbücher, aber Holzlego, mit dem man Fantasieburgen gebaut hat mit den anderen Buben aus dem Haus und ein Gemeinschaftsgefühl hatten wir auch dabei, denn wir sind uns ja in echt gegenübergesessen und nicht nur als Foto auf dem kleinen Handybildschirm. Fad war uns nie.
Beim Fußball im Hof war ich immer ein bisserl patschert, da ist mir oft der Ball vor dem Fuß liegen geblieben und der Schlapfen ins Tor gedonnert. Da haben mich die anderen aufgezogen, aber eine Hetz war’s trotzdem. Heute gingen Eltern von so einem Kind gleich zum Kinderpsychologen, weil ihr hochbegabter Nachwuchs ausgelacht wurde und jetzt sicher ein Trauma fürs ganze Leben hat! Lauter kleine Egomanen-Waserln erzeugen diese Eltern. Wie würde ich der Sally Waserl erklären, weil dieses Wort würde sie hundertprozentig nicht verstehen, genausowenig wie die Sonja? Ängstliche Person heißt das wohl auf Hochdeutsch und Angsthaserl auf Wienerisch.
Jetzt ist die Wärme von der Sonja gänzlich aus dem Bett verschwunden, wie schade. Das verstehe ich nicht an der Sonja, dass sie so unglaublich penibel ist mit dem Aufstehen. „Um 6:30 Uhr muss ich raus“, sagt sie immer wie eine überkorrekte Deutsche, dabei ist sie doch aus Moldawien und nicht aus Preußen! „Du hast eine preußische Seele“, sage ich ihr dann. „So gründlich und genau wie eine Preußin!“ Was eine Preußin ist, wusste sie natürlich anfangs nicht. Aber dass die Deutschen gründlich sind, das hat sich bis in das kleine Moldawien herumgesprochen.
Wenn ich sage, „geh, bleib doch noch liegen“, dann wird sie fast ein bisserl grantig, löst sich aalglatt aus meiner Umarmung und weg ist sie.
Wenn die Mutter Haare gewaschen hatte, immer am Sonntagnachmittag, bin ich auf ihren Schoß geklettert und habe mit den nassen Strähnen gespielt, so lange, bis sie luftgetrocknet waren und die Mutter mich von sich gestoßen hat, weil so eine Kuschlerin war sie ja nicht. Dann hat sie sich diese strenge Aufsteckfrisur gemacht, die damals fast alle Frauen hatten, die ich vom Sehen gekannt habe. Dutt hat man gesagt. Den haben sich die Frauen selber machen können, da musste man nicht zur Friseurin.
Das hat sich nicht geändert, dass die jungen Mädels, für die das Gymnasium nichts gewesen wäre, Friseurin werden wollen. Da können sich die Behörden noch so bemühen, denen andere Berufe schmackhaft zu machen, vor allem so typische Männerberufe wie Mechaniker, die meisten Mädchen mit ohne Bildung werden noch immer Friseurin. Na ja, es dauert eben ein, zwei Generationen, bis gewisse eingefahrene Denkmuster überwunden sind, das weiß man ja als Historiker.
Coiffeur, Trottoir, all diese schönen alten Wörter sterben aus. Heute sagt man Gehsteig oder gleich Fuzo, weil die Fußgängerzonen nehmen überhand und abgekürzt wird auch alles, weil wir haben ja keine Zeit mehr heutzutage, nicht einmal mehr für längere Wörter. Und die Friseurinnen taufen ihre Läden Haircut oder Kopfwerk oder HairArt oder Hair Dreams, nur ja nicht Friseur, weil man will ja mit der Zeit gehen. Ich mag das nicht, dass nichts mehr so heißt, wie es einmal geheißen hat in unserer Sprache.
Manchmal verstehe ich nicht einmal mehr, was die Chefitäten in der Zeitung reden vor lauter Englisch-Neusprech. „Wir haben einen smarten Move gemacht“, hat unlängst so ein Management-Depp in der Redaktionsversammlung gesagt. Zuerst habe ich nicht einmal verstanden, dass das Englisch war! Dann hat er etwas von einem „activity-based workplace“ gefaselt, den sie in ein paar Jahren planen. Und dass sie das „Facility-Management outgesourct“ haben, hat er uns auch noch erzählt, als er eigentlich sagen wollte, wir haben jetzt eine Putzfirma engagiert, die ist billiger. Mittlerweile kenne ich diese Englisch-Schmähs, aber am Anfang war das eine Fremdsprache für mich. Nicht das Englische, mein Englisch ist ja ganz passabel, sondern seine vertrottelte Invasion ins Deutsche.
Seit das Facility-Dings ausgesourct wurde, tummelt sich der Lurch zwar unter den Bücherregalen, aber das ist der Chefetage wurscht, die surft auf der Welle des economical success. „Wir müssen da auch succeeden“, sagt der Online-Chef alle Augenblicke, der grundsätzlich sehr genau auf seine Work-Life-Balance achtet und aktiv recht wenig beiträgt zum success der Zeitung. Der alte Chefredakteur hat wenigstens den guten, alten amerikanischen Spruch drauf: „Nothing succeeds but success!“ Und das stimmt auch. Erfolg macht erfolgreich. Heute mehr denn je.
Aber der Onliner ist eben ein Trottel! Trottel sagt man ja auch nicht mehr, das heißt jetzt Person mit Teilleistungsschwäche. Oder mit ohne Intelligenzhintergrund. Und die, die nichts verstehen, die sind jetzt die bildungsferne Schicht. Ich sag’ noch immer Proleten, aber da wird man heutzutage gleich schief angeschaut, wenn man etwas beim Namen nennt. Die Personen mit ohne Intelligenzhintergrund, die jede Schule geschmissen haben und Kinder produzieren mit Berufswunsch AMS, die werden uns, die wir noch etwas gelernt haben, noch überrollen wie die Flüchtlingswelle.
Bei allem Verständnis für die einfachen Leute mit ihrem berechtigten Ärger über viele Dinge, die nicht gut laufen in der Politik und in der Gesellschaft, weil die sind ja meine Hauptkundschaft: Aber wenn ein Drittel der Österreicher in einer Umfrage angibt, sie könnten auch Kanzler, da fragt man sich schon, ob die wo angedonnert sind! Die würden ja nicht einmal physisch das Tagespensum derschnaufen, das diese Politiker haben. Das weiß ich sehr gut, ich habe oft genug Politiker begleitet. Und man mag sie für alles Mögliche halten, aber Kondition haben sie! Und ein gutes Gedächtnis auch. Allein, wen die aller erkennen können müssen, auf der Straße, im Restaurant, auf ihren Versammlungen. Das könnte ich nicht. Aber ich bilde mir eben auch nicht ein, ich könnte mal einfach so Minister.
In Amerika und in England kann man sich schon anschauen, was herauskommt, wenn die Deppen die Demokratie, jedenfalls die Wahlurne entdecken und ihre eigene Wut zum Maßstab nehmen. Mein Gott, früher war Amerika das gelobte Land für uns und wir haben ungeduldig gewartet, dass die Erfindungen von dort endlich zu uns kommen. Fünf Jahre später, das wusste man dann auch bald einmal, waren sie in Österreich. Mit den Blue Jeans hat es angefangen. So eine musste man einfach haben! „Arbeiterg’wand!“ hat die Mutter den Kopf geschüttelt, als ich sie um so eine Hose angebettelt habe. „Wieso zieht ihr euch ein Arbeiterg’wand an und glaubt’s, das wäre schick?!“
Nach Amerika wollte damals niemand von uns, das erschien uns utopisch weit weg. Aber nach England wollten wir alle, schon allein wegen der Beatles und wegen der Leichtigkeit des Lebens von den Hippies, die sich einfach nichts mehr gepfiffen haben um Kleiderordnung und Haarschnitt und alles Klassische, von den Manieren bis zur Musik. Einmal im Hyde Park stehen, am Speakers’ Corner, und die eigene Meinung in die Welt hinausposaunen, das war ein Traum von mir. Und was ist heute? Kein Mensch braucht mehr eine Ecke im Park! Heute schnappt man sich das Handy und rülpst seine Meinung in die Welt, noch ehe man sie sich gebildet hat.
Und was ist heute mit England? Heute flüchten die Leute von der Insel, nur weil die Mehrheit auf die Lügen von ein paar ordentlichen Lügenbaronen in der Politik hereingefallen ist. Wir auf dem Festland sind das, was Großbritannien immer über uns gesagt hat: Europe. Und sie werden „die Insel“. Die werden sich noch wundern, wenn sie draufkommen, dass die einzige Insel der Seligen unser Österreich war, all diejenigen, die den Populisten und dem Boulevard auf den Leim gegangen sind! Man muss sich als Journalist leider auch eingestehen, dass die Rolle der Medien bei der Hysterie um die EU keine gute war. Aber wir in Österreich haben ja zum Glück nicht so furchtbare Medien wie die in Großbritannien. Selbst wir vom Boulevard sind in Wahrheit seriös, auch wenn wir vielleicht bei den Headlines manchmal ein bisserl zu weit gehen nach meinem Geschmack.
Wir zum Beispiel haben damals sogar wochenlang für die EU kampagnisiert, vor dem Beitritt im 1994er-Jahr. Unsere Chefetage wusste genau, dass das gut für die Wirtschaft ist und dass sie mitnaschen werden am ökonomischen Erfolg, wenn Österreich in dem Verein Mitglied wird. Es war nicht zuletzt unserer Zeitung zu verdanken, dass zwei Drittel der Österreicher in die EU wollten. Also damals war es genau genommen noch die EG, die Europäische Gemeinschaft.
Nicht einmal unser österreichischer Brüllboulevard ist so niveaulos wie das, was sich in England Newspaper nennt. Diese Medien haben die Engländer deppert gemacht, das waren nicht nur Politiker mit irren Frisuren und ebensolchem Blick. Da bin ich schon sehr froh, dass meine Zeitung ihr Niveau hält. Wir sind ein seriöses Boulevardblatt. Am Boulevard ist ja nichts Schlechtes, es muss auch Zeitungen geben, die die einfachen Menschen verstehen. Seriös kann man ja trotzdem sein.
In Amerika sitzt jetzt einer im Weißen Haus, der hätte früher nicht einmal Portier werden können im Allerheiligsten der Macht. Ein Oberproll mit seiner Proll-Sprache und seiner chirurgisierten Frau, diesem Jugo-Import, hat die Amerikaner wucki gemacht. Wenn ich mich erinnere, was das für eine Diskussion war, als sich der Bill Clinton ohne Sakko im Oval Office hat fotografieren lassen! Ja, das geht doch nicht, der entweiht doch das Allerheiligste, hat der Chefredakteur entsetzt gesagt. Ohne Sakko im Oval Office! Und sogar recht fortschrittliche Kollegen haben damals aufgejault beim hemdsärmeligen Clinton. Wobei: Entweiht hat der das Oval Office später schon, mit der dicken Praktikantin, aber bitte. „Oral Office“ haben wir’s dann getauft, aber natürlich nur unter uns Journalisten. Geschrieben hätten wir das nie, hätten ja auch nicht so wahnsinnig viele unserer Leser verstanden, und außerdem wäre es damals, in der Clinton-Ära, noch viel zu despektierlich gewesen. Heute gibt es ja vor nichts und niemandem mehr Respekt. Nicht einmal vor den Funktionen, wenn schon nicht vor den Leuten, die sie innehaben.