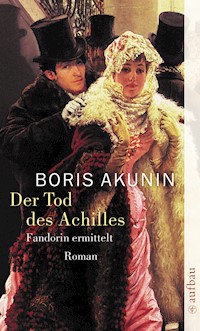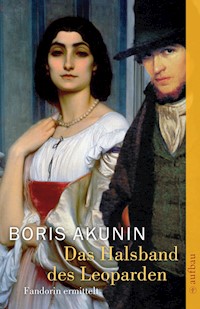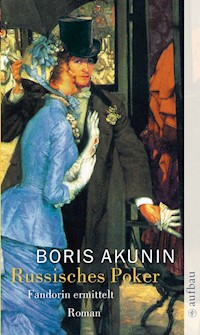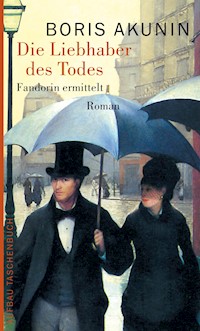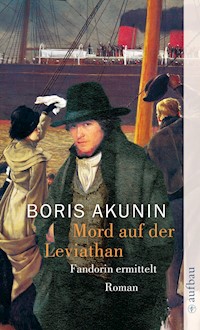Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fandorin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Fandorin ermittelt im Selbstmörder-Club
Moskau 1900: Die schöne Colombina trägt eine lebende Natter um den Hals und schreibt blumige Gedichte. Die Sehnsucht nach einem Leben voller Leidenschaft hat sie nach Moskau geführt. Bald schon ist sie die Geliebte von Prospero, der einem geheimen Club von Todesanbetern vorsteht. Einer nach dem anderen folgt hier dem Ruf ins Jenseits und begeht Selbstmord. Doch wollten all diese jungen Menschen wirklich sterben? Ein Mann, der sich Prinz Gendsi nennt und einen japanischen Diener hat, erscheint im Club und stellt seltsame Fragen.
»Boris Akunin ist der Meister der Russischen Kriminalautoren. Ich habe jeden seiner Romane verschlungen.«Wladimir Kaminer
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Boris Akunin
Der Magier von Moskau
Fandorin ermittelt
Roman
Aus dem Russischen von Renate und Thomas Reschke
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
Любовница смерти
erschien 2001 bei Sacharow-AST, Moskau.
Nachdichtungen von Katja Lebedewa
ISBN 978-3-8412-0162-1
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© B. Akunin 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Dagmar &Torsten Lemme, Berlin
unter Verwendung der Gemälde »Der Student«, 1881,
von Nikolai Alexandrowitsch Jaroschenko und
»Moskauer Hof«, 1878, von Wassili Polenow
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
ERSTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
ZWEITES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
DRITTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
VIERTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
FÜNFTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
SECHSTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
3. Aus dem Ordner »Agentenmeldungen«
ERSTES KAPITEL
1. Aus Zeitungen
DIE AUFOPFERUNG DES VIERBEINIGEN FREUNDES
Gestern gegen drei Uhr nachts wurden die Bewohner eines Mietshauses der Gesellschaft »Goliath« in der Semjonowskaja-Straße vom lauten Aufschlag eines schweren Gegenstands und einem nachfolgenden durchdringenden Geheul aus dem Schlaf gerissen. Es kam von dem Pointer des Photographen S., der das Dachatelier innehatte. Der auf den Lärm herausgeeilte Hausmeister blickte nach oben und sah das erleuchtete Fenster, wo der Hund stand und herzzerreißend jaulte. Im nächsten Moment entdeckte der Hausmeister auf dem Pflaster den reglosen Körper von S., dessen Sturz offenbar den Lärm ausgelöst hatte. Vor den Augen des bestürzten Hausmeisters sprang der Pointer plötzlich herunter und schlug unweit des Leichnams seines Herrn auf.
Es gibt zahlreiche Legenden über die Hundetreue, aber eine Aufopferung, die den Selbsterhaltungstrieb überwindet und den Tod verachtet, kommt bei unseren vierbeinigen Freunden doch höchst selten vor. Und noch seltener Selbstmord.
Die Polizei vermutete zunächst, daß S., bekannt für seine liederliche und nicht immer nüchterne Lebensweise, zufällig aus dem Fenster gefallen wäre, doch eine in der Wohnung gefundene Mitteilung in Gedichtform machte deutlich, daß der Photograph Hand an sich gelegt hatte. Die Beweggründe für diesen Verzweiflungsschritt sind unklar. Nachbarn und Bekannte von S. sagten aus, daß er keinerlei Anlaß gehabt habe, seinem Leben ein Ende zu setzen, im Gegenteil, er sei in den letzten Tagen in bester Stimmung gewesen.»Moskauer Kurier« vom 4. (17.) August 1900, S. 6
L. S.
DAS GEHEIMNIS DES VERHÄNGNISVOLLEN GELAGES GELÜFTET
Unglaubliche Einzelheiten des tragischen Vorfalls in der Furmanny-Gasse
Wie bereits vor drei Tagen gemeldet, nahm die Geburtstagsfeier, zu der der Gymnasiallehrer Soimonow vier Arbeitskollegen eingeladen hatte, ein höchst betrübliches Ende. Der Hausherr und seine Gäste wurden am gedeckten Tisch leblos aufgefunden. Die Obduktion der Leichen ergab, daß die Todesursache bei allen fünf Personen Portwein der Marke Castello war, der eine ungeheuerliche Dosis Arsen enthielt. Diese Nachricht bewegte die ganze Stadt, und in den Weinhandlungen ging die Nachfrage nach dem genannten Wein, der zuvor bei den Moskowitern beliebt gewesen war, auf Null zurück. Die Polizei leitete eine Ermittlung gegen die Abfüllfirma der Gebrüder Stamm ein, die den Castello an die Weinhandlungen ausgeliefert hatte.
Aber heute steht fest, daß dem geschätzten Getränk nichts vorzuwerfen ist. In der Tasche von Soimonows Gehrock fand sich ein Zettel folgenden Inhalts:
Abschiedsgedicht
Ohne Liebe ist kein Leben!
Wachsam ständig acht zu geben,
Zwanghaft lächelnd sich zu plagen,
Muß ich nun nicht mehr ertragen.
Schluß, ihr Spötter könnt nun gehen,
Hattet Spaß, es ist geschehen.
Helft dem jungen Bräutigam,
Seine Trauung naht heran.
Stehe an dem offnen Grabe
Ruf sie, die mit dunkler Gabe
Zeigte mir der Liebe Sinn:
»Wie die Blume nimm mich hin!«
Der Sinn dieses Abschiedsgedichts ist dunkel, doch wird deutlich, daß Soimonow vorsätzlich aus dem Leben ging und das Gift selbst in die Flasche schüttete. Das Motiv für die Wahnsinnstat ist unverständlich. Der Selbstmörder war ein verschlossener und verschrobener Mensch, zeigte jedoch keinerlei Anzeichen eines seelischen Leidens. Wie Ihrem gehorsamen Diener zu ermitteln gelang, war der Verewigte im Gymnasium nicht beliebt: Bei den Schülern galt er als strenger und langweiliger Lehrer, die Kollegen warfen ihm Hochmut und Galligkeit vor, und manche bespöttelten auch sein sonderbares Benehmen und seinen krankhaften Geiz. Aber all das reicht nicht aus als Beweggrund für eine so aberwitzige Handlungsweise.
Soimonow besaß weder Familie noch Dienerschaft. Nach der Aussage seiner Vermieterin, Frau G., ging er abends häufig aus und kehrte erst lange nach Mitternacht zurück. Unter seinen Papieren fanden sich zahlreiche Rohentwürfe für Gedichte düstersten Inhalts. Keiner seiner Arbeitskollegen hatte gewußt, daß er Gedichte schrieb, und als sie über die poetischen Versuche dieses »Menschen im Futteral«1 unterrichtet wurden, weigerten sie sich gar, das zu glauben.
Die Einladung zum Geburtstag, der so entsetzlich endete, kam für die Gymnasiallehrer gänzlich überraschend. Nie zuvor hatte Soimonow Gäste zu sich gebeten, und auf einmal hatte er ausgerechnet die vier Kollegen eingeladen, die er am wenigsten leiden konnte und die ihn, wie viele bezeugten, am meisten verspottet hatten. Die Unglücklichen hatten eingewilligt, da sie annahmen, daß Soimonow sich endlich mit ihnen aussöhnen wollte, und überdies (wie der Gymnasialinspektor Serdobolin sich ausdrückte) »aus schierer Neugier«, denn noch keiner hatte den Misanthropen je in seiner Wohnung aufgesucht. Wohin diese Neugier führte, ist bekannt.
Es liegt auf der Hand, daß der Giftmischer dem Teufel nicht nur sein zuwider gewordenes Leben hat darbringen wollen, sondern auch das seiner »Spötter«. Aber was bedeuten die Worte über diejenige, die »zeigte mir der Liebe Sinn«? Steckt hinter der makabren Geschichte womöglich eine Frau?»Moskauer Kurier« vom 11. (14.) August 1900, S. 2
L. Shemailo
SELBSTMÖRDERKLUB IN MOSKAU?
Unser Korrespondent ermittelt auf eigene Faust und äußert eine furchtbare Vermutung!
Geklärt sind nunmehr die Umstände des Doppelselbstmords, der ganz Moskau erschütterte. Romeo und Julia unserer Tage – das sind der 22-jährige Student Sergej Schutow und die 19-jährige Kursistin Jewdokia Lamm (s. insbesondere unseren Artikel »Eine traurigere Geschichte gibt es nicht« vom 16. August). Die Zeitungen meldeten, daß die Verliebten gleichzeitig, wohl auf ein Signal, mit Pistolen aufeinander geschossen hatten. Dabei wurde die junge Lamm tödlich getroffen, Schutow hingegen erlitt in Herznähe eine schwere Verwundung und wurde ins Marienspital gebracht. Er war bei vollem Bewußtsein, beantwortete jedoch keine Fragen und sagte nur immer wieder: »Warum? Warum? Warum?« Unmittelbar vor seinem Tod lächelte er plötzlich und sagte leise: »Ich gehe, also liebt sie mich.« Die sentimentalen Reporter sahen in der blutigen Geschichte ein romantisches Liebesdrama, doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß es hier überhaupt nicht um Liebe geht. Jedenfalls nicht um Liebe zwischen den Beteiligten der Tragödie.
Ihr gehorsamer Diener konnte ermitteln, daß die beiden jungen Menschen, wenn sie denn eheliche Bande angestrebt hätten, durch nichts behindert worden wären. Die Eltern von Fräulein Lamm sind moderne Menschen. Ihr Vater ist Professor an der Moskauer Universität und in Studentenkreisen bekannt für seine fortschrittlichen Ansichten. Nach seinen Worten würde er sich niemals dem Glück seiner vergötterten Tochter widersetzt haben. Schutow wiederum war volljährig und besaß ein wenn auch nicht großes, so doch für ein sorgenfreies Dasein ausreichendes Kapital. Das Paar hätte also ohne weiteres heiraten können! Weshalb schossen sie sich gegenseitig in die Brust?
Diese Überlegung ließ uns Tag und Nacht keine Ruhe und bewog uns zu einigen Nachforschungen. Dabei stellte sich etwas höchst Sonderbares heraus. Gute Bekannte der beiden Selbstmörder versicherten übereinstimmend, daß Lamm und Schutow lediglich befreundet gewesen seien und keinerlei leidenschaftliche Gefühle füreinander gehegt hätten.
Nun ja, dachten wir, Bekannte sind oft blind. Vielleicht hatten die jungen Leute ja Gründe, ihre Leidenschaft geheimzuhalten.
Aber heute fiel uns (fragen Sie nicht, wie, das ist Journalistengeheimnis) ein Gedicht in die Hand, das die Selbstmörder vor ihren tödlichen Schüssen zu Papier brachten. Das poetische Werk ist höchst ungewöhnlich und vielleicht sogar einzigartig. Es ist mit zwei Handschriften geschrieben – offenbar haben Schutow und Lamm abwechselnd je eine Zeile verfaßt. Somit haben wir eine kollektive Schöpfung vor uns. Der Inhalt zwingt uns, sowohl den Tod von Romeo und Julia als auch die Selbstmordserie der letzten Wochen in Moskau völlig neu zu sehen.
Er erschien ganz in Weiß. Er stand dort auf der Schwelle.
Er erschien ganz in Weiß. Durch das Fenster sah er.
»Liebesbote bin ich. Zu dir schickte Sie mich.«
»Seine Braut wirst du sein. Dich zu holen, kam ich.«
Sagte er dann und reichte die Hände mir her.
Sagte er dann. Die Stimme klang rein und so tief!
Seine Augen warn schwarz, und sie schauten so hart.
Seine Augen warn hell, und sie schauten so zart.
Und ich sprach: »Bin bereit. Warte lang schon auf dich.«
Und ich sprach: »Gleich komm ich. Überbring: Gleich komm ich.«
Rätsel über Rätsel. Was bedeutet »ganz in Weiß«? Von wem kam der Bote – von Ihr oder Ihm? Wo stand er – auf der Schwelle oder am Fenster? Und was für Augen hatte der geheimnisvolle Herr denn nun – schwarze und harte oder helle und zarte?
Hier erinnerten wir uns an die kürzlich verübten und scheinbar ebenso grundlosen Selbstmorde des Photographen Swiridow (s. unsere Notiz vom 4. August) und des Lehrers Soimonow (s. unsere Beiträge vom 8. und vom 11. August).
In beiden Fällen war ein Abschiedsgedicht vorhanden, was in unserem prosaischen Rußland, wie Sie mir beipflichten werden, nicht eben häufig vorkommt!
Bedauerlich, daß die Polizei nicht die Abschiedszeilen des Photographen Swiridow aufgehoben hat, doch es gibt auch so reichlich Stoff für Überlegungen und Mutmaßungen.
In dem Abschiedsgedicht Soimonows wird eine geheimnisvolle Person erwähnt, die dem Giftmischer »zeigte der Liebe Sinn« und ihn dann »hinnehmen« sollte »wie die Blume«. Zu Schutow kam ein Liebesbote von Ihr, einer ungenannten Person weiblichen Geschlechts, und zu Lamm ein Bote des Bräutigams.
Liegt es nicht nahe, anzunehmen, daß die liebreiche Person in den Gedichten der drei Selbstmörder der Tod selber ist? Dann wird vieles klar: Die Leidenschaft, welche die Liebenden nicht ins Leben, sondern ins Grab stößt, ist die Liebe zum Tod.
Ihr gehorsamer Diener hat keinen Zweifel mehr daran, daß sich in Moskau nach dem Beispiel etlicher europäischer Städte eine Geheimgesellschaft von Todesanbetern gebildet hat, Wahnsinnigen, die in den Tod verliebt sind. Der Geist von Unglauben und Nihilismus, die Krise von Sittlichkeit und Kunst, noch mehr aber der gefährliche Dämon, dessen Name Ende des Jahrhunderts lautet – das sind die Bazillen, die das tödliche Übel hervorgebracht haben.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, soviel wie möglich über die Geschichte rätselhafter Gesellschaften, sogenannter Selbstmörderklubs, herauszufinden. Folgende Informationen konnten wir zusammentragen.
Selbstmörderklubs sind keine rein russische, ja, überhaupt keine russische Erscheinung. Bislang hat es solche ungeheuerlichen Organisationen in den Grenzen unseres Imperiums nicht gegeben. Aber da wir Europa auf dem Weg des »Fortschritts« folgen, kommen wir offenbar auch nicht an dieser verderblichen Mode vorbei.
Die erste historische Erwähnung einer freiwilligen Vereinigung von Todesanbetern geht zurück auf das erste Jahrhundert vor Christus; damals gründete das legendäre Liebespaar Antonius und Kleopatra die »Akademie der im Tode Unzertrennlichen« – für Liebende, die »gemeinsam sterben wollten: still, freudig und zum gewünschten Zeitpunkt«. Dieses romantische Vorhaben endete bekanntlich nicht so idyllisch, da es die große Königin im entscheidenden Moment vorzog, sich von dem besiegten Antonius zu trennen und ihr Leben zu retten. Als sich dann aber zeigte, daß ihre hochgepriesenen Reize auf den kühlen Octavian keine Wirkung hatten, legte Kleopatra doch noch Hand an sich, wobei sie mit Bedacht und Geschmack zu Werke ging, ganz im Stil der Antike: Lange suchte sie nach der besten Methode, sich zu töten, erprobte an Sklaven und Verbrechern alle möglichen Gifte und entschied sich schließlich für den Biß der ägyptischen Kobra, der fast keine unangenehmen Empfindungen zur Folge hat, abgesehen von leichtem Kopfschmerz, der sehr bald abgelöst wird von »unüberwindlicher Todessehnsucht«.
Das ist eine Legende, werden Sie sagen, zumindest aber ein uralter Hut. Für solche »Akademien« ist der moderne Mensch doch viel zu irdisch und materialistisch eingestellt und klammert sich viel zu sehr ans Leben.
Nun denn, betrachten wir das aufgeklärte 19. Jahrhundert. Gerade in ihm florierten Klubs von Selbstmördern, Menschen, die sich in Geheimorganisationen zusammenschlossen zu dem einzigen Zweck, ohne großes Aufsehen aus dem Leben zu scheiden.
Schon 1802 entstand in dem gottlosen Paris nach der Revolution ein Klub mit 12 Mitgliedern, deren Zusammensetzung sich begreiflicherweise ständig erneuerte. Laut Statut wurde die Reihenfolge des Hinscheidens durch das Kartenspiel ermittelt. Zu Beginn jedes neuen Jahres wurde ein Vorsitzender gewählt, der verpflichtet war, sich noch vor Ablauf seiner Vollmachten zu töten.
1816 entstand in Berlin ein »Todeszirkel«. Seine sechs Mitglieder machten keinen Hehl aus ihren Absichten, im Gegenteil, sie bemühten sich nach Kräften, weitere Mitglieder zu gewinnen. Als legitim galt nur der Selbstmord mit der Pistole. Schließlich hörte der »Todeszirkel« auf zu bestehen, da sich alle seine Mitglieder erschossen hatten.
Später waren Selbstmörderklubs nicht mehr exotisch, sondern nachgerade ein Attribut europäischer Großstädte. Freilich zwang strafrechtliche Verfolgung diese Vereinigungen zu strenger Konspiration. Nach unseren Informationen gab es (und gibt es vielleicht noch) »Selbstmörderklubs« in London, Wien, Brüssel, in Paris, Berlin und sogar in dem provinziellen Bukarest, wo das »russische Roulette« als modisches Vergnügen reicher junger Offiziere gilt.
Den größten Ruhm genoß der Londoner Klub, der jedoch von der Polizei aufgespürt und zerschlagen wurde, nachdem er zwei Dutzend seiner Mitglieder dazu verholfen hatte, sich ins Jenseits zu befördern. Die Entlarvung der Todesanbeter gelang nur durch Verrat. Einer der Anwärter hatte die Unvorsichtigkeit begangen, sich zu verlieben, was zur Folge hatte, daß er brennende Zuneigung zum Leben und grimmige Abneigung gegen den Tod faßte. Dieser Abtrünnige fand sich bereit auszusagen. Dabei kam heraus, daß der streng geheime Klub lediglich Mitglieder zuließ, die es mit ihrem Entschluß nachweislich ernst meinten. Die Reihenfolge wurde durch das Los entschieden: Man spielte Karten, und der Gewinner erhielt das Recht, als erster zu sterben. Alle gratulierten ihm und veranstalteten zu Ehren des »Glückspilzes« ein Bankett. Der Tod wurde, um unerwünschte Gerüchte zu vermeiden, als Unglücksfall getarnt, an dessen Organisierung sich die übrigen Mitglieder der Bruderschaft beteiligten: Sie ließen einen Ziegel vom Dach fallen, überfuhren den Auserwählten mit der Kutsche und dergleichen.
Etwas Ähnliches trug sich im österreichisch-ungarischen Sarajewo zu. Dort gab es eine Selbstmörderorganisation, die sich »Klub der Wissenden« nannte und mindestens 50 Mitglieder zählte. Sie pflegten sich abends zu versammeln, um das Los zu ziehen – jeweils eine Karte, bis das Todesblatt kam. Wer die verhängnisvolle Karte gezogen hatte, mußte binnen 24 Stunden sterben. Ein junger Ungar verkündete seinen Kameraden, er scheide aus dem Spiel aus, denn er habe sich verliebt und wolle heiraten. Sie willigten nur unter der Bedingung ein, daß er noch einmal an der Verlosung teilnehme. In der ersten Runde zog der junge Mann das Herz-As, das Symbol der Liebe, doch in der zweiten das Todesblatt. Er war ein Mann von Ehre und erschoß sich. Die untröstliche Braut zeigte die »Wissenden« bei der Polizei an, und so gelangte die traurige Geschichte an die Öffentlichkeit.
Wie die Vorgänge der letzten Wochen in Moskau deutlich machen, scheuen unsere Todesanbeter die öffentliche Meinung nicht, jedenfalls treffen sie keine Maßnahmen, um ihr Wirken zu kaschieren.
Ich verspreche den Lesern des »Kuriers«, daß die Untersuchung weitergeht. Wenn sich in unserer Metropole tatsächlich eine geheime Liga von Wahnsinnigen etabliert hat, die mit dem Tode spielen, muß die Öffentlichkeit das erfahren.
Lawr Shemailo
»Moskauer Kurier« vom 22. August (4. September) 1900, S. 1, Forts. S. 4
2. Aus dem Tagebuch von Colombina
Sie traf an einem stillen fliederblauen Abend in der STADT DER TRÄUME ein
Alles war beizeiten bis ins kleinste bedacht worden.
Als Marja auf dem Rjasaner Bahnhof aus dem Irkutsker Zug gestiegen war, blieb sie einen Moment stehen, kniff die Augen zu und sog den Geruch von Moskau ein – es roch nach Blumen, Schmieröl, Kringeln. Dann öffnete sie die Augen und deklamierte so laut, daß es den Bahnsteig entlangschallte, den Vierzeiler, den sie drei Tage zuvor geschrieben hatte, als der Zug die Grenze zwischen Asien und Europa überquerte.
In der Tiefe schäumendes Gähnen
Zertrümmert im Schiffsunglück
Ohne Worte, Bedauern und Tränen
Im Fallen, im Flug – kein Zurück!
Nach dem tönenden Fräulein mit dem dicken Zopf drehte man sich um, neugierig oder mißbilligend, und ein kleiner Kaufmann tippte sich gar mit dem Finger an die Schläfe. Gleichwohl darf Maschas erste öffentliche Aktion im Leben, wenn es auch nur eine winzige war, als gelungen gelten. Warten Sie ab, was noch kommt.
Die Handlung war symbolisch, mit ihr begann eine neue Epoche, die riskant und rigoros war.
Abgereist war sie in aller Stille, ohne jede Öffentlichkeit. Für Papa und Mama hatte sie auf dem Tisch im Salon einen überlangen Brief zurückgelassen. Darin versuchte sie alles zu erklären – das neue Jahrhundert, die Unmöglichkeit ihres Dahinvegetierens in Irkutsk, die Poesie. Die Blätter waren mit ihren Tränen beträufelt, doch die Eltern würden es nicht verstehen. Wäre Mascha einen Monat eher geflohen, vor ihrem Geburtstag, so wären sie zur Polizei gelaufen, um die entwichene Tochter mit Gewalt zurückholen zu lassen. Nun aber hatte Marja Iwanowna Mironowa die Volljährigkeit erreicht und konnte ihr Leben nach eigenem Gutdünken gestalten. Auch über ihr Erbe, das die Tante ihr vermacht hatte, durfte sie nun frei verfügen. Das Kapital war nicht groß, nur fünfhundert Rubel, doch für ein halbes Jahr reichte es selbst in dem bekanntermaßen kostspieligen Moskau, und für eine längere Frist vorauszuplanen war abgeschmackt und phantasielos.
Sie nannte dem Kutscher das Hotel »Elysium«, von dem sie schon in Irkutsk gehört und dessen quecksilbrig perlender Name sie bezaubert hatte.
Während der Fahrt blickte sie immerzu auf die großen Steinhäuser und auf die Ladenschilder und fürchtete sich schrecklich. Die Stadt war riesig, eine Million Einwohner, und keiner von ihnen, kein einziger, interessierte sich für sie, für Mascha Mironowa.
Warte nur, drohte sie der STADT, du wirst mich noch kennenlernen. Ich werde dir Begeisterung und Zorn abringen, und deine Liebe brauche ich nicht. Selbst wenn du mich zermalmst zwischen deinen steinernen Kiefern, egal. Einen Weg zurück gibt es nicht.
Sie wollte sich selber Mut machen, wurde aber immer zaghafter.
Und vollends ließ sie den Kopf sinken, als sie die elektrisch angestrahlte Kristall- und Bronzepracht in der Hotelhalle des »Elysium« sah. Sie schämte sich, während sie sich in das Registrierbuch eintrug und »Marja Mironowa, Oberoffizierstochter« schrieb, obwohl sie sich einen besonderen Namen hatte geben wollen, Annabella Grey oder einfach Colombina.
Na wenn schon, Colombina würde sie ab morgen heißen, nachdem sich der graue Provinzfalter in einen buntgeflügelten Schmetterling verwandelt hatte. Dafür hatte sie das teuerste Zimmer genommen, mit Blick auf den Fluß und den Kreml. Mochte die Nacht in dieser vergoldeten Bonbonniere auch fünfzehn Rubel kosten! An das hier würde sie sich bis ans Ende ihrer Tage erinnern. Und gleich morgen würde sie sich nach einer schlichteren Bleibe umsehen. Eine Mansarde sollte es sein, vielleicht gar eine Bodenkammer, damit niemand in Filzpantoffeln über ihrem Kopf herumschlurfen konnte, sondern nur das Dach über ihr wäre, auf dem graziöse Katzen schlichen, und weiter oben der schwarze Himmel und die gleichgültigen Sterne.
Mascha blickte eine Weile auf den Kreml und packte ihre Koffer aus, dann setzte sie sich an den Tisch, schlug das in Saffian gebundene Heft auf, dachte, am Bleistift knabbernd, ein Weilchen nach und schrieb:
»Heutzutage führen alle Tagebuch, alle wollen bedeutender erscheinen, als sie sind, wollen vor allem das Sterben besiegen und über den Tod hinaus leben, und sei es in Form eines in Saffian gebundenen Hefts. Allein das sollte mich davon abhalten, ein Tagebuch zu führen, habe ich doch schon vor einer ganzen Weile, am ersten Tag des neuen, zwanzigsten Jahrhunderts beschlossen, nicht so zu sein wie alle. Und doch sitze ich da und schreibe. Aber das wird kein sentimentales Seufzen sein, mit gepreßten Vergißmeinnicht zwischen den Seiten, sondern ein richtiges Kunstwerk, wie es das bisher in der Literatur nicht gegeben hat. Ich schreibe Tagebuch nicht, weil ich den Tod fürchte oder etwa fremden Menschen gefallen will, die irgendwann diese Zeilen lesen. Was kümmern mich die Menschen, ich kenne sie nur zu gut und verachte sie. Und den Tod fürchte ich überhaupt nicht. Warum sollte ich, wo er doch ein natürliches Gesetz des Daseins ist? Alles, was geboren wurde, also einen Anfang hat, muß früher oder später auch ein Ende finden. Da ich, Mascha Mironowa, vor einundzwanzig Jahren und einem Monat zur Welt gekommen bin, wird unumstößlich auch der Tag kommen, an dem ich diese Welt verlasse, daran ist nichts Besonderes. Ich hoffe nur, daß dies geschieht, bevor sich mein Gesicht mit Runzeln überzieht.«
Sie überlas das Geschriebene, verzog das Gesicht und riß das Blatt heraus.
Was war das schon für ein Kunstwerk? Viel zu platt, zu fad, zu gewöhnlich. Sie mußte lernen, ihre Gedanken (für den Anfang zumindest auf dem Papier) feinsinnig, wohlduftend, berauschend darzulegen. Die Ankunft in Moskau galt es ganz anders zu beschreiben.
Mascha dachte wieder nach und knabberte dabei nicht am Bleistift, sondern an ihrem üppigen goldblonden Zopf. Dann neigte sie den Kopf wie eine Gymnasiastin und schrieb:
»Colombina traf an einem stillen fliederblauen Abend in der STADT DER TRÄUME ein, beim letzten Seufzer eines trägen, langen Tages, den sie am Fenster eines pfeilgeschwinden Eilzugs verbracht hatte, an dunklen Wäldern und hellen Seen vorbeifahrend, ihrem Schicksal entgegen. Ein günstiger Wind, wohlgesonnen jenen, die verstreut über das silbrige Eis des Lebens gleiten, hatte Colombina ergriffen; die langersehnte Freiheit lockte die leichtsinnige Abenteurerin, breitete über ihrem Kopf die durchscheinenden Flügel.
Der Zug brachte die blauäugige Reisende nicht ins quirlige Petersburg, sondern ins traurige und geheimnisvolle Moskau, in die STADT DER TRÄUME, die einer lebenslang ins Kloster eingesperrten Zarin glich, von einem launischen, leichtfertigen Herrscher, der statt ihrer eine kalte, schlangenäugige Heuchlerin zur Frau genommen. Mochte die neue Zarin den Ball im Marmorpalast anführen, dessen Spiegel die Wasser der Ostsee reflektierten. Die Verlassene weinte sich derweil die hellen, klaren Augen aus, und als ihre Tränen versiegten, schickte sie sich in ihr Los, verbrachte die Tage am Spinnrad und die Nächte im Gebet. Ich bin mit ihr, der Verlassenen, Ungeliebten, nicht mit der anderen, die siegreich ihr gepflegtes Antlitz der matten nördlichen Sonne entgegenreckt.
Ich bin Colombina, unbedarft und unberechenbar, untertan lediglich der Laune meiner wunderlichen Phantasie und dem Wehen des übermütigen Windes. Habt Mitgefühl mit dem armen Pierrot, dem das bittere Los zufallen wird, sich in meine bonbonsüße Schönheit zu verlieben, denn es ist mein Schicksal, ein Spielzeug zu sein in den Händen des tückischen Betrügers Arlecchino, um hernach zerbrochen am Boden zu liegen, eine Puppe mit unbekümmertem Lächeln auf dem Porzellangesichtchen …«
Wieder überlas sie das Geschriebene, und jetzt war sie zufrieden, schrieb aber nicht weiter, denn sie dachte über Arlecchino nach, Petja Lilejko (Li-lej-ko – welch luftiger, lustiger Name, wie ein Glöckchenklang oder ein Tropfenschauer im Frühling!). Er war tatsächlich im Frühling gekommen, war in das Irkutsker Nicht-Leben eingebrochen wie ein Rotfuchs in einen schläfrigen Hühnerstall, hatte sie verzaubert mit seinen auf die Schultern niederwallenden feuerroten Locken, dem weiten Hemd und den betörenden Gedichten. Früher hatte Mascha nur darüber geseufzt, daß das Leben ein hohler und dummer Scherz sei, doch er sagte lässig, als sei das selbstverständlich, wahre Schönheit sei nur im Verwelken, Erlöschen, im Sterben. Die Provinzträumerin begriff: Ach, wie recht er hat! Wo wäre sonst noch Schönheit? Doch nicht im Leben! Was kann im Leben Schönes sein? Einen Steuerinspektor heiraten, einen Haufen Kinder gebären und mit sechzig mit einem Häubchen auf dem Kopf am Samowar hocken?
Am Hochufer, bei der Laube, küßte der Moskowiter Arlecchino das vergehende Fräulein und raunte: »Aus dem blassen und zufälligen Leben mache ich ein Beben ohne Ende.« Und da war die arme Mascha vollends verloren, denn sie hatte begriffen: Das ist es. Ein schwereloser Schmetterling werden, der mit den regenbogenfarbigen Flügelchen flattert, und nicht an den Herbst denken.
Nach dem Kuß bei der Laube (weiter war nichts) stand sie lange vor dem Spiegel, betrachtete ihr Bild und haßte es: das runde, rosige Gesicht, den albernen dicken Zopf. Und diese gräßlichen rosa Ohren, die bei der kleinsten Erregung glühten wie Mohn!
Nachdem Petja die Ferien bei seiner Großtante, der Vizegouverneurswitwe, verbracht hatte, fuhr er mit dem Transkontinentalzug wieder zurück, und Mascha zählte die Tage, die noch bis zu ihrer Volljährigkeit blieben – genau hundert, so viele wie Napoleon nach Elba vergönnt waren. Im Geschichtsunterricht hatte ihr der Kaiser schrecklich leid getan – nur für hundert Tage wieder Ruhm und Größe zu erlangen, doch jetzt begriff sie, wie lang hundert Tage sein können.
Aber alles geht einmal zu Ende. Die hundert Tage waren um. Als die Eltern ihr an ihrem Geburtstag das Geschenk überreichten – Silberlöffelchen für den künftigen Hausstand –, ahnten sie nicht, daß sie ihr Waterloo gefunden hatten. Mascha hatte Schnittmuster für unvorstellbar kühne Kleider entworfen. Noch ein Monat nächtlicher Arbeit an der Nähmaschine, und die sibirische Gefangene war bereit für die Verwandlung in Colombina.
Während der ganzen einwöchigen Bahnfahrt malte sie sich aus, wie Petja staunen würde, wenn er die Tür öffnete und sie sah – nein, nicht das schüchterne Irkutsker Dummchen im langweiligen weißen Musselinkleidchen, sondern eine verwegene Colombina im wehenden blutroten Überwurf, auf dem Kopf ein perlenbesticktes Mützchen mit Straußenfeder. Sie würde unbekümmert lächeln und sagen: »Wie aus heiterem Himmel, stimmt’s? Du kannst mit mir machen, was du willst.« Ihm würde natürlich die Luft wegbleiben von solcher Kühnheit und vom Empfinden seiner grenzenlosen Macht über dieses zarte, wie aus Äther gewobene Geschöpf. Er würde sie um die Schultern fassen, sich mit gierigem Kuß an ihren weichen, nachgiebigen Lippen festsaugen und sie in das von geheimnisvollem Dämmerlicht erfüllte Boudoir ziehen. Vielleicht aber würde er mit der Leidenschaft eines jungen ungezügelten Satyrs gleich auf dem Fußboden der Diele von ihr Besitz ergreifen.
Ihre lebhafte Phantasie malte ihr sofort die leidenschaftliche Szene inmitten von Schirmständern und Galoschen aus. Die Reisende verzog das Gesicht und richtete den nichts sehenden Blick auf die Ausläufer der Uralberge. Sie erkannte: Den Altar der bevorstehenden Opferung mußte sie selbst vorbereiten, dabei durfte sie nichts dem Zufall überlassen. Und da tauchte in ihrer Erinnerung das wundersame Wort »Elysium« auf.
Nun, die fünfzehn Rubel teure Dekoration war des heiligen Rituals wohl würdig.
Mascha, nein, nicht mehr Mascha, sondern Colombina ließ zärtlich den Blick über die mit lila Atlasmoiré bespannten Wände gleiten, betrachtete dann den gemusterten flauschigen Teppich und die luftigen Möbel auf gebogenen Beinchen und warf einen scheelen Blick auf die nackte Najade im üppigen Goldrahmen (was zuviel ist, ist zuviel).
Und da bemerkte sie auf dem Tischchen vorm Spiegel einen noch luxuriöseren Gegenstand, nämlich ein richtiges Telephon! Ein Telephon direkt im Zimmer! Man denke nur!
Sofort kam ihr eine Idee, noch effektvoller als die ursprüngliche, einfach vor seiner Tür zu stehen. Da konnte sie stehen, und er war vielleicht gar nicht zu Hause. Überdies wäre das doch recht provinziell und unverfroren. Und was sollte sie eigentlich dort, wenn ihr Fall (der zugleich ein schwindelerregender Höhenflug sein mußte) hier stattfinden würde, auf dem katafalkartigen Bett mit den geschnitzten Säulchen und dem schweren Baldachin? Und Telephonieren, das war modern, elegant, hauptstädtisch.
Petjas Vater war Arzt, der mußte zu Hause Telephon haben.
Colombina nahm von dem Tischchen die elegante Broschüre »Moskauer Telephonanschlüsse« und schlug sie – na bitte – gleich bei dem Buchstaben »L« auf. Da: »Terenzi Saweljewitsch Lilejko, Dr. med., 3128.« War das etwa kein Wink des Schicksals?
Sie stand ein Weilchen vor dem lackierten Kasten mit den blanken Metallbügeln und konzentrierte sich. Mit einer raschen Bewegung drehte sie die Kurbel, und als eine blecherne Stimme »Vermittlung« sagte, sprach sie die vier Ziffern.
Während sie wartete, ging ihr plötzlich auf, daß der zurechtgelegte Satz für das Telephongespräch ungeeignet war. »Aus heiterem Himmel?« würde Petja fragen. »Wer spricht denn da? Und warum sollte ich mit Ihnen etwas machen, gnädige Frau?«
Um sich ein Herz zu fassen, öffnete sie das auf dem Bahnhof erstandene beinerne Zigarettenetui aus Japan und zündete die erste Papirossa ihres Lebens an (die Pachitos, die Mascha einmal in der fünften Klasse gepafft hatte, zählten nicht – damals hatte sie noch nicht gewußt, daß man den Tabakrauch einatmen muß). Sie stützte den Ellbogen auf das Tischchen, wandte sich halb dem Spiegel zu, senkte leicht die Lider. Nicht schlecht, interessant und sogar ein wenig geheimnisvoll.
»Hier bei Doktor Lilejko«, sagte eine Frauenstimme im Hörer. »Wen möchten Sie sprechen?«
Die Raucherin war etwas verwirrt – sie hatte gedacht, Petja würde an den Apparat gehen, doch sie schalt sich sogleich. So was Dummes! Natürlich lebte er nicht allein. Da waren seine Eltern und die Dienerschaft und vielleicht auch Geschwister. Eigentlich wußte sie nur sehr wenig über ihn: daß er Student war, Gedichte schrieb und wunderbar über die Schönheit des tragischen Todes reden konnte. Und daß er viel besser küßte als Kostja Lewondini, ihr ehemaliger zukünftiger Verlobter, dem sie den Laufpaß gegeben hatte wegen seiner Bravheit und Langweiligkeit.
»Ich bin eine Bekannte von Pjotr Terenzijewitsch«, stammelte Colombina höchst trivial. »Mein Name ist Mironowa.«
Gleich darauf ertönte im Hörer der wohlbekannte Bariton mit zauberhaft gedehnter Moskauer Aussprache:
»Hello? Frau Mironowa? Die Assistentin von Professor Simin?«
Da riß die Bewohnerin des schicken Hotelzimmers sich zusammen. Sie blies einen blaugrauen Rauchstrahl in die Sprechmuschel und flüsterte: »Ich bin’s, Colombina.«
»Wer?« fragte Petja verwundert. »Sie sind nicht Frau Mironowa vom Lehrstuhl für römisches Recht?«
Sie mußte dem Begriffsstutzigen erklären: »Erinnerst du dich nicht an die Laube über der Angara? Und wie du mich Colombina genannt hast?« Und nun paßte prächtig der zurechtgelegte Satz: »Ich bin’s. Wie aus heiterem Himmel. Ich bin zu dir gekommen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Kennst du das Hotel ›Elysium‹?« Sie ließ dem klangvollen Wort eine Pause folgen. »Komm her. Ich warte auf dich.«
Jetzt hatte er begriffen! Er atmete hastig und sprach dumpf, hatte wohl die Hand über die Muschel gelegt.
»Maschenka, das heißt, Colombina, ich freue mich schrecklich, daß Sie da sind …« In Irkutsk hatten sie sich zwar gesiezt, aber nun empfand Colombina diese Anrede als unpassend, wenn nicht beleidigend. »Wirklich, wie aus heiterem Himmel … Nein, das ist einfach fabelhaft! Nur kann ich jetzt nicht kommen, ich habe morgen eine Wiederholungsprüfung. Ist auch schon spät, da löchert Mama mich mit Fragen …«
Und dann stammelte er Klägliches über eine verhauene Prüfung und das Ehrenwort, das er dem Vater gegeben habe.
Das Spiegelbild klapperte mit den hellen Wimpern, die Mundwinkel krochen abwärts. Wer hätte gedacht, daß der listige Verführer Arlecchino vor einer Liebeseskapade seine Mami um Erlaubnis fragen mußte? Um die sinnlos ausgegebenen fünfzehn Rubel tat es ihr entsetzlich leid.
»Weshalb sind Sie nach Moskau gekommen?« flüsterte Petja. »Wirklich nur, um sich mit mir zu treffen?«
Sie lachte schallend, das gelang ihr gut, ein bißchen heiser, von der Papirossa wohl. Damit er sich nicht zu viel einbildete, sagte sie geheimnisvoll: »Das Treffen mit dir ist nur das Präludium zu einem anderen Treffen. Verstehst du mich?«
Und sie deklamierte aus Petjas Gedicht:
»Wie den Versklang das Leben zu schätzen.
Ohne Schwanken den Punkt einst zu setzen.«
Damals in der Laube hatte die frühere, noch dumme Mascha mit glücklichem Lächeln (peinlich, jetzt daran zu denken) gehaucht: »Das muß das Glück sein.« Der Moskowiter Gast hatte nachsichtig gesagt: »Glück, Maschenka, ist ganz was anderes. Glück ist nicht ein flüchtiger Augenblick, sondern die Ewigkeit. Nicht ein Komma, sondern der Punkt.« Und er sprach das Gedicht. Mascha erglühte, riß sich aus seiner Umarmung und stellte sich an den Rand des Abgrunds, unter dem das dunkle Wasser atmete. »Soll ich jetzt gleich den Schlußpunkt setzen?« hatte sie gerufen. »Glaubst du, ich fürchte mich?«
»Sie … Du meinst das im Ernst?« kam es ganz leise aus dem Hörer. »Denke nicht, ich hätte das vergessen …«
»Und ob ich’s ernst meine«, sagte sie auflachend, erregt vom besonderen Klang seiner Stimme.
»Eines kommt zum anderen«, flüsterte Petja Unverständliches. »Ist gerade eine Vakanz … Verhängnis. Schicksal … Ach, komme, was wolle … Hör zu … Wir wollen uns morgen abend treffen, um viertel neun … Ja, genau um viertel … Bloß wo?«
Colombinas Herz hämmerte rasch-rasch – sie versuchte zu erraten, was für einen Treffpunkt er ihr vorschlagen würde. Einen Park? Eine Brücke? Einen Boulevard? Gleichzeitig rechnete sie nach, ob sie es sich leisten konnte, das Zimmer im »Elysium« für eine weitere Nacht zu behalten. Das wären zusammen dreißig Rubel, davon konnte sie einen Monat leben. Wahnsinn!
Aber Petja sagte: »Beim Beerenmarkt auf dem Sumpf.«
»Auf dem Sumpf?« fragte Colombina verdutzt.
»Auf dem Sumpfplatz, der ist nicht weit vom ›Elysium‹. Von dort gehen wir zu einem ganz besonderen Ort, wo du ganz besondere Leute kennenlernen wirst.«
Er sagte das so geheimnisvoll, so feierlich, daß Colombina nicht den Schatten einer Enttäuschung empfand, im Gegenteil, sie spürte deutlich das zauberhafte »Beben ohne Ende« und begriff: Jetzt beginnen die Abenteuer. Nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt hatte, aber sie war doch nicht vergeblich in die STADT DER TRÄUME gekommen.
Bis spät in die Nacht saß sie am offenen Fenster im Sessel, in ihr Plaid gehüllt, und sah die Lastkähne mit schaukelnden Laternen auf dem Moskwa-Fluß fahren.
Sie war höchst gespannt auf diese »ganz besonderen Leute«.
Wenn nur der morgige Abend bald anbräche!
Der letzte Augenblick der Kleopatra
Als Colombina auf der gewaltigen Lagerstatt, die nun doch nicht zum Altar der Liebe geworden war, erwachte, war es bis zum Abend noch lange hin. Sie aalte sich im weichen Pfühl, telephonierte dann mit dem Empfang und verlangte Kaffee, den sie zur Feier des neuen verfeinerten Lebens ohne Sahne und Zucker trank. Er war bitter und schmeckte nicht, paßte aber zur Boheme.
Nachdem sie ihre Rechnung bezahlt und ihre Koffer in die Gepäckaufbewahrung gegeben hatte, durchblätterte sie im Foyer die »Moskauer Gouvernementsnachrichten« und schrieb sich ein paar Wohnungsanzeigen heraus, Häuser mit mindestens drei Etagen, die eine Dachwohnung hatten.
Sie feilschte mit dem Kutscher, der drei Rubel verlangte, während sie nur einen geben wollte; man einigte sich auf einen Rubel vierzig. Das war ein guter Preis, zumal der Kutscher eingewilligt hatte, das Fräulein zu allen vier Adressen zu fahren, aber letztendlich hatte sie doch zuviel gezahlt, da ihr gleich die erste Wohnung, mitten im Zentrum, im Bezirk Kitaigorod, so gut gefiel, daß sie nicht mehr weiterzufahren brauchte. Sie versuchte, den Kutscher mit einem Rubel abzuspeisen (auch das war schon reichlich für eine Viertelstunde Fahrt), doch er verblüffte die Provinzlerin mit dem Satz: »Bei uns in Moskau hält auch der größte Spitzbube sein Wort.« Da errötete sie und zahlte, bestand aber darauf, daß er noch ihr Gepäck aus dem »Elysium« herschaffte.
Die Wohnung war wunderbar und die Miete für Moskauer Verhältnisse günstig, ein Monat kostete soviel wie eine Nacht im »Elysium«. In Irkutsk freilich hätte sie dafür ein ganzes Haus mit Garten und Bedienung bekommen, aber hier war schließlich nicht die sibirische Einöde, sondern die Metropole.
Auch hatte sie in Irkutsk noch nie so hohe Häuser gesehen. Fünf Stockwerke! Der Hof gepflastert, da wuchs kein Grashalm. Man spürte sogleich, daß man in einer richtigen Stadt lebte und nicht im Dorf. Das Gäßchen, auf das die Fenster ihres Zimmers blickten, war sehr schmal. Wenn sie in der Küche auf den Hocker stieg und durch das Lüftungsfensterchen spähte, konnte sie die Türme des Kreml und des Museums für Geschichte sehen.
Zwar war es keine Mansardenwohnung, wie Colombina geträumt hatte, aber sie lag immerhin im obersten Geschoß. Überdies war sie voll möbliert, hatte Gasbeleuchtung und einen amerikanischen Eisenherd. Und die Wohnung selbst! Colombina hatte noch nie etwas so Verrücktes gesehen.
Zuerst kam man in eine kleine Diele. Rechterhand war die Tür zum Wohnzimmer, von dort ging es links in die kleine Küche und wieder links durch einen kleinen Gang zum Bad, das ein Waschbecken und eine Wanne hatte, und von dort führte ein Korridor wieder in die Diele. All das bildete einen Kreis, den irgendwer zu irgendwelchen Zwecken so projektiert hatte.
Das Zimmer hatte einen Balkon, in den sich die frischgebackene Moskauerin sofort verliebte. Er war breit und hatte ein Eisengitter, in das – bestechend durch seine Sinnlosigkeit – eine Pforte eingelassen war. Vielleicht hatte der Baumeister von außen eine Feuertreppe anbauen wollen und es sich dann anders überlegt?
Colombina zog den klemmenden Riegel zurück, öffnete die schwere Pforte, blickte hinab. Weit weg, tief unter ihren Schuhspitzen, fuhren winzige Kutschen, krochen spielzeugkleine Menschlein. Das war so wundervoll, daß die Himmelsbewohnerin sogar zu singen begann.
Auf der gegenüberliegenden Seite blinkte, etwas tiefer, ein Blechdach. Darunter ragte bis fast in die Mitte der Gasse eine sonderbare Blechfigur: ein wohlgenährter Engel mit weißen Flügeln, an dem ein Schild hing: »VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT MÖBIUS UND SÖHNE. Mit uns haben Sie nichts zu fürchten.« Herrlich!
Es gab aber auch Minuspunkte, wenngleich unwesentliche.
Kein Fahrstuhl, das ging noch hin, wie lange brauchte sie schon bis zum fünften Stock?
Etwas anderes machte ihr Sorgen. Der Wirt hatte die künftige Mieterin redlicherweise gewarnt, es könne Mäuse geben oder, wie er sagte, »kleine Hausnager«. Im ersten Moment war Colombina irritiert gewesen, denn vor Mäusen hatte sie schon als Kind Angst gehabt. Wenn sie nachts das Kratzen der winzigen Pfötchen auf dem Fußboden hörte, kniff sie die Augen so fest zu, daß sie unter den Lidern glühende Kreise sah. Aber das war in ihrem früheren Leben, sagte sie sich sogleich. Colombina hingegen ist ein leichtsinniges, unbekümmertes Wesen, das sich von nichts einschüchtern läßt. Diese flinken, flitzenden Tierchen sind jetzt ihre Verbündeten, denn wie Colombina gehören sie nicht dem Tag, sondern der Nacht. Schlimmstenfalls kann sie ja »Antirattenwurst« kaufen, für die in den »Nachrichten« geworben wird.
Colombina ging auf den Markt, um Lebensmittel zu holen (diese Preise in Moskau!), da erwarb sie noch einen Verbündeten aus der nächtlichen Welt des Mondlichts.
Sie kaufte einem Jungen für acht Kopeken eine kleine schillernde Natter ab, die sich im Korb sogleich zusammenringelte und ganz still war.
Wozu sie die kaufte? Sie wollte so schnell wie möglich Marja Mironowa aus sich austreiben. Die dumme Gans hatte Schlangen noch mehr gefürchtet als Mäuse. Wenn sie eine auf einem Waldweg entdeckt hatte, war des Kreischens kein Ende gewesen.
Zu Hause nahm Colombina, sich auf die Lippe beißend, das Reptil in die Hände. Das Schlänglein war entgegen seinem Aussehen nicht feucht und glitschig, sondern trocken, rauh und kühl. Die winzigen Äuglein blickten verängstigt auf die Riesin.
Der Junge hatte gesagt, wenn man die Schlange in Milch lege, werde sie gut gedeihen, und wenn sie groß sei, tauge sie zum Mäusefangen. Aber Colombina hatte einen anderen Einfall, der noch interessanter war.
Als erstes fütterte sie die Natter mit Dickmilch, dann gab sie ihr den Namen Luzifer und färbte die gelben Flecke an beiden Seiten des Kopfes mit Tusche schwarz – so entstand ein geheimnisvolles Reptil, das durchaus tödliches Gift verspritzen konnte.
Colombina machte vor dem Spiegel den Oberkörper frei, legte das vom Fressen ermattete Tier an die entblößte Brust und weidete sich an dem Anblick – infernalisch. War das nicht wie der »Letzte Augenblick der Kleopatra«?
Das Glückslos
Auf die Begegnung mit Arlecchino bereitete sie sich stundenlang vor, dann ging sie beizeiten aus dem Haus, um ihre erste feierliche Promenade durch Moskaus Straßen ohne Eile zu absolvieren und der Stadt Gelegenheit zu geben, den Anblick der neuen Einwohnerin zu genießen.
Beide – Moskau und Colombina – machten großen Eindruck aufeinander. Die Stadt war an diesem trüben Augustabend träge, gelangweilt, blasiert, das Fräulein dagegen hellwach, nervös, jedweder Überraschung gewärtig.
Für ihre Moskauer Premiere hatte Colombina eine Gewandung gewählt, wie sie hier sicherlich noch nie gesehen wurde. Ein Hütchen hatte sie als bürgerliches Zubehör nicht aufgesetzt, hatte statt dessen ihr dichtes Haar gelöst, unterhalb des rechten Ohrs mit einem breiten schwarzen Band zusammengerafft und dieses zu einer üppigen Schleife gebunden. Über der zitronengelben Seidenbluse mit den spanischen Ärmeln und einem vielschichtigen Jabot trug sie eine himbeerrosa Weste mit Silbersternchen; der unendlich weite Rock, dunkelblau schillernd und mit zahllosen Falten, umwogte sie wie Ozeanwellen. Ein wichtiges Detail ihres frechen Kostüms war ein orangener Stoffgürtel mit einer hölzernen Schnalle. Für die Moskowiter gab es also allerhand zu sehen. Ein paar besonders neugierige Gaffer erwartete eine zusätzliche Erschütterung: Das schwarzblinkende Halsband der umwerfenden Spaziergängerin erwies sich bei näherem Hinschauen als lebendige Schlange, die ab und zu das schmale Köpfchen hin und her drehte.
Von Ohs und Ahs begleitet, schritt Colombina stolz über den Roten Platz, überquerte die Moskwa-Brücke und bog in die Sofiskaja-Uferstraße ein, wo das bessere Publikum promenierte. Hier präsentierte sie sich, schaute aber auch selbst mit großen Augen und sammelte Eindrücke.
Die Moskowiterinnen kleideten sich größtenteils langweilig: glatter Rock und weiße Bluse mit Schlips oder Seidenkleid in tristen dunklen Farbtönen. Beeindruckend war die Größe der Hüte, die in dieser Saison besonders opulent waren. Extravagante Damen und Fräuleins waren fast gar nicht zu sehen, höchstens eine mit einem wehenden Gazeschal, und dann ritt eine perlgrau gekleidete verschleierte Amazone vorüber, in der Hand eine lange Zigarettenspitze aus Bernstein. Stilvoll, fand Colombina, indes sie ihr mit dem Blick folgte.
Junge Männer mit Bluse und Baskenmütze, mit langem Haar und einem Schleifchen auf der Brust gab es in Moskau reichlich. Einen sprach sie sogar an, weil sie ihn von weitem für Petja gehalten hatte.
Am Treffpunkt erschien sie absichtlich mit zwanzig Minuten Verspätung, dazu hatte sie auf der Uferstraße zweimal umkehren müssen.
Arlecchino wartete bei dem Brunnen, in dem die Kutscher ihre Pferde tränkten, und er sah genauso aus wie in Irkutsk, aber hier, zwischen den granitenen Kaimauern und den eng beieinander stehenden Häusern, wirkte er fad. Warum hatte er sich in all den Monaten gar nicht verändert? Warum war er nicht irgendwie größer oder neuer oder anders geworden?
Auch Petjas Benehmen war falsch. Er errötete, stammelte. Er wollte sie küssen, traute sich aber nicht, streckte ihr statt dessen linkisch die Hand hin. Colombina blickte voll fröhlicher Verständnislosigkeit auf seine Hand, als hätte sie noch nie einen spaßigeren Gegenstand gesehen. Da wurde er noch verlegener und reichte ihr lila Veilchen.
Sie zuckte launisch die Achseln. »Was soll ich mit den Blumenleichen?«
Sie trat zu einer Droschkenstute und hielt ihr das Sträußchen hin. Die Hellbraune faßte es mit labberigen Lippen und verspeiste es.
»Schnell, wir kommen zu spät«, sagte Petja. »Das ist bei uns nicht üblich. Da bei der Brücke ist die Haltestelle der Pferdebahn. Gehen wir!«
Er warf einen nervösen Blick auf seine Begleiterin und flüsterte:
»Die Leute gucken nach Ihnen. In Irkutsk waren Sie anders angezogen.«
»Genierst du dich mit mir?« fragte Colombina herausfordernd.
»Ich bitte Sie … dich!« rief er erschrocken. »Ich bin Dichter und verachte die Meinung der Menge. Es ist nur sehr ungewöhnlich … Aber das macht nichts.«
Ob er sich meiner schämt? dachte sie verwundert. Können Arlecchinos sich überhaupt schämen? Sie betrachtete in einem erleuchteten Schaufenster ihr Spiegelbild und zuckte innerlich zusammen, gar zu auffällig sah sie aus, doch die aufkommende Zaghaftigkeit wurde sogleich mit Schimpf und Schande verscheucht. Dieses erbärmliche Gefühl sollte für immer hinter den Zacken der Ural-Berge zurückbleiben.
In der Pferdebahn erzählte er ihr halblaut, wo sie jetzt hinfuhren.
»Solch einen Klub gibt es in Rußland sonst nirgends, nicht mal in Petersburg«, sagte er, und sein Atem kitzelte ihr Ohr. »Da triffst du Leute, solche hast du in Irkutsk noch nicht gesehen! Bei uns trägt jeder einen besonderen, selbst ausgedachten Namen. Mancher wird aber auch vom Dogen verliehen. Mir zum Beispiel hat er den Namen Cherubino gegeben.«
»Cherubino?« fragte Colombina enttäuscht und dachte dann, Petja habe tatsächlich mehr Ähnlichkeit mit einem lockenköpfigen Pagen als mit dem selbstbewußten und siegreichen Arlecchino.
Petja mißverstand die Intonation der Frage, er nahm eine stolze Haltung ein.
»Das ist noch gar nichts. Da gibt es noch ganz andere Namen: Abaddon, Ophelia, Caliban, Horatio. Und Loreley Rubinstein …«
»Was denn, Loreley Rubinstein ist auch dabei?« staunte die Provinzlerin. »Die Dichterin?«
Zum Staunen gab es Grund. Die gepfefferten, schamlos sinnlichen Gedichte der Loreley waren mit großer Verspätung nach Irkutsk gelangt. Die fortschrittlichen Fräuleins, die sich in der modernen Poesie auskannten, konnten sie auswendig hersagen.
»Ja.« Cherubino-Petja nickte gewichtig. »Bei uns heißt sie Löwin der Ekstase. Oder einfach Löwin. Dabei wissen natürlich alle, wer sie in Wirklichkeit ist.«
Ach, welch süßes Ziehen ging Colombina durch die Brust! Die freigebige Fortuna schickte sich an, ihr die Tür zu der erlesensten Gesellschaft zu öffnen, und sie sah Petja viel zärtlicher an als zuvor.