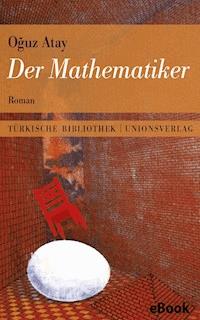
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Ingenieur und Mathematiker Mustafa Inan ist ein Universalgelehrter: Zwar fiel er mit vier Jahren vom Dach, und sein Vater bezweifelt zeit seines Lebens, dass aus dem schwächlichen Jungen noch etwas Rechtes wird. Doch bald machen ihn sein mathematisches Genie, sein phänomenales Gedächtnis und seine eiserne Willenskraft zur Legende. Eine Promotion in der Schweiz befördert seine wissenschaftliche Karriere an der Technischen Universität Istanbuls, wo er schließlich Dekan und Rektor wird. Der eigenwillige Forscher und Lehrer verzweifelt jedoch an der Denkfaulheit, die sich in den Köpfen der Dozenten und Studenten wie eine Geisteskrankheit eingenistet hat. Unermüdlich sucht er nach einer Möglichkeit, die Logik Einsteins und die intuitive Weisheit der Sufi-Mystiker miteinander in Einklang zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Ingenieur und Mathematiker Mustafa Inan ist ein Universalgelehrter. Er verzweifelt jedoch an der Denkfaulheit, die sich in den Köpfen der Dozenten und Studenten wie eine Geisteskrankheit eingenistet hat. Unermüdlich sucht er nach einer Möglichkeit, die Logik Einsteins und die intuitive Weisheit der Sufi-Mystiker miteinander in Einklang zu bringen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Oguz Atay (1934–1977) war nach dem Studium mehrere Jahre lang als Dozent für Bauwesen an der Universität in Istanbul tätig. 1972 erschien sein erster Roman Die Haltlosen.
Zur Webseite von Oğuz Atay.
Monika Carbe (1945–2021) studierte Germanistik, Indologie und Philosophie und schloss ihr Studium mit einer Dissertation über Thomas Mann ab. Ab den Achtzigerjahren übersetzte sie aus dem Türkischen.
Zur Webseite von Monika Carbe.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Oğuz Atay
Der Mathematiker
Mit einem Nachwort von Gürsel Aytaç
Roman
Aus dem Türkischen von Monika Carbe
Türkische Bibliothek
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1975 unter dem Titel Bir Bilim Adamının Romanı bei Bilgi Yayınevi, Ankara.
Türkische Bibliothek im Unionsverlag, Zürich, herausgegeben von Erika Glassen und Jens Peter Laut
Eine Initiative der Robert Bosch Stiftung
Originaltitel: Bir Bilim Adaminin Romani (1975)
© by Oğuz Atay 1975
© İletişim Yayınları 2003
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Erol Akyavaş, Interior
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30604-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 00:49h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER MATHEMATIKER
1 — Der Preis für wissenschaftliche Leistungen2 — Die ersten Jahre3 — Lernen und Lehren in einem4 — Jedermanns Freund5 — Ein Mann, der sein Wort hält6 — Im Dienst der Wissenschaft7 — Traum und Wirklichkeit8 — Orient und Okzident9 — Die letzten Studentenjahre10 — Die Liebe des jungen Lehrers11 — Schwere Zeiten12 — Erschöpft13 — Theorie und Praxis14 — Der Mann, der sich allem widmet15 — Fotoelastizität16 — Der berühmte Forscher der Lehre vom Widerstand17 — Wissenschaft und Verwaltung18 — Tod eines Professors19 — SchlussNachwortWorterklärungenStadtteile, Orte, Gegenden in IstanbulGroßstädte, Regierungsbezirke, Städte und kleinere Orte in der TürkeiZur Aussprache des TürkischenMehr über dieses Buch
Über Oğuz Atay
Über Monika Carbe
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Türkei
1
Der Preis für wissenschaftliche Leistungen
An einem heißen Tag im Frühjahr stand ein mittelgroßer, dunkelhäutiger junger Mann mit scheuem Blick vor dem großen Tor der Universität. Jemand verstellte ihm den Weg, dem dunklen Anzug und dem mürrischen Gesichtsausdruck nach zu urteilen ein Beamter, der wohl dachte, der schäbig gekleidete junge Mann mit dem offenen Kragen wolle in der Kühle hinter dem großen Tor Schutz vor der Hitze suchen: »Wohin des Wegs, Landsmann?« Wieso Landsmann, fragte er sich. Würdest du mir denn den Weg versperren, wenn wir Landsleute wären? »Zur Naturwissenschaftlichen Fakultät«, sagte der schwarzhaarige junge Mann und wiederholte dann, als hätte er vergessen, in welcher Stadt er war: »Zur Naturwissenschaftlichen Fakultät von Ankara.« »Ja, das ist hier, und worum gehts?« Der junge Mann steckte den zerknitterten Kragen ins Jackett und murmelte so etwas wie: »Um die Aufnahmeprüfung.« Dann hob er wieder den Kopf und schaute ihn an. Das dunkle Hindernis, das ihm das Tor versperrte, streckte seinen bevollmächtigten Arm aus, um ihm die Richtung zu weisen: Dort, die schmale Eisenpforte. Und hatte den jungen Mann auch schon wieder vergessen.
Vor den Listen mit den Prüfungsresultaten gab es ein großes Gedränge. Er wollte sich nicht unter die Leute mischen, die sich in dem dunklen Korridor herumschubsten, sondern ging ein Stück weiter, bog um die Ecke, stieß mit der Schulter eine Schwingtür auf und entfernte sich von dem Lärm und den Mutmaßungen über die erreichten Punkte, die Zahlen und Kommata.
Irgendwo dort, wo die Korridore endeten, in einer Fensternische, die von der Sonne beschienen wurde, rauchte er eine seiner billigen Zigaretten, deren Tabak immer in die Taschen seines Jacketts bröselte. Dann geriet er in einen anderen Gang, der genauso still dalag. Als er später zurückgehen wollte, hatte er sich auch schon verirrt. Wieder habe ich mich verlaufen, ärgerte er sich. Was solls, ich bin nun mal aus der Provinz. Schon »mein Landsmann« am großen Tor hat mir das an den Augen abgelesen.
Er sah sich die Schilder an den Türen an: Professorennamen auf Messingtafeln. Eine weit entfernte und schwer vorstellbare Zukunft … Im Moment hatte er noch nicht einmal den Mut, an die geschlossenen Türen zu klopfen. Er ging weiter. Schließlich war da eine helle Tür mit Glasscheiben, und schon stand er wieder unter der heißen Sonne. Er müsste das riesige Gebäude umrunden und noch einmal die schmale Eisenpforte suchen. Man muss ständig hinter den Punkten her sein, ob ich wohl mehr als dreihundert habe? Nebenan war noch ein Gebäude. Auch vor diesem Tor herrschte großes Gedränge. Und viel Aufsichtspersonal war zu sehen. Leute gingen hinein, denen man ansah, dass ihnen der Kummer um Prüfungsresultate fernlag; sie strömten regelrecht durch die Tore. Wenn du eine Menschenmenge siehst und ordentlich angezogen bist, tritt ruhig näher, denn dann darfst du hinein. Er überwand das erste Hindernis, indem er sich das Gewimmel zunutze machte. Er streckte den Hals und versuchte hineinzuschauen. »Was ist denn dort los?« Möglicherweise hatte er dabei einen älteren Mann, mittelgroß und mit Brille, zur Seite geschoben, offenbar ein höflicher Mensch, denn er gab Auskunft, als ob man ihn nicht angerempelt, sondern gefragt hätte: »Heute werden die Preise der Wissenschaftlich-Technischen Forschungsgemeinschaft der Türkei überreicht.« Der junge Mann wandte sich zu ihm um.
»Wahrscheinlich haben Sie keines meiner Worte verstanden.« So war es, und der junge Mann schüttelte auch den Kopf. »Es geht um eine Preisverleihung.« Immerhin, das hatte er begriffen. Er starrte nach unten und sah auf seine verstaubten, ausgetretenen Schuhe auf dem für die Feier blank geputzten Boden. Der ältere Herr lachte: »Das macht nichts. Jackett und Schlips müssten reichen.« Dann wechselte er sofort das Thema: »Du bist doch nicht wegen der Feierlichkeiten gekommen, oder?« Er hob den Kopf: Obwohl der Herr mittleren Alters dunkel gekleidet war, hatte er nichts von einem Aufseher an sich, und dennoch antwortete der junge Mann schüchtern: »Wegen der Aufnahmeprüfung« – und schwieg. »Hast du die Resultate schon erfahren?« Der junge Mann machte eine Handbewegung; er wollte gerade erzählen, wie er sich in den Korridoren der Wissenschaft verlaufen hatte. Dann ließ er es sein und schüttelte den Kopf. »Ich weiß noch nicht genau, was ich machen will.« Der ältere Herr lächelte: »Vielleicht überlegst du dir sogar, ob du zu Hause einen Laden oder dergleichen aufmachen willst.« Nein, mein Lieber, ganz bestimmt nicht. Er hatte sagen wollen, dass ihm noch nicht ganz klar war, für welche Fakultät er sich entscheiden sollte. Welche wäre am besten? Der Herr mit der Brille lachte: »Du meinst, was am lukrativsten wäre? Das wolltest du wissen? Also, meiner Meinung nach ist der Gedanke an den Laden …« Er konnte nicht weiterreden, die beiden wurden im Gewimmel von Beamten in dunklen Anzügen an den Rand gedrängt. Die Menschenmenge an der Tür geriet in Bewegung; der ältere Herr rückte den Kragen seines Jacketts zurecht und murmelte: »Der Staatspräsident kommt, um die Preise zu überreichen«, und runzelte die Stirn. »Immer wenn ich von Wissenschaft spreche, schaust du mich an, als ob du dieses Wort noch nie gehört hättest.« Wahrscheinlich waren sie so rasch miteinander vertraut geworden, weil sie Schulter an Schulter vor der Tür standen. Sie schauten sich an und lachten. Der ältere Herr meinte: »Aber wie du siehst, die Wissenschaft lockt sogar die Prominenz an.«
Der junge Mann nahm seinen ganzen Mut zusammen: »Vermutlich haben auch Sie etwas mit der Wissenschaft zu tun?« »Vielleicht«, antwortete der ältere Herr. »Außerdem trage ich eine Brille und bin so dunkel gekleidet, als ob man mich zur Feier eingeladen hätte. Was meinst du, wenn du auf vierhundert Punkte oder mehr kämst, würdest du dann auch gern zur Familie der Wissenschaftler mit der bärbeißigen Miene gehören?« Der junge Mann sagte in einem Tonfall, der im Nu die kleine Stadt in der Provinz, das Haus aus Lehmziegeln, das Milieu, die Gegend, in der er lebte, und seine ganze Herkunft verriet: »Woher solln wirn das wissen?« »Aha«, platzte der »Gelehrte« mit der Brille heraus: »Mustafa İnan redete in genau demselben Adanaer Tonfall und in diesem Dialekt, aber er machte nicht den Eindruck, als ob er sich jemals dafür geschämt hätte.« Der junge Mann mit dem dunklen Teint hielt sich die Hand vor das Gesicht, um zu verbergen, dass er sich für seinen Dialekt schämte, und fuhr sich durch das dichte Haar, das ihm in die Stirn fiel. »Mustafa İnan – wer ist das?«
Der »Gelehrte« wurde ernst: »Unser Preisträger.« Der junge Mann, der gerade erfahren hatte, dass er ein Landsmann von Mustafa İnan war, antwortete fast schon ein wenig enthusiastisch: »Mit anderen Worten, Sie kennen ihn persönlich?« Er streckte den Kopf zur Tür. »Wahrscheinlich sitzt er in der ersten Reihe. Zeigen Sie ihn mir doch mal.« »Er ist nicht da«, antwortete Mustafa İnans Bekannter. »Kommt er noch?« Der ältere Herr wurde traurig: »Nein, er kann nicht kommen.« »Warum nicht? Ist er etwa krank?« »Er war krank – vor vier Jahren etwa um diese Zeit.« Er fasste den jungen Mann am Arm. »Komm, gehen wir hinein.« Der Herr mit der Brille ging zu einem der Aufseher und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Der Mann nahm Haltung an und sagte: »Bitte sehr, Herr Professor«, dann bahnte er ihnen einen Weg durch die Menge.
Vier Jahre nach seinem Tod wurde Mustafa İnan der Preis für wissenschaftliche Leistungen verliehen:
Die Wissenschaftskommission der Wissenschaftlich-Technischen Forschungsgemeinschaft der Türkei hat in ihrer 134. Sitzung vom 9.°August beschlossen, Professor Dr. Mustafa İnan in Würdigung seiner Forschungen auf dem Gebiet der Angewandten Mechanik, die er 1944 an der Technischen Universität Istanbul aufnahm und bis zu seinem Ableben im Jahre 1967 fortführte, seines beispielhaften Wirkens in der Lehre und aufgrund der Tatsache, dass er eine Schule im modernen Sinne begründete, indem er zahlreiche junge Forscher und Wissenschaftler herangebildet hat, den Preis für Verdienste um die Wissenschaft des Jahres 1971 zu verleihen.
So stand es auf der Ehrenurkunde. »Er hat eine Schule begründet, was bedeutet das?«, fragte der junge Mann leise. »Es würde lange dauern, dir das zu erklären. Wenn es dich wirklich interessiert, können wir später darüber reden.« In diesem Augenblick ging der Staatspräsident zum Rednerpult. Als er Jale İnan, der Witwe des Professors, den Preis überreichte, sagte er: »Diese Auszeichnung hatte ich Mustafa İnan persönlich übergeben wollen. Indem ich sie Ihnen aushändige, finde ich immerhin ein wenig Trost.«
»Da haben wir nun auch Mustafas mit einer glanzvollen Zeremonie gedacht«, meinte der Professor, als sie die Gedenkfeier verließen. »In gewisser Hinsicht gibt es in seinem Leben viele herausragende Wendepunkte. Mustafa İnan hat das Gymnasium mit dem ersten Preis abgeschlossen. Mustafa İnan hat sein Studium an der Technischen Universität als Bester seines Jahrgangs – und was noch wichtiger ist – mit einem sehr guten Notendurchschnitt beendet. So einen Notendurchschnitt gibt es dort nur etwa einmal in zwanzig Jahren. Mustafa İnan hat auch seinen Doktor in der Schweiz mit glänzendem Ergebnis gemacht, an der Technischen Universität hat er den ersten Doktortitel verliehen, Mustafa İnan ist Dekan, später Rektor geworden.«
Sie gingen zusammen über den Korridor. »Willst du nicht mal einen Blick auf die Listen dort werfen?«, fragte der Professor. Dann aber besann er sich anders: »Lass das jetzt lieber. Wir sollten uns die schöne Stimmung der Feier nicht verderben, nicht wahr?« Es war offensichtlich, dass der Ältere etwas erzählen wollte. »Die jungen Leute hören nicht so gern zu, aber du bist gerade erst aus der Provinz gekommen, daher wirst du die Gewohnheiten der Großstädter noch nicht übernommen haben. Lass dich auch nicht von der Menschenmenge verwirren«, meinte der Professor, als sie durch das große Tor hinausschritten. Der Aufseher, der sich vor einer Weile drohend vor dem jungen Mann aufgebaut hatte, grüßte sie respektvoll. Du bist nicht mein Landsmann oder dergleichen, lächelte der junge Mann insgeheim, mein eigentlicher Landsmann ist Mustafa İnan. »Nicht aller Anfang ist so glanzvoll«, erklärte der Professor. »Wenn ich jemandem etwas von Mustafa İnan erzählen sollte, würde ich nicht mit dieser Feier beginnen, oder ich würde sagen: Die Begeisterung im Saal hatte ihren Höhepunkt erreicht, jeder folgte gespannt den Ereignissen, man gedachte Mustafa İnans mit einer glanzvollen Zeremonie.«
Er setzte sich auf eine Bank im Garten, bat den jungen Mann, neben ihm Platz zu nehmen, und forderte ihn auf: »Nun hör mir mal genau zu! Vor sechzig Jahren, am 24. August 1911, an einem Freitag, ging es in Adana, im Haus des reisenden Postbeamten Hüseyin Avni Bey, nicht so feierlich zu. Vielleicht war die Aufregung größer, denn Hüseyin Avni Beys Frau, Rabia Hanım, hatte einen Jungen zur Welt gebracht. Außerdem versuchten Hüseyin Bey und Rabia Hanım, ihre Freude zu verheimlichen. Hätte ihre finanzielle Situation es zugelassen, hätten sie dennoch keine glanzvolle Feier ausgerichtet, denn in ihrem dreizehnjährigen Eheleben hatte noch kein Junge, der ihnen geboren wurde, überlebt. Hüseyin Avni, der zuvor sechs Kinder verloren hatte, erhoffte sich schließlich Hilfe von abergläubischen Praktiken: Vor der Geburt hatte man keinerlei Vorbereitungen für das Kind getroffen. Daher wurde Mustafa İnan mit den Geschenken der Nachbarn gewickelt und bekleidet. Auch das Bett der Wöchnerin wurde nicht geschmückt, kurzum, man unterließ alle Freudenfeiern, die sonst üblich waren. Dieser Junge sollte auf jeden Fall überleben. Und wenn man die Freude über sein Leben verheimlichte, könnte der Tod vielleicht nichts davon erfahren und gar nicht erst kommen. Um den Tod auf eine falsche Fährte zu locken, wurde ihm bisweilen etwas vorgegaukelt: Bis Mustafa zur Schule ging, steckte man ihm Ohrringe an und zog ihm zerfetzte, ausgeblichene Uniformjacken an, die bis zum Hals zugeknöpft waren. Und Rabia Hanım bezog das Wöchnerinnenbett auch nur mit einer Wolldecke, dazu noch mit einer schwarzen. Tatsächlich war die finanzielle Lage der Familie auch nicht gerade glänzend: Niemand hätte behaupten können, dass sie sich absichtlich so verhielten, um das Schicksal in die Irre zu führen, das ihre anderen Söhne dahingerafft hatte.«
Da ging gerade Jale İnan an dem Professor und dem jungen Mann vorüber; die Ehrenurkunde für wissenschaftliche Leistungen hatte sie fest an sich gedrückt. Der Professor stand auf: »Wie geht es Ihnen?« – und setzte sich wieder. »Neben ihr, das war ihr Sohn, Hüseyin«, erklärte er dem jungen Mann, der Mutter und Sohn nachschaute. »Mustafa İnan hat ihn bestimmt unter guten Bedingungen aufwachsen lassen«, meinte dieser. »Natürlich«, antwortete der Professor mit der Brille sofort. »Hüseyins Vater war nun mal kein Postfahrer.« Er dachte eine Weile nach: »Halt, nicht so voreilig! Hüseyin ist ebenfalls nicht unter glänzenden Bedingungen geboren, auch wenn er vierunddreißig Jahre nach seinem Vater zur Welt kam. Hätte Mustafa İnan jedoch den Vorschlag seines Schwagers angenommen und wäre Bauunternehmer geworden, hätte er in der Nacht, als sein Sohn geboren wurde, vielleicht nicht von der Poliklinik in Haydarpaşa zum Haus seines Schwiegervaters in Erenköy zu Fuß gehen müssen. Aber hast du erst einmal deinen Kopf aus dem geheiligten Tor der Universität herausgestreckt, um zu erfahren, wie die Leute es anstellen, Geld zu verdienen, nimmt das ein böses Ende.« »Was wird bös enden?«, fragte der junge Mann. Der Professor lachte: »Die Wissenschaft, mein Lieber.«
Jale İnan sah ihren Sohn an. »Was hatten wir doch für eine Angst, dass du im staatlichen Krankenhaus mit anderen Kindern verwechselt werden könntest! Aber was blieb uns denn anderes übrig, mein Junge, wir konnten uns doch keine Privatklinik leisten. Schließlich hatten wir einen Arzt gefunden, einen Bekannten von uns. ›Nur keine Sorge‹, hatte der Doktor gesagt, ›euer Kind wird nicht verwechselt.‹ Das Krankenhaus war billig. Wirklich, billig? Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich gleich am nächsten Tag wieder gegangen, aber Mustafa bestand darauf: ›Kann sie denn nicht noch ein paar Tage liegen bleiben und sich ausruhen?‹, hatte er den Arzt gefragt. Ach du meine Güte, Mustafa, was machst du nur, ich kann mich doch zu Hause erholen. Als der Arzt zur Tür hinaus war, schalt Jale ihren Mann: ›Mustafa, du weißt, dass wir nicht genug Geld haben, ich muss noch heute raus.‹ Er ließ den Kopf hängen und sagte: ›Ich hab kein Geld.‹ ›Wie das? Mein Lieber, haben wir das nicht zusammen ausgerechnet? Hatten wir dafür nicht dreißig Lira zurückgelegt?‹ ›Heute Morgen ist meine Schwester gekommen‹, hat er gesagt, und er musste sie zum Zahnarzt bringen. Der Zahnarzt war ein Bekannter von uns, natürlich bekam er kein Honorar. Aber Mustafas Schwester hatte auch ihre Kinder mitgebracht, und da war zuerst das Mittagessen, dann die Kosten für die Hin- und Herfahrerei … ›Und ich als ihr Bruder hatte ihr natürlich das Geld geben müssen. Schließlich war das Geld für das Krankenhaus bis auf die letzte Lira ausgegeben. Mach dir keine Sorgen‹, hat Mustafa gesagt. ›Heute ist Samstag. Am Montag borge ich mir was von Freunden. Ruh dich doch noch zwei Tage aus. Das staatliche Krankenhaus ist immerhin billig.‹ Am darauffolgenden Montag hatte sich also der Dozent Doktor Mustafa İnan fünfunddreißig Lira von Professor Salih Murat Uzdilek geliehen und mich, seine Frau, aus dem Krankenhaus geholt.«
»Vielleicht hat so ein Leben auch etwas Schönes an sich«, sagte der Professor. »Vielleicht wird sogar eines Tages jemandem ein Preis überreicht, weil er der Wissenschaft einen Dienst erwiesen hat.« Er schaute den jungen Mann an: »Dir zum Beispiel.« »Wie bitte?«, horchte der junge Mann auf. »Was überreicht man mir?« »Den Preis für Verdienste um die Wissenschaft.« Der Professor drohte ihm mit dem Finger: »Es reicht aber nicht, wenn du dich in deinem Zimmer einschließt und in Büchern vergräbst, du musst auch eine Schule begründen.« »Ach, richtig, Sie wollten mir doch erklären, was das heißt, eine Schule zu begründen.« Der Professor stand auf. Sie gingen schweigend eine Weile nebeneinander her. »Ich weiß nicht recht, wie ich es erklären soll. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel bemühe, dir die Vorteile eines Wissenschaftlerdaseins aufzuzeigen, versuche ich vielleicht schon im Kleinen, eine Schule zu begründen, oder?« »Wie?«, fragte der junge Mann. »Könnten Sie mir das bitte etwas genauer erklären?« »Mit Vergnügen«, meinte der Ältere und hängte sich bei dem Jüngeren ein. »Setzen wir uns doch in irgendein Café, was hältst du davon?« Den jungen Mann überkam ein Gefühl von Schüchternheit. Ich kenne die Sitten der Städter nicht, dann würde ich Sie vielleicht eines Tages stören, das sollte ich wahrscheinlich sagen. »Hab keine Angst«, beschwichtigte ihn der Professor, als hätte er seine Gedanken erraten. »Ich fühle mich nicht gestört, und das Geld kommt auch von mir.« »Das wollte ich doch gar nicht sagen …« Der Professor lachte: »Das wäre ja noch schöner! Der Vorschlag kam doch von mir, das heißt, ich will dich beunruhigen, mit anderen Worten, ich will dich für die Wissenschaft begeistern. Wenn mir das gelingt, werde ich mir gleich selbst einen Preis stiften.«
Zuerst aßen sie Kuchen und tranken Tee. »Das ist eine wichtige Frage«, begann der Professor. »Ich sollte nicht mit der Tür ins Haus fallen und dir einen Schrecken einjagen. Mustafa würde es genauso machen, doch er hätte dir nicht so geradeheraus erklärt, was dich erwartet.« »Sie machen sich doch nicht etwa über mich lustig?« Der Professor runzelte die Stirn: »Gibt es vielleicht etwas Ernsteres als dieses Thema? Es reicht schon, wenn du meine Worte ernst nimmst, denn du kannst nicht alles sofort und auf einen Schlag begreifen. Um dich für die Wissenschaft zu interessieren, muss man angemessen vorgehen. Wir sollten im Leben der Menschen etwas finden, das über Klatschgeschichten hinausgeht, nicht wahr?«
»Ja«, antwortete der junge Mann. »Also gut, dann hör mir mal zu: Als Mustafa İnan seinen Doktor gemacht hatte und aus der Schweiz zurückgekehrt war, wurde er zum Assistenten für Technik, Mechanik und Widerstand an der Fachhochschule für Ingenieure ernannt. Im selben Jahr, das heißt 1944, als die Fachhochschule für Ingenieure zur Technischen Universität von Istanbul erhoben wurde, beförderte man ihn zum Dozenten. Eigentlich reicht Mustafa İnans Lehrtätigkeit, wenn man so will, weit in seine Vergangenheit zurück: Schon zu Studienzeiten, als er noch im dritten Studienjahr war, stellte Kerim Erim, der Mathematikprofessor, Mustafa, den er sehr mochte, seinen Kollegen als ›meinen Dozenten‹ vor. Schließlich war Mustafa İnan wirklich Dozent geworden, aber die Bedingungen hatten sich nicht wesentlich geändert: Er begann in dem kleinen Mechanikraum zu arbeiten, in dem er zusammen mit den Assistenten saß. Wie anders waren doch die Voraussetzungen in der Schweiz gewesen, als er dort seinen Doktor machte! An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich hatte er jahrelang in den weiträumigen Laboratorien Versuche gemacht und weiter an seiner Dissertation gearbeitet. Hier aber gab es kein Labor oder dergleichen, noch nicht einmal für jeden ein Zimmer. Der Name hatte sich geändert, ja, aber das hier war noch immer die Ingenieursschule. Doch Mustafa İnan wollte für frischen Wind sorgen. Er wollte, dass aus der Fachhochschule wirklich eine Technische Universität würde, wollte, dass man Lehrstühle einrichtete und sich der Forschung widmete. Die Mitglieder des Lehrkörpers sollten sich auch daran gewöhnen, Forschung zu betreiben. Damals wusste Mustafa vielleicht nicht genau, was eine Schule war, vielleicht aber begründete er sogar die erste Schule zusammen mit seinen Assistenten in dem kleinen Mechanikraum, und dort impfte er Bekir Tekinalp und İlhan Kaya ein, wie wichtig es ist zu forschen. Andererseits begann er auch, die ersten Seminare an der Universität durchzuführen. Und an der Universität war er der erste Professor, der einen Doktortitel vergab. In den Seminaren zur Angewandten Mechanik, die er bis an sein Lebensende mit großer Sorgfalt abhielt, brachte er nicht nur den Studenten und Assistenten, sondern sogar den Professoren etwas bei.«
»Und dann?«, fragte der junge Mann. »Nichts weiter«, antwortete der Professor. »Das ist es erst einmal. Jetzt hast du alles über Mustafa İnan erfahren.« »Das mag ja sein, aber …«, wandte der junge Mann aufgeregt ein. Der Professor lachte: »Was hast du denn erwartet? Wolltest du etwa in einer halben Stunde alles über den herausragenden Mustafa İnan hören? Das ist ein weites Feld, und vielleicht interessiert es dich ja gar nicht wirklich.« »Doch, auf jeden Fall! Bitte, erzählen Sie doch.«
»In jenen Jahren, das heißt, in den ersten Jahren an der Technischen Universität, versammelten sich die Lehrer in der Regel nach dem Mittagessen in Mustafa İnans kleinem Raum und diskutierten über Probleme des Ingenieurwesens. Viele Themen für Dissertationen und Forschungsarbeiten wurden im Laufe dieser Gespräche gefunden. Der berühmte Mathematiker Cahit Arf war auch bei diesen Versammlungen. Mit diesem Mathematiker verstand sich Mustafa am besten. Ich glaube, Mustafa İnan hatte einst auch Mathematiker werden wollen. Daher bestand er wahrscheinlich auf der wichtigen Rolle der Mathematik für die Mechanik. Eines Tages sagte Cahit Arf zu Mustafa İnan: ›Nenn mir doch mal ein Problem des Ingenieurwesens, aber eines im Bereich der Mathematik.‹ Mustafa berichtete Cahit Arf von einem Thema, das er untersucht hatte, als er an seiner Dissertation gearbeitet hatte. ›Ich habe schließlich auch ein paar Kurven gefunden‹, hat mir Cahit Arf berichtet. ›Mustafa war ganz begeistert und ließ seine Assistenten sofort die Kurven zeichnen. Als sie sich als die gleichen herausstellten wie jene Kurven, die er bei seinen Versuchen in der Schweiz entdeckt hatte, freute er sich sehr.«
Der Professor hielt inne. »Was ist?«, fragte der junge Mann. »Ich habe an Mustafa gedacht, und mir ist eingefallen, wie interessant er den Stoff dargestellt hat. Wenn er jetzt all dem zuhören würde, was ich erzähle, gefiele ihm das bestimmt nicht. Moment mal, würde er sagen, lasst mich mal die Geschichte erzählen.
Obwohl Cahit Arf in den von Mustafa gehaltenen Seminaren zu erklären versuchte, wie er das erwähnte Problem gelöst hatte, bemerkte Mustafa İnan, dass niemand so recht verstanden hatte, worum es eigentlich ging. ›Ich redete nicht so, dass die Assistenten und Studenten es verstanden‹, erzählte Cahit Arf die Geschichte. ›Erst als Mustafa aufstand und ihnen unsere Kurven erklärte, begriffen sie es.‹ So war es in vielen Seminaren. Im Allgemeinen bereiteten die Assistenten die Themen vor; zum Schluss stand Mustafa İnan auf, stellte Fragen, tat so, als habe er ein paar Punkte nicht begriffen, beantwortete die Fragen, die er gestellt hatte, wiederum selbst und fasste das Thema zusammen. Sogar der Assistent, der das Seminar vorbereitet hatte, lernte den Stoff dabei erst richtig.
Professor Günay Özmen, einer der ehemaligen Studenten Mustafas, sagt, er habe in diesen Seminaren auch sehr viel gelernt. ›In den Sechzigerjahren hörte man im ganzen Land zum ersten Mal von elektronischen Rechenmaschinen; sie wurden die Lehrer. 1962 führte Mustafa İnan ein Seminar über numerische Rechenmethoden durch und erläuterte uns die Grundlagen des Themas. Als dann seine ehemaligen Studenten, Şenol Utku und Canap Oran, die damals an der Technischen Universität des Nahen Ostens in Ankara arbeiteten, nach Istanbul kamen, um Vorträge über den praktischen Umgang mit elektronischen Rechenmaschinen zu halten, war Mustafa Hoca so begeistert wie kein anderer. Die Vorträge wurden in einem kalten Saal der Universität gehalten. Professor Doktor Mustafa İnan saß im schwarzen Wintermantel in der vordersten Reihe und lernte diesen neuen Stoff von seinen ehemaligen Studenten. Wie ein Professorenkollege sagte, freute er sich wie ein Kind, dass die elektronische Rechenmaschine Einzug in die Universität hielt.‹
Wenn es mir gelungen ist, dir diese Begeisterung und Freude zu erklären, habe ich dir Mustafa İnan hoffentlich ein wenig nähergebracht«, sagte der Professor. »Wenn seine Assistenten ein Problem lösten, das er ihnen vorgelegt hatte, freute Mustafa sich viel mehr darüber als sie. ›Sehr schön!‹, pflegte er zu sagen, ›da will ich doch gleich ein Seminar zum Thema vorbereiten.‹ Mustafa fürchtete sich nicht davor, dass seine Studenten ihn eines Tages überflügeln könnten. Manche Professoren leben mit dieser Angst. Vielleicht sammelten sich sogar deshalb die begabtesten Schüler um Mustafa İnan und ermöglichten ihm damit, im Fach der Angewandten Mechanik eine Schule zu gründen.« Der Professor sah dem jungen Mann ins Gesicht. »Bitte?«, sagte der junge Mann. »Ich schaue nur, ob sich Anzeichen der Begeisterung bei dir zeigen.« »Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, vielleicht ist das die Nachwirkung der Feier.« »Dann sollten wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wie manche Metalle erwärmen sich unsere Leute schnell und kühlen sich auch rasch wieder ab. Ich habe ein paar Dokumente von und über Mustafa. Wenn du willst, können wir uns mal gründlich mit diesem Thema befassen.« »Aber gern«, antwortete der junge Mann.
2
Die ersten Jahre
Mustafa İnan wurde nach Auskunft seiner Ehefrau, der Archäologin Jale İnan, am 24. August 1911 in Adana geboren.« Der Professor blätterte die Papiere vor ihm durch; sie saßen in seinem Arbeitszimmer. »Mustafa hat jedoch im Vorwort seiner Doktorarbeit, die er in Zürich verfasste, Folgendes geschrieben: Ich, Mustafa İnan, bin am 2. April 1911 als Sohn von Hüseyin und Rabia in Adana/Türkei zur Welt gekommen. Da auf der Geburtsurkunde nur das Jahr 1327, will sagen 1911, steht, muss man sich mit Vermutungen begnügen, an welchem Tag er wirklich auf die Welt gekommen ist. Außerdem hat Jale Hanım von Mustafas Mutter gehört, dass er drei Tage vor dem Ramadan geboren wurde. Mit dem genauen Geburtsdatum in seiner Doktorarbeit wollte Mustafa İnan womöglich vertuschen, dass unsere Geburtsurkunden nicht korrekt ausgefüllt werden.
Sein Vater stammte aus der Familie der Hacı Müminler, das heißt der frommen Mekkapilger aus Malatya. Die Großväter von Hüseyin Avni Bey gehörten zu den Honoratioren der Stadt. Der Namensgeber der Familie, Hacı Mümin, hatte das Amt eines Vali in Malatya inne. Man sagt, in der Stadt gebe es eine Inschrift auf einem Brunnen, die seinen Namen trägt. Hüseyin Avni Bey war der Jüngste einer kinderreichen Familie.« Der Professor zeigte dem jungen Mann den Stammbaum der Hacı Müminler. »Da sind sie also, die Müminler, das heißt die Gläubigen. Bei den Hacı Müminler handelte es sich um eine tiefreligiöse Familie. Nachdem das Gesetz zur Einführung der Familiennamen 1934 in Kraft getreten war, sollen einige von ihnen Bedenken gegen das Wort İman, Glaube, gehabt haben. Und schau nur, was der Verwandte, der diese Ahnentafel hier geschickt hat, schreibt:
›Mit dem Gesetz zur Einführung der Familiennamen, das jeglicher wissenschaftlichen Grundlage entbehrt und nur dazu beiträgt, das Volk von seiner Familientradition zu entfremden, und auf der Welt nur in den Ländern angewandt wird, wo man unter einem unglückseligen Regime lebt, in dem der Kommunismus herrscht, wurden unsere Familiennamen geändert. Wir haben in dem auch euch bekannten Wörterbuch nachgeschlagen und den Familiennamen İNAN angenommen, der MÜMIN entspricht.‹
Dieser Beyefendi gehörte zu den Enkeln der zweiten Generation des Hacı Mümin, sie nannten sich schließlich Müminoğlu, das heißt, die Söhne von Mümin. Hüseyin Bey dagegen, Mustafas Vater und einer der Enkel von Hacı Hasan, war aufgeschlossener; seine Familie soll die türkische Form des Namens, die etwa ihrem Beinamen Müminzade entsprach, nämlich İnan, gewählt haben. Wahrscheinlich übten die großen Brüder in Malatya zu viel Druck auf Hüseyin Avni aus, sodass er schließlich in jungen Jahren vor seiner Familie aus Malatya floh. Er war ein sensibler junger Mann. Er wird bestimmt nicht gegen die Einführung der Familiennamen und weitere ›Erfindungen der Ungläubigen‹ gewesen sein. Und als er dann seinen Militärdienst in Istanbul in der Kaserne von Selimiye leistete, hat er beim drahtlosen Funkdienst gearbeitet und diese ›gottlose‹ Erfindung ziemlich gut kennengelernt. Schließlich hat er sich auch noch neben dem Morseapparat in Uniform fotografieren lassen.
Hüseyin Avni Bey ließ sich in Adana nieder und ging nie wieder nach Malatya. Daher führte er ein hartes Leben und hatte immer nur mit Mühe und Not sein Auskommen. Trotzdem kehrte er nie zu seiner Familie zurück. Nachdem er den Militärdienst beendet hatte, heiratete er 1898 Rabia Hanım, die Tochter von Hafız Bekir aus Pozantı. Rabia Hanım war damals erst dreizehn Jahre alt. Hüseyin Avni machte sich das Handwerk, das er beim Militär gelernt hatte, zunutze und fand eine Arbeit als reisender Postbeamter. Er verbrachte sein Leben auf den Postfrachtwaggons der Züge und verteilte Pakete auf Bahnhöfen. Viele von Avni Beys und Rabia Hanıms Kindern, die vor Mustafa geboren worden waren, starben früh. Als Mustafa das Licht der Welt erblickte, waren nur zwei Mädchen am Leben geblieben: Emine und Zübeyde. Nach Mustafa kamen noch Güzide, Mehmet und Sami auf die Welt. Es war ein Wunder, dass der kleine Mustafa überlebte, denn das Überleben der Kinder in Anatolien kam – vor allem damals – einem Wunder gleich. Krankheiten und Unfälle folgten aufeinander. Und dann fiel der kleine Mustafa im Alter von vier Jahren auch noch vom Dach.«
»Er ist vom Dach gefallen?«, fragte der junge Mann. »Ja, wirklich, so war es. Du weißt doch, im Sommer herrscht in Adana drückende Hitze. Der Seyhan, der Fluss, der die Stadt im Frühling reichlich mit Wasser versorgt, versiegt dann im Sommer fast ganz; im fast ausgetrockneten Flussbett tummeln sich dann ein paar Hundert Büffel. Die Reichen flüchten auf die kühle Hochebene. Die Armen aber schlafen bei dieser Hitze im Freien auf den flachen Dächern ihrer Häuser. Und Mustafa konnte in so einer Nacht in seinem auf dem Dach ausgebreiteten Bettlager einfach nicht einschlafen. Die Augen taten ihm weh. Seine Mutter hatte ihm ein Hausmittel in die Augen geträufelt und ihm die Augen verbunden. Doch diese Binde war dem kleinen Mustafa lästig. Mit den ersten Strahlen der Morgensonne stand er auf, und noch ganz schlaftrunken wollte er ein bisschen umherlaufen. Rabia Hanım war auch früh auf den Beinen. Um all die Arbeit zu bewältigen, die in einer so großen Familie anfiel, musste sie vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung arbeiten. Vielleicht war sogar wieder Waschtag, einer der Tage, die Mustafa ein Leben lang ein Graus waren. Seine Mutter kehrte im Haus das Unterste zuoberst, um die schmutzigen Wäschestücke zu finden, und vor lauter schmutziger Wäsche konnte man sich nicht rühren. Mustafa fürchtete sich vor diesem Durcheinander. Jale Hanım erwähnt sogar, dass Mustafa auch später an den Waschtagen überhaupt nicht nach Hause kam. Vielleicht hatte er sich sogar als Reaktion auf dieses Durcheinander das Prinzip der geregelten Lebensweise angeeignet, an das er sich sein Leben lang hielt, weil ihm als Kind dieses Chaos einen Schrecken eingejagt hatte, wer weiß?
Als Rabia Hanım gerade das Haus aufräumte, sah sie auf einmal zufällig zum Fenster hinaus: Da fiel etwas vom Dach. Der kleine Mustafa hatte nicht sehen können, dass das Dach zu Ende war, weil ihm ja die Augen verbunden waren. Rabia Hanım sprang auf und rannte hinaus: Mustafa lag ohnmächtig vor der Tür. ›Da haben also alle Mühen nichts genützt: die Ohrringe, die man ihm angesteckt hatte, um, vor wem nur?, zu verbergen, dass unser Kind ein Junge war, so zu tun, als freute man sich nicht … Selbst die schwarze Decke, die ich auf mein Wochenbett gelegt habe, hat nichts gebracht‹, jammerte sie. Die Nachbarn kamen angerannt, um der Mutter beizustehen, die schrie, als würde sie einen Toten beklagen. Sie hoben Mustafa hoch und brachten ihn zum Arzt. Die Wunden des Jungen wurden genäht und verbunden. Trotzdem kam Mustafa nicht zu sich, und man hatte die Hoffnung auf sein Leben aufgegeben.«
Der Professor blickte dem jungen Mann ins Gesicht: »Wenn Mustafa İnan damals gestorben wäre, hätten wir vielleicht jahrelang keine gute Lehre im Bereich der Mechanik gehabt. Vielleicht hätten wir uns gestern auch gar nicht kennengelernt, vielleicht wären wir einander nie begegnet, wer weiß? Damit will ich sagen, dass in unserem Land alles an einem seidenen Faden hängt. Wie viele Mustafa İnans sind vielleicht gar nicht wieder zu sich gekommen, nachdem sie vom Dach gefallen waren, vielleicht sind viele sogar noch früher, schon bei der Geburt oder kurz danach, gestorben?« Mit leisem Spott schaute er den jungen Mann an und lächelte: »Wie vielen Mustafa İnans ist es möglicherweise noch schlechter ergangen, auch wenn sie unvorhergesehene Unfälle überstanden haben, nur weil sie nicht wussten, was sie anfangen sollten. Was meinst du?« Der junge Mann war tief beeindruckt: »Hat Mustafa İnan sich denn erholt?«, fragte er. Der Professor antwortete betrübt: »Wer weiß? Möglicherweise hat er sein Leben lang an den Folgen dieser Erschütterung gelitten. Vielleicht wurde er deswegen so oft krank, hatte daher eine so schwache Konstitution und war schnell erschöpft. Vielleicht konnte er auch deshalb nie ein vollkommen gesunder Mensch werden.
Als Hüseyin Bey jedenfalls seinen Sohn bewusstlos am Boden liegen sah, murmelte er: ›Aus diesem Jungen wird nichts Rechtes mehr. Was ist dem Kind passiert, Frau?‹ Rabia Hanım wollte den Vorfall vor ihrem Mann geheim halten. Sie machte sich für Mustafas Sturz verantwortlich und dachte: Wenn ich ihm nicht die Augen verbunden hätte, wäre der Junge nicht vom Dach gefallen. Mit den Nachbarn hatte sie sich abgesprochen. ›Mustafa ist die Treppe hinuntergefallen, Mann.‹ Mustafas Vater glaubte dieses Märchen nicht. Er wusste, was passiert war: ›Aus diesem Jungen wird nichts mehr‹, wiederholte er. Mustafa fiel nicht noch einmal vom Dach, und wenn Rabia Hanım ihre Kinder nach diesem Vorfall auf dem Dach schlafen legte, dachte sie immer daran, ihnen die Füße ans Bett zu binden.
Später wurde der kleine Mustafa zwar wieder gesund, aber er litt noch lange an der Gehirnerschütterung. Wenn er beim Rennen stolperte und hinfiel oder sich irgendwo leicht mit dem Kopf anstieß, hatte er sofort Nasenbluten, und das Bluten war kaum zu stillen. Daher hatte seine Mutter den Lehrer an Mustafas erstem Tag in der Schule des Stadtviertels angefleht: ›Was auch immer passiert, schlagen Sie meinen Jungen nicht!‹ Mustafa war ein braves Kind, warum sollte der Lehrer ihn schlagen? Der Lehrer richtete sich, wenn es ums Prügeln ging, sowieso nicht danach, ob die Kinder ungezogen waren; Prügeln war Gewohnheit. Der Junge trägt noch einen dauernden Schaden davon, sagte man, ist er nicht sowieso nur Haut und Knochen? Der Lehrer aber sorgte immerhin dafür, dass Mustafa sich ganz hinten anstellte, wenn er einen nach dem anderen verprügelte; nachdem jeder seine Hiebe bezogen hatte und gegangen war, schickte der Lehrer auch Mustafa nach Hause, ohne ihn zu schlagen. Die Kinder durften nicht sehen, dass Mustafa keine Prügel bezog, damit die Ordnung der Klasse nicht durcheinandergeriet.
Die bedrückende Zeit in der Schule des Viertels hielt nicht lange an; über neuen Bedrängnissen vergaß Mustafa die Angst vor dem Lehrer. Im Jahr 1914, das heißt, als Mustafa İnan drei Jahre alt war, hatte der Erste Weltkrieg begonnen, und im Jahr 1918, als Mustafa sieben Jahre alt war, besetzten die Franzosen die Stadt Adana, die ihnen später entsprechend dem Vertrag von Sèvres zugesprochen wurde. Mit dem Krieg hatten die Jahre der Not und Armut begonnen. In Hüseyin Avnis Familie mit den vier Kindern wuchs auch nach und nach die Sorge um das tägliche Brot. Trotzdem versuchte man, Mustafa die Härte der Kriegsjahre nicht spüren zu lassen. Vielleicht wollte man es Mustafa an nichts fehlen lassen, weil man sah, dass er eine äußerst zarte Konstitution hatte, vielleicht aber auch, weil abzusehen war, dass er trotz der falschen Voraussage seines Vaters ›ein ordentlicher Mensch‹ werden konnte. Seine Schwester Güzide weiß zu berichten, dass ihm so manches Privileg gewährt wurde.
›Nur mein großer Bruder Mustafa durfte so viele Zuckerstücke in seinen Tee tun, wie er wollte. Und Mustafa mochte Süßes sehr gern. Wenn er müde wurde, ging immer eine meiner großen Schwestern mit, weil er Angst davor hatte, allein aufs Dach zu klettern und sich schlafen zu legen.‹ Wegen des Kriegs und der bitteren Armut konnte Mustafa seine Kindheit nicht ausleben. Außerdem war er still und besonnen; seit seiner Kindheit soll er so gewesen sein. ›Nie hat jemand gesehen, dass mein großer Bruder je durch den Garten gerannt wäre.‹ Sogar in den ersten Jahren der Kindheit soll er ein braver, kluger ›Mustafa Bey‹ gewesen sein. ›Wenn man neue Kleider bekam, freute sich mein großer Bruder Mustafa nicht besonders. Er mochte es nicht, wenn man sich zur Schau stellte.‹ Wenn er einen neuen Anzug erhielt, soll er sich eine Weile gescheut haben, ihn anzuziehen, und dann Jacke und Hose einzeln getragen haben.
Seinen Vater sah er nur selten; Hüseyin Avni Bey war sein ganzes Leben lang unterwegs. Vielleicht war der kleine Mustafa daher auch ein wenig still und traurig. Er sehnte sich sehr nach seinem Vater, und an den Tagen, an denen er nach Hause kommen sollte, ging Mustafa schon früh zum Bahnhof. Die Züge hatten damals oft Verspätung. Stundenlang wartete Mustafa im Wartesaal auf seinen Vater und nickte dabei ein. Hüseyin Avni, der müde und abgespannt aus dem Zug stieg, schalt seinen Sohn dann aus Spaß: ›Hast du etwa wieder mal nicht genug geschlafen? Aus dir wird nie was Rechtes!‹ Ins Gespräch vertieft – der eine nahm Anteil an den Sorgen des anderen – kehrten dann zwei erwachsene Männer heim.
Auch an dem Tag, als die Franzosen Adana besetzten, reiste Hüseyin Avni Bey in dem kleinen Waggon, der an den Postzug angehängt war, von einem Bahnhof zum anderen. In den ersten Tagen der Besatzung kam sein Zug in Konya an. Rabia Hanım war in dem ärmlichen Haus ohne Mann und ohne Geld geblieben. Wer auch immer eine Möglichkeit fand, floh aus der Stadt. Wer diese Zeiten erlebt hatte, sprach von der Flucht als ›Nichts wie weg!‹. Rabia Hanım hatte es sehr schwer. Die paar Kuruş, die ihr Mann bei der Abreise dagelassen hatte, hatte sie aus Angst, dass mit den Franzosen auch der Mangel einkehren würde, für Lebensmittel ausgegeben, und sie war gerade mit ihrem zweiten Sohn Mehmet, den Hüseyin Avni Bey noch gar nicht gesehen hatte, niedergekommen. Sie war vollkommen mittellos und erschöpft.«
Der Professor seufzte. »Wie ich schon sagte, waren das keine Zeiten, in denen die Kinder auf den Straßen herumtollten und ihre Kindheit genießen konnten. In Mustafas Familie lebte jetzt noch ein Mehmet in Windeln, ein zweites männliches Wesen nach Mustafa, und niemand in dem kleinen Haus besaß einen einzigen Kuruş. Den Franzosen ging es da schon besser. Der Kommandant der Besatzungstruppen logierte eine Straße weiter in einem großen, stattlichen Haus. Der kleine Sohn des Kommandanten langweilte sich so ganz allein in dem riesigen Gebäude, er suchte Anschluss an die Kinder im Viertel und wollte mit ihnen spielen. Niemand ging zu dem Jungen in der ungewohnten Kleidung, der aus einer anderen Welt zu kommen schien. Die Frau des französischen Kommandanten schickte ihren Sohn am nächsten Tag mit einer Kuchenschachtel los. Den Kuchen aßen die Kinder zwar nicht, doch sie nahmen die Schachtel an sich, um sich dem Jungen gegenüber nicht ungehörig zu zeigen. Das war der Feind, sagte man ihnen, und was die Feinde verschenkten, sei vergiftet. So wie er war, wurde der Kuchen auf den Müll geworfen. Vor dem Feind musste man fliehen, in der Gegend hier war kein Bleiben mehr. Und dennoch war es genauso gefährlich zu fliehen, wie in Adana zu bleiben: Durch die Straßen zogen Banden der nichtmuslimischen Minderheiten und Räuber.« Der Professor dachte eine Weile nach. Schließlich fragte er: »Verstehst du, warum bei uns nicht so ohne Weiteres ein Wissenschaftler heranwachsen kann? Siehst du, was der Wissenschaft schon in jungen Jahren widerfährt? Da war also die Heimat der Gelehrsamkeit, der Westen, nach Adana gekommen und spendierte überdies den kleinen Kindern nicht nur Kuchen. Da die Truppen der Nationalen Befreiungsbewegung mit dem Aufstand gegen den Feind begonnen hatten, bombardierten Flugzeuge Straßen und Dörfer. Noch bevor Mustafa die Schule im Stadtviertel abgeschlossen hatte und die Furcht vor der Prügelstrafe nicht mehr länger nötig war, regte sich bei ihm die Angst vor dem Feind. Kannst du dir einen Newton in der Vorschule vorstellen, wie er mit der Angst vor Schlägen, mit dem Alphabet und den Wörtern einer Sprache kämpft, die er nicht versteht? Oder kannst du dir Leibniz vorstellen, wie er als Vierjähriger vom Dach fällt?« »Wer ist dieser Leibniz?«, fragte der junge Mann. »Ein großer Mathematiker«, murmelte der Ältere. Dann wurde er wütend: »Ich weiß nicht, warum man in der Schule nicht von solchen Menschen spricht. Warum erzählt man den Kindern nichts von Gauß und Pascal, statt ihnen Alexander den Großen und Napoleon als Vorbild hinzustellen?« Er lachte: »Als ich Gauß sagte, fiel mir gerade ein, dass er als kleiner Junge in den Graben vor dem Haus seiner Eltern gefallen ist. Was wäre damals aus der Mathematik, was wäre aus der Physik geworden, wenn ihn nicht ein gerade vorbeikommender Bauer gerettet hätte?« Dann wurde der Professor wieder ernst: »Als Leibniz aber so alt war wie Mustafa, las er lateinische und griechische Gedichte aus dem Bücherschrank seines Vaters und drechselte lateinische Verse. Mustafa jedoch erlebte die Hast und Aufregung der Flucht vor den Franzosen aus Adana.
Überlassen wir die europäischen Gelehrten sich selbst und kommen zu unserer Geschichte zurück: Rabia Hanıms älteste Tochter Emine hatte sich mit ihrem Mann dem Flüchtlingstreck angeschlossen. Da sie bei ihrer Abreise aus Adana ihrer Mutter etwas Geld dagelassen hatte, begann man sofort mit den Vorbereitungen für die Flucht. Wir wissen nicht, was Mustafa in der Zeit machte, als seine Mutter in der Küche den Teig für die lange Reise knetete, die am nächsten Tag beginnen sollte. Ganz gewiss rezitierte er keine Gedichte von Vergil, und er hatte auch keine Ahnung von den Ghaselen des Fuzûlî. Ob er die Welt mit anderen Augen gesehen hätte, wenn er den Vers
Dost bî-perva felek bî-rahm devrân bî-sükûn
Dert çok hem-derd yok düşman kavi tâli’ zebûn
gekannt hätte, als er sich in der Morgendämmerung den Brotbeutel auf den Rücken lud?« »Was ist denn das?«, fragte der junge Mann. Der Professor lachte: »Ist das denn die Möglichkeit? Kennst du den Vers wirklich nicht? Als Mustafa am ersten Morgen mit dem Treck zur großen Ebene von Adana wanderte, hatte er noch nichts von Fuzûlî gehört, doch als er in deinem Alter war, trug er viele seiner Ghaselen fließend auswendig vor. Als er das Gymnasium abschloss, war er einer der glühendsten Verehrer der Diwan-Literatur. »Was sagt Fuzûlî denn?«, fragte der junge Mann.
Gleichgültig der Freund, ohn’ Erbarmen der Himmel, unstet die Zeit.
Groß das Leid, kein Mitfühlender weit und breit.
Der Feind kennt nur Gewalt, das Glück keinen Halt.
Mustafas große Schwester Zübeyde hatte den Wäschebeutel auf dem Rücken, und Güzide trug den Proviantkorb. So brachen sie auf. Mehmet, aus dem später auch ein Professor werden sollte, lag in den Armen von Rabia Hanım. Sie hatten keine Kleider mitgenommen, damit sie ihnen nicht zur Last fielen.
Wie Mustafas Mutter Jahre später erzählte, war die Lage verworren: ›Flugzeuge schwirrten durch die Luft, da machten wir uns also zu Fuß auf den Weg und kamen zur großen Ebene. Dort lagerten wir auf dem Erdboden. Und weinten und weinten. Meine Mutter, Gott hab sie selig, ging zurück. Sie warf einem Esel die Satteltasche über, steckte dann die Bratpfanne und den Topf rein, warf noch drei Teppiche drüber und führte ihn zur Ebene. Den Esel mietete sie, sie hatte gehört, dass die Franzosen überall auf den Straßen auf Posten stehen.‹
Die Karawane, die sich unter der Führung der Großmutter gerade auf den Weg machte, hatte wahrscheinlich alles Nötige dabei. Mustafa jedoch sprang plötzlich von seinem Platz auf und rannte nach Hause. Er kam mit einem Napf, das heißt, mit einer Schale in der Hand zurück. ›Mein Junge, was willst du damit machen?‹, fragte seine Mutter. ›Woraus sollen wir denn sonst unterwegs Wasser trinken?‹, erwiderte er. Der Napf war ihnen später wirklich sehr nützlich.
Ein paar Tage lang schliefen sie in der Ebene im Freien, dann kehrte die Großmutter nochmals nach Hause zurück und bat den Fuhrmann, der den Nachbarn zur Flucht aus der Stadt verholfen hatte: ›Bring uns nach Konya.‹ Sie wollten zu Hüseyin Avni Bey fahren. ›Gute Frau‹, antwortete der Fuhrmann, ›wo liegt Adana und wo Konya?‹ Schließlich willigte er ein, und die Familie İnan, die in der Ebene auf der Erde gelagert hatte, bestieg den Ochsenkarren. Der Wagen brachte sie bis Dikili. Dort trafen sie zufällig einen ihrer Bekannten: ›Ich kann doch nicht mit einem Mann reden, kein Wort darf ich sagen. Mein Bruder, fragte ich ihn schließlich, wo wohnt ihr? Sie wohnten in den Weinbergen.‹ Sie ließen den Ochsenkarren dorthin ziehen und übernachteten in einem Haus, das ein Dorfbewohner verlassen hatte, als er geflohen war. Am nächsten Tag hörte man von Weitem ein Dröhnen: ›General Sinan kommt‹, sagten die Dorfbewohner. Vor lauter Aufregung rannte Rabia Hanım mit dem Kind auf dem Arm dorthin, wo die Freiheitskämpfer waren: ›Da sahen wir, dass die Soldaten Berittene waren. Alle sind ins Tal hinuntergerannt. Auch Flüchtlinge aus Van waren da. Wir haben keinen Mann, der uns beschützt, sagte ich, er ist in Konya. Gebt uns eine Genehmigung für den Zug, sagte ich, ach was, für den Transport auf einem Reittier, das heißt, fürs Maultier. Sie stellten uns so ein Dokument aus.‹ Der Familie İnan wurden zweieinhalb Maultiere zugestanden; das heißt, auf der Hälfte des dritten Maultiers ritten Flüchtlinge aus Van. ›Mit Müh und Not stieg ich auf das Lasttier, Mustafa ließ ich hinten auf dem Maultier aufsitzen, mein Kopftuch nahm ich ab und band mir Mehmet damit ganz fest um die Taille.‹ Wieder brachen sie auf. Jetzt reisten sie mit der Order von General Sinan. ›Wie gut es doch war, dass wir uns an jenem Tag auf den Weg gemacht haben.‹ Sonst wären sie einen Tag später bei dem Bombardement durch französische Flugzeuge ums Leben gekommen. Endlich kamen sie am Bahnhof an. ›Die Flüchtlinge aus Van stiegen in den Zug, doch uns nahm man das Dokument ab, das wir in der Hand hielten.‹ Sie waren alle erschöpft und wanderten ziellos durch die Straßen der Kleinstadt, ohne zu wissen, was sie tun sollten.
›Da gab es einen Zeitungsreporter, und die Kinder sagten zu ihm: Wir sind aus Adana, und unser Vater ist in Konya. Ich helfe euch, sagte der Journalist und sorgte dafür, dass man mit Konya telefonierte. Den Vater meiner Kinder habe ich das letzte Mal gesehen, als ich mit Mehmet im fünften Monat schwanger war.‹ Hüseyin Avni Bey war seit sechs Monaten unterwegs und hatte noch nicht einmal erfahren, dass er noch einen Sohn bekommen hatte. Mustafa und seine große Schwester Zübeyde fragten auf der Straße jeden, der ihnen über den Weg lief, nach ihrem Vater. ›Dein Vater hat sich aus Konya gemeldet‹, sagte man ihnen eines Tages. ›Am Mittwoch käme er mit der Post, habe er ausrichten lassen.‹
Hüseyin Avni Bey kam nicht an dem Tag, als man ihn erwartete, und es vergingen noch ein paar Tage. ›Meine Mutter, Gott hab sie selig, saß am Ufer des Flusses, stocherte mit einer Gerte im Wasser und weinte. Plötzlich sah die Großmutter Hüseyin Bey kommen. Meine Mutter weinte, und wir weinten.‹ Der Familienvater kümmerte sich um sie und brachte sie in einem schwarzen Waggon unter, in einem für vierzig Personen. Alle waren Flüchtlinge und in Schweiß gebadet. Das Käppi des Jungen klebte ihm vor Hitze am Kopf. ›Und wahrhaftig, was sahen wir denn da, als wir ihm das Käppchen abnahmen? Alle seine Haare waren daran festgeklebt. Wir hatten kein Wasser und nichts zu essen. Der Staat verteilte Maismehl an die Flüchtlinge. Was sollten wir denn mit Maismehl machen? Die Dorfbewohner hatten auch kein Mitleid, selbst als wir sie um eine Zwiebel für zwanzig Kuruş baten, gaben sie uns keine. Nun ja, wie auch immer, irgendwie gelangten wir nach Pozantı. Der Vater schaffte es, von den Leuten dort wieder eine Reisegenehmigung für den Zug zu bekommen, und wir fuhren umsonst.‹
Jetzt reisten sie also auf Samtpolstern«, erzählte der Professor weiter. »Als die Bahnbeamten sahen, dass die Familie İnan es sich auf den Samtpolstern bequem gemacht hatte, brüllten sie: ›Flüchtlinge in den schwarzen Waggon.‹ Sie zeigten ihnen sofort das Dokument. Auch Mustafa genoss es, wie die reichen Leute auf Samtpolstern zu reisen; darüber hinaus wurde ihm ein weiteres Privileg zugestanden: Er schlief im Bett seines Vaters im Postwaggon. Mit dem Zug erreichten sie Konya von Pozantı aus in drei Tagen; ihr Treck war fünfundzwanzig Tage unterwegs gewesen. ›Das Glück war uns wohl wieder günstig. Während wir auf den Vater warteten, schwirrten Flugzeuge durch die Luft. Dauernd kamen schlechte Nachrichten: Die Flugzeuge warfen Bomben ab, die Leute starben auf den Straßen vor Hunger und kamen beinahe um vor Durst. Der selige Mehmet Efendi starb unterwegs vor Durst, weil er zu dick war. Außerdem war da ein Mädchen namens Fatma, sie starb auch vor Durst, weil sie zu dick war. Gott sei Dank haben wir sie nicht gesehen.‹
In Konya blieben sie zweieinhalb Jahre. Mustafa wurde mit seinen Geschwistern in die Şehit-Muhtar-Bey-Schule geschickt. Mustafa İnan mochte Konya sehr. Er wanderte von Moschee zu Moschee und hörte sich die Predigten an, die auf Persisch gehalten wurden. Seit den Seldschuken, die einst das Persische als offizielle Staatssprache angenommen hatten, als sie in Iran herrschten, seit Mevlâna, der Türkisch und Persisch schrieb, lebten diese beiden Kulturen in Konya einträchtig miteinander.
Mein Gedächtnis ist nicht so gut, doch an einen Vers von Mevlâna erinnere ich mich«, sagte der Professor. »Er hat ihn in zwei Sprachen gemischt geschrieben; so etwas nennt man Mülemma, bunte Verse.«
Dâni ki men zi âlem yalguz seni severmin
Ger der berem neyâyi ender gamet ölermin.
»Zitieren Sie diese Zeilen, um mich durcheinanderzubringen?«, fragte der junge Mann. »Nein, mein Lieber. Wir wollen doch Mustafa ein wenig kennenlernen, oder etwa nicht? Würden wir nicht über die Diwan-Literatur sprechen, bliebe uns meiner Meinung nach eine wichtige Facette von Mustafas Persönlichkeit verborgen.« »Ganz bestimmt hatte er keine Ahnung davon, als er in Konya war«, meinte der junge Mann. »Doch, doch«, erwiderte der Ältere. »Die Predigten, die er hörte, lernte er auswendig, auch wenn er sie nicht verstand, vermutlich, weil er die Melodie der Worte liebte. Eines Abends wiederholte er die persischen Ausdrücke, die er an jenem Tag in der Moschee gehört hatte, Wort für Wort.« »Was ist denn der Sinn des Verses, den Sie zitiert haben?«, fragte der junge Mann. »Auch den Sinn dieser Zeilen habe ich auswendig gelernt:
Auf der Welt lieb ich dich allein, wie du weißt,
kämst du nicht zu mir, wär’ ich längst aus Gram um dich gestorben.
So heißt es in etwa auf Türkisch. Du weißt doch, wenn man Gedichte in eine andere Sprache übersetzt, wird nichts Rechtes draus.« »Sagen Sie mal«, wandte der junge Mann ein, als erinnerte er sich an ein bestimmtes Wort. »Soll das vielleicht heißen, dass Mustafa Hoca ein Mystiker war?« Der Professor lachte: »Warum sagst du das so, als würdest du den Namen eines exotischen Wesens in den Mund nehmen? Ja, Mustafa hat die mystische Wirkung Konyas vielleicht sein ganzes Leben lang gespürt. Er sagte oft, dass er am meisten von den Zeremonien des Mevlevî-Ordens beeindruckt war. Wenn er seinen Freunden vom Rauschen der wirbelnden Gewänder der Mevlevîs und der Schönheit der Rohrflötenmusik erzählte, schloss er immer die Augen. Und als Mustafa İnan eines Tages mit Professor Cahit Arf unterwegs war, fragte er ihn plötzlich wie aus heiterem Himmel: ›Cahit, glaubst du den Mystikern?‹ ›In dieser Zeit las er stets Yunus Emre‹, sagte mir Cahit Arf, der damals Mustafa antwortete: ›Nein, ich würde jedoch lügen, wenn ich sage, dass ich davon nichts wissen will.‹ Mustafa freute sich sehr über Cahits Worte.‹«
Der Professor blätterte wieder in den Papieren. »Da hat er also viele Jahre nach seinen Erlebnissen in Konya einen Text entworfen: Notizen über den Großen Arya-Dharma, den Hinduismus«, erläuterte der Ältere dem Jüngeren. »Die ›Glaubensfrage‹, in der Mustafa eine ›Seelenreinigung‹ sah, interessierte ihn sehr. In seinem Text hat er diese Begriffe auch unterstrichen sowie den Begriff ›Befreiung‹. Ich glaube, dass er auf seiner Indienreise genauer darüber nachgedacht hat. Ja, und da haben wir ja noch einen Text. Als Mustafa den Tempel der Göttin Lakschmi und ihres Gatten Vischnu besichtigte, gab man ihm einen Essay über dieses Thema zu lesen. Für Mustafa İnan war nichts ohne Bedeutung, und meiner Ansicht nach war keines seiner Interessen nur eine flüchtige Neigung. Schließlich hielt er einen Vortrag über das Thema Arya-Dharma.
In Konya interessierte sich der kleine Mustafa auch für andere Dinge. Den ganzen Tag schlenderte er durch die Straßen und schaute sich die Bauwerke aus der Zeit der Seldschuken an. Und eines Tages blieb sein Blick an einem Anschlag an einer Mauer hängen: Der Staat führte eine Beschneidungsfeier durch, und zwar für Flüchtlingskinder wie Mustafa. Er war augenblicklich begeistert. ›Ich bin neun Jahre alt und noch nicht beschnitten. Schließlich ist mein Vater auch nicht reich.‹ Mustafa Efendi war jetzt ein kleiner Mann, der einen reifen Eindruck machte, und manche Angelegenheiten konnte er nun selbst in die Hand nehmen. Er ging also los, um sich ganz allein für die Beschneidungsfeier eintragen zu lassen. Der Beamte, der für die Registrierung zuständig war, wunderte sich nicht darüber, dass dieser ernste kleine Herr mutterseelenallein kam, und fragte ihn auch nicht nach seinen Eltern. ›Zu Hause habe ich auch nichts gesagt‹, meinte Mustafa İnan. Vielleicht hätte man nicht gewollt, dass der Sohn als armseliges Flüchtlingskind zusammen mit den ärmlichen Kindern beschnitten würde. ›Erst am Tag der Beschneidungsfeier sagte ich der Familie Bescheid; und meine Mutter fing an zu weinen: Warum hast du das nicht früher gesagt, mein Junge? Ich hätte dir wenigstens ein Nachtgewand genäht.‹ ›Das verstehst du nicht, jetzt bin ich doch groß, und all das kann ich ganz allein erledigen. Du wirst sehen, sogar mein Vater wird bald einsehen, dass ich ein ordentlicher Mensch werde.‹
Die Familie kehrte noch lange nicht nach Adana zurück. Der Befreiungskrieg hatte begonnen. Mal kam der Grieche näher, mal zog er sich zurück; sie lebten ständig in Angst. So musste der im Jahr 1911 geborene Mustafa İnan außer der Armut des reisenden Postbeamten Hüseyin Avni, die er bis zum Alter von zwölf Jahren erduldete, auch zwei große bedrohliche Kriege miterleben. Dann war der Krieg zu Ende, die Armut allerdings blieb: Als sie nach der Ausrufung der Republik nach Adana zurückkehrten, fanden sie ihr Haus völlig leer vor. Man musste mit allem wieder von vorn beginnen. Mustafa musste noch die Grundschule abschließen. Zu Hause herrschte ein bedrückendes Klima, und außerdem machte Mustafa keine Hausaufgaben. Da niemand etwas von seinem außergewöhnlichen Gedächtnis wusste, schimpfte der Vater. Seit der Junge vom Dach gefallen war, war er wohl auch nicht wieder ganz genesen. Ja, aus diesem Jungen würde nie etwas werden. Er sollte wenigstens ein Handwerk lernen und auch etwas zum Haushalt beitragen. In den Schulferien gab man Mustafa, den zukünftigen Professor für Mechanik, einem Goldschmied in die Lehre, damit vielleicht doch noch etwas Rechtes aus ihm würde. Gott sei Dank hatte dieser Junge an allem Interesse. Die Goldschmiedekunst begriff er in kurzer Zeit und verdiente sich ein Taschengeld damit; hoffentlich würde er später einmal ein guter Juwelier werden und seinen Eltern Freude machen. Der Meister war auch mit dem Jungen zufrieden. Dennoch ging Mustafa abends früh zu Bett, vielleicht, weil er kränklich war? Er hatte sowieso kein Heft und kein Buch, wie sollte er denn überhaupt lernen? Hüseyin Avni Bey wurde wieder wütend: ›Aus diesem Jungen wird kein ordentlicher Mensch.‹ Mustafa zeigte seine Gefühle nicht, auch an seinem blassen Gesicht ließ sich kaum ablesen, was er fühlte. Wenn sein Vater ihn tadelte, lächelte er nur. Insgeheim war er aber bekümmert: ›Man tut mir Unrecht, den ganzen Sommer lang habe ich mich abgerackert, um etwas Rechtes zu werden, alles, was mir möglich war, habe ich getan, um das Juwelierhandwerk zu lernen.‹ Er liebte auch dieses Handwerk. Diese Welt war für ihn eine unerschöpfliche Quelle. Was er einmal gesehen hatte, vergaß Mustafa nie wieder.





























