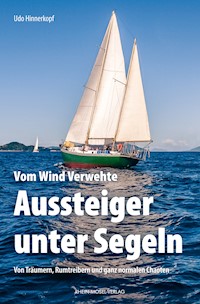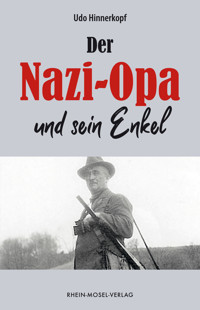
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für den 6-jährigen Holger wird die Flucht in einem Panzer aus dem zerbombten Dresden und die Ankunft auf dem Hof seines vom Nazi-Mythos besessenen Großvaters im Dorf auf der Hohen Rhön zum Alptraum. Monate nach Ende des NS-Reiches ist der Großvater noch immer Mitglied der Partei, die längst nicht mehr existiert. Als aktiver Anhänger des Systems glaubt er unbeirrt an die Genialität des Führers und hofft auf dessen Wiederkehr. Die Spuren des Krieges und die Zwänge durch den Nazi-Opa begleiten den Jungen auf seinem weiteren Weg. Wie er sich dem Einfluss durch den verhassten Großvater entziehen kann, wird ihm vom Schicksal abgenommen: Das Ende des Alten durch seine Pferde Max und Moritz ist selbstverschuldet und dramatisch. Die Erzählung ist keine Autobiografie, sie beruht aber zum großen Teil auf den Erlebnissen des Autors. Die Erinnerungen an das Leben unter der Fuchtel des Großvaters, werden von dem ehemaligen Kriegskind (Jahrgang 1938), aus der Sicht des distanzierten Erzählers geschildert und der Opa in seiner unerbittlichen Besessenheit dargestellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2023 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-942-2Lektorat: Gabriele Korn-SteinmetzAusstattung: Stefanie ThurTitelfoto: privat
Udo Hinnerkopf
Der Nazi-Opa und sein Enkel
Die größte Gefahr geht vom Vergessen aus.
»Das innerliche Miterleben dieser authentischen Erzählung kann eigene Erinnerungen wecken, ein größeres Verständnis bewirken und helfen, die eigene Seele freier zu machen.«
Renate Seehaus-MaucherPsychologische Psychotherapeutin
1. Das Ende
Johann Hardt war tot. Die Jagdgesellschaft stob entsetzt auseinander. Der Apotheker beugte sich über den leblosen Körper, befreite ihn vom Zügel, der sich um die Hand des Toten gewickelt hatte und zog ihn auf die Seite ins feuchte Gras. Dann trug er den Toten zu seinem verbeulten Vorkriegs-DKW und fuhr mit ihm ins Dorf zurück.
Dabei hatte der Tag gut begonnen. Es war die fünfte Jagd mit großer Gesellschaft nach dem Ende des Krieges. Auch im hohen Alter liebte der von seinen Pferden über den steinigen Boden zu Tode geschleifte Besitzer des Jagdreviers, der Großbauer und Gastwirt Johann Hardt, den Beginn der Jagdzeit im Herbst über alles, selbst wenn ihn mehr und mehr die Knie schmerzten und die Gicht plagte.
Die Kutsche, geputzt und geschmiert, stand auf dem Hof, die Schnapsfässchen und die Gläser im Mahagonikästchen waren unter den Sitzbänken verstaut. Max und Moritz, die beiden Pferde, mit Extrafutter versorgt und vor die Kutsche gespannt.
Zuvor hatte Opa Hardt angekündigt, diesmal wolle er seinen Enkel Holger zur Jagd mitnehmen. »Der Junge soll erleben, wie gejagt wird und wie man am Ende das erlegte Wild beim Verblasen der Strecke feiert und ehrt.«
Das hatte der zehnjährige Holger gehört, der oben auf der Treppe stand, die zum Haus hinauf führte.
»Nein, nicht!«, flehte er und rannte durch den Hausflur in den kleinen Garten hinter der Kegelbahn. Dort kroch er unter den Holunderbusch, seinen Zufluchtsort. Er warf sich auf den feuchten Boden und hämmerte mit den Fäusten auf die nach Moos und verwelkten Blättern riechende Erde.
Die Treibjagden fanden meist an Sonntagen statt; sie begannen um 9 und endeten gegen 15 Uhr. Da es im Herbst früh dunkel wurde, reichte das Büchsenlicht oft nicht mehr aus. Der Jagdleiter informierte die Treiber über die Verhaltensregeln: »So viele Hunde wie möglich, aber auch so wenige wie nötig.« Meist wurde das Wild vom einen Ende des Hochwaldes in Richtung der Jäger zum anderen Ende getrieben.
Diese Sonntage schätzten die Teilnehmer, insbesondere, wenn Opa Hardt als Besitzer des Reviers die Jagd organisiert hatte, mit seiner Kutsche zum Endpunkt gefahren kam und seine Schnäpse und Würste an die fröhliche und trinkfreudige Gesellschaft verteilte.
Auch an diesem trüben Herbsttag hatte der Alte vor, mit der Kutsche zum Halali-Treff zu fahren. Bevor es losging, brüllte er laut vom Kutschbock herunter: »Wo steckt der Junge? Gerda, bring ihn sofort zu mir!«
Aber Holgers Mutter rührte sich nicht. Sie wusste, wo sich ihr Junge versteckt hatte und war bereit, alles zu tun, um zu verhindern, dass ihn ihr zorniger Vater zum Mitfahren zwingen würde. Der wiederum fluchte umso lauter: »Los, los! Ich will den Jungen mitnehmen.«
Unter dem Holunderbusch war es schummrig, moderig und feucht. Holger lag da und atmete den muffigen Geruch der Erde, bis sich sein Hemd und die kurze Hose nasskalt anfühlten und er rückwärts unter dem Gebüsch hervor robbte und zurück zur Treppe rannte, um nachzusehen, ob die Kutsche mit dem schimpfenden Opa abgefahren war.
Sie stand aber noch im Hof, Max und Moritz scharrten mit den Hufen und der alte Mann, wütend und grimmig, sah zu ihm hinauf und brüllte: »Los, komm her! Dies ist ein Befehl.«
Der Junge hielt sich am Geländer fest, schüttelte den Kopf und rief in Richtung Kutsche, so laut er konnte: »Ich komme nicht mit … weil … ich …« Das nachfolgende »nicht will« ging im Fluchen seines Großvaters unter. Unvermutet stand die Mutter wieder hinter ihrem Jungen, legte ihre Hände auf seine Schultern und flüsterte: »Sag’s ihm noch mal.«
»Ich komme nicht mit! – Weil … ich … NICHT… WILL!«, wiederholte er mit jetzt kräftiger Stimme. Unter dem Holunderbusch hatte er sich vorgenommen, dem Großvater diesmal entschlossen zu widersprechen. Erschrocken über seinen Mut ließ er das Geländer los und rannte ins Haus zurück.
Der alte Mann auf dem Kutschbock schüttelte den Kopf, knallte mit der Peitsche, rief »Hüjaa!« und los ging die Fahrt – ohne den Enkel. Die Pferde schnaubten und zerrten an den Zügeln. Sie genossen Ausfahrten wie diese, erlaubten sie ihnen doch die Freiheit, drauflos zu laufen und die Langeweile des ewigen Stallstehens abzutraben.
Zunächst ging es die Straße hinunter in Richtung Waldforst und weiter zum Buchenhain, wo die Jagd am Nachmittag enden sollte. Der Alte hielt die Zügel fest in den Händen und versuchte, die Geschwindigkeit durch Drehen der Bremskurbel herabzusetzen. Das klappte auch gut, doch die Pferde fühlten sich durch die schwerere Last angefeuert und begannen schneller zu traben – ihr Laufdrang war ungebremst.
Bald war die Abwärtsstrecke geschafft, die Straße verlief jetzt ein Stück geradeaus, an der Heuwiese mit dem duftenden, vor kurzem erst geschnittenen Gras vorbei. In munterem Galopp ging es dahin und der Alte hatte Mühe, die Kutsche in den Feldweg zum Buchenhain auf gemächlichere Fahrt abzubremsen.
Kurz vor der Abzweigung zog er am rechten Zügel und rief: »Hooh hott!«, das Signal für »rechts abbiegen«.
Aber anstatt langsamer zu werden schnaubten die Tiere, warfen die Köpfe zurück, dass ihre Mähnen im Fahrtwind flatterten und unversehens begannen sie in ungezügeltem Galopp schneller zu laufen, noch schneller und noch schneller, bis sie in die scharfe Rechtskurve einbogen, die hin- und herschaukelnde Kutsche mit sich zerrend.
Zunächst geriet das Gefährt leicht, dann stark ins Wanken, rutschte vom schmalen Weg ab und kippte mit lautem Krachen ins Schlehdorngestrüpp. Die Pferde bäumten sich auf und zogen die umgestürzte Kutsche die kleine Böschung hinauf, wobei der Alte vom Kutschbock gerissen wurde. Er schrie laut auf und wollte die Zügel loslassen. Das gelang ihm aber nicht, die Leine hatte sich unentwirrbar um seinen rechten Arm gewickelt. Er brüllte, bellte, fluchte – wimmerte dann nur noch … und verstummte.
Die Pferde scheuten jetzt erst recht. Mit wehenden Mähnen galoppierten sie, die auf der Seite liegende Kutsche im Schlepp, über den holprigen Waldweg, den geschundenen Körper, der durch die Zügel unlösbar mit dem Gespann verbunden war, durch Pfützen und Schotter hinter sich herziehend. Erst am Endpunkt des Jagdgeländes fand die wilde Fahrt ein Ende. Der blutverschmierte Alte war nicht mehr zu erkennen. Seine geliebten Pferde hatten ihn zu Tode geschleift.
2. Der Anfang
Bis zu seinem grausigen Ende war Johann Hardt ein umstrittener Bauer mit dem größten Hof im Dorf, gleichzeitig der von einem Teil der Dorfbewohner am meisten gehasste Anhänger der Partei, der bei Streitigkeiten gerne dazwischen ging und sich meist auf die Seite der Regime-Unterstützer schlug. Nach dem Ende des Krieges verehrte er den Führer unvermindert weiter, glaubte nicht an dessen angeblichen Selbstmord und hoffte auf seine Auferstehung und Wiederkehr, »damit das Land wieder ins Lot kommt.«
Über vierzig Jahre wirtschaftete er mit seiner Frau Paula auf dem Hof. Das Paar führte ein Leben, das teils erträgliche, bisweilen aber auch verstörende Seiten aufwies. Wie Martha ihrer Schwester Gerda nach deren Ankunft aus dem bombardierten Dresden später einmal erzählte, sei ihr diese Ehe ein Rätsel, denn selten habe sie zwei Menschen gesehen, die weniger zueinander passten als ihre Eltern. Dass die Ehe über 40 Jahre gehalten habe, sei für sie ein Wunder, da müsse der liebe Gott etwas ganz Außergewöhnliches im Sinn gehabt haben.
Kennengelernt hatten sich die beiden ein paar Jahre nach der Jahrhundertwende in der nahen Bischofsstadt, wo er am Gymnasium unterrichtete und sie eine seiner Schülerinnen war – die Klassenbeste in Deutsch. Bei Lehrer Hardt hatte sie zum ersten Mal von Brentano, Mörike und Schlegel gehört, auch vom nationalbewussten Hölderlin und dem heimatverbundenen Wilhelm Busch. Gewiss war es kein Zufall, dass alle Pferde, die im Lauf der Jahrzehnte auf dem Hof vor die Leiterwagen und bei Schnee vor den großen Schlitten geschirrt wurden, die Namen »Max« und »Moritz« erhielten. Andererseits verehrte er Tolstoi, doch darüber sprach er nur einmal. Wie konnte es sein, fragte er Paula, dass ein einsamer Mensch so viel über andere Menschen wissen konnte. Es sei doch gar nicht möglich, dass er das alles selbst erlebt haben konnte, um dann so empathisch über Herz und Verstand seiner Figuren schreiben zu können.
Angetan von ihrer Wissbegierde lud der junge Deutschlehrer Johann Hardt seine Schülerin Paula zu einem Erntedank-Spaziergang zu den nach frischgeschnittenem Gras duftenden Herbstwiesen ein. Sie genierte sich, bekam rote Backen, fröstelte ein wenig – sie wollte nicht mit dem »alten« Mann gesehen werden, obwohl sie ihn respektierte und auch heimlich verehrte. Er war zweiunddreißig Jahre alt, Paula neunzehn. Sie versteckte sich hinter ihren Freundinnen. Die aber schubsten sie nach vorne und sagten kichernd: »Los, mach hin!«
Nach diesem ersten Spaziergang bat der Lehrer um einen Termin bei ihren Eltern. Er brachte eine Schachtel Pralinés mit und hielt um Paulas Hand an. Von Berufswechsel war die Rede, von einem Bauernhof auf der Hohen Rhön, von viel Arbeit, aber eben auch von sicherer Versorgung und Unabhängigkeit.
Bald darauf wurde Verlobung gefeiert und zwei Monate später geheiratet, wie das im Kaiserreich nach der Jahrhundertwende üblich war. Sie zogen in das Bauernhaus im Dorf auf der Hohen Rhön. Er gab den Lehrerberuf auf und wurde Bauer. Zum Hof, der stetig wuchs, kamen im Lauf der Jahre eine Gastwirtschaft hinzu, ein gut sortierter Lebensmittelladen, eine Kegelbahn, ein Tanzsaal und für besondere Anlässe ein Casino mit Klavier. In rascher Folge kamen auch die Kinder – drei Jungen, Hans, Willi und Hermann, und vier Mädchen, Martha, Gerda, Renate und Else.
In der Ehe war Paula die ruhende Kraft, anders als ihr Mann, der nicht in der Lage war, ein Kind auf seine Knie zu heben, mit ihm zu scherzen, zu schaukeln oder ihm ein Märchen vorzulesen. Stattdessen war er jähzornig und jederzeit bereit, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und das Geschirr zum Tanzen zu bringen.
Große Gefühle gehörten nicht zum Kitt dieser Ehe. Die Kinder kamen, wie das üblich war, eins nach dem anderen, ohne Abstand. Wie Paula dies hätte verhindern können, wusste sie nicht. Ihr Dasein bestand aus harter Arbeit und aufopferungsvoller Fürsorge.
So kamen beide, Paula und Holgers Großvater, trotz aller Widrigkeiten auf ihre Weise durch die Jahre – ein eingespieltes Paar. Sie ließ ihn wettern, schimpfen, toben und schämte sich im Stillen für ihn und seine egozentrische und unnahbare Art. Von seiner humanistischen Bildung, die ihn zum Gymnasiallehrer hatte aufsteigen lassen, war im alltäglichen Leben auf dem Hof nichts geblieben. Der Kampf mit den Maschinen und Wetterkatastrophen, den Überschwemmungen, der Trockenheit und den daraus folgenden Missernten, sowie die angebliche Dummheit des Gesindes und die vermeintliche Unbelehrbarkeit der Kinder hatten ihn hart gemacht. Er war ein schwieriger und sprunghafter Mann, der nicht selten brüllte und auch schon mal mit der Hand zuschlug. Er ließ seine Frau pflegen, schlichten und heilen, während sich sein explosiver Charakter auch im Alter nicht mehr änderte und der Umgang mit ihm immer schwieriger wurde. Meist saß er auf dem Sofa und brummte vor sich hin. Niemand wagte sich in seine Nähe, besonders die Enkelkinder nicht, die Angst davor hatten ihm zu nahe zu kommen, denn er fand nichts dabei ihnen eine Kopfnuss zu verpassen, wenn immer sie laut waren oder ihm ihr Lachen, Kreischen und Herumhüpfen als unangemessen und störend erschien. Dann konnte er brüllen, dass die Tischbeine wackelten.
Über seine Kindheit war wenig bekannt. Weder erzählte er von den Jahren, die er als kleiner Junge in der Bischofsstadt erlebt hat und wie er studierte und Lehrer am Gymnasium wurde. Dass er von seinen älteren Brüdern oft gehänselt worden war, erzählten diese einmal Paula, und dass sie alle von ihrem Vater wenig Liebe und Anerkennung erfahren hatten, stattdessen aber oft verprügelt wurden. Dagegen habe besonders er, der Jüngste, wie eine Klette am Rockzipfel seiner Mutter gehangen. Sie habe ihn von Herzen verwöhnt und verhätschelt, weil er unter den Brüdern der fleißigste und klügste war und die Mutter am liebsten ihm alleine vorgelesen habe. Und auch, dass er mit 19 eine kleine Jüdin geschwängert, sich dann aber geweigert habe, sie zu heiraten.
3. Kurze Schulzeit
Gerda, die dritte von Johann Hardts Töchtern, lebte im Herbst 1944 mit ihren Kindern Holger und Carla in einem beim Flughafen gelegenen Vorort von Dresden. Dort bewohnten sie eine Zweizimmerwohnung in einem kleinen Haus. Gerda war mit ihrem Mann Reinhard nach der Hochzeit nach Sachsen gezogen, wo er Arbeit als Flugzeugmonteur gefunden hatte. Kurz nach Kriegsbeginn war er bei einer Fliegerstaffel an der Ostfront im Einsatz. Hätten die ersten Bomben nicht der Stadt, sondern dem Dresdner Flughafen gegolten, hätte Reinhard seine Frau und die Kinder nie mehr in die Arme nehmen können.
Holger, der sechs Jahre alte Sohn, wurde von seiner Mutter manchmal Floh genannt, weil er wie so ein kleiner, schüchterner Kaumetwas durch sein bisheriges Leben gehüpft war, während seine zwei Jahre jüngere Schwester Carla überlegter und vorsichtiger war.
Anfang September 1944 wurde Holger eingeschult. Zur selben Zeit marschierten amerikanische Einheiten bereits bei Trier über die Grenzen im Westen und die Rote Armee über die Weichsel im Osten.
Holger erinnerte sich schwach an die wenigen Schulstunden in dem nach Bohnerwachs und abgestandener Luft riechenden Schulgebäude, einem hässlichen Klotz aus roten Ziegelsteinen.
Jeden Morgen brachte ihn Gerda über einen Feldweg an Äckern und Wiesen vorbei, zu der nicht weit entfernten Schule. Holger hätte den Weg auch alleine gehen können. Aber seine Mutter hatte Angst, er würde sich verlaufen oder etwas anderes könnte passieren – es war ja Krieg.
Als sie ihn eines Tages abholte, mussten sie auf dem Nachhauseweg den Luftkampf zweier Jagdflieger mit ansehen. Die beiden Flugzeuge umkreisten sich laut aufheulend, stiegen hoch empor, und stürzten dann aus dem blauen Himmel mit kreischenden Motoren aufeinander los.
Mutter und Sohn hörten die Schüsse der Bordkanonen und das Pfeifen der Flügel im Wind. Plötzlich drehte sich eine Maschine jaulend um die eigene Achse und trudelte, eine weißgraue Rauchfahne hinter sich herziehend, auf den Acker zu, an dessen Rand sich Gerda und Holger erschrocken duckten. Augenblicke später schlug das brennende Flugzeug mit dumpfem Krachen in die Furchen des Ackers. Die Explosion riss die Flügel vom Rumpf und eine schwarze Rauchwolke stieg pilzförmig in den Himmel.
Schreckensbleich standen die beiden da. Dann packte die Mutter den Jungen am Arm und zog ihn vom Anblick des zertrümmerten Flugzeuges fort. Es roch gefährlich nach verbranntem Benzin. Vorwärtsstolpernd starrte Holger wie hypnotisiert zurück auf die feurig glühenden Trümmer, bis Gerda mit zitternder Stimme rief: »Komm jetzt, das ist zu schrecklich … wir müssen weiter.«
Später am Nachmittag erfuhren sie von einer Nachbarin, dass der deutsche Pilot, der von der sowjetischen Yak-3 abgeschossenen Messerschmitt, in den Trümmern seiner Maschine verbrannt war.
Nach dem ersten Luftangriff auf Dresden im Oktober 1944, ein halbes Jahr vor der totalen Zerstörung der Stadt durch amerikanische B17 Bomber, wurden alle gerade erst geöffneten Schulen wieder geschlossen. Damit war Holgers erstes Schuljahr nach drei Wochen beendet.
Die Wintermonate vor dem Großangriff auf Dresden waren für Mutter Gerda und ihre Kinder beinahe idyllisch. Im Gartenzaun zum Birkenwäldchen neben ihrem Haus gab es einen Durchschlupf, durch den Carla und Holger bei schönem Wetter verschwanden, um sich unter dem üppigen Holunderbusch, der hinter dem Zaun wucherte, zu verstecken. Ihre Mutter musste sie dann suchen, wobei sie das Finden oft hinaus zögerte und dabei ihr Lieblingslied summte:
»Ringel, Ringel, Reihe,
sind der Kinder zweie,
sitzen unterm Hollerbusch,
machen beide husch, husch, husch!«
Um die Kinder zu necken, lief sie manchmal auch scheinbar besorgt im Birkenwäldchen hin und her, bis sie die beiden gefunden hatte und sich alle drei in die Arme fielen, sich herzten und küssten, und dann kichernd durch den Durchschlupf zurück ins Haus huschten.
4. Bombennächte
Als in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 Feuer vom Himmel auf die Stadt an der Elbe fiel, wohnte Gerda mit Holger und Clara noch immer in dem kleinen Haus neben dem Birkenwäldchen nahe beim Flughafen. In einem Feldpostbrief hatte Vater Reinhard geschrieben, er sei zu einem Ingenieurs-Lehrgang auf die Nordseeinsel Föhr versetzt worden, dort sei das Leben friedlich und vom Krieg nichts zu spüren und zu sehen. Aber er mache sich Sorgen um seine Lieben und wünschte, den Brief persönlich vorbeibringen zu können, um sie zu sehen und in die Arme zu schließen. Von ganzem Herzen hoffe er, dass der Krieg bald vorbei sei und sie wieder zusammen sein könnten.
Wenige Nächte nach dieser Nachricht riss die Mutter ihre beiden Kinder aus tiefstem Schlaf: »Schnell, schnell! Fliegeralarm!« Schlaftrunken stolperten sie mit zusammengerafften Kleidern in den engen, wenig sicheren Keller.
Wumm, Wumm, Wumm! Unten hörten und spürten sie das Brummen der Bomber, die Detonationen in der Nähe, das Beben der Erde und das Zittern der dünnen Zementdecke über ihnen. Sie hörten, wie die Bombeneinschläge näher kamen und der Putz von den Kellerwänden rieselte. Die Mutter drückte die zitternden Kinder an sich und versuchte sie zu beruhigen.
In der ersten Nacht warfen britische Bomber Tonnen von Sprengbomben in die Stadt, die die Dächer abdeckten und Fenster und Türen zerbersten ließen. So konnten die an den folgenden zwei Tagen abgeworfenen Brandbomben ungehindert als Feuerorkane durch die offenen Fenster und Hauseingänge fegen. Nicht wenige der in Panik flüchtenden Menschen blieben im von der Hitze aufgeweichten Asphalt der Straßen stecken und wurden in die alles verglühende Höllenhitze hineingezogen.
Begonnen hatte der Wahnsinn durch die Bombardierung der mittelenglischen Industriestadt Coventry durch die deutsche Luftwaffe im November 1940. Elf Stunden lang warfen mehr als fünfhundert deutsche Flugzeuge Bomben auf die Stadt und zerstörten vor allem Wohnviertel mit hohen Verlusten in der Zivilbevölkerung. Sie flogen leer zurück, luden neue Bomben, kamen wieder und warfen sie erneut auf die unvorbereitete Stadt. All dies geschah unter dem zynischen Operationsnamen »Mondscheinsonate«. Damit schuf Deutschland das Muster für die bald darauf folgenden Angriffe englischer und amerikanischer Verbände auf die Großstädte zwischen Rhein und Elbe.
Drei Tage und Nächte harrte Gerda mit ihren Kindern im Keller aus. Sie hörten, wie nicht weit entfernt Mauern barsten und Häuser zusammenstürzten. Der durch den Feuersturm angefachte Wind brachte nicht nur Wellen heißer Luft bis in den Keller, sondern auch beißende, noch nie wahrgenommene Gerüche.
In den Bombenpausen huschte Gerda nach oben und kochte Grießbrei für Carla und Holger. Sie selbst lebte von in Wasser aufgeweichtem Brot, runzligen Mohrrüben und einigen Kartoffeln, die sie in der fast leeren Speisekammer fand.
Am Tag nach den verheerenden Bombenangriffen kam eine Gruppe Frauen und Kinder aus der zerstörten Stadt und baten um Unterschlupf. Ihre Kleider rochen nach Verbranntem, die Gesichter waren mit Ruß verschmiert und von Angst entstellt. Gerda nahm sie auf, kochte die wenigen Reste, die sie noch fand und die sie von der Nachbarin Wally aus deren Garten bekam. Wortlos saßen die Ausgebombten am Tisch in der Küche und waren nicht in der Lage, über das Erlebte zu sprechen.
5. Flucht im Panzer
Wenige Wochen bevor die Bomben auf Dresden fielen, hatte eine versprengte Staffel der Wehrmacht mit zwei Tiger VI Kampfpanzern und einem Transportpanzer im Birkenwäldchen neben dem kleinen Haus Halt gemacht, um sich unter den Bäumen vor russischen Jagdfliegern zu verstecken. Bei diesem Manöver hatten sie den Holunderbusch niedergewalzt.
Holger war enttäuscht, weil ihr Versteck zerstört war. Unter dem Busch hatte er sich geborgen gefühlt und war oft auch ohne Carla durch das Loch im Zaun hinüber gekrochen und hatte den Schmetterlingen bei ihren Flattertänzen zugeschaut. Jetzt waren die Panzer mit ihren langen Kanonenrohren und den Kettenrädern eine aufregende Abwechslung.
Während die Soldaten auf den verdreckten Stahlmonstern in der Sonne saßen und auf neue Befehle warteten, rauchten sie Nordland-Zigaretten, winkten die Kinder zu sich und ließen sie in das Innere eines Panzers hineingucken. Dabei freuten sie sich über die Neugier der beiden. Einer sagte, Carla erinnere ihn an seine kleine Tochter zuhause.
Für Holger waren die Panzer bedrohliche Ungeheuer. In so einem engen Eisenkoloss zu sitzen oder gar unterwegs zu sein, war unvorstellbar für ihn.
»Mitfahren?«, fragte einer der Soldaten und grinste. Holger sah seine Schwester an.
»Nein, nein«, rief sie, fasste nach der Hand des Bruders und lief mit ihm davon.
Wenige Tage später war die kleine Panzerstaffel verschwunden.
»Im Osten die Russen aufhalten«, hatte einer der Soldaten beim Losrattern in der Nacht der Mutter zugerufen, die, aufgeschreckt durch das Getöse, nachgesehen hatte, was draußen los war. »Wenn das nicht gelingt, kommen wir zurück und nehmen euch mit.«
Zwei Wochen später waren sie wieder da. Mit dröhnenden Motoren hielten die Stahlkolosse vor dem Birkenwäldchen, zwei Soldaten sprangen heraus.
»Schnell, schnell! Die Russen sind bald hier!«, rief einer von ihnen der Mutter zu. Sie erklärten knapp, dass sie die beiden Kinder und sie mitnehmen würden, um sie vor der Roten Armee in Sicherheit zu bringen. Gerda überlegte nicht lange und raffte ein paar Sachen zu einem Bündel aus zusammengeknoteten Betttüchern zusammen. Ihr Ziel war das Dorf ihrer Eltern in Hessen auf der Hohen Rhön, wo sie sich mit Reinhard treffen wollte, wenn der Krieg zu Ende war. Die Mitfahrgelegenheit im Panzer kam ihr gerade recht, auch wenn die Fahrt nicht ungefährlich schien.
Hilflos und unsicher stand die kleine Familie eingezwängt in dem engen gepanzerten Militärfahrzeug. Einer der Soldaten hielt sich neben ihnen an einer Stahlschiene fest. Er klopfte mit der Hand auf eine Munitionskiste, auf die sie sich setzen und gut festhalten sollten. Der Kommandant rief: »Fahrt marsch!« und der stählerne Koloss ratterte den beiden vorausfahrenden Panzern hinterher.
Mit ohrenbetäubendem Gerassel fuhren sie auf der von Löchern und Kratern übersäten Straße und entfernten sich immer mehr von dem Birkenwäldchen. Die Kuppeln mit den Geschützrohren schwenkten in östliche Richtung. Sie umfuhren die zerstörte Stadt über eine noch halbwegs intakte Elbbrücke.
»Nach Südwesten«, erklärte der hohlwangige und übermüdete Soldat. Er hockte sich neben Gerda auf die Kiste und lächelte: »Keine Angst, wir bringen euch in Sicherheit.«
Er setzte seine Mütze ab, kratzte sich am Kopf und sagte: »Wir kommen durch, überall, egal ob Sumpf, Acker, Feld oder Wald.«
Holger verstand nichts, es war viel zu laut in dem engen Raum. Der Soldat zog eine Schachtel Zigaretten aus seiner Brusttasche und bot Gerda eine an. Sie schüttelte den Kopf. »Danke, ich rauche nicht.«
Er versuchte eine Zigarette aus der Packung zu ziehen. Aber seine Finger zitterten so wie der gesamte Innenraum des Stahlmonstrums. Schließlich hatte er eine herausgefingert, steckte sie an und blies den Rauch nach oben durch die halb geöffnete Luke in den blauen Himmel.
»In Russland sind wir durch eine Scheune gefahren«, begann er zu erzählen. »Vorne rein …«, er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen, »und hinten wieder raus. Die halbe Scheune krachte auf uns runter, aber wir fuhren weiter … ha ha.« Er lachte müde. »Keine Angst, fürchtet euch nicht!«
Die beiden Kinder saßen mit weit aufgerissenen Augen auf der schmalen Kiste in dem rüttelndem Ungetüm. An den Wänden zitterten Instrumente, deren Zeiger tickten und pendelten. Jeder Zentimeter Platz war genutzt. Durch die Luke konnten sie ab und zu den hellen Himmel und die Äste vorbeihuschender Bäume sehen, die an der stählernen Außenwand des Monstrums entlang schrappten. Der Lärm war unvorstellbar. Die Kinder klammerten sich an ihre Mutter, die beide fest umschlungen hielt.
Am frühen Nachmittag stoppte der Konvoi abrupt und die Geschützrohre drehten sich nordostwärts in den Himmel. Dort tauchten zwei russische Jagdflieger auf, die mit schauerlichem Heulen und Pfeifen auf sie herunterstürzten. »Alle Luken dicht!«, brüllte der Kommandant.
Rechts schlugen Geschosse in den Acker, wenige Meter voraus explodierten mehrere Granaten, Schrapnells zischten durch die Luft, eine Salve aus einer Bordkanone mähte über die Stahlplatten des Fahrzeugs. Die Luft vibrierte, jaulte, dröhnte und pfiff, die Einschläge prallten an den stählernen Außenwänden ab.
Aus den Rohren fauchten Geschosse in den Himmel, doch weit an den Angreifern vorbei. Die drehten ab und verschwanden so rasch sie gekommen waren punktklein hinter dem Horizont.
»Raus, raus!«, schrie der Kommandant und riss die Luke bis zum Anschlag auf. »Ein Funkspruch – wir müssen zurück!«
Die Mutter ergriff ihr Bündel und rutschte mit beiden Kindern vom Stahlkoloss in den feuchten Straßengraben. Die Männer, die sie beschützen wollten, bedauerten dies mit enttäuschten Gesichtern und rasselten blass und müde zurück in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
Danach war Stille über dem Feld. Hoch über dem Acker jubilierte eine Lerche ihr Tedeum in den blauen Himmel.
Die Kinder wimmerten. »Sie kommen!«, entwischte ein Schrei aus Holgers Mund. Diesen Schrei würden alle, die in seiner Nähe saßen oder schliefen, noch lange aushalten müssen.
Die Mutter drückte beide Kinder fest an sich und flüsterte unzählige Gottseibeiuns. Erst in der Dämmerung richtete sie sich auf, zog Holger und Carla hoch, warf ihr Bündel auf den Rücken und lief mit ihnen, an jeder Hand ein Kind, in Richtung des Kirchturms, der in einiger Entfernung schwach zu sehen war. Spät in der Dunkelheit erreichten sie den kleinen Ort Rabenau, 15 Kilometer südwestlich von Dresden. Dort fanden sie bei einer Familie Unterschlupf für drei Tage und Nächte.
Am zweiten Morgen fuhren russische Panzer mit winkenden Soldaten in den Ort. Sie schwenkten Gewehre und Wodkaflaschen und sangen seltsam fremd klingende Lieder. Von den drei deutschen Panzern mit den übermüdeten Soldaten, die sie bis kurz vor Rabenau mitgenommen hatten, hat Gerda nie mehr etwas gesehen.
»Aetbopa – Kinder!«, schimpften die russischen Soldaten, wenn sie Kinder in den Schlafzimmern fanden. Sie schlugen grob die Türen zu und suchten weiter in anderen Häusern.
Am Abend des folgenden Tages sickerten Gerüchte von Waffenstillstands-Gesprächen in die kleine Küche. Zwei Polen, die in einem zerbeulten Kübelwagen der Wehrmacht nach Osten unterwegs waren und um Wasser und ein Stück Brot baten, berichteten grinsend: »Gitttler kaputt!«
Langsam setzte sich die Gewissheit durch: Der Führer, Eva Braun und Goebbels mitsamt seiner Frau hatten sich erschossen. Magda Goebbels habe vorher ihre sechs Kinder mit Gift getötet. In Berlin werde aber noch immer gekämpft.
Weitere Schreckensnachrichten machten die Runde. Eine aus Dresden zu ihrer Verwandtschaft nach Rabenau geflüchtete alte Frau stöhnte während des Wartens an der öffentlichen Wasserpumpe im Ortszentrum: »Lebt er immer noch, der Hund?«
Während das Wasser in die Kannen lief, konnte Gerda weitere Gesprächsfetzen aufschnappen. »In Meißen haben sich zwei SS-Offiziere erschossen«, berichtete eine Frau. Ein Arzt aus einem Nachbardorf habe seiner Familie Zyankali-Kapseln gegeben, und allen, auch den Kindern gezeigt, wie sie drauf beißen mussten; dann habe er selbst auf eine gebissen. Alle seien sofort tot gewesen.
Nirgendwo hätten sich so viele Menschen das Leben genommen, wie im vorpommerschen Demmin, hieß es. Aus Angst vor einer von »Rachegelüsten angetriebenen Horde grausamer Barbaren«. Viele hatten den Gerüchten Glauben geschenkt, die von der NS-Lügenpropaganda verbreitet worden waren. Als die Russen schließlich in Demmin einmarschierten, nahm die Selbstmordwelle dort noch zu.
Eine aus dem Westen angereiste Frau, die ihre Mutter suchte und mitnehmen wollte, erzählte von amerikanischen Panzern, die in eine Stadt am Neckar eingefahren waren. Ein Musiker habe am offenen Fenster gestanden und leidenschaftlich »Glory, Glory, Halleluja« auf seiner Trompete geblasen. Die Soldaten hätten gewunken, geklatscht und laut mitgesungen.
Als es dunkel wurde, verschwanden die letzten Frauen vom Brunnen. Eine seltsame Unruhe lag über dem Ort. Schüsse in der Ferne und das Bellen eines Hundes ganz nah waren zu hören. In den Häusern wurde noch rasch von den Wänden gerissen, was an die Nazi-Zeit erinnerte und im Herd verbrannt oder in einer abseits gelegenen Jauchegrube versenkt.
In der Nacht fielen Schüsse in der Nähe. Ein Trupp versprengter Wehrmachtssoldaten versuchte verzweifelt einen größeren Hof am Rand Rabenaus zu verteidigen, den die Russen mit Granaten beschossen.
Ein Stallgebäude ging in Flammen auf, das Blöken der Kühe und Schafe, die im zusammenbrechenden Gebäude verbrannten, schallte schauerlich durch die Nacht. Der Wind trieb das Feuer auf Scheune und Wohnhaus zu. Es roch weit über die Felder nach Rauch und verbranntem Fleisch.
Eine kleine Gruppe Flüchtlinge mit Kindern, die in dem Gehöft Zuflucht gesucht hatten, sprangen aus den Fenstern und liefen über die dunklen Felder davon.
Auch in dieser Nacht kamen russische Soldaten in das Haus, in dem Gerda mit Clara und Holger Unterschlupf gefunden hatte, und suchten nach versteckten nemetskiye soldaty – deutschen Soldaten.
Die Situation war hoffnungslos. »Kein Gott kann uns helfen«, wisperte Gerda zu ihren Kindern. »Wir müssen zurück, sonst wird uns Papa niemals finden.«
6. Zurück
Am nächsten Morgen bedankte sie sich für die Unterkunft. Das Gesicht mit Kohle beschmiert, die Haare mit Asche weiß gepudert, brach sie mit ihren Kindern auf. Zu Fuß liefen sie über die zerstörten Straßen zurück in Richtung ihres Hauses neben dem zerstörten Holunderbusch hinter dem Zaun beim Birkenwäldchen.
Ein nicht abreißender Strom von Flüchtlingen kam ihnen entgegen. Es waren vor allem Frauen und Kinder, die Karren mit Koffern und vollgestopften Bündeln zogen; auch ältere Menschen, die nur mühsam laufen konnten und von den Jüngeren immer wieder angestoßen wurden, schleppten sich voran.
Von ehemaligen polnischen Häftlingen, die nach Osten unterwegs waren, wurden sie überholt. Eine Truppe gefangener Wehrmachtssoldaten in zerlumpten Uniformen ohne Abzeichen, bewacht von bewaffneten russischen Milizen, kam ihnen entgegen – müde, abgekämpft, hoffnungslos die Gesichter.
Auf der Straße brodelte ein unvorstellbares Durcheinander. Erschöpfte Frauen hielten ihre Kinder an den Händen, setzten mechanisch einen Fuß vor den anderen und trieben mit Decken und Paketen beladene Kühe vor sich her. Ab und zu waren Hilferufe und laute Angstschreie zu hören. Kinder irrten elternlos und verloren zwischen Pritschenwagen, Karren, Motorrädern und leeren Kinderwagen umher und riefen schluchzend nach ihren Müttern. Lastautos, Panzer und Geschütze mit dem russischen Stern an den Seiten, ratterten an ihnen vorbei in Richtung Berlin.
Auf dem Fußmarsch zurück zu ihrem Haus ließ der Lärm und die unentwegt über den Himmel donnernden Flugzeuge, Holger immer wieder erstarren und sein kaum unterdrückter Angstschrei brachte die Mutter an den Rand der Verzweiflung.
Die Furcht war berechtigt. In der Unterkunft in Rabenau hatten sie bruchstückhaft mitgehört, was die Erwachsenen über die Verbrechen erzählten, die die Waffen-SS, die Gestapo und zum Teil auch Soldaten der Wehrmacht in den eroberten Gebieten der Zivilbevölkerung angetan hatten. So war die Furcht vor der Rache der russischen Armee allgegenwärtig und trieb die Menschen zur Flucht nach Westen. In amerikanisch besetztem Gebiet, so hofften sie, würde ihnen weniger rachsüchtig begegnet.
Gerda lief mit ihren Kindern gegen den Strom, der ihnen aus dem Osten entgegen kam. Angetrieben von der Hoffnung, Reinhard, wenn er überhaupt noch lebte, warte vielleicht in ihrer Wohnung statt wie vereinbart im Dorf bei ihren Eltern, um sie und die Kinder von dort abzuholen und mitzunehmen, egal wohin.
Nach zwei Tagen Fußmarsch und einer Nacht versteckt unter Büschen, waren die Blasen an ihren Füßen so weit aufgerieben, dass jeder Schritt weh tat. Weil Gerda keine Pflaster hatte, umwickelte sie die wunden Stellen mit Stoffstreifen, die sie von ihrer Bluse abriss.
Als sie erschöpft beim Haus am Birkenwäldchen ankamen, fanden sie ihre Wohnung besetzt. Eine Mutter und drei Kinder saßen auf ihren Stühlen und schliefen in ihren Betten – es waren deutsche Kommunisten, die von der auferstandenen Partei die Wohnung zugeteilt bekommen hatten.
Zwei Frauen, fünf Kinder, eine Küche, drei Töpfe und ein Herd – da drohten Konflikte. Doch die beiden Frauen arrangierten sich, jede Familie bekam ein Zimmer. So lebten sie, männerlos und entbehrungsreich, mit unterschiedlicher Sicht auf Krieg und Frieden und aufeinander Rücksicht nehmend, zusammen.
»Nu, geht doch«, sagte Tante Wally, die neben dem Haus mit ihrem kleinen Sohn Heinz in einem Gartenhäuschen ausgeharrt hatte. Im Garten blühten Kirschen, Pflaumen, Birnen und Apfelbäume, sie hoffte auf eine reichhaltige Ernte.
7. Zimmer mit Durchschuss
Zur selben Zeit war der größte Teil des Deutschen Reiches von alliierten Truppen besetzt. Zutiefst enttäuscht über die Nachricht, der Führer habe Selbstmord begangen und gleichzeitig erleichtert darüber, dass der Krieg vorbei war, begrüßten viele Deutsche vor allem die amerikanischen Soldaten. Wenn auf den Straßen die Panzer mit dem Sternenbanner vorbei rollten, hängten sie weiße Betttücher aus den Fenstern und winkten ihnen zu.
General Eisenhowers Befehl an seine Truppen lautete, sich nicht mit den Feinden zu verbrüdern, nur in Ausnahmefällen Häuser und Wohnungen zu betreten, keine Geschenke anzunehmen, keine Hände zu schütteln und nicht an Festen oder Tanzvergnügen teilzunehmen, überhaupt Gespräche und Diskussionen zu vermeiden.
Die Deutschen sollten kapieren, dass sie für die Amerikaner »Feinde« waren, die vielen ihrer Kameraden das Leben genommen hatten und die für den Krieg und die Gräueltaten der Nazis mitverantwortlich waren.
So sollte verhindert werden, dass deutsche Spione durch zu große Nähe zu amerikanischen Soldaten an geheime Informationen gelangten, die ihnen bei einem erneuten Aufblühen des Nationalismus von Nutzen sein konnten. Vor allem davor wurde gewarnt, sich mit deutschen Fräuleins einzulassen oder sich mit ihnen zu verloben oder sie gar zu heiraten.
Von den Anordnungen Eisenhowers hatte auch der fanatisierte Opa im Dorf auf der Hohen Rhön gehört. Er fürchtete für sich und die Seinen die harte Hand des Siegers. Die Dorfbewohner flüsterten sich unter vorgehaltener Hand Gerüchte zu, die vor allem ihn, den Dorf-Nazi, betrafen. Er sei, so hieß es, noch immer vom Hitler-Mythos besessen. Wenn der abends ins Bett gehe, trage er ein Nachthemd mit eingesticktem Hakenkreuz auf der Brust und Parteiabzeichen auf dem Ärmel.
Ende April bezog eine kleine Einheit mit fünf amerikanischen Panzern Stellung von Norden her über dem Dorf. Als auf das Angebot zur kampflosen Übergabe keine Antwort kam, schossen sie mit scharfen Granaten mehrfach in den Ort, um klar zu machen, dass sie bei Widerstand nicht spaßen würden.
Die sechs versprengten Wehrmachtssoldaten, die noch zwischen den Ställen im Dorf hockten, bereit für einen letzten Hinterhalt, mussten erkennen, dass sie keine Chance hatten, die Panzer aufzuhalten. In letzter Minute warfen sie sich auf ihre Motorräder und bretterten in Richtung Grundheim davon.
Opa Hardt missbilligte zunächst ihr Aufgeben, hielt er sich doch noch immer an Goebbels Durchhalteparole: »Wir wollen lieber sterben als kapitulieren!« Aber mit der Zeit sah auch er für sich und die Seinen Flucht als einzigen Ausweg, nachdem die letzte Verteidigungslinie vor seinen Augen zusammengebrochen war.
Damit verhielt er sich nicht anders als viele Amtsträger der Partei, die das Durchhalten bis zum Endsieg gepredigt hatten, sich aber als Erste aus dem Staub machten, als sie den Ernst der Lage erkannten. Auch manche der in Polen und noch weiter im Osten stationierten Einheiten dachten in der Endphase des Krieges nicht daran, die Parole vom heroischen Untergang auf sich selbst zu beziehen. Sie verschwanden in Richtung Westen: Nur nicht dem Russen in die Hände fallen. Aber auch nicht den Feldjägern der Wehrmacht, die Fahnenflüchtige hinter der Front aufspürten und oft gleich erschossen, frei nach Hitlers Befehl: »Der Soldat kann sterben, der Fahnenflüchtige muss sterben.«