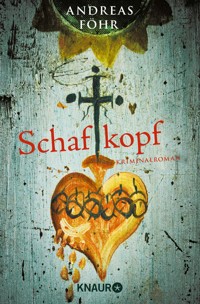Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Wallner & Kreuthner Krimi
- Sprache: Deutsch
In der Idylle lauert das Grauen: der erste Teil der Krimi-Reihe um die Kult-Ermittler Wallner und Kreuthner vom Tegernsee von Bestseller-Autor Andreas Föhr An einem eisigen Januarmorgen wird im zugefrorenen oberbayerischen Spitzingsee die Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden. Kurioses Detail: Sie wurde durch einen Stich mitten ins Herz getötet und trägt ein goldenes Brokatkleid. Als man im Mund des Opfers eine Plakette mit einer eingravierten Eins findet, ahnt Kommissar Wallner von der Kripo Miesbach, dass dies nur der Anfang einer grauenvollen Mordserie ist. Mehr oder weniger vorschriftsmäßig unterstützt vom ewig grantelnden Polizeiobermeister Kreuthner, beginnt Wallner mit den Ermittlungen, die ihn zu einem schicksalsträchtigen Tag zurückführen … Mit Kommissar Clemens Wallner und Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner, dem »Leichen-Leo«, hat der erfolgreiche Drehbuch-Autor Andreas Föhr ein Ermittler-Duo geschaffen, das längst Kult-Status genießt. Spannende Fälle, schwarzer Humor und ein typisch bayerischer Anarchismus zeichnen seine Krimi-Reihe aus. Alle Bände der »Wallner & Kreuthner«-Krimis auf einen Blick: Band 1 – Prinzessinnenmörder Band 2 – Schafkopf Band 3 – Karwoche Band 4 – Schwarze Piste Band 5 – Totensonntag Band 6 – Wolfsschlucht Band 7 – Schwarzwasser Band 8 – Tote Hand
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Föhr
Der Prinzessinnenmörder
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
An einem Januarmorgen wird im zugefrorenen Spitzingsee die Leiche einer 15-Jährigen gefunden. Das Mädchen wurde erstochen und trug ein goldenes Brokatkleid. Als man im Mund des Opfers eine Plakette mit einer eingravierten Eins findet, ahnen Kommissar Wallner und sein ewig grantelnder Kollege, Polizeiobermeister Kreuthner, dass dies nur der Anfang einer grauenvollen Mordserie ist …
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Dank
Jede vermeintliche Ähnlichkeit der Figuren des Buches mit lebenden oder verstorbenen Menschen wäre rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
Es war heiß im Wagen. Die Heizung lief auf Maximum. Vor dem Wagen lag ein Stück verschneite Straße im Scheinwerferlicht. Links und rechts der Fahrbahn Wände aus Schnee, glitzernd, mit Eiskristallen darauf. Hinter den Schneewänden – schwächer angeleuchtet – Fichten, deren Äste sich unter der weißen Last bogen. Es war kalt draußen. Minus achtzehn Grad. Polizeiobermeister Leonhardt Kreuthner gähnte und fingerte eine Zigarette aus einer zwei Tage alten Schachtel auf der Mittelkonsole des Wagens. Beim Anzünden der Zigarette musste er sich einen Moment auf die Feuerzeugflamme konzentrieren. In diesem Augenblick stieß der Wagen mit etwas auf der Straße zusammen. Der dumpfe Aufprall brachte Kreuthner zu Bewusstsein, dass er ziemlich erschöpft war. Im Rückspiegel sah er einen großen Eisbrocken auf der vom Rücklicht rötlich gefärbten Piste entlangkullern. Er nahm einen tiefen Zug aus der Zigarette, schüttelte sich wach und blickte wieder nach vorne.
Kreuthner hatte eine anstrengende Nacht hinter sich. Seit neun Uhr war er im Mautner gesessen und hatte mit Freunden Bier getrunken. Es war ein kurzweiliger Abend gewesen. Sie hatten über den Ausflug nach Südtirol im Oktober vor drei Jahren geredet. Kurz nach zehn war ein Streit darüber entbrannt, ob der Wiebek Toni, der damals noch dabei war, sich seinen legendären Rausch entgegen seiner sonstigen Art mit dem Lagreiner beigebracht hatte oder ob er nicht auch beim Törggelen dem Bier treu geblieben war. Der Sennleitner behauptete, der Wiebek könne sich mit Bier gar nicht so zusaufen, wie damals geschehen. Das sei bei dem biologisch unmöglich. Doch Kreuthner konterte mit dem Argument, der Wiebek sei ein Mann von Prinzipien. Der habe seit seinem elften Lebensjahr keine andere Flüssigkeit als Bier zu sich genommen. Ein Anruf beim Wiebek hätte Klarheit gebracht. Aber der Wiebek hatte vor einem Jahr geheiratet und ging jetzt jeden Abend um zehn ins Bett, weil die Kleine ab fünf wach war und er dann aufstehen musste. Bloße Rücksichtnahme hätte Kreuthner und seine Kumpane nicht davon abgehalten, beim Wiebek anzurufen. Aber es war bekannt, dass die Wiebeks die Angewohnheit hatten, abends um acht den Telefonstecker aus der Dose zu ziehen. Angeblich wegen der Kleinen. Wahrscheinlich wollten sie einfach ihre Ruhe haben. Ja – so kann ein Mensch vor die Hunde gehen, musste sich Kreuthner denken. Vor drei Jahren noch Jahrhunderträusche, jetzt um zehn ins Bett.
Gegen vier war das Thema Wiebek immer noch nicht geklärt. Aber die drei Freunde wurden von der Bedienung gebeten, ihre Ärsche an die frische Luft zu bewegen. Und so stand Kreuthner auf dem Parkplatz des Mautner neben seinem vereisten Wagen und befand, er habe eindeutig zu viel getrunken, um ins Bett zu gehen. Da könne es nicht schaden, zum Ausnüchtern ein bisschen in der Gegend herumzufahren. Zwischen Tegernsee und Schliersee überkam ihn ein nützlicher Gedanke. In zwei Wochen würde das jährliche Eisstockschießen der Oberlandpolizisten stattfinden. Kreuthner saß im Organisationskomitee, denn dieses Jahr waren die Miesbacher mit der Veranstaltung dran. Als Austragungsort hatte man den Spitzingsee gewählt. Das war ein kleiner See hoch oben in den Bergen gelegen, auf über tausend Metern, und damit eissicher. Der Tegernsee war schon seit Jahren nicht mehr zugefroren. Und selbst bei dem kleineren und nicht so tiefen Schliersee war das eher Glückssache. Der Spitzingsee hingegen war eine Bank. Zwischen Tegernsee und Schliersee kam Kreuthner also der Gedanke, eine Ortsbesichtigung durchzuführen.
Als sich Kreuthner dem Spitzingsee näherte, begann sich der Himmel im Osten schon blass zu färben. Er stellte den Wagen auf einem geräumten Parkplatz ab, der tagsüber von Skitouristen benutzt wurde. Als Kreuthner ausstieg, schnitt ihm die Morgenluft fast den Atem ab, so kalt war es da draußen. Er setzte sich eine Mütze auf, zog Handschuhe an und holte eine Schaufel vom Rücksitz seines Wagens. Im Winter hatte er immer eine Schaufel dabei. Die konnte vielfach von Nutzen sein. Sei es beim Ausschaufeln verschneiter Autos oder auch beim Bau einer Schneebar. Oft war er schon verlacht worden wegen seiner Schaufel. Aber das war ihm egal. Wer zu dumm war, den Sinn einer Schaufel zu erkennen, der sollte halt lachen.
Mit trotzigen Gedanken im Kopf und der Schaufel in der Hand stapfte Kreuthner durch knirschenden Schnee zum Seeufer hinab. Sein Atem kondensierte und fror am Kragen fest. Kreuthner spürte förmlich, wie der Alkohol aus seinem Körper in die Morgenluft verdunstete. Eine unglaubliche Frische machte sich in Lungen und Kopf breit, und er sah hinauf zum Himmel. Dort verblassten gerade die letzten Sterne. Es würde ein klarer, wolkenlos blauer Januartag werden. Kreuthner betrat den zugefrorenen See. Er war etwa dreißig Zentimeter hoch mit Schnee bedeckt. Kreuthner stieß die Schaufel in den Schnee und stellte fest, dass er pulverig war und leicht. Hier oben waren die Temperaturen seit drei Wochen nicht über minus fünf Grad gestiegen. Der Schnee lag locker auf der Eisschicht. Kein Tauwetter hatte ihn mit dem Eis verklebt. Er musste nur noch weggeschaufelt werden.
Kreuthner ging hinaus auf den See. Etwa fünfzig Meter weit. Es knirschte. Kreuthner konnte nicht ergründen, ob es der Schnee war, der knirschte oder das Eis darunter. Ein weiteres Mal steckte er seine Schaufel in den Schnee und hob den Schnee vorsichtig vom Eis. Dann arbeitete er sich zwei Meter in die Länge vor. Von dem freien Streifen aus trug er zur Linken zwei weitere Meter Schnee ab, bis er eine vier Quadratmeter große Fläche blanken Eises hatte. Erschöpft ließ sich Kreuthner in der Mitte seines Miniatur-Eisstadions niedersinken. Es war inzwischen hell geworden. Mit den Händen wischte er die letzten Schneebrösel zu Seite und betrachtete fasziniert das Eis. Wenn man genau hinsah, dann war es nicht vollkommen eben. Winzige Erhebungen waren zu erkennen, kleine Hochebenen und Tafelberge, platt gedrückt wie Kaugummi auf der Straße. Im Eis selbst sah Kreuthner kleinste Luftblasen und jenseits davon Dunkelheit. Die Eisschicht mochte hier vielleicht dreißig Zentimeter messen. Darunter waren es zwanzig Meter bis zum Seegrund.
Kreuthner starrte auf das dunkle Eis. Die Kälte biss sich durch die Hose, die bereits am Eis festgefroren war, in seine Knie. Doch das kümmerte Kreuthner in diesem Moment nicht. Etwas anderes fesselte seine Aufmerksamkeit: Er meinte mit einem Mal zu sehen, wie sich die Dunkelheit unter dem Eis aufhellte. Ein goldfarbener Fleck mit unscharfen Konturen bildete sich dort in der Tiefe. Der Fleck wurde langsam heller und größer, fast hatte es den Anschein, als komme er auf ihn zu. Kreuthner hatte auf einmal das beklemmende Gefühl, dieses Etwas könne in wenigen Sekunden durch den Eispanzer brechen und sich auf ihn stürzen, ihn packen und mit sich in die Tiefe zerren. Ein Fluchtreflex stieg in ihm hoch. Doch Kreuthner widerstand der Versuchung, aufzustehen und zum Ufer zu rennen. Zum einen klebten die Knie am Eis. Zum anderen sagte er sich, das Eis sei bestimmt dick genug, um das, was da auf ihn zukam – was immer es auch war – aufzuhalten. Aber was war es? Ein Fisch? Dafür war es zu groß. Eine Luftblase? Wo sollte die herkommen? Und auch für eine Luftblase war es zu groß, wie man jetzt erkennen konnte, da das Ding immer näher kam. Ein Teil davon hatte eine käsig bleiche Farbe, die Kreuthner an die Gesichtsfarbe vom Wiebek Toni bei seinem Jahrhundertrausch erinnerte. Je näher das weiße Etwas kam, desto mehr Einzelheiten waren zu erkennen. Es waren Punkte auf dem Weiß, das wiederum umgeben war von einer Art goldener Aura. Die Punkte im Weiß erinnerten an ein menschliches Gesicht. Und wie er diesen Gedanken dachte, da schoss Kreuthner das Adrenalin bis in die Haarspitzen. Denn das, was da näher kam, war ein menschliches Gesicht! Immer deutlicher war es zu erkennen. Lautlos schwebte es auf Kreuthner zu. Langsam und schwerelos, wie im Weltall. Bis es schließlich mit einem Ruck unterhalb des Eises zur Ruhe kam. Es war das Gesicht eines jungen Mädchens. Es hatte die Augen geöffnet und starrte Kreuthner an. Und um das Mädchengesicht herum die goldene Aura, die Kreuthner sehr verwirrte.
2. Kapitel
Wallner kam mit seinem Wagen nicht allzu nah an den Tatort heran. Er musste ihn etwa zweihundert Meter vom See entfernt am Straßenrand abstellen. Die meisten Kollegen waren schon eingetroffen. Ebenso die Feuerwehr, die in der Zwischenzeit das Eis aufgesägt und die Leiche geborgen hatte. Die Feuerwehrleute räumten gerade ihre Sachen zusammen und hinterließen einen spurensicherungstechnischen Trümmerhaufen. Wallner betrachtete das Treiben. Er hatte keine Eile.
Wallner war achtunddreißig Jahre alt, groß und halbwegs schlank – was im Augenblick nicht zu erkennen war. Denn Wallner trug eine voluminöse Daunenjacke. Die trug er den ganzen Winter. Das heißt von Ende September bis Anfang Mai. Wallner litt an einem Leiden, das sonst zumeist den Frauen nachgesagt wird: Wallner fror. Ständig. Im Winter sowieso. Aber auch im Sommer. Wenn andere Männer nachts im Biergarten ihre Unverfrorenheit zur Schau stellten, wenn sie, als sei man in der Karibik, in T-Shirt oder dünnem Baumwollhemd unterm freien Sternenhimmel saßen, trug Wallner schon Strickjacke oder einen Wollpullover, von denen er eine große Auswahl besaß. Wallners größter Feind aber war der Luftzug. Nicht dass sich Wallner Sorgen um seine Gesundheit machte. Er fror einfach, wenn es zog. Andere Menschen waren oft erstaunlich unsensibel in der Hinsicht. Wallner hingegen hatte die empfindlichsten Antennen für Luft, die nicht stillstehen wollte. Hier am See war die Luft still. Bei minus dreizehn Grad.
Auf einer Wiese am See stand ein Campingtisch im Schnee. Auf dem Tisch Pappbecher und Thermoskannen. Wallner kannte den Tisch. Die Kollegen vom K 3, der Abteilung für Spurensicherung, führten den mit. Eine Insel der Kaffee-und-Kuchen-Gemütlichkeit an traurigen Orten. Sogar ein Teller mit Plätzchen stand darauf. Wallner ging zum Tisch und zapfte sich einen Becher dampfenden Kaffee. Während er sich umsah, trank er in kleinen Schlucken. Der Becher wärmte die Finger. Wallner griff gerade nach einem Zimtstern, als ihm der Gedanke kam, dass der Zimtstern wahrscheinlich steinhart gefroren war. Aber da hatte er ihn bereits in der Hand. Er drückte den Stern ein bisschen zwischen den Fingern. Man hätte damit eine Windschutzscheibe einschmeißen können. Wallner überlegte, ob er den Zimtstern zurücklegen sollte, entschied dann aber, ihn in die Tasche seiner Daunenjacke zu stecken.
In einiger Entfernung sah er Tina und Lutz, die an der nackten Leiche einer jungen Frau arbeiteten. Die Leiche lag auf dem Eis. Daneben hatte man in einer großen durchsichtigen Plastiktüte etwas Goldenes verstaut. Wallner konnte nicht erkennen, was es war. Nur, dass es groß war. Eigenartig groß. Was sollte eine Wasserleiche so viel Gold bei sich haben? In diesem Augenblick fiel ein erster Sonnenstrahl auf das goldene Ding. Und es war, als ginge es in Flammen auf, so leuchtete es. Als habe einer ein Lagerfeuer auf dem gefrorenen See entfacht.
»Als Letzter kommen, nix arbeiten und den anderen an Kaffee wegsaufen. San doch immer die Gleichen.«
Wallner blickte in Mike Hankes übernächtigtes Gesicht, das gleichwohl spitzbübische Laune verstrahlte. Mike gluckste und freute sich wie ein Kind über den Spruch, den er schon Dutzende Male angebracht hatte. Wallner goss Mike einen Kaffee ein und reichte ihm den Becher.
»Hier. Tu was für dein Gesicht. Was sind denn das für Ringe um die Augen?«
»War gestern noch mit dem Kreuthner unterwegs.«
Wallner war um die frühe Zeit noch nicht auf der Höhe seiner geistigen Beweglichkeit. Aber »Kreuthner« sagte ihm etwas.
»Hat der nicht die Leiche gefunden?«
»Hat er«, sagte Mike und nickte dabei, als mische dieser Umstand dem Fall besondere Tragik bei.
Mike berichtete, was vorgefallen war. Wie der Kreuthner vom Mautner in den Morgenstunden noch an den Spitzingsee gefahren war und dort unterm Eis die Leiche gesehen hatte. Er habe nicht lange gefackelt und die Kripo verständigt, weil ihm sofort klar gewesen sei, dass da Fremdverschulden im Spiel war. Er habe sogar gewusst, dass Tina in dieser Nacht Bereitschaft hatte, und sie direkt zu Hause angerufen. Tina habe zunächst an eine Wichtigtuerei des Kreuthner geglaubt und dieser Vermutung mit ein paar derben Sätzen – man kenne Tina ja – bei ihrer Ankunft am Tatort Ausdruck verliehen, sich dann aber bei der Untersuchung der Leiche selber von der Angemessenheit der vom Kreuthner ergriffenen Maßnahmen überzeugen können. Soweit Mike mitbekommen hatte, war unter dem linken Rippenbogen eine große Einstichwunde – mitten ins Herz. Kreuthner habe nach der Entdeckung der Wunde Tina auf die bösen Verdächtigungen bei ihrer Ankunft angesprochen und gemeint, ob da nicht eine kleine Entschuldigung angebracht sei. Tina habe dem Kreuthner entgegnet, er solle sich lieber von ihrem Tatort verpissen, was der Stimmung nicht eben zuträglich gewesen sei. Das mit dem Tatort sei auch ungerecht gewesen, da Kreuthner tadellose Vorkehrungen zu dessen Sicherung getroffen, vor allem für die Einrichtung eines Trampelpfades Sorge getragen habe. Aber die »Sackgesichter von der Feuerwehr«, wie Kreuthner sie genannt habe, hätten da überhaupt keinen Sinn dafür gehabt und alles kaputt getreten und Zigarettenkippen fallen lassen. Der Schaden halte sich freilich in Grenzen, weil für die Spurensicherung bei dem vielen Schnee ohnehin nicht viel zu holen sei.
»Was ist da passiert?«, fragte Wallner mit Blick auf die Leiche.
»Ich hab net die geringste Ahnung. Das Mädel ist etwa fünfzehn. Tina meint, sie hätt sie mal gesehen. Vielleicht an der Schule.«
Das rief Wallner in Erinnerung, dass Tina eine fünfzehnjährige Tochter hatte. Er sah Tina neben dem Gesicht des toten Mädchens knien. Sie hatte eine Hand der Toten in der ihren und suchte unter den Fingernägeln nach Hautpartikeln und anderen Fremdkörpern.
»Ist das gut, dass Tina die Leiche …«
»Sie hat gesagt, es wär okay«, sagte Mike. Aber auch er hatte offenbar Zweifel, ob ausgerechnet Tina die Leiche untersuchen sollte.
Wallner verzichtete darauf, zu Tina zu gehen. In diesem Stadium hatte er unmittelbar am Tatort nichts verloren. Das war jetzt das Reich der Spurensicherung. Lutz kam auf sie beide zu. Er hatte den Plastikbeutel dabei, aus dem es so golden schimmerte, und ließ ihn jetzt neben den Tisch plumpsen. Wallner versuchte zu erkennen, was darin war. Es sah aus wie Brokat.
»Schöne Scheiße«, begann Lutz das Gespräch.
»Ja, ziemlich jung, das Mädel«, meinte Wallner.
»Und schau dir mal den Tatort an. Das sind ja Vandalen.« Lutz meinte die Feuerwehr.
»Ist nicht so wild, wie’s ausschaut. Die Leiche ist da ja nur aufgetaucht. Weiß jemand, wo sie in den See geworfen wurde?«
»Vom Ufer aus kann sie kaum dort hingetrieben worden sein. Wir haben mal das Bodenprofil vom See unter die Lupe genommen.« Mike zog eine gefaxte Karte des Spitzingsees hervor, auf der akribisch die Höhenlinien eingetragen waren. Er deutete auf ein Kreuz, das den Fundort der Leiche markierte. »Da hätte die irgendwann bergauf treiben müssen.«
Wallner warf einen flüchtigen Blick auf die Karte, nahm einen Schluck von dem Kaffee, der inzwischen nur noch handwarm war, und wandte sich an Lutz. »Wie lange ist sie da unten gelegen?«
»Schwer zu sagen. Bei dem kalten Wasser ist die Verwesung erheblich verlangsamt. Das müssen die in der Gerichtsmedizin klären. Ich sag mal so: Sie schaut ziemlich frisch aus.«
»Wie lange ist der See schon zugefroren?«
Mike zuckte die Schultern. »Genau hat das hier keiner gewusst. Die vom Hotel sagen, dass sie schon Silvester auf dem Eis gewesen sind.«
Wallner ließ seinen Blick über den See schweifen. »Das heißt, die Leiche wurde vor Silvester in den See geworfen oder jemand hat ein Loch ins Eis gehackt, um sie zu versenken. Gibt’s eine Vermisstenanzeige?«
Mike schüttelte den Kopf. »Nicht hier, nicht in Bayern. Die anderen Bundesländer checken wir gerade. Aber wahrscheinlich ist sie eh aus dem Landkreis. Tina hat gesagt …«
»Ja, hast du erzählt.« Wallner blinzelte in die aufgehende Sonne. »Irgendwas stimmt hier doch nicht. Eine Fünfzehnjährige, die Tage oder Wochen abgängig ist – das muss doch mal einer gemeldet haben.«
»Mei – es passieren die seltsamsten Sachen.«
Mit dieser Erklärung war Wallner nicht wirklich zufrieden. Aber im Augenblick fiel ihm auch nichts Besseres ein. Er nahm den Plastiksack und betrachtete den Inhalt.
»Goldbrokat?«
»Ein goldenes Kleid. So eine Art Prinzessinnenkleid für den Fasching.«
»Das hatte die Tote an?«
»Ja.«
»Das kann nicht sein, dass sie nach einem Faschingsfest erstochen und in den See geworfen wurde? Mal ganz blöd gefragt.«
»Kaum«, meinte Lutz. »Unter so einem Kleid trägt man normalerweise Unterwäsche.«
»Du meinst, sie hatte nur das Kleid an?«
»Ja. Und sie ist in dem Kleid auch nicht erstochen worden. Es gibt keine Einstichstelle im Kleid.«
»Das heißt, der Mörder …«
»… hat ihr das Kleid hinterher angezogen.«
Wallners Blick wanderte zu der Leiche des Mädchens. Er hatte schon den einen oder anderen Mord erlebt. Der Landkreis Miesbach war nicht die Bronx. Aber ein bisschen gemordet wurde immer. Wallner hatte auch brutalere Morde als diesen gesehen. Blutbäder mit verstümmelten Leichen. Aber die Gründe waren immer die gleichen: Eifersucht. Drogen. Habgier. In neun von zehn Fällen stand der Täter innerhalb einer Stunde fest, man musste ihn nur finden und festnehmen. Der Rest war irgendwie kalkulierbar. Das hier war anders. Der Mörder dieses Mädchens hatte keines der üblichen Motive. Er wollte durch die Machart des Verbrechens etwas mitteilen. Die Frage war: Was und wem?
3. Kapitel
Wallner stellte den Becher mit dem mittlerweile kalten Kaffee neben den Plätzchenteller, sog die eisige Morgenluft bis in die Bronchien und ging ein paar Schritte in Richtung See. Bis zur Absperrung. Tina wurde auf Wallner aufmerksam und winkte ihm zu. Er winkte zurück. Dann begann Wallner den Ort des Geschehens in sich aufzunehmen. Nicht wie die Kollegen von der Spurensicherung. Die suchten nach Details, um sie zu sammeln und aus den Puzzlestücken ein Ganzes zu bauen. Darin waren sie besser, als Wallner es je werden konnte. Lutz und Tina hatten im Lauf der Jahre einen sicheren Instinkt entwickelt, welche der zigtausend Einzelteile an einem Tatort Hinweise auf den Täter geben konnten. Wallner suchte etwas anderes. Wallner spürte der Aura des Tatorts nach. Jeder Ort, an dem ein Verbrechen begangen oder ein Opfer gefunden wurde, hatte nach Wallners Meinung diese Aura. Ein Mord störte den ruhigen Fluss der Dinge. Als ob ein Stein auf die glatte Wasseroberfläche eines Teichs geworfen wurde. Das Wasser wurde unruhig, warf Wellen. Und diese Wellen waren noch einige Zeit, nachdem der Stein untergegangen war, sichtbar. Ebenso hallte für Wallner das Echo eines Mordes am Tatort nach. Er erinnerte sich an seinen letzten Tatort. Ein Haus in der Miesbacher Innenstadt. Eine Frau war von ihrem eifersüchtigen Freund mit vierundzwanzig Messerstichen getötet worden. Das war kein Stein im Teich gewesen. Es war, als hätte jemand mit einer Schrotflinte auf die Wasseroberfläche gefeuert. Die Wellen waren chaotisch und heftig gewesen, aber von kurzer Dauer. Das hier war anders. Das hier waren große Wellen, die von weit her kamen. Stark und geordnet.
Wallner betrachtete den See. Die Januarsonne hatte die Schneefläche in ein flaches, aber helles Licht getaucht. Er sah das Loch, aus dem man die Leiche geholt hatte, er sah Tina, zu der sich gerade der Gerichtsmediziner aus München gesellte. Er sah die Spuren der Feuerwehrleute im Schnee. Sein Blick glitt über die unberührten Teile des Sees. Eine weiße, blitzende, fast konturlose Fläche. Wallners Blick blieb hängen. Er spürte es mehr, als dass er es sah. Es war am anderen Ende des Sees. Die Sonnenstrahlen brachen sich an einer Stelle geringfügig anders als auf dem restlichen See. Irgendetwas war dort. Wallner ging zurück zu Mike, zeigte ihm die Stelle und bat ihn, ein paar Leute dorthin zu schicken. Aber sie sollten vorsichtig sein. Das Eis sei an dieser Stelle wahrscheinlich dünner. Ohne weitere Erklärungen entfernte sich Wallner. Er war bereits wieder in seine Gedanken versunken. Mike hatte mit der Zeit gelernt, kryptische Anweisungen seines Chefs in praktische Maßnahmen umzusetzen. Also nahm er sich ein paar Leute und begab sich zu der von Wallner angegebenen Stelle.
Was man denn da suche, wollte ein junger Kollege wissen, während sie über den verschneiten See stapften. Mike wusste auch nicht, was sie suchten. So ermahnte er den jungen Kollegen, keine Volksreden zu halten und stattdessen lieber hurtig die Schneeschaufel zu schwingen. Und wer als Erster ins Eis einbreche, zahle eine Runde Glühwein. Das sei eh klar. Der junge Kollege machte sich sogleich an vorderster Front ans Schaufeln, war aber nicht gewillt, sich mit dummen Sprüchen abspeisen zu lassen. Ob das hier eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sei, und was das Ganze eigentlich solle. Denn für heute Abend sei wieder Schnee angesagt. Dann könne man morgen gleich noch mal ausrücken. Oder glaube Mike vielleicht, dass der Täter hier das Messer auf dem Eis habe liegen lassen? Im Übrigen habe der Täter die Leiche ja logischerweise in den See geworfen, bevor der zugefroren sei. Und zwar dreißig Zentimeter dick. Da könnten sie lange auf einen Glühwein warten. Praktisch mit diesen Worten hatte der junge Kollege die Runde Glühwein auch schon verwirkt. Denn plötzlich knarzte und krachte es, und eh der Mann begriff, was geschah, steckte er bis zum Bauch im Eis.
Wallner war unterdessen um den See herumgegangen. Etwas hatte ihn beunruhigt. Und es war nicht die Stelle gewesen, an der der junge Kollege jetzt im Eis steckte. Als Wallner die kleine Unregelmäßigkeit auf dem Schnee entdeckt hatte, da war ihm, als sei dahinter noch etwas anderes. Im Wald. Aber der Schnee hatte in der Morgensonne geglitzert und geblendet. Und das hatte den Wald hinter dem See ganz schwarz aussehen lassen. Es war ein kleines Licht gewesen. Rot und einsam flackerte und tanzte es im dunklen Wald. Eine Täuschung, hätte er sich unter anderen Umständen gesagt. Nichts, weswegen er an einem kalten Januarmorgen um den ganzen Spitzingsee gelaufen wäre. Doch das kleine, rote Irrlicht war Wallner erschienen wie … nun, Wallner war nicht sehr gläubig, aber ihm war, als flackere dort eine einsame Seele. Und es war ihm weiter, als sei es die Seele des toten Mädchens, die da einen elfenhaften, traurigen Tanz vollführte. Wallner hatte sich die Augen gerieben und heftig den Kopf geschüttelt. Dann hatte er sich zwei Hände voll Schnee ins Gesicht gepackt und abermals zum Wald hinübergeschaut. Das Licht war jetzt verschwunden, und Wallner sagte sich, dass er sich in Acht nehmen müsse, dass ihm seine Müdigkeit keine Streiche spiele. Ihm ruhelose Seelen vorgaukele, wo in Wirklichkeit nichts war. Nur ein ungeklärter Mord. Wallner betrachtete Mike und seine Männer, die über den See zogen. Und da war es wieder aufgetaucht, das rote Seelenlichtlein.
Wallner kämpfte sich durch den verschneiten Wald und versank bald knöcheltief, bald bis übers Knie im lockeren Schnee. Von fern hörte er Männerstimmen, aufgeregt durcheinanderschreiend, dazwischen Mikes Anweisungen, wie man den jungen Kollegen aus dem Eis zu befreien habe; mit scharfem Ton verlangte er nach einer Wärmedecke, und nach dem Gerichtsmedizinfritzen solle man schicken, dass er sich das Schlamassel mal ansehe, nicht dass sich der junge Kollege noch wichtige Teile abfriere, bevor er seinen Glühwein auszutun die Gelegenheit habe. Wallner wandte sich vom Ufer ab, und die Stimmen wurden leiser. Immer mühsamer wurde der Weg durch den tiefen Schnee. Aber Wallner war sich seines Weges sicher. Hier hatte er das rote Lichtlein tanzen sehen. Es konnte nicht weit sein. Wallner war außer Atem geraten, halb vor Anstrengung, halb in erregter Erwartung dessen, was er antreffen würde. An einer umgestürzten Fichte blieb er stehen, blickte um sich. Es war dunkler geworden. Bleigraue Wolken hatten die Sonne verdeckt. Obwohl noch früh am Tag, herrschte mit einem Mal Dämmerstimmung. Die Kondenswolken aus dem eigenem Mund vernebelten Wallner den Blick. Als sie sich verzogen, sah Wallner hinter einer schneebedeckten Bodenwelle etwas Dreieckiges hervorragen. Wallner ging näher heran. Es war ein Holzdach, sehr klein. Von Traufseite zu Traufseite vielleicht einen Meter messend. Und recht viel mehr erhob es sich auch nicht über den Boden. Wallner beschleunigte seinen Schritt, rannte die letzten Meter. Schließlich stand er vor dem kleinen Dach, das ihm bei näherem Ansehen ein durchaus vertrauter Anblick war. Jetzt konnte er erkennen, was es war – das rote Licht. Nichts Ungewöhnliches. Doch was er über dem roten Lichtlein sah, raubte Wallner den Atem.
4. Kapitel
Die Sonne stand schon tief. Es war gegen halb fünf. Peter sah im Westen Wolken aufziehen. Aber der Westen ist weit, wenn man auf einem Zweitausender sitzt. Den ganzen Tag über hatte der Föhn den Alpenhauptkamm in Sonne und laue Winde gehüllt. Selbst jetzt war es noch warm. Peter blickte auf seine Skischuhe, an denen der Schnee sich zum größten Teil in Wasser verwandelt hatte, das in kleinen Bächen zwischen den Schnallen abfloss. Er nahm einen Schluck aus der Thermoskanne und reichte sie an das Mädchen weiter. Lisa saß zwei Meter weiter auf einem Stein. Sie war blond und hatte die Haare zu zwei Zöpfen geflochten und die Zöpfe um den Kopf gewunden. Die Strahlen der Nachmittagssonne verzauberten ihr Gesicht, brachten ihre blauen Augen mit dem dunkelblauen Ring um die Iris zum Leuchten und machten jede einzelne Sommersprosse auf ihrer Nase sichtbar. Sie war fünfzehn und lächelte. Sie lächelte erschöpft und jung, und das Herz wurde ihm schwer vor Glück.
»Schade, dass Mama nicht Ski fährt«, sagte Lisa und nahm einen Schluck aus der Thermoskanne.
»Ja, schade«, sagte Peter.
»Wir erzählen’s ihr besser nicht, wie?« In Lisas Blick lag Sorge.
»Na, wir erzählen’s ihr schon. Also im Wesentlichen.« Lisa sah ihn an, und ein schelmisches Lächeln spielte um ihre Lippen. Ein paar Sommersprossen auf der Nase verschwanden in kleinen Falten.
»Wir waren Skifahren. Das reicht ja.«
»Warum will Mama eigentlich nicht, dass ich Touren gehe?«
»Sie fährt nicht Ski. Deswegen weiß sie nicht, wie das ist, wenn man Touren geht. Und weil sie’s nicht kennt, macht es ihr Angst. In den Nachrichten bringen sie ja nur, wenn Tourengeher von Lawinen verschüttet werden. Sie denkt, das passiert ständig, verstehst du?«
»Klar. Wenn ich das nur aus den Nachrichten wüsste …« Lisa schraubte die Thermosflasche zu. Sie war ganz konzentriert auf diesen Vorgang, wie auf alles, was sie tat. Er sog die kleinste Bewegung von ihr ein. Sie gab ihm die Flasche zurück, und die abendlichen Sonnenstrahlen brachen sich in ihren Augen.
Gestern Nacht waren sie in das irische Pub gegangen. Lisa hatte auf der Schule davon gehört. Unter Leuten ihres Alters war es legendär. Die Gäste waren meist Engländer, Australier, Holländer und Schweden, kaum einer über zwanzig. Das Personal kam aus England und seinen ehemaligen Kolonien. Nur Claudia, die dunkelhaarige, leicht verlebte Schönheit hinter der Bar, war eine Einheimische aus dem Spertental. Ab 22 Uhr war der Boden des Lokals mit Glasscherben und Zigarettenkippen übersät und die Kellner betrunkener als die Gäste. Aus den Lautsprechern kam ein Musikmix aus Nirvana, Guns ’n’ Roses, Green Day und wieder Nirvana. Lisa hatte fünf Minuten, nachdem sie gekommen waren, einen holländischen Verehrer von siebzehn Jahren, der aber auf dem Weg zur Tanzfläche gegen einen schwedischen Tisch torkelte und anschließend in längere Verhandlungen über die Bezahlung der zu Boden gerissenen Getränke verwickelt wurde. Zwei junge Männer aus Wolverhampton sprangen für den Holländer ein. Peter behielt Lisa im Auge. Er setzte sich an die Bar und begann ein bisschen mit Claudia zu flirten. Claudia hatte gesehen, dass Peter mit Lisa gekommen war. Sie fragte, wer denn die Kleine sei. Peter sagte, das sei seine Tochter. Claudia schien einen Augenblick irritiert. Dann sagte sie: »Die hosch guat hinkriagt.«
Lisa stand mit den zwei Jungs auf der Tanzfläche. Blond, schlank, hochgewachsen. Sie trug die Haare offen und Jeans mit Löchern und Tennisschuhe aus Segeltuch. Peter bemerkte, wie die Männer im Raum seine Tochter anstarrten. Die zwei Engländer spielten Luftgitarre und versuchten, Lisa mit allerlei Albernheiten zu unterhalten. Lisa benahm sich höflich distanziert, lächelte, lachte auch. So wie eine Prinzessin, die halb amüsiert, halb in geübter Gewohnheit Huldigungen entgegennahm. Schließlich ließ sie ihre Verehrer stehen und ging zu Peter an die Theke.
»Was ist? Sind die Jungs nicht nett?«
»Ja, ganz süß.« Sie zuckte mit den Schultern. Er schob ihr einen Maracujasaft hin, den er bei Claudia bestellt hatte. Sie nahm den Strohhalm zwischen die Lippen und sog die Flüssigkeit ein. Für einen Augenblick verschmolz sie ganz mit dem Maracujasaft. Es schien nichts anderes zu geben als das Glas, den Saft, den Strohhalm und sie. In solchen Momenten hatte sie die Augen fast geschlossen. Er fragte sich, was sie zwischen ihren langen Wimpern sehen mochte. Vielleicht nichts. Vielleicht war ihr Blick auch nach innen gerichtet, und sie träumte von irgendetwas, das sie für sich behielt. Sie setzte das Glas mit Grazie auf dem Tresen ab.
»Tanzt du mit mir?«
»Bist du sicher? Ich meine, ich bin froh, dass mir hier noch niemand seinen Platz angeboten hat.«
Lisa lächelte ihn an. »So ein Quatsch«, sagte sie, als wäre sie fünfunddreißig. Dann zog sie ihn am Hemd und deutete mit dem Kopf zur Tanzfläche. In dieser Nacht hatten sie getanzt, Spaß gehabt, Lisa hatte zwei Gläser Sekt getrunken und eine Zigarette geraucht. Sie waren um halb drei in die Pension zurückgekehrt.
»Komm, Prinzessin, es wird Zeit, dass wir abfahren.« Lisa nickte und gab ihm die Thermoskanne zurück. Dann begann sie andächtig, die Schnallen ihrer Skischuhe zu schließen.
Die Idee mit der Skitour war Peter heute Morgen gekommen. Sie hatten spät gefrühstückt nach der anstrengenden Nacht. Es war ein schöner Tag. Die Luft war mild und der Frühling schon zu erahnen. Die Pisten würden brechend voll sein. Die meisten Leute hatten heute frei.
»Komm«, hatte Peter gesagt, »wir machen eine Skitour. Da sind wir allein auf der Piste.«
»Einfach so?«, hatte Lisa gefragt. »Wir haben doch gar nichts dabei.«
»Wir leihen uns Skier und Felle. Was meinst du?«
Sie waren zum nächsten Skiverleih gefahren, hatten sich die Ausrüstung ausgeliehen und gefragt, wo man in der Gegend am besten eine einsame Skitour machen könne. Peter war früher oft Skitouren gegangen. Er kannte sich einigermaßen aus. Drei Stunden später standen sie auf dem Gipfel in zweieinhalbtausend Metern Höhe. Die Sonne schien. Das Zillertal lag zu ihren Füßen.
Peter betrachtete Lisa, wie sie in sich versunken den Reißverschluss ihres Anoraks hochzog. Er fragte sich, wie oft sie noch eine Skiwoche miteinander verbringen würden. In ein oder zwei Jahren würde Lisa einen festen Freund haben oder lieber mit ihrer Clique verreisen. Noch ein paar Jahre später würde sie heiraten. Peter hoffte, dass Lisa einen Mann fände, den er mochte. Einer, mit dem man Ski fahren und ein paar vernünftige Sätze wechseln könnte. Auf ihrer Hochzeit würde Peter den Brautwalzer mit Lisa tanzen. Ganz altmodisch. Aber sie würde das so wollen.
»Was ist los? Du siehst mich so komisch an.« Lisa lächelte unsicher.
»Nichts. Ich war in Gedanken.«
Peter genoss noch einmal den Panoramablick. Im Südwesten konnten sie bis zum Ortler sehen, der schon in Südtirol war. Im Osten leuchteten rosa Großglockner und Großvenediger, im Norden begrenzten die schroffen Felsformationen des Karwendel den Horizont. Sie hatten eineinhalb Stunden Zeit, bevor es dunkel wurde. Das war mehr als genug, um ins Tal abzufahren. Lawinen waren nicht zu befürchten. Es hatte seit über einer Woche nicht geschneit. Was Peter etwas Sorge bereitete, war der feste Schnee. Lisa war keine erfahrene Tiefschneefahrerin. Aber sie war sportlich und hatte Kraft.
Peter packte die Felle in den Tourenrucksack und verstaute die Thermosflasche. Schließlich stieg er in seine Bindung und kontrollierte noch einmal, ob auch Lisa richtig in der Bindung stand.
»Und? Bist du fit?«
»Klar«, sagte Lisa und fuhr ein paar Meter ab, bis sie den Einstieg in den ersten Hang erreichte. Er war relativ steil, wurde aber nach unten zu flacher.
»Du brauchst ein bisschen Geschwindigkeit, sonst kriegst du die Skier nicht rum. Der Schnee ist ziemlich schwer.«
Lisa betrachtete mit ernstem Gesicht den unter ihr liegenden Hang und nickte.
»Also fahr schräg rein. Aber nicht zu schräg. Ich fahr vor. Versuch, ungefähr meiner Spur zu folgen.«
»Okay.«
Peter merkte, dass Lisa Respekt hatte vor dem Hang. Vielleicht auch Angst. Sie waren bislang erst zweimal auf einer Skitour gewesen. Aber das war in flacherem Gelände gewesen, in leichtem Pulver. Das hier war anspruchsvoller.
»Wenn’s nicht geht, dann einfach traversieren, anhalten, umdrehen und weiterfahren. Unten wird’s dann leichter.«
»Das geht schon«, sagte Lisa und biss sich auf die Oberlippe. Peter überlegte, ob er noch etwas zu ihrer Beruhigung sagen sollte, entschied sich dann aber loszufahren. Wenn Lisa tatsächlich Probleme haben würde beim Abfahren, dann könnte die Zeit, entgegen seiner ursprünglichen Berechnung, knapp werden.
Peter fuhr vorsichtig in den Hang, wobei er gründlich überlegte, welchen Einfahrtswinkel er Lisa zumuten konnte. Schon auf den ersten Metern spürte Peter, dass der Schnee fester war, als er angenommen hatte. Er zog ein paar weite Bögen. Doch das fiel selbst ihm nicht leicht. Auf halber Höhe des Hangs blieb er stehen.
»Sei vorsichtig! Der Schnee ist ziemlich fest!«, rief er zu Lisa hoch. Lisa zögerte, studierte den Hang, rutschte ein paar Meter ab, bevor sie sich entschloss loszufahren. Sie begann sehr flach, doch nach einer kleinen Kuppe wurde ihre Bahn steiler. Sie legte das Gewicht nach hinten. Dadurch gewann sie an Fahrt. Das erlaubte es ihr, einen großen Bogen zu fahren. Aber Peter sah, dass sie die Skier kaum noch unter Kontrolle hatte.
»Nicht so schnell, Lisa! Gewicht nach vorne!«
Doch Lisa hörte ihn nicht mehr. Oder sie hörte ihn, konnte seinen Rat aber nicht mehr befolgen, weil jetzt Skier und Schwerkraft das Kommando übernommen hatten. Kurz darauf flog sie an Peter vorbei. Er sah die Angst in ihrem Gesicht.
»Halt an! Lass dich fallen!«, schrie er ihr hinterher. Aber Lisa schoss jetzt fast senkrecht Richtung Tal. Es gelang ihr noch mit großer Kraftanstrengung, ihren Skiern eine Linkskurve aufzuzwingen. Doch dadurch raste sie jetzt auf eine Felskante zu. Peter stand paralysiert im Hang und starrte auf das kleiner werdende Mädchen, das sich mit unverminderter Geschwindigkeit der Kante näherte. Nur noch wenige Meter trennten Lisa vom Abgrund. Endlich ließ sie sich fallen. Nasser Schnee wirbelte auf. Die Skier wurden ihr von den Füßen gerissen und flogen durch die Luft. Lisa wurde – wenn auch abgebremst – weiter auf den Abgrund zugeschleudert. Peter betete, dass sie rechtzeitig anhalten möge. Doch ihre Geschwindigkeit war zu groß. Plötzlich war sie hinter der Felskante verschwunden. Peter blickte fassungslos nach unten. Kurz darauf hörte er zeitversetzt Lisas Schrei. Dann Stille.
5. Kapitel
Die Flamme flackerte in einem durchsichtigen roten Plastikbecher, der die Kerze vor Wind schützte. Ein Totenlicht wie zu Allerheiligen. Das Licht war an einem kleinen, überdachten Kruzifix angebracht – einem Marterl. Diese Holzkreuze wurden gewöhnlich im Gedenken an einen geliebten Menschen aufgestellt, der den Tod im Straßenverkehr gefunden hatte. Am Berg auch manchmal für einen, der nicht wiedergekommen war. Abgestürzt, vom Blitz erschlagen. Auch der ein oder andere Holzfäller war darunter, denn die Holzfällerei war kein ungefährliches Gewerbe. Das Kreuz, vor dem Wallner stand, war für ein junges Mädchen aufgestellt worden. Sein Name war Pia Eltwanger. Das Mädchen hatte ausweislich der Inschrift vom 4. November 1990 bis zum 14. Januar 2007 gelebt. Wallner konnte nicht beurteilen, ob das am Marterl angebrachte Foto das Mädchen zeigte, das da drüben tot auf dem Eis lag. Aber der angegebene Todeszeitpunkt lag erst einen Tag zurück. Und dort über der Kerze stand wörtlich: »Ermordet am 14. Januar 2007.«
»Was ist das?« Wallner drehte sich um. Hinter ihm stand eine Frau von etwa fünfundvierzig Jahren. Nicht unattraktiv, wenngleich sie eine gewisse Mütterlichkeit ausstrahlte. Wallner, aus seinen Gedanken gerissen, sah sie überrascht an. Dann erkannte er, wen er vor sich hatte. Die Frau hieß Lea Kesselbach. Sie war die Staatsanwältin und musste den Fußspuren nach direkt über den See gelaufen sein. Wallner hatte das eine oder andere Mal mit ihr zu tun gehabt. Nicht oft. Denn Kapitalverbrechen – und für die war Lea Kesselbach zuständig – passierten selten im Landkreis.
Die Staatsanwältin deutete auf das Kreuz.
»Hat das was mit unserem Fall zu tun?«
Wallner wandte sich, statt eine Antwort zu geben, wieder dem Kruzifix zu. Auch Lea Kesselbach nahm jetzt die Inschrift mit dem Wort »ermordet« wahr. Sie starrte entsetzt auf das Kreuz und murmelte: »Wie krank ist das denn?«
Die Staatsanwältin kam – ebenso wie der Gerichtsmediziner – aus München. Der Landkreis Miesbach hatte in Ermangelung eines Landgerichts keine eigene Staatsanwaltschaft. Der letzte Fall, der Lea Kesselbach und Wallner zusammengeführt hatte, lag vier Jahre zurück. Damals waren die beiden aneinandergeraten, weil die Staatsanwältin unablässig geraucht hatte. Wallner fühlte sich weniger durch den Rauch gestört, als durch den Umstand, dass Lea Kesselbach ständig das Büro lüften wollte. Es war auch damals Winter gewesen.
»Ich hab mir inzwischen das Rauchen abgewöhnt«, sagte die Staatsanwältin.
»Freut mich zu hören. Ich mir das Frieren leider noch nicht.«
»Das kann ja heiter werden.«
Wallner lächelte Lea Kesselbach so gewinnend an, wie ihm das bei der Aussicht auf offene Fenster möglich war.
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt war klar, dass man es nicht mit einem Routinemord zu tun hatte. Der Fall würde einiges an Ermittlungsaufwand erfordern. Man richtete sich auf arbeitsame Wochen ein. Praktisch die gesamte Belegschaft der Kripo Miesbach – das waren circa zwanzig Mitarbeiter – würde zunächst für den Mordfall arbeiten. Dazu kam Verstärkung von der Polizeidirektion Rosenheim. Wallner ordnete noch am Tatort an, alle Vorbereitungen für die Einrichtung einer Sonderkommission zu treffen und die Kollegen in Rosenheim zu verständigen.
Der Konferenzraum war mit fast dreißig Personen gut gefüllt, die Atmosphäre angespannt und erwartungsvoll. Die meisten Anwesenden waren nicht am Tatort gewesen und wussten nur von Kollegen, worum es ging. Diese Kollegen wiederum kannten das meiste ebenfalls nur vom Hörensagen. Gerüchte schossen ins Kraut. Ein ganz abgedrehter Mord sei das. Von Satanisten oder Sekten ging die Rede, andere hatten angeblich gehört, es sei noch eine zweite Leiche gefunden worden, und ein ganz schlecht informierter Spurensicherer aus Rosenheim verbreitete die Geschichte, der Kreuthner habe nachts im Suff ein Mädchen in den Tegernsee geworfen.
Das hitzige Getuschel ebbte ab. Wallner hatte zusammen mit der Staatsanwältin den Raum betreten. Die beiden nahmen am Kopfende eines großen Tisches Platz. Wallner hatte Papiere dabei, die er vor sich auf den Tisch legte. Er wechselte noch zwei Sätze mit Lea Kesselbach und schenkte ihr dabei Kaffee aus einer Thermoskanne ein. Dann wandte er sein Gesicht dem Saal zu. Das letzte Gezischel verstummte.
Wallner bat zunächst, das Fenster zu schließen, und stellte die Staatsanwältin vor. Dann begrüßte er die Kollegen aus Rosenheim, dankte ihnen für ihr Kommen und verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass man sie nicht allzu lange benötigen würde. Allerdings verlasse niemand diese Polizeiinspektion, bevor nicht sämtliche Plätzchen aufgegessen seien, die sein Großvater zu Weihnachten für die Kripo Miesbach gebacken habe und die in teils versteinerter Form in der Teeküche lagerten. Es dürfte sich um etwa zwanzig Kilo handeln.
Damit war der humorige Teil der Veranstaltung beendet. Wallner machte eine Pause und blickte kurz in seine Papiere.
»Heute Morgen wurde im Spitzingsee unter dem Eis die Leiche eines sechzehnjährigen Mädchens gefunden. Das Mädchen hieß Pia Eltwanger und wohnte in Rottach-Egern. Die Kollegen aus Wiessee verständigen gerade die Eltern.«
Ein Kollege meldete sich zu Wort, der ganz am Anfang am Tatort gewesen, dann aber mit Organisationsaufgaben zurückgeschickt worden war.
»Woher wissen wir das? Irgendwer hat doch gesagt, sie hätt keine Papiere dabeigehabt.«
»Das ist richtig. Und gekannt hat sie auch keiner. Der Mörder hat eine Art Hinweistafel am Tatort aufgestellt.«
Ein Raunen ging durch den Saal. Da! Habe man es nicht gesagt? Eine vollkommen schräge Kiste sei das. Und man könne gespannt sein, was noch komme.
Wallner berichtete von dem Prinzessinnenkostüm, das die Leiche anhatte, von der Stichverletzung und von dem eigenartigen Marterl, das der Mörder – jemand anderer kam dafür kaum in Frage – ein paar Meter vom Ufer entfernt im Wald aufgestellt hatte.
»Der Mörder«, setzte Wallner seinen Vortrag fort, »der Mörder ist sehr umsichtig vorgegangen, hat aber einige Dinge getan, die nur schwer zu begreifen sind. Allerdings hat er uns damit auch Hinweise über den Tathergang an die Hand gegeben. Wie es im Augenblick aussieht, hat sich Folgendes abgespielt: Der Täter hat das Mädchen auf irgendeine Weise in seine Gewalt gebracht. Vermutlich kampflos, also durch einen Trick. Die Leiche wies nirgendwo Kampfspuren auf. Im Übrigen auch keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Dann hat er das Mädchen betäubt und durch einen sehr gezielten Stich ins Herz getötet. Der Einstichwunde nach mit einem Stilett. Das mit der Betäubung vermuten wir nur. Nach der Obduktion wissen wir mehr. Aber der Stich ist so präzise, den kann man eigentlich nicht setzen, wenn sich das Opfer wehrt. Zum Zeitpunkt der Tat war das Opfer vermutlich schon entkleidet. Es haben sich jedenfalls an der Einstichstelle keine Hinweise auf Textilien gefunden. Als das Mädchen tot war, hat der Täter ihm dieses goldene Kleid angezogen.« Wallner hielt ein Foto der bekleideten Leiche hoch, so wie sie aus dem See gezogen worden war. »Die meisten, die das gesehen haben, sagen, sie schaut aus wie eine Prinzessin. Vielleicht hat das ja irgendwas zu bedeuten. Okay. Dann hat er sie mit einem Polaroidapparat fotografiert und ist mit der Leiche zum Spitzingsee gefahren. Also wahrscheinlich. Wir vermuten mal, dass der Mord nicht da passiert ist. Ist aber momentan nur so ein Gefühl. Zum Schluss hat er ein Loch ins Eis gehackt und die Leiche im See versenkt. Wir haben eine Stelle im Eis gefunden, die dünner war. Offenbar noch nicht lange zugefroren. Leider ist der Bichl Toni da eingebrochen. Ich hoffe, es geht ihm wieder einigermaßen.«
»Dem geht’s erst schlecht, wenn er wieder fit is«, meldete sich Mike. »Ich hab so a G’fühl, wie wenn der sich vor dem Glühwein drücken will. Deswegen wär’s mir ganz recht, wenn mir des im Protokoll festhalten könnten: Bichl Anton – eine Runde Glühwein schuldig.«
Interessierte Fragen nach dem Grund für die Runde Glühwein und vor allem nach dem Kreis der Begünstigten prasselten auf Mike ein.
»Mei«, fasste Mike die Ereignisse zusammen, »ich hab g’sagt, gebt’s Obacht. Wer z’erscht einbricht, zahlt a Rund’n Glühwein. Und er? Nix wie blöd daherreden. Und zack – war er weg.«
Heiterkeit machte sich breit. Wallner blätterte inzwischen in seinen Papieren, um zu sehen, was er noch vortragen musste. Unversehens hatte sich der Saal in eine scherzende Schwatzrunde verwandelt.
»Hallo, Kollegen! Können wir weitermachen?«
Es wurde wieder still.
»Also: Der Täter hat die Leiche im See versenkt. Die letzte Nacht war ziemlich kalt da oben am Spitzingsee. Das Loch ist daher schnell wieder zugefroren. Und dann hat es die ganze Nacht draufgeschneit. Deswegen hat man am Anfang auch nichts gesehen von dem Loch. Dann gibt es noch dieses Holzkreuz, das etwa dreißig Meter vom Ufer entfernt im Wald gestanden ist.« Er hielt ein Foto hoch. »Auf dem Kreuz steht unter anderem: Pia Eltwanger. Ermordet am 14. Januar 2007. Also gestern. Es ist nicht zu vermuten, dass der Mörder uns damit in die Irre führen will. Wenn er das gewollt hätte, hätte er gar nichts gemacht. Dann wäre die Leiche vielleicht erst im Frühjahr aufgetaucht, und wir hätten so gut wie nichts über den Todeszeitpunkt sagen können. Also noch mal: Der Mord wurde höchstwahrscheinlich gestern begangen. Dafür spricht auch was anderes: Es gibt keine Vermisstenanzeige. Dass das Mädchen schon länger verschwunden war, ist also kaum vorstellbar. Was es jetzt mit diesem Holzkreuz noch auf sich hat, kann uns der Lutz erzählen.«
Lutz sah bedächtig in seine Akten, dann stellte er sich kurz den auswärtigen Kollegen vor und begann in einer leicht unbeholfen und verwirrt wirkenden Art zu referieren, wobei er ein großes Farbfoto des Kreuzes in die Luft hielt und es dann herumgehen ließ.
»Des is des Kreuz, also a Marterl praktisch, wo sich am Tatort, das heißt Tatort wiss’ ma ja net, aber praktisch am Fundort der Leiche, äh, aufgefunden wurde. Ich lass des jetzt amal rumgehen. So – wo hammas denn …«, er kramte in seinen Papieren, fand endlich das Blatt, das er suchte, und studierte es dann, als bekomme er es zum ersten Mal zu Gesicht. Es kam schon Ungeduld auf, als Lutz endlich mit seinem Vortrag fortfuhr. »Äh, genau«, sagte er und tippte dabei auf das Papier. »Des Holz von dem Kreuz is Fichte. A schlichte Ausführung, könnt ma sagen. Trotzdem keine Massenware. Des hat, vermuten mir jetzt amal, a Schreiner g’macht. Deswegen hamma vielleicht a Chance, dass mir rauskriegen, wo des genau her is, und wenn ma Glück ham – ich glaub’s ja net –, aber wie g’sagt, vielleicht kommt ma ja doch auf’n Käufer. Äh, Fingerabdrücke waren jetzt keine drauf, also am Kreuz selber. Auch net auf der Kerze, und auf dem Windschutz war auch nix. Des war wirklich, wie wenn mei Schwiegermutter des putzt hätt.«
Höfliches Gelächter. Lutz freute sich, dass ihm ein Scherz gelungen war.
»Nur auf dem Foto, da war a einzelner Fingerabdruck. A Daumenabdruck. Inzwischen wiss’ ma auch, dass der vom Opfer stammt. Und, äh, mir vermuten auch, weil hinten, da war jetzt nix drauf, also kein Abdruck von am anderen Finger. Deswegen glauben mir nicht, dass das Opfer quasi des Foto in die Hand genommen hat.«
»Is eh unwahrscheinlich, dass die a Foto von sich als Leich in die Hand nimmt. Des kann ich dir auch so sagen.«
Das anschließende Gelächter brachte Lutz etwas aus dem Konzept. Mike gluckste und schaute mit blitzenden Augen in die heitere Runde. Wallner sah Mike genervt an. Er hatte ihn schon mehrfach gebeten, Lutz nicht bloßzustellen. Aber Mike hätte sich eher den kleinen Finger abgehackt, als die Steilvorlage von eben nicht zu verwerten.
»Ja logisch«, nahm Lutz verlegen lächelnd den Faden wieder auf. »So g’sehen. Des is natürlich auch richtig. Jedenfalls – und des is jetzt des Interessante – hat der Täter selber den Fingerabdruck da draufgemacht auf das Foto. Also natürlich net in dem Sinn, dass er selber, also net seinen Fingerabdruck … er hat halt den Daumen von dem Opfer genommen und den praktisch auf das Foto druckt. Ich hoff, ich hab mich da …« Er blickte unsicher in die Runde. Mike klopfte ihm auf die Schulter.
»Ich glaub, jetzt hat’s jeder kapiert. Was ich net versteh, is: Wieso hat er’s g’macht?«
»Na ja, eine Erklärung wäre …«, Wallner unterbrach sich selbst. »Danke, Lutz. Ich denk, das war’s auch so im Groben.« Lutz gab durch eine Geste sein Einverständnis, dass Wallner wieder das Wort ergriff. Dann wandte sich Wallner Mike zu. »Ich vermute Folgendes: Der Täter konnte ja nicht damit rechnen, dass der Kollege Kreuthner schon am nächsten Morgen die Leiche entdeckt.«
»He, Kreuthner, wie hast’n des g’schafft mit dem Rausch im G’sicht?!« Der Zwischenrufer war Polizeimeister Sennleitner, einer der Männer, mit denen Kreuthner vor der Entdeckung der Leiche im Mautner gezecht hatte.
»Ich geh mal davon aus, dass der Kollege Kreuthner nüchtern war, sonst hätte er ja nicht mehr mit dem Auto zum Spitzingsee fahren können«, sagte Wallner. »So. Spaß beiseite. Meine Hypothese: Der Täter hat das Kreuz aufgestellt, damit man die Leiche möglichst bald findet. Ich schätze, der Fingerabdruck auf dem Foto sollte lediglich untermauern, dass es sich nicht um einen makabren Scherz handelt.«
»Und was hat er davon, wenn die Leiche schnell gefunden wird?«
»Gar nichts. Die Motive des Täters sind nicht rational nachvollziehbar. Aus irgendeinem Grund ist ihm daran gelegen, dass das Opfer und die Tat ans Licht der Öffentlichkeit kommen.«
»Aber dann schmeiß ich die Leiche doch net in ’n Spitzingsee. Dann tu ich die irgendwohin, wo man sie leicht findet.«
»Im Prinzip richtig. Nur – wenn ich mir das Ganze ansehe, dann scheint das eine einzige perverse Inszenierung zu sein. Wer immer das getan hat, hat Gründe, die werden wir in einer Million Jahren nicht verstehen.«
Wallner nutzte die Gelegenheit, um ein paar Worte über das Täterprofil zu verlieren. Er war kein Fachmann. Aber ein paar Grundkenntnisse hatte er sich erworben, und er konnte eine grobe Einschätzung abgeben. Für eine konkretere Aussage musste man das Ergebnis der Operativen Fallanalyse abwarten, besser bekannt unter der Bezeichnung Profiling. Die Fallanalytiker waren eine eigenständige Abteilung der Polizei und bei einer Mordermittlung nicht Teil der Sonderkommission. Sie lieferten ihre Erkenntnisse dazu wie die Gerichtsmedizin oder die Labors. Es konnte allerdings Wochen dauern, bis ein Täterprofil erstellt war.
Im vorliegenden Fall musste man davon ausgehen, dass der Täter nicht mehr ganz jung war, über dreißig, wahrscheinlich über fünfunddreißig. Dafür sprach das äußerst planvolle Vorgehen. Das Fehlen von Kampfspuren und der Umstand, dass der Täter das Mädchen vermutlich irgendwo an einem nichtöffentlichen Ort betäuben konnte, waren Hinweise darauf, dass Täter und Opfer sich kannten. Das wiederum mochte bedeuten, dass der Täter entweder in der Umgebung des Opfers zu suchen war – Verwandte und Bekannte der Eltern oder auch der Bäcker um die Ecke oder ein Lehrer. Die andere Variante: Das Opfer kannte den Täter ursprünglich nicht. Der Täter hatte sich aber das Vertrauen des Mädchens erworben.
»Glauben Sie, er hat sein Opfer zufällig ausgewählt?«, fragte die Staatsanwältin.
»Er muss das Mädchen lange beobachtet haben, er hat alle Vorbereitungen getroffen, um genau dieses Mädchen zu töten. Er kannte ihren Namen und hat ihn auf einem Holzkreuz eingraviert. Und auch die Konfektionsgröße des goldenen Kleides stimmt. Insofern kann man kaum von Zufall sprechen. Eine andere Frage ist: Kam es ihm wirklich darauf an, Pia Eltwanger umzubringen? Oder war es einfach ihr Aussehen? Hat sie zufällig in sein Opferschema gepasst? Hat sie ihn zufällig an jemanden erinnert? Ich weiß es nicht.«
In diesem Moment klingelte Wallners Handy. Er sah am Display, dass es Tina war, entschuldigte sich und verließ den Raum.
Tina klang aufgeregt. Sie rief aus der Gerichtsmedizin an. Tina war bei der Obduktion der Leiche dabei gewesen und hatte weitere Spuren vom Körper des Opfers gesammelt. Der Tod des Mädchens war vor etwa achtzehn Stunden eingetreten, so das Obduktionsergebnis. Eine Vergewaltigung hatte nicht stattgefunden. Im Blut der Leiche war Flunitranzepam nachgewiesen worden, ein Wirkstoff aus der Gruppe der Benzodiazepine – besser bekannt als K.-o.-Tropfen. Damit war Pia Eltwanger betäubt worden, wie Wallner vermutet hatte. Aber sie hatten noch etwas anderes gefunden, und das kam Tina so seltsam vor, dass sie Wallner gleich angerufen hatte.
»Was ist es denn?«, fragte Wallner.
»Ich weiß offen gesagt nicht, was es ist«, sagte Tina. »Es könnte eine Botschaft des Mörders sein.«
6. Kapitel
W