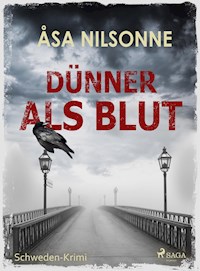Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Monika Pedersen
- Sprache: Deutsch
Monika Pedersen wird auf tragische Weise mit ihrer eigenen Lebensgeschichte konfrontiert: In einem Buch eines Psychologen liest Pedersen über eine junge Frau, die aufgrund psychischer Labilität ihr Kind zur Adoption freigab und kurz darauf ermordet wurde. Alles deutet darauf hin, dass es sich um Pedersens eigene Mutter handelt, nur dass diese bei einem Autounfall ums Leben kam... Was ist dran an der Geschichte? Pedersen deckt die fehlenden Puzzleteile nach und nach auf.Die fünf Kriminalromane rund um die ehrgeizige Stockholmer Polizistin Monika Pedersen kreisen nicht nur um spannende Fälle in bester skandinavischer Krimitradition, sondern handeln auch von ihrer persönlichen und professionellen Entwicklung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Åsa Nilsonne
Der Psychologe - Schweden-Krimi
Saga
Der Psychologe - Schweden-Krimi Übersetzt Gabriele Haefs Coverbild / Illustration: Sutterstock Copyright © 2004, 2020 Åsa Nilsonne und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726445046
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Prolog
Marie-Clothilde de Juniac fröstelte in der kühlen Kellerluft. Die schwarze Steinmauer neben ihrem dünnen Arm war klamm wie ausgekühlte Haut, und es fiel ihr schwer, sich zu konzentrieren.
Inzwischen war sie allein mit Schwester Miséricorde, die an dem kleinen Pult vorn im Raum Aufsätze korrigierte, was auch die nächste Dreiviertelstunde noch so bleiben würde. Marie-Clothilde bereute den nächtlichen Raubzug durch die Schulküche trotzdem nicht; es war die zwei Stunden Nachsitzen eindeutig wert gewesen.
Sie tunkte die Spitze des schweren Zirkels ins Tintenfass. Seit undenklichen Zeiten schrieben die Mädchen in der Klosterschule mit Tinte, und die Schwestern sahen keinen Grund, etwas daran zu ändern, nur weil man mittlerweile das Jahr 1959 schrieb. Marie-Clothilde drückte die Spitze durch das Papier, stellte sie so ein, dass die Linie exakt die richtige Breite hatte und zeichnete ihren Kreis.
Sie hörte vage, dass Schwester Miséricorde sich vom Pult erhob und ihren Stuhl zurückschob. Der Kreis war zur Hälfte fertig. Die Schwester sollte sehen, dass Marie-Clothilde fleißig arbeitete. Plötzlich stand die Schwester direkt neben ihr. Durch den groben Stoff der schwarzen Tracht spürte Marie-Clothilde ihren breiten Oberschenkel an ihrem nackten Oberarm. Sie zog ihn zurück, als sei sie selbst im Weg und nicht die Schwester ihr zu nah gekommen.
Aber Schwester Miséricorde legte Marie-Clothilde die Hand auf die Schulter, schob sie zurück und drückte sie an ihre weich geschwungene Hüfte. Die Nonne roch nach Küche, nach der Lavendelseife, die in der Schule benutzt wurde, nach Talg und alternder Haut. Sie hatte breite, platte Fingernägel.
Marie-Clothilde machte Anstalten, sich zu wehren, aber die Schwester war stärker und hielt sie fest. Ihre andere Hand befand sich plötzlich auf Marie-Clothildes Rücken und wanderte langsam nach oben.
Marie-Clothilde saß stocksteif da und wagte kaum zu atmen. Am Ende erreichte die Hand der Schwester Marie-Clothildes Nacken, wo die dicken weißen Finger vorsichtig die weichen Haare betasteten, sie zu einer kleinen Schlinge drehten und sie durch ihre Fingerspitzen gleiten ließen.
Die Schwester keuchte wie nach einem Dauerlauf, und ihre Stimme war nicht wiederzuerkennen, als sie sprach.
»Vor der Liebe braucht man sich nicht zu fürchten«, sagte sie so dicht neben ihr, dass Marie-Clothilde ihren warmen, feuchten Atem deutlicher spürte, als sie die Worte hörte.
Es war offenbar so weit.
Langsam setzte Marie-Clothilde sich gerade, drehte sich ein Stück und blickte Schwester Miséricorde in die Augen. Ihr fiel auf, dass in einem Augenwinkel ein wenig getrocknetes Augensekret klebte.
Marie-Clothilde hielt den Zirkel noch immer in der rechten Hand, während sie mit der linken nach ihrer Feder suchte. Sie klappte den Zirkel gerade und betastete die scharfe Spitze mit dem Zeigefinger. Der keuchende Atem der Schwester kam jetzt in regelmäßigen Stößen und legte sich auf ihren Hals und ihre Wange.
Es war eindeutig so weit.
Marie-Clothilde holte tief Luft, stemmte ihre Unterarme gegen die weiche Körpermitte der Schwester und stieß sich ab, was ihr den nötigen Raum verschaffte, um die Hände zwischen sich und die Nonne zu schieben. Der Zirkel funkelte wie ein Messer, als sie ihn vor dem Gesicht der Schwester hochhob. Mit der linken Hand legte sie die Feder quer davor, so dass ein Kreuz entstand.
»Arrière de moi, Satan«, sagte sie, ehe sie, mehrsprachig, wie sie war, hinzufügte: »Get thee behind me, Satan« und »Apage Satanas!«
Die Wirkung fiel genauso dramatisch aus, wie sie erhofft hatte. Schwester Miséricorde verstummte zuerst, dann erbleichte sie, wich mit weit aufgerissenen Augen zurück und stürzte stolpernd davon, als hätte sie den Teufel gesehen und nicht das Kreuz.
Um der Wirkung willen sandte Marie-Clothilde noch ein »vade retro, Satan« hinterher, obwohl die Schwester schon halb zur Tür hinaus war.
Marie-Clothilde seufzte, schüttelte ihren mageren Leib wie ein Hund, der sich vom Wasser befreit, und wandte sich wieder ihrem Kreis zu. Jetzt standen nur noch vierundvierzig Minuten Nachsitzen aus, die sie brav hinter sich zu bringen beabsichtigte.
Als sie am nächsten Tag ihren wöchentlichen Brief nach Hause schickte, fügte sie ein PS an:
»Merci maman pour tes conseils regardant les soeurs amoureuses, ils ont servi à merveille.«
(»Danke, Mama, für deine Ratschläge zu den amourösen Nonnen – sie haben wunderbar gewirkt.«)
1
Die Härchen auf Monika Pedersens Armen sträubten sich. Die Bewegung setzte in der Nähe der Armbeuge ein und pflanzte sich wie eine Welle oder eine Seuche bis zu den Händen fort.
Rasch ließ sie das Buch sinken und atmete tief durch. Der harte Einband schlug gegen ihr verletztes Bein, und sie verkrampfte sich in Erwartung eines Schmerzes, der jedoch überraschenderweise ausblieb. Das musste ein Zeichen des Fortschritts sein. Ihr Unfall lag jetzt fast drei Monate zurück, aber die Heilung war nur langsam vorangeschritten. Monika war noch immer krankgeschrieben und brauchte also nicht zum Dienst bei der Kriminalpolizei zu erscheinen.
Misstrauisch blickte sie auf die dicht beschriebenen Seiten, die mit einem Mal anonym und unpersönlich aussahen. Offenbar hatte sie das Gelesene missverstanden. Ein Buch, von dem sie nie in ihrem Leben gehört hatte, konnte wohl kaum von ihrer Mutter handeln. Vielleicht kam es häufiger vor, dass jemand auf Buchstellen stieß und sich darin wiederzuerkennen glaubte.
Um sich im Krankenhaus die Zeit zu vertreiben, hatte sie angefangen zu lesen und auch nach ihrer Entlassung damit weitergemacht. Nach den ersten fünf oder sechs Büchern hatte sie förmlich eine Art Hunger entwickelt.
Sie wollte die Welt durch anderer Menschen Augen sehen und näherte sich neuen Büchern jetzt mit großer Freude und Neugier.
In den vergangenen drei Monaten hatte sie mehr Bücher gelesen als während der gesamten fünfundzwanzig Jahre davor. Liebesromane, historische Romane, Fantasy und Science Fiction, Biografien, alles mit einer bedingungslosen Entdeckungslust. Das Einzige, was sie nicht anrührte, waren Kriminalromane – sie hatte mit mehr Morden zu tun gehabt, als sie sich erinnern konnte, und das Letzte, worüber sie lesen wollte, waren fiktive Ermittlungen, vor allem, da die Morde oft reichlich grotesk dargestellt wurden und die Arbeit der Polizei geradezu lächerlich unwahrscheinlich wirkte.
Das Buch, das jetzt auf ihren Knien lag, hatte lange warten müssen, bis es an die Reihe gekommen war – weder Einband noch Klappentext hatten sonderlich verlockend gewirkt. Aber die Krankenhausbibliothekarin hatte sie mit den fröhlichen Worten auf ihren wöchentlichen Bücherstapel gelegt: »Sie interessieren sich doch für Menschen, da wird Ihnen dieses Buch gefallen.«
Der Titel hatte alles andere als verheißungsvoll ausgesehen – Meine Patienten – mein Leben, dazu der Untertitel: »Vierzig Jahre psychoanalytische Erforschung der menschlichen Psyche«. Monika hatte sich das Buch nur geben lassen, weil sie hoffte, der Autor könne hilfreiche Hinweise geben, wie man einen stetigen Strom von Patienten, von menschlichem Elend überlebte. Vielleicht wussten Psychologen in dieser Hinsicht ja etwas, von dem die Polizei noch nicht gehört hatte.
Die Frage war nur, ob dieses Wissen noch immer relevant war. Sie war mit der brutalen Arbeitssituation, in der sie bisher gelebt hatte, doch fertig. Vielleicht war dies eine Erklärung dafür, dass sie das Buch noch nicht gelesen hatte, aber ein wenig neugierig war sie ja doch gewesen, deshalb hatte sie es nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus mit nach Hause genommen. Dort war es dann wieder liegen geblieben, aber nun hatte sie es endlich hervorgeholt. Sie hatte es neben Teetasse und Morgenzeitung auf den Küchentisch gelegt, als Puffer zwischen sich und dem langen, planlosen Tag, der ihr bevorstand.
Der Umschlag war abgegriffen, doch innen hatte das Buch unberührt ausgesehen – vielleicht hatten es andere ausgeliehen und als Unterlage benutzt, es aber nicht gelesen? Aber das sollte sich jetzt ändern!
Sie hatte sich bequem hingesetzt, zu frühstücken angefangen und gelesen. Wie sie festgestellt hatte, bestand das Buch aus einer Sammlung von Fallstudien – Zusammenfassungen von Lebensschicksalen und Therapieverläufen. Das Lesen war ihr schwer gefallen, da die Sprache mit Fachbegriffen gespickt war und keinerlei stilistischen Ehrgeiz aufwies, und nach ein paar frustrierenden Minuten hatte Monika beschlossen, dem Buch nur noch eine Stunde Zeit zu gewähren. Wenn es nicht spannender wurde, konnte sie es immer noch beiseite legen.
Aber bei der zweiten Fallstudie hatten sich ihre Haare gesträubt.
Sie griff nach dem Buch und las weiter.
»Wer berühmt wird, entdeckt plötzlich, dass dieser Ruhm andere berühmte Menschen anzieht. Auch in meinem Fall war das so. Eine unserer prominenten Politikerinnen suchte mich auf, um ihrer Tochter zu helfen, und ich nahm mich wider besseres Wissen ihrer an, weil ich Hilfe bieten wollte, fast als patriotische Pflicht. Deshalb konnte ich die tragische Entwicklung einer ganz besonders schweren Charakterneurose über fünfzehn Jahre verfolgen, leider ohne sie wirklich beeinflussen zu können. Das Ganze gipfelte im Tod der Patientin, nicht durch Selbstmord, wie man doch meinen könnte, sondern durch Mord, was eine ungewöhnliche und reichlich erschütternde Art ist, eine Patientin zu verlieren, auch wenn dieser Mord in diesem Fall durchaus seine Logik hatte.«
Hier war Monikas Interesse ein wenig geweckt worden – ein Mord könnte den spröden Text vielleicht zugänglicher machen, und es handelte sich immerhin nicht um Gewalttaten, die der Unterhaltung dienen sollten.
Mordermittlungen waren ihr selbstgewählter Lebensinhalt gewesen, ihre Art, sich für eine bessere Gesellschaft zu engagieren. Die ersten Jahre waren auch zufrieden stellend verlaufen, aber ihre Arbeitsfreude hatte immer mehr nachgelassen und war am Ende ganz verflogen.
In den vergangenen Monaten hatte sie versucht, nicht an ihre Arbeit zu denken, doch nun tauchte ein Mord in einem ganz unerwarteten Zusammenhang auf.
Das erinnerte sie daran, dass sie zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben nicht wusste, was aus ihr werden sollte.
Sie las weiter.
»Es war eine hoch gewachsene, elegant gekleidete Frau, die meine Praxis aufsuchte. Sie war am Vortag aus New York eingetroffen und schien höchst energiegeladen zu sein, vielleicht lag das aber nur an ihrer professionellen Disziplin. Es war eine Frau, die keine der üblichen weiblichen Schwächen oder irgendeine Form von Empfindsamkeit an den Tag legte. Eine Erklärung dafür bekam ich viel später: Ihr Vater hatte sie wie den Sohn aufgezogen, den er sich gewünscht hatte. Sie hatte diesen kastrierten Zustand mit dem innigen Wunsch kompensiert, es in einer männlichen Sphäre weit zu bringen, was ihr auch gelungen war. Doch wie meist in diesen Fällen hatte das einen hohen Preis gefordert, der teilweise von ihrem einzigen Kind bezahlt werden musste, einer Tochter, die sie mit knapp dreiundvierzig Jahren zur Welt gebracht hatte. Und diese Tochter, die nun ihrerseits schwanger war, wurde meine Patientin.«
An dieser Stelle hatte Monika innegehalten. Monikas Großmutter war groß gewesen, hatte in New York gearbeitet und mit knapp dreiundvierzig Jahren ihr erstes und einziges Kind bekommen. Sie hatte spät geheiratet und nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Geburt dieser Tochter ein unvorhergesehenes und in Wahrheit unerwünschtes Ereignis in ihrem Leben gewesen war.
Monika hatte sich gesagt, dass es nicht allzu selten passierte, dass beruflich erfolgreiche Frauen erst spät Kinder bekamen, und erfolgreiche Frauen durchaus häufig in New York arbeiteten. Die Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen Familie hatten gewiss nichts zu bedeuten.
»Ich traf diese tief und bereits früh gestörte junge Frau, nennen wir sie Fräulein F., zu zwei Behandlungsrunden. Sie war zwanzig, als die erste Behandlung anfing, oder genauer gesagt, der erste Behandlungsversuch, denn es fehlte ihr an der Fähigkeit zu konstruktiver Introspektion und Objektkonstanz, die notwendig ist, um von einer analytischen Behandlung zu profitieren. Fräulein F. war zu diesem Zeitpunkt von zwei ausländischen Schulen verwiesen worden und hatte in der dritten, einer schwedischen, lediglich aufgrund des starken Drucks der Mutter bleiben dürfen. Sie war eine angespannte und unreife junge Frau, die unter offensichtlichen Problemen mit der Impulskontrolle und Grenzen litt, die ich nun in die analytische Arbeitsweise einführen sollte. Sie war unmotiviert und verbrachte viel Zeit mit unbegründeten Anklagen gegen ihre Mutter und andere Autoritätsgestalten. Ihr Vater – das war natürlich von größter Bedeutung – war zu diesem Zeitpunkt seit vierzehn Jahren tot.«
An dieser Stelle hatten sich Monikas Haare gesträubt.
Das konnte nun wirklich kein Zufall mehr sein. Monikas Großvater war gestorben, als ihre Mutter sechs Jahre alt gewesen war. Ihre Mutter war von einer Schweizer Klosterschule verwiesen worden, die von der Schule in New York, die sie nicht mehr haben wollte, empfohlen worden war. Am Ende war sie in einem schwedischen Internat gelandet, dessen Leitung es nicht gewagt oder nicht geschafft hatte, sie auch von dieser Schule zu werfen.
Die junge Frau, dieses anonyme Fräulein F., konnte eigentlich keine andere sein als Monikas Mutter.
»Disruptive influence«, hatte Monikas Mutter in den seltenen Momenten oft gesagt, wenn sie in Stimmung für einen Rückblick gewesen war. »In New York haben sie behauptet, ich sei ein disruptive influence, und damit hatten sie wohl Recht . . .« Ihr amerikanischer Akzent war übertrieben. Sie lachte über die Unfähigkeit der Schulleitung, mit einer Dreizehnjährigen fertig zu werden, machte sich lustig über die Vorstellung, wie eine Schülerin die anderen so negativ beeinflussen konnte, dass der Schule nichts anderes übrig blieb, als die Eltern zu bitten, sich eine andere Lehranstalt zu suchen.
Eine andere Lehranstalt in einem anderen Erdteil – eine Schweizer Klosterschule, deren jahrhundertelange Erfahrung mit Mädchen aller Art dafür bürgte, dass sie auch dem schwierigsten Fall gewachsen wären. Eine Schule mit klaren Regeln und wohltuender Disziplin. In dieser Schule hatte Monikas Mutter nicht einmal ein halbes Jahr verbracht.
Aber »Fräulein F.«? Das klang erfunden und anachronistisch.
Monika las aufmerksam weiter. Bestimmt würde sie bald weitere Details finden, die bewiesen, dass Fräulein F. eine ganz andere Frau gewesen war, die sie nicht kannte.
Sie verstand nicht, was sie las.
Aggressions- und Sexualpathologie. Identitätsdiffusion. Primitive Affektivität. Unbewusste und verdrängte infantile Sexualität. Primitive Aggressivität in der Sexualität. Distorsion – feuchtes und genitales Vokabular, das Monika unangenehm war. Es war noch peinlicher als die Gelegenheiten, wenn sie in das enge Badezimmer geplatzt war und ihre Mutter überrascht hatte, wie sie sich die Beine rasierte oder Haare aus einem Muttermal auf ihrer Wange zupfte.
Noch dazu war es unverständlich und hörte sich alles andere als normal an.
Monika las weiter.
»Ihr Leben endete – wenig überraschend – jäh und brutal, als sie im Alter von fünfunddreißig Jahren ermordet wurde, vermutlich von einem Mann, dessen Verteidigungsmaßnahmen nicht ausreichten, um den heftigen Hass zu bezwingen, der durch die ungelösten Überführungsbeziehungen entstand, die sich einstellten, als Fräulein F.s unintegrierte infantile Wut auf die Menschen in ihrer unmittelbaren Nähe projiziert wurde.«
Fräulein F. war mit fünfunddreißig Jahren gestorben, genau wie Monikas Mutter.
Das konnte kein Zufall mehr sein.
Aber Fräulein F. konnte unmöglich ihre Mutter sein. Ihre Mutter war nicht ermordet worden. Und bei einem Psychologen war sie auch nicht in Behandlung gewesen.
Oder vielleicht doch? Monika ging auf, wie wenig sie über sie wusste. Über ihre Mutter wurde so selten gesprochen, dass allein Monikas Existenz einen unwiderlegbaren Beweis dafür bot, dass sie überhaupt gelebt hatte.
Es war unbegreiflich. Von dem, was Monika verstand, stimmte alles, bis auf den Kontakt zu diesem Psychoanalytiker und auf den Mord. Danach stimmte gar nichts mehr.
Sie legte das Buch beiseite. Das hier brachte doch nichts.
Sie wurde wütend. Was bildete sich dieser Autor eigentlich ein? Wie konnte er auf diese Weise über eine Frau schreiben, die dadurch wiederzuerkennen war?
Olzén hieß er. Sören Olzén, Psychoanalytiker.
Sie griff wieder zu dem Buch und schlug das Erscheinungsjahr des Buches nach. 1992. Damals war ihre Mutter seit fünfzehn, ihre Großmutter seit zehn Jahren tot gewesen. Vielleicht hatte der Autor geglaubt, es spiele keine Rolle mehr, er könne über Leute, die durch ihren Tod ihre Menschenrechte eingebüßt hatten, sagen, was er wollte. Oder hatte er vielleicht zwei Patientinnen miteinander vermischt – hatte er die Geschichte von Monikas Mutter genommen und mit dem Tod einer anderen Patientin verbunden?
Diese Frage ließ ihr keine Ruhe. Monikas Gehirn, das sich in letzter Zeit so sehr mit fruchtlosen Überlegungen über ihre Zukunft und der Frage beschäftigt hatte, wieso alles so schief gegangen war, stürzte sich dankbar auf diese neue Problematik.
Sie räumte das Frühstücksgeschirr weg und versuchte sich auf diese Tätigkeit zu konzentrieren, was ihr jedoch nicht gelang. Ihre Gedanken kreisten unablässig um Olzéns seltsamen Text.
Eine Bewegung unten auf dem Hof erregte ihre Aufmerksamkeit. Eine junge Frau in einer verschlissenen Jacke stemmte sich mit einer Zigarette in der einen und einer Einkaufstüte in der anderen Hand gegen den Wind. Ihr folgte ein kleines Mädchen, dessen abgenutzter roter Overall an den Beinen Falten warf. Die Ärmel waren so lang, dass die Hände der Kleinen nicht zu sehen waren. Das Ganze wurde von einer schief sitzenden, flauschigen weißen Mütze gekrönt.
Die Winterstiefel der Kleinen waren klobig, so dass sie plötzlich stolperte und der Länge nach auf den Asphalt fiel, sich jedoch rasch wieder aufrappelte. Soweit Monika sehen konnte, schrie sie nicht, sondern rannte einfach so schnell weiter, wie sie in ihrer dicken Kleidung konnte, und versuchte, ihre Mutter einzuholen, die ihr Tempo nicht verlangsamt hatte. Monika spürte den starren Nylon und die Füße, die in den breiten Stiefeln herumrutschten, fast am eigenen Leib. Dann hatte die Kleine die Mutter erreicht und griff vorsichtig nach der Tüte. Die Mutter blickte nach unten, schien sie aufzufordern, loszulassen, und zog abermals an ihrer Zigarette. Sie hatte die schmalen Schultern hochgezogen, gegen die Kälte, gegen den Wind, gegen die Armut.
Beeindruckt von der Entschlossenheit der Kleinen, wählte Monika die Telefonnummer ihres Vaters. Sie musste in Erfahrung bringen, ob ihre Mutter Olzéns Patientin gewesen war.
Besetzt.
Während sie wartete, liefen ihre Gedanken abermals mit ihren Gefühlen um die Wette. Was sollte sie sagen?
»Hallo, wie geht’s dir? Weißt du zufällig, ob Mama psychisch krank war und von einem Psychanalytiker behandelt wurde?«
Unmöglich.
»Hast du je von einem Psychologen namens Olzén gehört?«
Auch unmöglich.
Also fragte sie, ob sie kurz vorbeikommen könne – seine Wohnung war nur fünf Gehminuten von ihrer entfernt, in einem Haus, das nach demselben Plan gebaut war wie alle Häuser in der Gegend.
Er schien sich über ihr Kommen zu freuen, und das machte ihr ein schlechtes Gewissen. Es würde kein schmerzloser Besuch werden, daran bestand kein Zweifel.
Monika wusste, wie ihre Mutter ums Leben gekommen war. Sie war ein kleines Stück von ihrer Wohnung entfernt auf einem Zebrastreifen überfahren worden. Doch Monika hatte keiner Menschenseele jemals verraten, dass sie alles gesehen hatte.
Sie war auf dem Heimweg von einer Freundin gewesen, an einem späten, fast stockdunklen Novembernachmittag. Es hatte heftig geregnet, und der Regen war so kalt gewesen, dass er fast schon in Eisregen übergegangen war. Als Monika um die Ecke bog, sah sie eine Menschenmenge, die sich um ein kleines schwarzes Bündel unmittelbar neben dem Bürgersteig scharte. Auf der anderen Seite des Bündels waren buschige schwarze Haare zu sehen, bei denen es sich jedoch nicht um Haare handelte, sondern um einen Kragen aus Webpelz, einen Kragen, der Düfte ansammelte und an den Monika manchmal heimlich ihre Wange schmiegte. Die hintere, dem Gesicht zugewandte Seite, war von Creme beige verfärbt.
Was hatte dieser Kragen auf der Straße zu suchen? Wieso lag er im Rinnstein, im Schneematsch? Monika wurde von einer Stille erfasst, die sich immer dann über sie legte, wenn in ihrer Nähe eine Katastrophe drohte. In diesem Kragen, in diesem Mantel durfte ihre Mutter nicht stecken. Das reglose Bündel musste etwas sein, das jemand verloren hatte, irgendjemand, der einen ähnlichen Geschmack besaß, hatte auf dem Weg zur chemischen Reinigung etwas fallen lassen. Aber so war es nicht. Die Leute rannten umher, und ihre Körpersprache verriet, dass etwas passiert war, dass niemand etwas verloren hatte.
Monika stand stocksteif und unsichtbar da und weigerte sich, zu glauben, was sie sah. Es war drei Tage vor ihrem dreizehnten Geburtstag.
»Mama«, murmelte sie, aber vielleicht dachte sie es auch nur. Ihre Mutter reagierte nicht, wie so oft, nur dass es diesmal endgültig war.
Später, als der Krankenwagen fort war, war sie wie betäubt nach Hause gegangen, hatte die leere Wohnung betreten, in der es ebenfalls nach Rauch und Parfüm roch. Ihr Vater kam immer erst gegen halb sieben nach Hause, und sie hatte auf ihn gewartet, ohne ans Telefon zu gehen, das alle fünf Minuten läutete, ohne Licht zu machen, ohne zu denken.
Als ihr Vater nach Hause kam und sie im Dunkeln sitzen sah, schaltete er die Lampen ein und nahm das Telefon ab. Sein Gesicht lag im Schatten, deshalb hatte Monika seine Miene nicht erkennen können, sondern hatte nur gesehen, wie er die Schultern anspannte, während sein Körper in sich zusammensackte. Das Gespräch war ziemlich wortkarg verlaufen.
»Ja, ich bin das . . . woher? Ja, das ist meine Frau . . . was? . . . wann? . . . sicher? Ich kann sofort kommen.«
Er hatte weiter ins Leere gesprochen, nachdem er aufgelegt hatte, obwohl er sich Monika zuwandte, die hinter ihm auf dem Sofa saß.
»Das war das Krankenhaus. Mama hatte einen Unfall, ich muss hin. Du wartest hier, oder, nein, geh nach unten zu Ahlgrens. Nein, warte, ich komme mit.«
Sie waren die beiden Treppen zu den Ahlgrens hinuntergegangen, deren Tochter in Monikas Klasse ging. Monikas Vater hatte mit Frau Ahlgren gesprochen, als wäre nichts Außergewöhnliches passiert. Es war ihr deutlich anzusehen gewesen, dass ihr Monikas Besuch ungelegen kam, aber niemand konnte schließlich ein Kind zurückweisen, dessen Mutter eben überfahren worden war.
Als er sie abholen gekommen war, hatte er sich verändert. Er war grauer geworden, kleiner und stummer.
Fahrerflucht, hieß es schließlich, als die Ermittlungen abgeschlossen waren. Ein Auto, das niemals identifiziert werden konnte, war aus der Dunkelheit aufgetaucht, hatte Monikas Mutter in hohem Tempo angefahren und war dann verschwunden. Niemand hatte es danach noch gesehen, und falls der Fahrer unter Drogen oder Alkohol gestanden hatte, dann hatte es ihn nicht daran gehindert, sich vom Unglücksort zu entfernen. Der Wagen hatte offenbar ähnlich ausgesehen wie ein Volvo, aber die Zeugenaussagen gingen auseinander, was das Fahrzeug und eventuelle Insassen anging.
Fest stand nur, dass Monikas Mutter sofort tot gewesen war. Die offizielle Todesursache war ein gebrochenes Genick, aber auch sonst wäre sie an ihrem eingedrückten Brustkorb gestorben oder verblutet. Als der Krankenwagen eintraf, lebte sie schon nicht mehr.
Sich an diesen Tag zu erinnern war, als sehe man sich ein altes Video von schlechter Qualität an – veraltet, schwarzweiß, körnig. Wieso aber sprach der Psychologe von Mord, wenn Babs und Fräulein F. ein und dieselbe waren? Meinte er, sie sei vorsätzlich überfahren worden? Die einfachste und wahrscheinlichste Erklärung war wohl, dass er die Todesursache nicht klar definiert hatte – für ihn bestand vielleicht kein Unterschied zwischen Mord, Totschlag und fahrlässiger Tötung. Andererseits sprach er von Menschen, die Fräulein F. gehasst hatten, und von einem Mann, der sie angeblich ermordet hatte.
Nein, der Analytiker hatte bestimmt eine ganz andere Frau behandelt, eine, die erschossen oder erwürgt oder erschlagen worden war. Es bestand vermutlich kein Grund, Monikas Mutter mit einem Mord oder mit verwirrenden sexuellen Problemen in Verbindung zu bringen. Aber Monika war sich darüber im Klaren, dass ihre Mutter schon lange versuchte, die Aufmerksamkeit ihrer Tochter zu wecken. Ihr letzter Fall – vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes ihr letzter, der zu ihrer Beinverletzung geführt hatte – hatte ihre Gedanken auf das Thema Mütter und Töchter gelenkt.
Es war offenbar Zeit, sich mit den Erinnerungen auseinander zu setzen.
Ihre Mutter hatte ein seltsames Vakuum hinterlassen, einen Teil von Monikas Innerem, der ihr stets verschlossen geblieben war. Dieser Teil musste geöffnet werden.
Monikas Mutter. Barbara Ellen.
Monika hatte sie stets Babs genannt, und ihre Bekannten hatten sie mit Babbie, Babsan, Babba, Babsie oder Babette angesprochen.
In einer der wenigen Anekdoten über ihre Großmutter, die Monika zu Ohren gekommen war, ging es darum, wie Barbara Ellen sich ihres Namens angenommen hatte.
»Ich war noch ziemlich jung. Sie nannte mich immer Ellen, aber ich fand diesen Namen so schrecklich. Sie sagte immer, sie habe mich nach Ellen Key so genannt.«
Babs war eine gute Imitatorin gewesen, und Monika, die ihre Großmutter nicht oft genug gesehen hatte, um sich ein eigenes Bild von ihr zu machen, hatte sich mit Hilfe von Babs’ Vorstellungen eines zurechtgelegt.
Babs hatte sich kerzengerade hingestellt, die Lippen zu einer schmalen Linie zusammengepresst und mit leiser, klangvoller Stimme verkündet:
»Du heißt so nach Ellen Key, die dafür gesorgt hat, dass Frauen das Stimmrecht bekommen. Sie war eine starke Frau, die etwas erreichen wollte und ihr Leben dem Versuch widmete, dieser Geißel ein Ende zu machen, die der Krieg so viele Jahrtausende hindurch dargestellt hatte. Sie hatte eine Vision. Ist der Name dir plötzlich nicht gut genug? Du darfst dich nicht Babsie nennen.«
»Aber da«, fügte Babs an dieser Stelle stets hinzu, »da habe ich gesagt dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob es ihr recht war oder nicht. Ich hätte nicht vor, noch weiter Ellen zu heißen.«
Sie hielt einen Moment inne.
»Barbara, nach der du ebenfalls heißt, war eine elegante Frau, die sich niemals anders genannt hat als mit ihrem vollständigen, richtigen Namen«, fuhr Babs mit ihrer Imitation fort.
»Darauf scheiß ich, denn ich kann schließlich nichts dafür, nach wem du mich genannt hast, meine Namen gehören jetzt mir, MIR!«
»Reg dich doch nicht auf, Ellen . . .«
»Ich heiße Babsie!«
»Du heißt Barbara Ellen!«
Und dann hatte Babs ihre Trumpfkarte ausgespielt.
»Ellen. Ellen Key. Spielt es denn keine Rolle, dass sie sich geirrt hatte? Nur, weil das Frauenstimmrecht eingeführt wurde, haben die Leute doch nicht aufgehört, Kriege zu führen! Die Alte war doch verrückt. Ihr seid allesamt verrückt. Und ich werde nicht mehr reagieren, wenn du mich Ellen nennst. Und da«, endete Babs mit einem zufriedenen Lächeln, denn von diesem Triumph hatte sie ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch gezehrt, »konnte sie einfach nichts mehr sagen oder tun.«
Monikas Großmutter hatte ihre Tochter weiterhin Ellen genannt. Babs hatte sich konsequent geweigert, darauf zu reagieren, was zu allerlei Verwicklungen, Missverständnissen und zurückgesandten Briefen geführt hatte. Keine der beiden hatte jemals nachgegeben.
Dann war Babs ums Leben gekommen, und einige Jahre später war ihre Mutter in ihrer Wohnung in New York im Schlaf gestorben.
Monika konnte sich nicht an ein wirkliches Gefühl von Verlust erinnern, stattdessen hatte sie sich vor allem leer und stumm gefühlt. Sie hatte es vermieden, an Babs oder an ihre Großmutter zu denken.
Doch nun war Babs in Monikas Gedanken zurückgekehrt – ein reichlich unverständlich geschriebener Text in einem Buch, das Monika unter anderen Umständen niemals gelesen hätte, hatte das Tor aufgestoßen. Der Zeitpunkt kam ihr nicht gerade gelegen, aber in solchen Fällen hatte man wohl keine Wahl.
Sie wollte fragen, was Niels über Olzén wusste, ihre stumme Vereinbarung brechen, nicht über Babs zu sprechen. Sie zog ihren Mantel an und dachte an das kleine Mädchen in dem großen Overall.
Was die konnte, konnte Monika ja wohl auch.
2
Vaterlos war Monikas nicht einmal in ihrer Fantasie jemals gewesen, da ihr Vater sich an ihr schon rein äußerlich viel zu deutlich zeigte. Sie besaß die gleichen dünnen, hellblonden Haare, die gleiche Augenfarbe, irgendwo zwischen Grau, Grün und Blau, und die gleiche runde, ein wenig flächige Gesichtsform. Von Babs’ schmalem Gesicht und ihren braunen Haaren war bei Monika nicht einmal ein Hauch zu erkennen. Auch der gedrungene Körperbau verband Niels und Monika, während Babs lange Arme und Beine und schmale Füße und Finger gehabt hatte.
Jetzt öffnete er die Tür und trat einen Schritt zurück, um sie eintreten zu lassen. Er lächelte, sein gewohntes Lächeln und sagte mit gewohnter Stimme »Willkommen.«
Monika ließ sich wie immer auf dem Sofa nieder und fragte sich, wo sie anfangen sollte.
Am Ende zog sie einfach das Buch aus der Tasche und legte es auf den Couchtisch.
»Ich habe gerade eine Fallstudie in diesem Buch gelesen, die so gut auf Babs passt, dass sie es eigentlich sein muss.«
Niels’ Blick streifte das Buch, dann hob er den Kopf und schaute aus dem Fenster, wo es jedoch offenbar nichts Besonderes zu sehen gab.
»Papa?«
Am Ende blickte er sie mit ausdrucksloser Miene an.
»Darüber will ich nicht sprechen«, sagte er tonlos.
»Du brauchst nur eine einzige Frage zu beantworten. War Babs bei diesem Mann in Behandlung?«
Ihr Vater schwieg eine Weile.
»Hör auf damit, das habe ich doch schon gesagt. Woher hast du dieses Buch überhaupt?«
»Aus der Krankenhausbücherei.«
Er schaute jetzt wieder aus dem Fenster, und sie stellte mit einem unbehaglichen Schauder fest, dass die Existenz des Buches keinerlei Überraschung für ihn darstellte.
»Du hast davon gewusst, ja? Du hast gewusst, dass Olzén über Babs geschrieben hat, aber du hast kein Wort gesagt.«
»Ich sage, dass du damit aufhören sollst. Sie ist jetzt seit zweiundzwanzig Jahren tot, und es bringt nichts, in den alten Geschichten herumzuwühlen.«
»Dann weißt du also auch von seiner Behauptung, dass sie ermordet worden ist.«
»Ich will nicht darüber reden. Ich meine es ernst.«
»Spielt es keine Rolle, was ich will? Ich will wissen, ob Fräulein F. in dem Buch Babs ist.«
Doch die Worte schienen von Niels’ gekrümmtem Rücken abzuprallen. Er hatte sich mühsam aufgerichtet und war in die Diele gegangen, wo er seinen Mantel anzog, um das Haus zu verlassen, fort von diesem Gespräch, mit dem er nicht umgehen konnte. Sie wusste, dass es einige Stunden dauern würde, bis er zurückkehrte, durchnässt und halb erfroren. Sie wusste auch, dass er durch die Tür kommen würde, als sei nichts geschehen, er würde wie immer »Hallo« rufen, und wenn Monikas Fragen noch immer unbeantwortet waren, wenn sie noch immer wütend oder empört war, würde er sie gequält und beleidigt ansehen: Alles sollte wieder gut sein. Alles sollte sein wie immer.
So war es immer gewesen.
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss.
Monika schlug mit der Faust auf die Armlehne des Sofas – verdammt, warum hatte sie in all diesen Jahren keine Gegenstrategie entwickelt? Wieso konnte er sie mit so einfachen Mitteln manipulieren? So dass eine Frage, der er den Rücken kehrte, einfach zu Boden fiel und starb?
Aber diesmal sollte das nicht passieren.
Sie schaute sich in der Wohnung um.
Niels hatte das Kapitel Babs in der Tat endgültig abgeschlossen. Es gab nirgendwo ein Foto von ihr, weder Aschenbecher noch Stofftiere. Früher hatte die Sofaecke, wo Monika jetzt saß, ein wuscheliger großer Eisbär in Beschlag genommen, während in der Küche ein hübsches Stoffhuhn Staub gesammelt hatte. Babs hatte ihr Bett mit so vielen Schmusetieren geteilt, dass gar nicht alle Platz gehabt hatten und wie Opfer einer schrecklichen Katastrophe in den seltsamsten Stellungen und mit blinden Augen auf dem Boden herumlagen. Babs nahm oft ein Schmusetier auf den Schoß oder in den Arm und liebkoste es in einer Weise, wie sie Monika oder Niels niemals liebkost hatte.
Der Eisbär, das Huhn, der Muminvater, sie alle waren verschwunden gewesen, als Monika eines Tages aus der Schule gekommen war. Ins Kinderheim in der Sowjetunion, hatte Niels gemurmelt, für Kinder, die sie brauchen. Für Monika, die oft heimlich an den Tieren geschnuppert hatte, da Babs’ Duft noch in ihrem Fell hing, waren die Tiere eine viel deutlichere Erinnerung gewesen als Fotos, aber sie hatte nicht dagegen protestiert, da es ohnedies zu spät war.
Die Bilder von Babs hatten einst das Regal über dem Herd gefüllt und die Kühlschranktür bedeckt. Egoistisch, hatte Niels geklagt, aber Monika wusste noch, wie Babs sie bisweilen angestarrt hatte, als könnten die Bilder ihr verraten, wer sie war. Sie hatte sich mit einem breiten, aber unpersönlichen Lächeln gesehen, mit ihrem schlanken Körper in vorteilhaften Posituren, rein äußerlich eine junge Frau, die in ihrem Inneren dorthin zu gehören schien, wo sie sich gerade aufhielt.
Am liebsten hatte sie Bilder gemocht, auf denen sie Ähnlichkeit mit Frauen in der Werbung gehabt hatte und ihr eigenes Aussehen nicht so deutlich hervorgetreten war.
Ein Foto, das jahrelang den Kühlschrank geschmückt hatte, war von einem jungen Fotografen mit großem künstlerischem Ehrgeiz aufgenommen worden. Monika, die damals sieben oder acht gewesen war, hatte in der nackten Frau, die vor weißem Hintergrund saß, die Arme um die Knie geschlungen, die Haare vor dem Gesicht, ihre Mutter nicht wiedererkannt.
»Wer ist das denn?«, hatte sie gefragt, verblüfft von der Größe des Bildes, der glänzenden Oberfläche und den harten Kontrasten.
Babs hatte stumm und müde am Küchentisch gesessen; die Luft war vom Zigarettenrauch schon vernebelt gewesen.
Sie war zusammengezuckt und hatte Monika aus rot unterlaufenen Augen angestarrt.
»Was soll das heißen? Erkennst du deine eigene Mutter nicht?«
Eilig war sie gefährlich dicht an Monika herangetreten.
»Glaubst du, ich könnte nicht gut aussehen? Glaubst du, niemand sieht meine Möglichkeiten?«
»Reg dich ab!«, hatte Niels sich eingeschaltet.
Diese Mahnung zeigte niemals irgendeine Wirkung, trotzdem brachte er sie immer wieder an, da er zu glauben schien, Babs werde seinem Rat eines Tages doch noch folgen, sich abregen, wie andere sein.
»Kommandier mich hier ja nicht herum, verdammt noch mal! Reg dich doch selber ab. Reg dich ab, bis du tot bist. Und unbeschreiblich öde. Und . . .«, doch dann hatte ihre Stimme versagt, und sie war in Tränen ausgebrochen. »Ich weiß nicht, warum ich überhaupt versuche . . .«
Monika hatte sich inzwischen Cornflakes geholt, Milch darauf gegossen und angefangen zu essen, obwohl sich ihr Magen zusammenkrampfte, denn sonst würde Niels sie zurechtweisen. Zu einem normalen Leben gehörte schließlich ein Frühstück, und Monika hätte so gern ein normales Leben geführt.
Babs hatte immer heftiger geweint, das machte sie immer so.
»Was tue ich überhaupt hier? Niemand kümmert sich um mich. Ihr habt ja keine Ahnung, wie einsam ich bin . . .«
Und dann hatte Babs sich aufs Sofa zu ihrem Eisbären zurückgezogen, während Niels und Monika schweigend gefrühstückt hatten. Außer Babs’ Schniefen war es totenstill gewesen.
Inzwischen waren die Fotos lange verschwunden, aber Monika sah sie immer noch vor sich; sie wusste genau, wo sie gestanden und wie sie ausgesehen hatten. Ein einziges Bild von damals war noch da – das der kleinen Bethlehem, die wie immer auf dem Sims über dem Herd stand.
»Bethlehem«, hatte Monika eingewandt, als ihre Mutter das kleine Foto in einem billigen neuen und etwas zu großen Rahmen aufgestellt hatte. »Bethlehem ist doch eine Stadt, oder? So kann sie doch nicht heißen.«
Babs hatte den Text auf der Rückseite des Bildes noch einmal gelesen, kurz gezögert und noch einmal gelesen.
»Doch. In Äthiopien kann man offenbar Bethlehem heißen, hier steht jedenfalls Name und nicht Geburtsort. Sie wissen wohl nicht, wo sie geboren worden ist, sondern schreiben nur, ›in der Nähe von Mekele‹.«
Monika hatte Bethlehem lange betrachtet. Bethlehem trug ein schmutziges kariertes und zu weites Kleid, ihre Füße waren nackt und staubig, und um ihren Hals hing ein Amulett oder Anhänger an einem Lederriemen. Was vor allem überraschte, war ihr Lächeln. Es hätte zu einem kleinen Mädchen gepasst, das bei einem lustigen Spiel zusah oder es gerade auf dem Fahrrad bis zum Tor geschafft hatte, ohne umzukippen oder mit den Füßen den Boden zu berühren.
Dank Monika und ihren Eltern konnte sie jetzt in einem Heim wohnen, wo sie etwas zu essen und Kleider bekam und zur Schule ging.
Aber Bethlehem!
Man konnte doch keine Schwester haben, die Bethlehem hieß, so wenig wie eine Schwester Göteborg oder Helsingfors heißen konnte. Bettie, das war ein passender Name für eine Schwester. Bettie sollte sie heißen, wenn Monika an das kleine Mädchen mit dem strahlenden Lächeln dachte, an das Mädchen, das glücklicher und munterer lächelte, als Monika auf irgendeinem Foto, das sie in demselben Alter zeigte.
Und Bethlehems Foto war noch da gewesen, als alle Bilder von Babs verschwunden waren. Monika hatte nicht mitbekommen, wie Niels sie entfernt hatte, wie sein Gesicht ausgesehen hatte, als er die Bilder von der Wand genommen, die Klebestreifen abgepult und den Klebstoff weggekratzt hatte. Sie wusste nicht einmal, ob er die Fotos weggeworfen oder nur verpackt und irgendwo verstaut hatte. Sie fragte sich, ob er getrauert hatte. War er wütend gewesen, oder hatte er sich vielleicht geschämt?
Hier in der Wohnung war jedenfalls keine Spur von Babs mehr. Und wenn Niels nicht über sie sprechen wollte, gab es kaum jemanden, der Monika sonst helfen konnte. Babs hatte keine Geschwister gehabt, und ihre Eltern waren schon seit vielen Jahren tot.
Monika ging zurück zum Bücherregal. Dort hatte Niels nicht so sorgfältig Ordnung geschaffen wie in der übrigen Wohnung. Die Bücher der Großmutter standen immer noch da. Ihre dreibändige Autobiografie. Monika hatte sie nie gelesen – teils, weil sie sich an Babs’ Reaktion auf den dritten Band erinnerte. Monika zog ihn hervor – ja, er war noch immer verzogen, und die eine Ecke war geknickt, weil Babs das Buch an die Wand geworfen hatte, als sie festgestellt hatte, dass sie nicht darin vorkam. Wer es nicht besser wusste, hätte durchaus glauben können, Babs habe niemals existiert, sei niemals geboren worden. Der trockene Kommentar von Monikas Großmutter, das Buch handele von dem, was in ihrem Leben wichtig war, nämlich von dem, was sie geleistet hatte, war ebenfalls alles andere als hilfreich gewesen. Auf dem Vorsatzblatt stand mit schwarzer Tinte und kleiner Handschrift:
»Für meine liebe Ellen von Mutter.«
Die Lektüre dieser Bücher wäre Babs gegenüber unsolidarisch gewesen, außerdem waren sie schwer verständlich und langweilig, zumindest hatte Monika es als Zwölfjährige so empfunden.
Aber vielleicht halfen sie ihr weiter, schließlich hatte die Großmutter Babs ihr Leben lang gekannt.
Als Monika das Buch in der Hand hielt, musste sie wieder an die Beerdigung der Großmutter denken. Damals sie war siebzehn gewesen, und sie und Niels hatten als die einzigen Verwandten daran teilgenommen. Aber es war eine große Trauerfeier gewesen. Was der Großmutter an Verwandtschaft gefehlt hatte, hatte sie durch ihre beruflichen Kontakte wettgemacht. Es hatte viele prachtvolle Kränze gegeben – von der UNO, vom Außenministerium (ein Kranz in den schwedischen Landesfarben), von Organisationen und Verbänden jeglicher Art.
Die Frau, über die der Pastor sprach und die so vielen Menschen offenbar so viel bedeutet hatte, hatte kaum Ähnlichkeit mit Monikas vagen Erinnerungen an ihre Großmutter besessen. Die Großmutter war groß, sehnig und ungeduldig gewesen, und bei den seltenen Gelegenheiten, wenn sie einander begegnet waren, hatte Babs sich stets seltsam angespannt und schnippisch gezeigt. Monika war so gut wie nie allein mit ihrer Großmutter gewesen, erinnerte sich aber noch genau daran, dass sie ständig hatte wählen müssen – zwischen Puppen, die sie nicht haben wollte, zwischen Kuchen, von denen sie wusste, dass sie sie niemals aufessen würde. Sie erinnerte sich an die Gereiztheit ihrer Großmutter und an ihre eigene Unzulänglichkeit: nicht einmal eine so einfache Wahl konnte das Kind treffen. Es waren alte, undeutliche Erinnerungen, die das Gedächtnis zu einer Stimmung, zu einer Reihe verblasster Empfindungenreduzierte.
Aus einem Impuls heraus nahm Monika alle drei Bücher mit, als sie ging. Das erste hieß »Anlauf« und behandelte die Jugend der Großmutter in Sundsvall, der zweite Band mit dem undurchsichtigen Titel »Der Einsturz des Weltengebäudes« schilderte die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, und das letzte hieß »Die Jahre bei den Vereinten Nationen«. Der Umschlag des ersten Bandes zeigte Schwarzweißbilder der Großmutter als weißblonder Backfisch, den Blick in die Ferne gerichtet. Der zweite bestand aus einer Collage – die Großmutter, Mussolini und ein geschmeidiger, braunhäutiger Mann mit würdevoller Haltung und festem Blick. Der dritte Umschlag war so nichtssagend wie der Titel. Vor dem UNO-Gebäude war die Großmutter an einem Rednerpult zu sehen.
Auf dem Heimweg schmiedete Monika Pläne. Sie wollte wissen, ob Fräulein F. Babs war – und wenn Niels nicht mit ihr reden wollte, musste sie eben Olzén fragen.
Sie hoffte nur, dass er noch lebte. Und dass die gesuchten Informationen noch in der kollektiven Datenbank namens Menschenhirn zu finden waren.
Zum ersten Mal seit langer Zeit kam sie gern nach Hause. Sie hatte eine Aufgabe, ein Ziel, und die freie Zeit, die vor ihr lag, hatte plötzlich einen Sinn, statt ein Problem darzustellen.
Wie immer fing sie mit dem einfachsten Teil der Aufgabe an. In diesem Fall griff sie zum Telefonbuch. Als sie die Hand danach ausstreckte, schien etwas mit dem Zimmer zu geschehen: das Licht war mit einem Mal schärfer, und es wurde kälter. Ihr Körper verriet Monika, dass jetzt der Arbeitsgang eingeschaltet war, ob sie wollte oder nicht. Offenbar glaubte ihr Körper, dass sie mit einer neuen Ermittlung begann. Monika staunte, dass ihr Körper sie so verraten konnte.
Sie wusste, dass dies keine normale Ermittlung war, was auch immer ihr Körper glauben wollte, sie wusste es, obwohl sie von einem höchst vagen Verdacht ausging und die Wahrscheinlichkeit, mehr als zwanzig Jahre zurückliegende Sachverhalte aufklären zu können, gering war. Gleichzeitig fragte sie sich, ob es ein formaler Fehler war, sich in ihrer eigenen Branche sozusagen freiberuflich zu betätigen. War sie überhaupt befugt, eine inoffizielle kleine Mordermittlung in eigener Sache zu starten?
Sie unterbrach sich bei diesem Gedanken. Das hier war keine Mordermittlung, sondern sie war einfach eine Tochter, die wissen wollte, was mit ihrer Mutter passiert war. Daran konnte ja wohl niemand Anstoß nehmen.
Und, Fehler hin oder her, der Startschuss war gefallen.
Sie blätterte im Telefonbuch.
Olzén, das konnte kein gängiger Name sein, sondern eine Variante, die Namen wie Olsson und Nilsson und Andersson in individuellere, historisch gesehen jedoch belanglose Nachnamen verwandelte.
Einen Sören Olzén gab es nicht. So leicht sollte es also nicht sein.
Der nächste Schritt war die Auskunft – er konnte immerhin nach Sigtuna oder Vadstena oder an einen anderen ruhigen Ort gezogen sein, wo alte Leute gern ihren Lebensabend zubrachten.
Aber das hatte er offenbar nicht getan, denn er hatte eine Geheimnummer, was annehmen ließ, dass er noch lebte und nach wie vor in Stockholm wohnte.
Also musste sie ihr Glück beim Berufsverband versuchen, den sie im Telefonbuch fand: die Psychoanalytische Vereinigung.
Eine freundliche Frauenstimme meldete sich, und Monika schilderte ihr Anliegen.
»Soll das heißen, Sie wissen nicht, ob Ihre Mutter bei Herrn Olzén in Behandlung war?«
»Ja. Aber als ich sein Buch gelesen habe, kam mir der Verdacht, das meine Mutter Patientin bei ihm war.«
»Was ist danach aus ihr geworden?«
»Nichts Gutes. Sie ist gestorben. Und in seinem Buch behauptet er, dass sie, wenn sie es denn tatsächlich war, ermordet worden ist.«
»Und Sie wissen auch nicht, ob Ihre Mutter ermordet worden ist?«
»Nein, deshalb würde ich ja gern Kontakt zu ihm aufnehmen.«
»Und wie alt waren Sie, als das passiert ist?«
»Zwölf.«
Das Gespräch wurde langsam zum Verhör.
»Über das alles möchte ich mit ihm selbst sprechen. Ich wollte Sie wirklich nur um seine Telefonnummer bitten«, sagte Monika.
»Seine Geheimnummer?«
»Ja.«
»Dann haben Sie wohl nicht verstanden, warum er eine Geheimnummer hat. Bei unserer Arbeit stoßen wir auf so viele Probleme, auf so vieles, das starke Gefühle weckt. Nicht alle können uns als Fachleute und Privatpersonen auseinander halten. Ich gebe Ihnen den Rat, falls Sie nicht damit fertigwerden, dass Ihre Mutter Sie in einem so verletzlichen Alter im Stich gelassen hat, und ich kann wirklich verstehen, dass so etwas möglich ist, jedenfalls lautet mein Rat, suchen Sie sich einen eigenen Therapeuten, mit dem Sie über das alles reden können.«
»Ich will aber keine Therapie machen. Ich werde doch das Recht haben zu erfahren, ob meine Mutter bei diesem Olzén in Behandlung war.«
»Wenn sie bei ihm in Therapie oder Analyse war und zu Hause nichts davon erwähnt hat, dann hatte sie sicher ihre Gründe. Er musste ihren Wunsch respektieren und auf ihrer Seite stehen, auch wenn sie jetzt tot ist, und auch wenn er aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz über sie geschrieben haben sollte.«
»Das ist doch lächerlich. Sie können doch nicht wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, und es kann wohl nichts schaden, wenn ich mit Olzén spreche.«
»Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Sie können einen Brief schreiben und an uns schicken. Wir leiten ihn gern an ihn weiter. Dann kann er selbst entscheiden, ob er mit Ihnen sprechen will. Aber eigentlich können Sie sich die Mühe sparen – er wird nicht mit Ihnen reden wollen, aus berufsethischen Gründen.«
Monika spürte, wie die Wut in ihr hochstieg, was im Vergleich zu der Gleichgültigkeit der vergangenen Monate immerhin ein Fortschritt war.
Und es machte ihr Mut. Sie hatte Widerstand immer schon zu schätzen gewusst und würde nicht lockerlassen, bis sie Olzéns Nummer hatte.
Wer nicht durch die Tür ins Haus gelangt, muss eben das Fenster nehmen. Sie rief den Verlag an, der Olzéns Buch veröffentlicht hatte.
Sie überlegte, was sie sagen sollte. Die Wahrheit, dass sie eine Tochter war, die ihre Mutter suchte, schien als Strategie nicht zu funktionieren, jedenfalls hatte sie bei der Analytiker-Vereinigung keine Wirkung gezeigt. Monika entschied sich daher für eine andere Methode.
In ihrer Eile hätte sie sich der Verlagsangestellten beinahe als Kriminalkommissarin vorgestellt, ehe sie in letzter Sekunde auf Journalistin umschwenkte. Sie arbeitete angeblich an einer Reportage über Psychoanalyse und wollte deshalb gern mit Sören Olzén sprechen. Die Lüge kam ihr überraschend leicht über die Lippen, und als Belohnung erhielt sie ohne weitere Fragen seine Adresse und seine Telefonnummer.
Wenige Minuten später brachte sie mit derselben Leichtigkeit noch einmal die gleiche Lüge vor. Seine dünne Greisenstimme hatte der Journalistin, die ihn interviewen wollte, nichts entgegenzusetzen. Sie sei jederzeit willkommen, jedenfalls ab dem nächsten Tag, da er sich erst vorbereiten müsse.
Monika bemerkte, dass sich nicht nur das Zimmer verändert hatte – plötzlich hatten die Zeiger ihrer Uhr einen großen Sprung nach vorn gemacht. Die Minuten, die nach dem Unfall so lang gewesen waren, waren nun kürzer, strömten vorüber und waren unwiederbringlich verschwunden.
Sie bemerkte auch, dass sie Angst hatte.
Unmittelbar nach Babs’ Tod war sie in Monikas Träumen und Erinnerungen ebenso unkontrolliert aufgetaucht wie früher in ihrem Leben. Im Traum stand Babs zumeist in der Tür zu Monikas kleinem Zimmer. Es war spät, und im Schein der Dielenlampe konnte Monika nur eine dünne, dunkle Frauengestalt sehen, die sich schwankend gegen den Türrahmen lehnte und hungrig an ihrer Zigarette zog.
Angst und Sehnsucht keimten gleichzeitig in ihr auf, neutralisierten sich gegenseitig und wichen Enttäuschung und Zorn, nur um kurz darauf wieder aufzuflammen und jedes andere Gefühl zu überflügeln. Monika wollte Mammmmmaaaa schreien, wollte gestreichelt werden, und sei es mit noch so ungeschickter Hand. Doch gleichzeitig wollte sie nicht von Babs angefasst werden, da es keine echte Berührung war und sie am nächsten Morgen schon keine Gültigkeit mehr hätte. Sie wollte nicht, dass Babs hereinkam, und sehnte sich zugleich brennend danach, dass sie es tat.
Babs’ Auftauchen in Monikas Träumen hatte dieselbe Wirkung wie früher im Leben – wie erstarrt lag Monika da, wie gelähmt, konnte sich nicht rühren, war erfüllt vom raschen, ängstlichen Schlag ihres Herzens, eines Herzens, das sich in ihrem kleinen Brustkorb auszudehnen schien und sie im nächsten Augenblick in einer Explosion aus heißem Blut zerfetzen würde. Dieser Traum, diese Erinnerung hatten ihr viele Jahre Angst gemacht.
Mit anderen Erinnerungen an Babs wurde sie besser fertig. Einige wenige waren harmlos, wie zum Beispiel Babs hinter dem Verkaufstresen in der Kosmetikabteilung eines Kaufhauses, von wo aus sie Monika zuwinken konnte wie eine normale Mutter. Oder Babs’ Gesicht, wenn sie sich konzentrierte und Mund und Augenbrauen zusammenzog, was sie so witzig aussehen ließ, ein Gesicht, über das man sogar lachen konnte, das keineswegs beängstigend wirkte. Ebenso wie ihr seltenes, kumpelhaftes Lächeln.
Und jetzt wollte Monika dieses Muster durchbrechen. Sie wollte versuchen, sich deutlicher zu erinnern statt weniger – ein Gedanke, bei dem ihr Körper sich anspannte.
Aber andererseits hatte sie ja keine Wahl.
Sie musste es tun.
Und wenn nicht jetzt, wann dann?