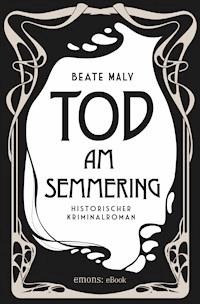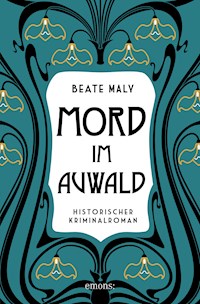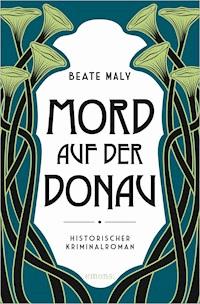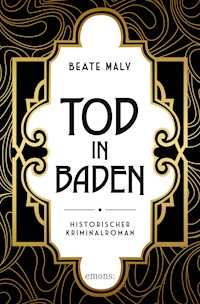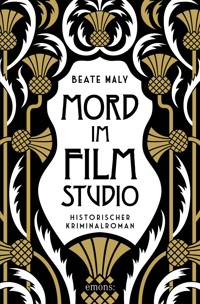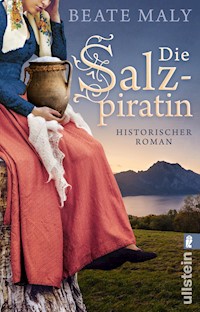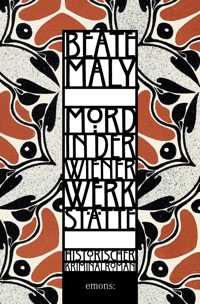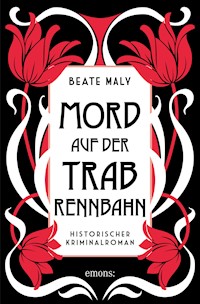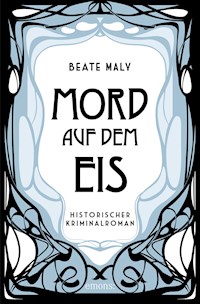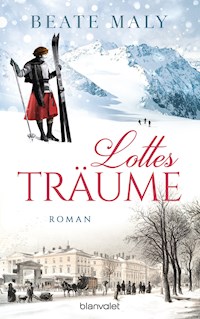8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Österreich-Ungarn im 15. Jahrhundert. Sie ist die letzte Hoffnung für die ungarische Krone: Helene, die Kammerfrau der Königin Elisabeth. Als der König stirbt und die hochschwangere Königin vor dem aufständischen Adel fliehen muss, nimmt Helene die heilige Stephanskrone - die kostbare Insignie der ungarischen Könige - an sich. Eine gefährliche Reise durch das Land beginnt. Helenes Ziel: Die Donaustadt Komorn, in der Elisabeth sie erwartet, um ihren neugeborenen Sohn zum neuen Herrscher zu krönen. Kann Helene die Hoffnungen ihrer Königin erfüllen und ihr die Krone bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Österreich-Ungarn im 15. Jahrhundert. Die junge Helene ist verwitwet und lebt mit ihrem Sohn bei ihrem Vater, einem ungarischen Kleinadeligen. Nach Ablauf des Trauerjahrs soll sie den Kammerherrn des Dompropstes heiraten. Elisabeth, Ehefrau von Herzog Albrecht und zukünftige Königin von Ungarn, macht Helene zu ihrer Kammerfrau. Als der Herzog unerwartet auf einem Kriegszug gegen die Türken stirbt, wird die Bedrohung für die hochschwangere Elisabeth immer größer, und nach der Geburt muss der Thronfolger so schnell wie möglich gekrönt werden. Die Königin bittet Helene, die heilige Stephanskrone – die kostbare Insignie der ungarischen Könige – aus der Plintenburg zu stehlen. Für Helene beginnt eine gefährliche Reise durch das Land. In der Donaustadt Komorn soll sie ihre Königin wiedertreffen und ihr die Krone übergeben. Wird Helene die Hoffnungen Elisabeths erfüllen?
Die Autorin
Beate Maly, geboren in Wien, ist Autorin zahlreicher Kinderbücher, Sachbücher und historischer Romane. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Wien.
Von Beate Maly sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Donauprinzessin
Das Sündenbuch·Der Fluch des Sündenbuchs
Die Hebamme von Wien·Die Hebamme und der Gaukler Die Zeichenkünstlerin von Wien
Beate Maly
Der Raub derStephanskrone
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1196-8
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: akg-images (Landschaft): akg-images/Pirozzi (Körper der Frau); © Sotheby’s/akg-images (Frauenkopf);FinePic®, München (Hintergrund)
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Sopron 1421
lisabeth hörte das Stimmengewirr schon von Weitem. Einmal im Jahr verwandelte sich der Hauptplatz der beschaulichen ungarischen Stadt Sopron in einen Ort reger Betriebsamkeit und pulsierenden Lebens. Dann konnte man erahnen, was die Welt außerhalb der engen Stadtmauern noch zu bieten hatte. Der Jahrmarkt zog Händler aus aller Herren Ländern an. Es gab Gewürze aus dem Orient, Spitze aus Flandern, Pelze aus Lettland und Wolle aus York in England.
Ausgerechnet diesen Tag, der eine Ausnahme im eintönigen Exilalltag war, hatte ihre Mutter Barbara von Chilli ihr verderben wollen. Aber Elisabeth ließ sich nichts verbieten, schließlich war sie das einzige überlebende Kind von Kaiser Sigismund, die Verlobte von Herzog Albrecht von Österreich und, so Gott wollte und ihre Mutter keinen männlichen Erben mehr zur Welt brachte, die zukünftige Königin von Ungarn, Böhmen und Mähren. Warum also sollte sie sich diesen Spaß nicht gönnen? Es war schlimm genug, dass sie wegen ihrer Mutter im Exil in Ungarn leben musste, während ihr Vater in Prag rauschende Feste feierte. Elisabeth konnte nichts dafür, dass Barbara von Chilli sich für okkulte Rituale interessierte und aus diesem Grund immer wieder von ihrem Vater vom Hof verbannt wurde.
Deshalb hatte sie heute das Verbot ihrer Mutter einfach ignoriert und war, sobald Barbara das Haus verlassen hatte, in ihre Kammer geschlichen, hatte ihr feinstes Kleid angezogen und danach aus der Geldtruhe ihrer Mutter drei Münzen entnommen. Außerdem hatte sie sich die wunderschöne Brosche in Form eines Schmetterlings geliehen. Schließlich konnte sie als zukünftige Königin nicht wie eine Bettlerin über den Markt laufen.
Das kostbare Schmuckstück mit den kleinen dunkelroten Steinen, echter böhmischer Granat, steckte nun an ihrer rechten Schulter und glitzerte im hellen Licht der Frühlingssonne. Zum ersten Mal seit Tagen war Elisabeth mit sich und ihrem Leben zufrieden. Mit hocherhobenem Kopf lief sie den bunten Verkaufsständen entgegen. Eine satte Geruchsmischung hing über dem Platz. Der Duft würziger Kräuter mischte sich mit dem teurer Parfums, fetter Speisen und beißendem Schweiß.
Das Großereignis zog nicht nur Hausfrauen aus der Umgebung an, die ihre Vorratskammern mit Salz, Fleisch und Gemüse auffüllen wollten, sondern auch Kaufleute und Händler, die Ware in großen Mengen ankauften, um sie dann in ihren eigenen Läden der Kundschaft anzubieten.
Elisabeth kam an dem Stand eines flämischen Tuchhändlers vorbei. Dunkelgelbe Wolle lag neben Ballen feinster Seide. Leider reichten die drei gestohlenen Münzen in ihrem Geldbeutel nicht aus, um ein paar Ellen davon zu erwerben. Sie lief weiter, vorbei an den Gewürzhändlern. Unter den großen Säcken aus grobem Leinen, die mit Pfeffer, kostbarer Zimtrinde und Koriander gefüllt waren, bogen sich die Bretter der Verkaufsstände. In einem Korb lagerten getrocknete Feigen, Datteln und Marillen.
Beim Anblick der Köstlichkeiten lief Elisabeth das Wasser im Mund zusammen. Verärgert runzelte sie die Stirn. Hätte sie doch nur mehr Münzen genommen! Ihrer Mutter wäre es nicht aufgefallen, und das Geld stand ihr zu, schließlich stammte es von ihrem Vater.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, blieb sie stehen. Sollte sie zuerst zu dem Stand mit den geklöppelten Tüchern aus Brüssel gehen? Oder lieber den Händler aus Venedig aufsuchen? Er hatte wunderschöne, mit Goldfäden durchwirkte Tücher und bunte Glassteine, die in der Sonne in allen nur erdenklichen Farben glänzten.
Sie entschied sich für einen Stand am Ende der Reihe. Dort wurden kunstvoll bestickte Bänder angeboten. Zielstrebig ging sie los und genoss die anerkennenden Blicke mancher Marktbesucher. Vielleicht lag es an ihrer aufrechten Haltung, vielleicht an ihrem wunderschönen Kleid und der außergewöhnlichen Brosche. Aber zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie sich wirklich als Tochter des Kaisers.
Ein Händler bot ihr Schuhe aus weichem Wildleder zum Kauf an, ein anderer hielt ihr einen Kamm aus Elfenbein entgegen.
»Dieses edle Stück hat einst der Haremsdame eines Sultans gehört«, raunte der kleine Mann mit der roten Knollennase im runden Gesicht. Der helle, glatt polierte Kamm glänzte, aber Elisabeth lehnte ab. Sie würde ihr Haar ganz sicher nicht mit dem Kamm einer Haremsdame kämmen. Die Vorstellung war geradezu lächerlich. So als müsste sie ihren dunklen Zopf vor dem Händler schützen, legte sie ihn über ihre rechte Schulter und blieb erneut stehen. Plötzlich beschlich sie das unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden. Aufmerksam blickte sie in die Gesichter der Menschen um sie herum. Aber sie konnte niemanden entdecken, der ihr übertrieben viel Aufmerksamkeit schenkte. Neben ihr stritten zwei Frauen wegen eines Kruges, den beide kaufen wollten. Ein kleiner Junge zog seine Mutter mit quengelnder Stimme zu einem Stand mit Honigtöpfen, und drei junge Männer feilschten um den Preis für eine Gürtelschnalle. Andere Marktbesucher drängten sich an ihnen vorbei. Elisabeth konnte niemanden ausmachen, der sie beobachtete. Dennoch fühlte sie sich zunehmend unbehaglich. Ihre Festtagsstimmung schwand. Aufmerksamer als zuvor setzte sie ihren Weg fort. Schließlich erreichte sie den Stand mit den Bändern. Nun war sie sich sicher, dass ihr jemand folgte. Sie konnte die Blicke förmlich in ihrem Rücken spüren. Abrupt hielt sie an und drehte sich erneut um. Für den Bruchteil eines Augenblicks sah sie in außergewöhnlich dunkelblaue Augen. Aber als sie sie festmachen wollte, waren sie verschwunden. Die Menschen schoben sich nun Schulter an Schulter zwischen den Reihen der Verkaufsstände durch. Mit einem Mal fühlte Elisabeth sich hier fehl am Platz. Besser sie kehrte wieder um. Wenn sie tatsächlich beobachtet wurde, konnte das nur Ärger bedeuten. Aber zuvor wollte sie eines der Bänder erstehen. Frech drängte sie sich an den Frauen, die vor dem Stand eine Traube gebildet hatten, vorbei. Eine von ihnen schimpfte ungehalten: »He, drängle nicht! Wir waren vor dir da!« Ganz offensichtlich wusste sie nicht, wer Elisabeth war, sonst hätte sie sich diesen Tonfall nicht erlaubt.
Elisabeth ignorierte die keifende Stimme und schob sich an der Frau, die nach Bratenfett roch, vorbei. Vorne schnappte sie nach einem Korb und durchwühlte ihn auf der Suche nach einem passenden Band.
»Darf ich behilflich sein?« Die Verkäuferin hielt ihr drei Bänder entgegen, die sie hinter dem Stand hervorgezaubert hatte. Alle passten perfekt zu Elisabeths Kleid. Sofort ließ sie von dem Korb ab und bewunderte die Bänder. Eines war hellgelb mit einem feinen Blumenmuster. Entschieden griff sie danach.
»Eine gute Wahl«, grinste die Frau. Sicher war es das teuerste der drei Bänder. »Eine ungarische Kunststickerin hat das Muster angefertigt.«
Elisabeth interessierte nicht, wer das Band bestickt hatte. Sie wollte rasch bezahlen und den Markt wieder verlassen. Immer noch hatte sie das Gefühl, dass sie jemand beobachtete. Aus ihrer Rocktasche holte sie die Prager Groschen hervor. Die Verkäuferin erkannte sofort den Wert der Münzen. Mit begehrlichem Blick ergriff sie eine davon, wog sie zufrieden in der Hand und meinte: »Dafür gebe ich Euch auch noch die beiden anderen Bänder.« Flink holte sie unter dem Verkaufstisch zwei weitere Bänder hervor. Elisabeth betrachtete die angebotene Ware. Es handelte sich um ein hellgrünes Band mit dunkelgrünem Rand und ein fliederfarbenes mit aufgestickten Schwalben.
Beide Bänder waren außergewöhnlich fein verarbeitet, und Elisabeth war mit dem Handel einverstanden. Sie sah zu, wie die Verkäuferin die Bänder sorgfältig einrollte, und nahm zufrieden das kleine Päckchen entgegen. Nun wollte sie so rasch wie möglich zurück. Erneut drängte sie sich an den Frauen vorbei und stieß einer dabei grob in die Seite. Die schimpfte lautstark und rempelte zurück. Elisabeth geriet ins Wanken. Sie fand das Benehmen der dicken Frau mit der nicht mehr ganz sauberen Haube unerhört und wollte schon zu einem Fluch ansetzen, als sie erneut neugierige Blicke spürte. Sie unterließ es, etwas zu erwidern, und raffte stattdessen nervös ihre Röcke. Mit raschen Schritten hastete sie über den Markt. Der Geruch von heißem Schmalz erinnerte sie daran, dass sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte, aber jetzt war keine Zeit für einen weiteren Halt. Sie wollte weg von hier. Erst als sie die Stände hinter sich gelassen hatte, fühlte sie sich wieder besser und verlangsamte ihr Tempo. Das Päckchen in ihrer Hand fühlte sich wie eine Jagdtrophäe an. Höchst zufrieden mit ihrem Kauf bog sie in die Essiggasse ein und ging auf ihr Haus zu. Als Erstes wollte sie die Brosche mit den wertvollen, dunkelroten Granatsteinen zurück in die Truhe ihrer Mutter legen. Ihr Blick glitt zu ihrer Brust, und sie schrie entsetzt auf. Dort, wo gerade noch die Brosche gewesen war, befand sich nur noch ein kleines Loch im hellgrünen Stoff. Elisabeth blieb stehen. Ihr wurde übel. Wie hatte das nur passieren können? Jemand hatte sie bestohlen. Ihr Herz begann zu rasen. Wut und Zorn paarten sich mit Angst. Tränen traten in ihre Augen, und das Loch im hellgrünen Kleid verschwamm zu einem verwaschenen Bild. Ob die schimpfende Frau mit der dreckigen Haube ihr die Brosche gestohlen hatte? Oder das Weib, das nach Bratenfett gestunken hatte? Im Grunde konnte es jeder gewesen sein. Der Kaufmann mit dem Elfenbeinkamm ebenso wie die Frau, die ihr die Bänder verkauft hatte. Elisabeth hatte einfach nicht gut genug aufgepasst. Wie einfältig sie doch war. Sollte sie zurückgehen und bei der Stadtwache den Diebstahl melden? Aber dann musste sie zugeben, dass sie die Brosche unerlaubterweise an sich genommen hatte. Ihrer Mutter würde dieser Zwischenfall mehr als gelegen kommen. Barbara von Chilli ließ keine Gelegenheit aus, ihre Tochter für ihr aufmüpfiges Verhalten zu bestrafen. Elisabeth hatte sich längst damit abgefunden, dass ihre Mutter in ihr nicht die Tochter sah, die es zu lieben galt, sondern eine Konkurrentin, die ihr in wenigen Jahren Macht und Einfluss nehmen würde. Am liebsten hätte Elisabeth sich ob ihrer Dummheit geohrfeigt. Nun konnte sie nur darauf hoffen, dass ihre Mutter das Fehlen des Schmuckstücks nicht sofort bemerken würde. Wenn sie genug Zeit hatte, in Ruhe nachzudenken, fand sie vielleicht eine Lösung. Benommen betrat sie das Haus durch den Seiteneingang. Sie stieg die Holztreppe hoch in ihre Kammer und schlüpfte aus ihrem Kleid. Die neuen Bänder hatten jede Bedeutung verloren. Achtlos warf sie sie auf ihr Bett. Da klopfte es an ihrer Tür.
Erschrocken fuhr Elisabeth hoch. War das etwa ihre Mutter? War sie schon zurück und hatte ihren Diebstahl bereits bemerkt?
»Fräulein Elisabeth!«, es war Luzi, und für einen Moment entspannte sich Elisabeth wieder. Sie räusperte sich. Niemand durfte merken, dass sie geweint hatte.
»Ja, bitte?«, fragte sie eine Spur zu schnell. Ihre Stimme klang krächzend, aber Luzi schien es nicht zu bemerken.
»Im Hof steht ein Mädchen, das nach Euch fragt«, sagte die Magd so leise, dass Elisabeth Mühe hatte, sie zu verstehen.
»Schick sie weg. Sicher ist es eine Bettlerin!« Im Moment hatte Elisabeth andere Sorgen. Ihr Sinn stand ihr nicht nach Mildtätigkeiten.
»Sie will nicht gehen und verlangt danach, Euch zu sprechen«, erwiderte Luzi zaghaft.
Ärgerlich fuhr Elisabeth die Magd an.
»Hast du mich nicht verstanden? Du sollst sie wegschicken«, schimpfte sie. Ungeduldig riss sie die Tür auf, und Luzi zog den Kopf ein und duckte sich, so als würde sie Schläge von ihrer jungen Herrin fürchten. Dabei schlug Elisabeth nur äußerst selten zu. Der verängstigte Blick der Magd schürte ihre Wut noch mehr.
»Du einfältiges Ding. Geh mir aus dem Weg. Ich werde die Bettlerin selbst wegschicken!«
Unwirsch schob sie Luzi zur Seite und polterte die Stufen hinunter. Die Haustür stand immer noch offen, und in der hellen Frühlingssonne stand ein dürres Mädchen, das kaum älter als Elisabeth war. Ihre Kleidung war sauber, aber abgetragen. Einfache dunkelbraune Wolle. Der Stoff hing lose an ihrem burschikosen Körper. Das blonde Haar hatte sie zu ordentlichen Zöpfen geflochten, die etwas widerspenstig vom Kopf abstanden. Am auffälligsten an ihr jedoch waren ihre Augen. Sie waren dunkelblau mit hellen Reflexen, wie das klare Wasser eines tiefen Bergsees an einem wolkenlosen Sommertag.
»Ich habe nichts zu verschenken! Verlass unseren Hof, sonst muss ich meinen Stallknecht rufen, der dich mit einem Prügel davonjagen wird«, rief Elisabeth verärgert.
Trotz ihrer heftigen Worte wirkte das Mädchen weder eingeschüchtert noch verängstigt. Ungerührt, vielleicht sogar belustigt hob es beide Augenbrauen, streckte die Schultern durch und hielt Elisabeth schweigend die rechte Faust entgegen. Langsam öffnete sie die Finger. Einen nach dem anderen, und auf ihrer Handfläche kam die Brosche in Schmetterlingsform zum Vorschein. Die roten Granatsteine funkelten im Licht der tiefstehenden Frühlingssonne.
»Die hast du verloren.« Ein Hauch von Spott lag in ihrer Stimme.
Elisabeth schnappte nach Luft und stand mit offenem Mund sprachlos da. Hatte die Fremde sie gerade geduzt? Wie unglaublich frech.
»Sie gehört dir doch. Oder?«
Unfähig zu sprechen, ein dicker Kloß saß in ihrer Kehle, nickte Elisabeth bloß. Etwas benommen griff sie nach der Brosche. Es war zweifellos das Schmuckstück ihrer Mutter. Warum hatte das Mädchen das wertvolle Stück nicht einfach behalten? Nach ihrem einfachen Kleid zu urteilen, hätte sie den Erlös, den ihr das Schmuckstück eingebracht hätte, gut brauchen können.
»Du hast die Brosche verloren, und ich wollte sie dir wiedergeben, aber immer wenn ich dir nahe war, bis du schnell weitergelaufen, und ich habe dich wieder aus den Augen verloren. Es waren verdammt viele Menschen auf dem Markt«, erklärte die Fremde. Sie fluchte. Das gehörte sich ganz und gar nicht. Sicher war sie eine einfache Bäuerin. Aber Elisabeth hörte großzügig darüber hinweg.
Angestrengt dachte sie nach. Hatte sie das Gesicht der Fremden in der Menge ausgemacht? Die blauen Augen, Elisabeth erinnerte sich wieder.
»Pass beim nächsten Mal besser auf deinen Schmuck auf«, sagte die Fremde. Sicher hatte sie keine Ahnung, mit wem sie gerade sprach.
»Warum … hast du mir die Brosche zurückgebracht und nicht behalten?«, fragte Elisabeth. »Niemand hätte es bemerkt.«
Das Mädchen schüttelte entsetzt den Kopf.
»Es wäre nicht recht gewesen, die Brosche gehört dir«, sagte sie mit einer Selbstverständlichkeit, die jede weitere Frage im Keim erstickte.
Dann hob sie wie ein Junge die Hand zum Gruß und winkte zum Abschied. Vielleicht war sie auf einem Hof mit einem Haufen Brüder aufgewachsen und verfügte deshalb über keine Manieren. Mit federnden Schritten lief sie unbekümmert über den Hof.
Verblüfft starrte ihr Elisabeth nach. Gerne hätte sie der ehrlichen Finderin eine der verbliebenen Münzen, die immer noch in ihrer Rocktasche steckten, gegeben. Aber schon war das Mädchen verschwunden. Elisabeth hatte sich nicht einmal mit Worten bedankt. Das war unhöflich und einer zukünftigen Königin unwürdig. Sollte sie der Fremden jemals wieder begegnen, würde Elisabeth ihren Fehler wiedergutmachen. Auch wenn sie den Namen des Mädchens nicht kannte, so würde sie das Dunkelblau ihrer Augen jederzeit wiedererkennen.
Sopron 1437
as scheppernde Geräusch zerbrechender Keramik war so laut, dass Helene es bis in die Küche hören konnte. Für einen Moment schloss sie die Augen und betete zu Gott, dass es nicht wieder ihr Sohn Matthias war, der etwas kaputt gemacht hatte. Dann erst wischte sie sich die Hände an ihrer Schürze ab und lief in den Hof. Der blonde Schopf ihres Sohnes war das Erste, was sie erblickte. Die Scherben des großen Tonkruges, in dem die Köchin Essiggurken für den Winter eingelegt hatte, entdeckte sie erst später. Essig, Gurken und Tonscherben lagen am Boden verstreut. Der stechend saure Geruch des Essigs verbreitete sich über den Hof und stieg Helene in die Nase, so dass sie ein Niesen unterdrücken musste.
»Wer war das?«, fragte sie ärgerlich, stemmte beide Hände in die schmalen Hüften und sah in das blasse, ängstliche Gesicht ihres Sohnes. Den anderen drei Kindern, die neben ihm standen und genauso rote Ohren hatten wie er, schenkte sie keine Beachtung.
Matthias war mit seinen fast sechs Jahren ungewöhnlich klein. Betroffen blickte er zu Boden.
»Sieh mich an«, forderte Helene streng. Es war das dritte Mal in dieser Woche, dass etwas im Haus ihres Vaters in Brüche ging, und jedes Mal war Matthias beteiligt gewesen.
Schüchtern hob der Junge den Kopf. Sein strohblondes, fast weißes Haar hing ihm in die Stirn und verdeckte die dunkelblauen Augen, die er von seiner Mutter geerbt hatte.
»Ich war es nicht«, sagte er so leise, dass nur er es hören konnte.
»Großvater hat dir vorgestern erklärt, dass er dich drei Tage im Schuppen einsperrt, wenn du noch einmal etwas kaputt machst!«, schimpfte Helene. »Willst du das?«
»Ich hab den Ball geworfen«, erklärte der Junge, der neben Matthias stand. Er war nur ein paar Monate älter, dafür aber um einen ganzen Kopf größer als Matthias. Beide Vorderzähne fehlten ihm, und er sprach undeutlich. Helene verstand ihn dennoch. Aber was er sagte, interessierte sie nicht.
»Sei still«, zischte sie ungehalten. Auch wenn der zahnlose Junge geschossen hatte, so war klar, dass Matthias an dem Missgeschick beteiligt gewesen war, und das allein zählte. Ihr Vater würde zu Recht verärgert sein, dabei war sein Unmut das Letzte, was sie im Moment heraufbeschwören wollte.
»Du gehst jetzt in deine Kammer und betest drei Rosenkränze!«, sagte sie zu Matthias. Sie war so verärgert, dass sie ihn rasch aus ihrem Blickfeld bekommen wollte. »Außerdem überlegst du dir, wie du den Schaden wiedergutmachen kannst.«
Helene konnte die Tränen sehen, die sich in den Augen ihres Sohnes sammelten. Einen Moment zögerte sie. War sie zu streng mit ihm?
»Aber das ist ungerecht«, sagte ein kleines Mädchen mit abstehenden Zöpfen. »Matthias hat nicht …«
Weiter kam es nicht, denn Helene wandte sich an das vorlaute Kind und funkelte es böse an. So weit würde es noch kommen, dass sie sich von einer Vierjährigen belehren ließ. Ihr Selbstzweifel war mit einem Mal verschwunden. »Ich habe dich nicht nach deiner Meinung gefragt«, zischte sie verärgert.
Sich der vorlauten Worte bewusst, presste das Mädchen die Lippen zusammen und schwieg betroffen. Helene sah, wie schwer es dem Kind fiel, nichts zu erwidern. Für einen kurzen Moment fühlte sie sich an ihre eigene Kindheit erinnert. Damals hatte sie sich gegen ihre Brüder zur Wehr gesetzt. Sie war mutig gewesen, schimpfende Mütter anderer Kinder hatten ihr keine Angst einflößen können. Um die Erinnerungen zu vertreiben, schüttelte sie den Kopf. Es war lange her und hatte nichts mehr mit der Frau zu tun, die sie heute war.
Hätte ihr Vater in der Stube nicht auf sie gewartet, hätte sie vielleicht nicht so ungehalten reagiert. Aber das Gespräch, das sie gleich mit Peter Wolfram führen würde, ließ sie vor Angst zittern. Eine der ersten Lektionen, die sie in den letzten Jahren gelernt hatte: Es war besser, die eigene Angst an andere weiterzugeben. Helene sah in die tränennassen Augen ihres Sohnes. Genau das machte sie im Moment. An manchen Tagen ekelte ihr vor ihr selbst.
Trotz des herrlichen Wetters war es in der Stube finster und stickig. Helenes Vater war ein sparsamer Mensch. Das Anzünden von Öllampen oder Kerzen während des Tages war undenkbar. Gleichzeitig fror er aber auch ständig, weshalb ein Teil der Fensterläden geschlossen blieb und es niemals wirklich hell im Haus war.
Helene näherte sich zögernd dem Tisch, an dem er saß. Früher war Peter Wolfram ein gut aussehender Mann gewesen, mit einem kantigen Gesicht und einem vollen Bart. Doch seit einigen Jahren nahm er ständig an Gewicht zu, so dass er jetzt einen riesigen Bauch vor sich herschleppte und sein Doppelkinn trotz Bart nicht mehr zu verbergen war. Er war ein unbedeutender Kleinadeliger, aber gleichzeitig einer der wohlhabendsten Tuchhändler in der Stadt. In seinem Laden am Hauptplatz verkaufte er teure Stoffe aus Flandern, Florenz und Venedig. Alle waren von besonders hoher Qualität. Die Menschen in seinem Haushalt bekamen davon nichts zu spüren. Helene trug ein Kleid aus einfacher, brauner Wolle, ohne Borten, Bänder und anderem Schnickschnack. Praktisch, aber nicht wertvoll. So war es immer gewesen, und es hatte sie nie sonderlich gestört.
»Du wolltest mich sprechen?«, fragte sie vorsichtig. »Ist es sehr dringend? Oder kann ich zuvor die Arbeit in der Küche beenden?« Sie unternahm einen letzten Versuch, das Gespräch zu verschieben.
»Ja, es ist sehr wichtig«, sagte ihr Vater ernst, so dass jedes weitere Ausweichen unmöglich war. »Setz dich!« Er deutete auf einen der Stühle, und Helene nahm schweren Herzens darauf Platz.
Nur zu gut wusste sie, was sie gleich erwartete. Ihr Vater würde ihr sagen, dass er sie nicht länger in seinem Haus duldete, und noch bevor sie über eine Erwiderung nachdenken konnte, sprach er die schreckliche Hiobsbotschaft auch schon aus.
»Nächste Woche endet dein Trauerjahr«, begann er ernst. »Es wird Zeit, dass wir einen neuen Mann für dich suchen und du wieder heiratest.«
Das Wort »Heirat« löste in Helene Erinnerungen aus, die eng mit Angst und Gewalt verbunden waren. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Um sich zu beruhigen, faltete sie ihre Hände so fest in ihrem Schoß zusammen, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.
»Vater, ich will nicht …«
Ungeduldig wischte er ihren Einwand beiseite.
»Unsinn«, sagte er ungehalten. »Natürlich willst du heiraten. Jede ehrbare Frau will verheiratet sein. Du kannst nicht ewig in meinem Haus wohnen. Die Leute tratschen bereits. Du bist in den besten Jahren, hübsch und intelligent. Wir werden nach einem wohlhabenden Mann suchen, der dir ein guter Gatte sein wird.«
»So wie Peter Szekeles?«, fragte Helene leise. Bei dem Gedanken an ihren verstorbenen Ehemann zog sich ihr Magen krampfhaft zusammen. Erinnerungen, die sie lieber ganz tief in sich vergraben wollte, tauchten wieder auf und verursachten eine Übelkeit, die sie jedes Hungergefühl für Stunden und Tage vergessen ließ.
»Szekeles war Bürgermeister der Stadt. Er war einflussreich und wohlhabend. Du hättest keinen besseren Ehemann bekommen können«, antwortete Peter Wolfram unbeirrt.
»Keinen besseren Mann«, wiederholte Helene leise und fügte fassungslos hinzu: »Hast du den Tag der heiligen Barbara vergessen?« Vorsichtig hob sie ihren Kopf und beobachtete ihren Vater. Sie hoffte, dass die Erinnerungen an diesen Tag das Bild ihres Vaters von seinem verstorbenen Schwiegersohn wieder dorthin rückten, wo es hingehörte, in die Ecke der Verbrecher und Gewalttäter. Und tatsächlich, für einen Moment schwieg er betroffen. Peter Wolfram hatte den eisig kalten Dezembertag nicht vergessen, an dem seine Tochter und sein Enkelsohn mit Platzwunden, blauen Flecken und Knochenbrüchen im Schnee vor seiner Tür lagen.
Dennoch sagte er nach einer kurzen Pause: »Jeder Ehemann hat das Recht und die Pflicht, seine Frau und seine Kinder zurechtzuweisen und notfalls zu züchtigen, wenn sie ihm nicht gehorchen. Und mehr hat er nicht getan, schließlich seid ihr beide noch am Leben.«
Helenes Herz wurde schwer. Zwischen zurechtweisen, züchtigen und fast zu Tode prügeln lagen meilenweite Unterschiede. Hätte es sich nicht um den Bürgermeister gehandelt, wäre es zu einer Anzeige beim Stadtrichter gekommen. Aber Peter Wolfram war zu feige gewesen. Lieber hatte er dafür gesorgt, dass seine Tochter und sein Enkelsohn ohne großes Aufsehen gesund gepflegt wurden. Kaum hatte der Bürgermeister nach den beiden verlangt, hatte man sie wieder zu ihm geschickt. Peter Wolframs Angst, dass ein Skandal seinem Geschäft schaden könnte, war größer gewesen als die Sorge um seine Familie. Er hatte nie begriffen, was er mit dieser Entscheidung angerichtet hatte. Szekeles hatte nicht nur Helenes Körper geschändet, sondern auch ihre Seele zerstört. An manchen Tagen wusste Helene nicht, wovor sie mehr ekelte, vor ihrem verstorbenen Mann oder vor dem angsterfüllten Wesen, das er aus ihr gemacht hatte.
»Warum können wir nicht hierbleiben?«, fragte Helene leise. »Das Haus ist groß genug für uns alle. Mutter hätte es so gewollt.«
Beim Erwähnen seiner verstorbenen Frau verfinsterte sich das Gesicht ihres Vaters. »Lass deine Mutter aus dem Spiel«, sagte er ernst. »Sie war eine viel zu großzügige Frau. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten wir sämtliche Waisenkinder Ungarns bei uns aufgenommen und durchgefüttert, bis wir selbst bettelarm geworden wären.«
Für einen Moment schloss Helene die Augen. Das weiche Gesicht ihrer Mutter tauchte vor ihr auf. Sie war eine wundervolle Frau mit einem großen Herzen gewesen, die stets für ihre Kinder da gewesen war. Sie hatte Helene und ihren Brüdern eine herrliche Kindheit beschert. Erinnerungen, die ihr niemand nehmen konnte und die ihr geholfen hatten, den Wahnsinn zu überleben. Bis heute zürnte Helene Gott dafür, dass er sie so früh zu sich geholt hatte. Hätte Sophia Wolfram länger gelebt, wäre Helene nie mit dem Bürgermeister verheiratet worden.
Ihr Vater holte sie aus ihren Tagträumen. »Es liegt allein in deiner Hand, ob ein Ehemann mit dir zufrieden ist oder nicht«, sagte er ernst. »Niemand mag ein Weib an seiner Seite haben, das ständig widerspricht.«
Helene öffnete den Mund, klappte ihn aber wieder zu und schluckte die Bemerkung hinunter. Die einzige Person, die ihm je widersprochen hatte, war ihre Mutter gewesen. Mit ihrer ruhigen, unaufdringlichen Art hatte sie den Willen ihres Ehemanns gelenkt, ohne dass er es je bemerkt hätte. Warum hatte Helene dieses Talent nicht von ihr geerbt?
»Ich will, dass meine Tochter einen Mann heiratet, der Wohlstand in die Familie bringt und genug Einfluss hat, um unsere Geschäfte zu begünstigen. Auf diese Weise wird das Unternehmen erstarken, und deine Brüder werden eines Tages zu den mächtigsten Kaufleuten Ungarns zählen.«
Helene verdrehte die Augen. Ihre beiden Brüder waren in der Lage, selbst Geschäftskontakte zu knüpfen und ihr Vermögen zu vermehren. Weder Benedikt noch Adam würden sie jemals zu einer Ehe drängen. Ginge es nach ihnen, könnte sie ihr Leben als Witwe im Haus des Vaters verbringen. Aber noch war Peter Wolfram am Leben, erfreute sich bester Gesundheit und bestimmte Helenes Zukunft.
»Diesmal wird es noch einfacher sein, einen passenden Ehemann für dich zu finden«, sagte er zufrieden. »Du hast bewiesen, dass du fruchtbar bist und Söhne gebären kannst, auch wenn Matthias für sein Alter noch ziemlich klein und dünn ist.« Er hielt inne und musterte sie ungeniert. »Auch dir würden ein paar Pfund mehr auf den Hüften nicht schaden«, sagte er vorwurfsvoll.
»Das Essen ist uns beiden im Haus von Szekeles vergangen«, sagte Helene trotzig. Ein letzter, hilfloser Versuch, ihren Vater umzustimmen. Er missglückte.
»Hör endlich auf zu widersprechen«, fuhr er sie böse an.
Die Heftigkeit seiner Worte zeigte augenblicklich Wirkung. Helene duckte sich und beugte ihren Kopf über ihre Hände, die immer noch gefaltet in ihrem Schoß lagen.
»Szekeles hat nur getan, wozu er als Ehemann auch berechtigt war. Zugegeben, er hat übertrieben, aber du hast gewiss deinen Beitrag dazu geleistet. Übrigens will kein Mann mit einem Skelett im Bett liegen. Wenn du so dürr bleibst, wirst du keinen Mann erfreuen.«
»Vielleicht will ich gar keinen Ehemann erfreuen!«
Es war wohl die Aussichtslosigkeit ihrer Situation, die sie zu diesen Worten ermutigte. Helene wusste, dass ihre Bemerkung den ungebremsten Zorn ihres Vaters heraufbeschwören würde. Augenblicklich bekam sie die Rechnung für ihre unbedachten Worte präsentiert.
Mit der flachen Hand schlug Peter Wolfram auf die Tischplatte, so dass der Krug, der daraufstand, wackelte. Erschrocken fuhr Helene zusammen, ihr Herzschlag beschleunigte sich. Ängstlich presste sie ihre Hand gegen die Brust, in der Hoffnung, das lebenswichtige Organ von der Raserei abzuhalten. Aber ohne Erfolg. Sie konnte nichts dagegen tun. Mit aufgerissenen Augen starrte sie auf die Hand ihres Vaters. Es war genau wie an jenem Abend, als Peter Szekeles zum ersten Mal gezeigt hatte, wozu er fähig war. Seine Hand hatte zuerst flach auf dem Tisch gelegen, bevor sie zur Faust geballt in ihrem Gesicht gelandet war. Erst als ihr Vater weitersprach, konnte sie ihre Augen von seiner Hand lösen. Seine Worte holten sie in die Gegenwart zurück.
»Ich verspreche, dass ich mich bemühen werde, einen guten Ehemann für dich zu wählen. Jemand, der in deinem Alter ist. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, dass Szekeles die fünfzig bereits überschritten hatte«, sagte ihr Vater.
Vielleicht hatte er Helenes Angst bemerkt. Seine Stimme klang nun deutlich versöhnlicher, und Helenes Herz kam zur Ruhe. Doch es änderte nichts an der Tatsache, dass er sie zur Ehe zwang. Helene wollte weder einen jungen noch einen alten Mann heiraten. Die Vorstellung, noch einmal ein Kind unter Gewalt empfangen zu müssen, war einfach entsetzlich.
»Wir führen das Gespräch weiter, sobald es passende Anwärter gibt.« Mit einer knappen Handbewegung deutete ihr Vater an, dass sie nun wieder aufstehen und gehen könne.
Helene setzte zu einem allerletzten Versuch an.
»Vater, ich …«
»Helene, unsere Unterhaltung ist beendet. Wenn du etwas gegen meine Vorschläge einzuwenden hast, kannst du noch heute dein Bündel schnüren und mein Haus gemeinsam mit deinem Kind verlassen.« Seine Augen waren hart. Es fiel Helene schwer, darin den Mann wiederzuerkennen, der vor vielen Jahren liebevoll die Hand ihrer Mutter gehalten hatte.
Benommen erhob sie sich von dem Stuhl. Die Stube wirkte plötzlich noch erdrückender, und sie fürchtete zu ersticken. Ohne eine weitere Bemerkung wankte sie aus dem Raum auf den Gang. Sie musste sich am Handlauf festhalten, als sie die engen Stufen ins Erdgeschoss stieg. Ihre klobigen Holzschuhe polterten laut über die abgetretenen Stiegen aus Eichenholzbrettern. Rasch durchquerte sie die Küche, in der es bereits nach gebratenen Zwiebeln und Linsen fürs Mittagessen roch, und stürzte förmlich auf den Hof, wo sie sich neben den Brunnen hockte. Ein mit Wasser gefüllter Holzeimer stand neben ihr. Helene tauchte ihre Hände in das kühle Nass und bespritzte ihr heißes Gesicht mit Wasser. Auf diese Weise verhinderte sie, dass aus den einzelnen Tränen ein hemmungsloser Fluss wurde. Sie blinzelte das Wasser weg. Einige Tropfen blieben in ihren langen, dichten Wimpern hängen und ließen das Bild vor ihr verschwimmen. Dennoch erkannte sie aus den Augenwinkeln den hellen Schopf ihres Sohnes. Doch sobald sie den Kopf hob, versteckte er sich hinter dem Mauervorsprung und drückte sich fest gegen die Hauswand aus Stein, um unentdeckt zu bleiben. Helene wischte mit dem Handrücken über ihre Augen. Sie schniefte und steckte sich eine nasse Haarsträhne zurück unter die weiße Haube. Auch wenn Matthias nicht mehr in ihrem Blickfeld war, konnte sie sein schmales, blasses Gesicht mit der etwas zu breiten Nase vor ihrem inneren Auge sehen. Es waren die Nase und das spitze Kinn, die sie unweigerlich an Peter Szekeles erinnerten. Warum musste der Junge seinem Vater so ähnlich sehen und sie jedes Mal an die fürchterliche Nacht erinnern, in der er gezeugt worden war? Vielleicht war das der Grund, warum sie ihn jetzt nicht zu sich rief und ihm erklärte, warum sie weinte. Sie machte nicht einmal den Versuch, ihn zu beruhigen und ihm einen Teil seiner Angst zu nehmen, die ihn mit Sicherheit quälte, schließlich hatte er beobachtet, wie sie sich die Tränen aus den Augen gewischt hatte. Warum konnte sie ihm nicht eine Mutter sein, wie Sophia Wolfram es für sie gewesen war?
Helene stand erst auf, als sie sicher war, dass Matthias nicht mehr hinter dem Mauervorsprung hockte. Sie fühlte sich schrecklich und war voller Schuldgefühle. Sollte sie Gott darum bitten, ihr zu helfen? Aber Gott hatte sich in den letzten Jahren als nicht besonders hilfreich erwiesen. Vielleicht hatte sie all seine Gunst bereits als Kind aufgebraucht.
Wien 1437
as Haus des Wiener Dompropstes und Kanzlers Andreas Plank lag im vornehmsten Teil der Stadt, hinter der neu umgebauten Hofburg in der Herrengasse. Es handelte sich um ein prächtiges dreistöckiges Gebäude aus Schiefer, der eigens aus dem Leithagebirge über die Donau nach Wien getreidelt worden war. Verspielte Erker mit verglasten Fenstern und eine bemalte Hausfassade, auf der der heilige Florian zu sehen war, zeugten vom Reichtum des Besitzers. Neben Herzog Albrecht war Andreas Plank einer der mächtigsten und einflussreichsten Männer im Reich. Es gab böse Zungen, die behaupteten, dass der einstige Erzieher des Herzogs der eigentliche Drahtzieher in den habsburgischen Erbländern war. Keine Entscheidung, egal ob kirchlicher oder weltlicher Natur, wurde ohne sein Wissen getroffen. Hier in der Herrengasse liefen die Fäden der Macht zusammen.
Gerade bestieg Hauptmann Ernst Wallecek im Hof sein Pferd und lenkte das Tier Richtung Straße. Die beschlagenen Hufe klapperten laut über die dunklen Pflastersteine. Der Luxus stammte noch aus der Zeit, als die Römer ihr Militärlager Vindobona hier unterhalten hatten. Andreas Plank stand am Fenster und starrte dem alten Soldaten hinterher, der die letzten drei Stunden damit verbracht hatte, über die erfreuliche Lage im Kampf gegen die Hussiten zu berichten. Es schien, als hätte sich der jahrelange Krieg gegen die Ketzer nun endlich gelohnt. Das Heer der Ungläubigen war vernichtet, und bis auf ein paar kleine Scharmützel hier und da war im Moment mit keinem Widerstand aus Böhmen zu rechnen. Kaiser Sigismund, Albrechts Schwiegervater und engster Verbündeter, war es gelungen, die Ungläubigen zu vernichten. Wie immer hatte Andreas Plank recht behalten. Beharrlichkeit zahlte sich aus, und schlussendlich siegten stets der wahre Glaube und die Kirche. Auch wenn man mit großen Summen und gewaltigen Heeren nachhelfen musste. Fast dreißig Jahre hatte der Krieg gegen die Hussiten gedauert und nicht nur enorme Geldsummen verschlungen, sondern auch unzählige Menschenleben gekostet.
»Wollt Ihr das Schreiben an Herzog Albrecht jetzt gleich unterzeichnen, oder soll Anna zuerst das Abendessen auftragen?«
Planks Überlegungen wurden jäh unterbrochen. Hinter dem kleinen Schreibpult am anderen Ende des Raums stand Johann Kottanner, sein Kammerherr und Sekretär. Der junge Mann mit dem dunkelbraunen Haarschopf, der ihm stets unfrisiert in die Stirn fiel, sah ihn fragend an. Vor ihm lag ein Schriftstück, das er in den letzten Stunden angefertigt hatte. Eine gekürzte Version des Gesprächs, das Plank mit Wallecek geführt hatte. Die Summen, die darin genannt wurden, waren von Johann auf Wunsch seines Dienstherrn beschönigt worden.
»Ich unterschreibe gleich«, sagte Plank und ging auf Johann zu. Trotz seiner Bemühungen, nicht zu humpeln, zog er sein rechtes Bein steif hinterher, möglichst darauf bedacht, es nicht zu belasten. Das Rheuma plagte ihn wieder einmal, und das lag nicht nur am feuchtkalten Wetter, das seit Tagen herrschte und die Stadt hinter grauen Nebelschleiern verschwinden ließ, sondern vor allem an seinem Alter. Plank war einfach nicht mehr der Jüngste. Nächsten Monat ging er ins fünfundsechzigste Lebensjahr. Nur wenige seiner gleichalten Weggefährten waren noch am Leben. Aber Plank hatte noch lange nicht vor, diese Welt zu verlassen. Zu viele Aufgaben warteten noch auf ihn. Sein wichtigstes Ziel war letzte Woche mit dem Tod des Passauer Bischofs in greifbare Nähe gerückt. Jetzt könnte es ihm endlich gelingen, dem Papst das Bistum für Wien abzuringen. Die Stadt war geradezu prädestiniert für einen Bischofssitz. Sie verfügte über eine strategisch wichtige Lage. In den letzten Jahren war sie zu einer wichtigen Handelsmetropole gewachsen. Der Herzog hatte vor rund zehn Jahren alle Juden aus seinem Reich vertrieben und sich im Kampf gegen die Hussiten hervorgetan. Welcher andere weltliche Herrscher konnte sich solcher christlichen Heldentaten rühmen? Außerdem besaß Wien einen der prächtigsten Dome, durchaus vergleichbar mit Straßburg oder Köln. Für die Fertigstellung des Südturms hatte Plank die talentiertesten Steinmetzmeister aus ganz Europa holen lassen, damit sie Gottes Herrlichkeit für die Nachwelt in Stein meißelten und die ganze Welt sehen konnte, wie wichtig den Wienern ein würdiges Gotteshaus war. Plank war davon überzeugt, dass das Zögern des Papstes als einer der größten Skandale in die Kirchengeschichte eingehen würde. Denn wäre die Entscheidung des Papstes objektiv und nicht von einem intrigierenden Bischof beeinflusst worden, hätte man der Stadt schon vor Jahren den Bischofssitz zusagen müssen. Aber in Passau hatte man aus verständlichen Gründen Angst vor der Konkurrenz aus Wien gehabt, und der verstorbene Bischof hatte dem Heiligen Vater sehr nahegestanden. Im Moment prangerte man im Basler Konzil genau diese Machenschaften an. Es konnte also keinen besseren Zeitpunkt geben, das Anliegen erneut vorzubringen. Mit etwas Glück und den richtigen Verbündeten im Rücken sollte dem Bischofssitz nichts mehr im Wege stehen. »Bischof Plank«, das klang wunderbar. Versonnen blickte er ins Leere, bis das Räuspern seines Kammerherrn ihn auf unangenehme Weise aus seinen Tagträumen holte. Seufzend stellte er sich an das Schreibpult und nahm das Schriftstück entgegen, das Johann ihm mit einer gespitzten Schreibfeder zuschob. Plank machte sich nicht die Mühe, den Brief zu lesen. Er vertraute seinem Kammerherrn. Seit fast zehn Jahren war Johann nun in seinen Diensten, und Plank schätzte den Mann nicht nur wegen seines Verstandes, sondern weil er der einzige Mensch in seiner Umgebung war, der es wagte, ihm von Zeit zu Zeit zu widersprechen. Er war ein Künstler der wortgewandten Formulierungen. Unter seiner Feder wurden dringliche Forderungen zu höflichen Bitten. Selbst unangenehme Hiobsbotschaften verpackte er geschickt in galante Redewendungen, so dass dem Leser nicht sofort klar war, welch schreckliche Nachricht er soeben erhalten hatte.
Plank setzte also bedenkenlos seine Unterschrift unter den Brief und drückte seinen Siegelring in das flüssige Wachs, das Johann auf das zusammengefaltete Schriftstück hatte tropfen lassen, um es für unbefugte Leser zu verschließen.
»Ich bin froh, dass der Kampf gegen die Hussiten nun endlich ein Ende findet. Weitere Kämpfe hätte die leere Staatskassa nicht mehr verkraftet«, sagte Plank und ließ sich auf einen der gepolsterten Stühle neben dem Schreibpult nieder.
Johann hob die rechte Augenbraue. Plank war diese Geste durchaus bekannt, sie zeigte, dass der Kammerherr an seiner Aussage zweifelte.
Plank reagierte sofort. »Ich weiß. Ihr glaubt, dass immer noch jüdisches Gold in den Staatstruhen liegt. Aber dem ist nicht so. Der Kampf gegen die Hussiten, der Umbau der Hofburg und die Fertigstellung des Südturms von St. Stephan haben Unmengen geschluckt. Albrecht ist so mittellos wie vor der großen Judenvertreibung.«
»Wie kann das sein, er hat 900 Juden ihr gesamtes Vermögen weggenommen, bevor er sie vertrieben, gefoltert und getötet hat.«
Manchmal nahm sich Johann eine Spur zu viel heraus, so wie gerade eben. Dem Mann stand es nicht zu, über Entscheidungen des Herzogs zu urteilen. Vor allem dann nicht, wenn es sich um Kritik handelte.
»Die Vertreibung der Mörder Christi war unsere Christenpflicht«, sagte Plank streng. Er versuchte, den missbilligenden Blick seines Kammerherrn zu ignorieren. Im Moment wollte er sich nicht mit einem Thema auseinandersetzen, das ohnehin längst abgeschlossen war. Etwas anderes beschäftigte ihn.
»Sigismund hat Albrecht zu seinem Nachfolger designiert, aber es gibt Gerüchte, dass seine intrigante Frau versucht, seine Krönung zu verhindern. Sie favorisiert den polnischen König Wladislaw, der wiederum ein Verbündeter von Böhmen ist. Ein unglaubliches Vorgehen, angesichts der Tatsache, dass Albrecht als Einziger den Kaiser so tatkräftig im Kampf gegen die Hussiten unterstützt hat. Sigismund steht tief in Albrechts Schuld. Außerdem ist er mit Elisabeth, der Tochter von Sigismund und Barbara, verheiratet. Ich frage mich, was in der verrückten Frau vorgeht. Es gibt Stimmen, die behaupten, sie sei mit dem Teufel im Bunde.«
Plank rückte seinen Siegelring wieder zurecht und verschränkte die von Gicht und Rheuma geplagten Finger ineinander. Vorsichtig lehnte er sich zurück, ohne sich dabei zu entspannen. Er drückte seine Schultern durch. Plank war hager und trotz seines Alters immer noch außergewöhnlich groß.
»Ich dachte, Kaiser Sigismund sei mit seiner Frau zerstritten. Er hat sie doch immer wieder ins Exil geschickt. War unsere Herzogin nicht einige Jahre mit ihrer Mutter in Ungarn, während Sigismund in Prag weilte?«, fragte Johann. Er verstaute das Siegelwachs, die Schreibfeder und das Tintenfass in einer kleinen Holzkiste. Dann klappte er das Schreibpult hoch und stellte die Kiste in das leere Fach unter der Schreibfläche. Kurz darauf schnappte die Aufhängeeinrichtung wieder zu.
»Barbara von Chilli ist eine Hexe. Sie unterhält einen Alchemisten, der in ihrem Auftrag Giftsäfte braut. Es grenzt an ein Wunder, dass der Kaiser noch lebt. Unumstritten hat Sigismund das Weib wiederholt ins Exil geschickt, aber kaum ist sie wieder bei ihm, übt sie einen fast magischen Einfluss auf ihn aus. Vielleicht verhext sie ihn mit ihren Tränken.«
»Hm!« Johann legte das versiegelte Schreiben zu den anderen Schriftstücken in eine Ablage neben dem Schreibpult.
»Es ist mir zu Ohren gekommen, dass unsere Herzogin seit geraumer Zeit regen Schriftverkehr mit ihrer Mutter pflegt«, sagte Plank düster. Er strich mit dem Zeigefinger seiner Linken über das Wappen auf seinem Siegelring.
»Ich dachte, die beiden können einander nicht ausstehen.«
Während Johann fragte, zählte er die Schriftstücke in der Ablage ab. Stirnrunzelnd fügte er hinzu: »Ich muss jedoch zugeben, dass ich mein Wissen aus der Küche der Hofburg beziehe. Kann sein, dass die Dienstmägde nicht unbedingt die zuverlässigsten Informationsquellen sind.«
Plank schnaufte verächtlich: »Elisabeth wird sich hüten, irgendjemandem von ihren Plänen zu erzählen. Es gibt Stimmen, die sagen, sie kann ihre Mutter nicht ausstehen, und andere, die genau das Gegenteil behaupten.«
Neugierig zog Johann die rechte Augenbraue hoch: »Selbst wenn sie mit ihrer Mutter regen Kontakt pflegt, was fürchtet Ihr?«
»Wenn Elisabeth mit ihrer Mutter gemeinsame Sache macht, ist Albrechts Zukunft und damit das gesamte Reich in Gefahr.«
»Warum sollte Elisabeth das tun? Sie würde sich selbst und ihren Kindern schaden.«
Ungeduldig schüttelte Plank seinen Kopf. Diesmal schien Johann ihn einfach nicht verstehen zu wollen.
»Elisabeth ist genauso machthungrig wie ihre Mutter. Sie mischt sich in politische Angelegenheiten ein und versucht, auf Albrecht Einfluss zu nehmen. Beides ziemt sich für eine Frau nicht. Sie hat ihrem Mann zu gehorchen und damit basta. Die Frau entwickelt sich zu einer unberechenbaren Größe. Außerdem …« Plank machte eine Pause. Mühevoll erhob er sich wieder und humpelte zurück zum Fenster. Seine dunklen, fast schwarzen Augen, die im Laufe der Jahre nichts an Ausdruckskraft verloren hatten, blickten auf die regennasse Straße, so als könne er dort die Worte finden, nach denen er suchte.
»Es heißt, dass der Herzog die Herzogin nicht ausreichend …« Plank räusperte sich und drehte sich wieder zu Johann. Offensichtlich hatte er das passende Wort auch auf der Straße nicht gefunden. Hilfesuchend wartete er darauf, dass Johann seinen Satz ergänzen würde, aber der stellte sich taub.
Genervt presste der Kanzler die ohnehin schmalen Lippen zusammen und stieß die Worte mit Verachtung hervor: »Albrecht ist als Ehemann ein Versager!«
»Oh!«, sagte Johann. Seine Mundwinkel zuckten belustigt. Er wirkte jedoch wenig überrascht. Offensichtlich wussten die Mägde in der Hofburg auch darüber Bescheid.
»Ihr meint, dass die Herzogin sich nach einem Liebhaber umsieht?«
Plank machte eine abfällige Handbewegung.
»Dass die Herzogin sich andere Männer ins Bett holt, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Es ist mir völlig egal, mit wem sie sich vergnügt, wenn sie dabei einen starken männlichen Erben zeugt, soll es mir sogar recht sein. Wovor ich mich fürchte, ist die Möglichkeit, dass sie mit ihrer Mutter eine Intrige spinnt und die Ungarn zu einer Koalition mit den Polen bewegt. Vielleicht wartet sie darauf, dass Albrecht stirbt, um dann den König von Polen zu heiraten und mit Böhmen gemeinsame Sache zu machen. Auf diese Weise kämen die Anhänger von Jan Hus wieder aus ihren Löchern gekrochen, in die sie sich soeben zurückgezogen haben, und die christliche Welt wäre erneut bedroht. Zeitgleich wächst im Osten die Gefahr. Noch sieht sie niemand als ernsthafte Bedrohung, aber ich prophezeie Euch, die Osmanen werden nicht nur in Kärnten und der Steiermark einfallen, sondern ihre Finger auch nach Wien ausstrecken. Sie warten nur darauf, die Kreuze auf unseren Kirchturmspitzen gegen Halbmonde auszutauschen. Stellt Euch das nur vor. Ein Mond statt eines Kreuzes auf St. Stephan.« Plank schüttelte sich angewidert bei dem Gedanken. »Was wir brauchen, ist eine starke Verbindung von Kirche und Reich, einen christlichen Herrscher, der auf das Wort Gottes hört, unsere Werte hochhält und verteidigt. Eine christliche Front gegen Juden, Heiden und Ketzer.«
Plank war jetzt so aufgeregt, dass sein Kopf sich gefährlich rot färbte. Die Adern an seinen Schläfen traten dunkel hervor, und er griff sich schnaufend an die Brust. Besorgt machte Johann einen Schritt nach vorne. Er schob den Stuhl neben dem Schreibpult in Planks Richtung und bedeutete ihm, Platz zu nehmen. Geräuschvoll ließ er sich darauf nieder.
»Ihr seht, wie sehr mich Barbara und ihre Tochter Elisabeth aufregen. Es war ein Fehler gewesen, Albrecht mit der Tochter einer Hexe zu verheiraten. Aber wer hatte damals ahnen können, dass der Luxemburger seine Tochter in die Obhut seiner eigenen Frau gibt, anstatt sie von einer gottesfürchtigen Erzieherin in Demut und Gehorsam unterrichten zu lassen.«
Unaufgefordert ging Johann zu einem kleinen Tischchen, das vor dem großen Erkerfenster stand. Darauf standen mehrere Becher aus Kristall und eine Karaffe mit schwerem Wein. Schwungvoll schenkte er die rubinrote Flüssigkeit ein und brachte sie dem Dompropst.
»Ihr solltet Euch weniger Gedanken um Elisabeth machen. Mag sein, dass die Ehe mit Albrecht sie nicht glücklich macht, aber ich glaube nicht, dass sie ihren eigenen Kindern und vor allem nicht sich selbst schaden will. Wenn Albrecht nicht Sigismunds Nachfolger wird, würde Elisabeth am meisten darunter leiden.«
Plank nahm den Becher entgegen und schwenkte nachdenklich die Flüssigkeit darin, bevor er einen kräftigen Schluck nahm.
»Dennoch wissen wir nicht, was im Kopf der Frau vorgeht. Warum schreibt sie ständig Briefe an ihre Mutter? Was planen die beiden? Die Ungewissheit macht mich krank. Wenn ich wüsste, was die Herzogin vorhat, wäre mir leichter ums Herz.«
»Das wird schwierig«, sagte Johann. »Ihr müsstet jemanden finden, der Elisabeths Vertrauen besitzt, um an diese Informationen zu gelangen.«
»Ich weiß!« Erneut drehte Plank den Becher in seinen alten, knorrigen Händen. Er schnalzte mit der Zunge.
»Ingeborg Kreiner ist letzte Woche verstorben. Die Herzogin sucht nach einer Erzieherin für ihre eben geborene Tochter Elisabeth«, sagte er leise.
»Wollt Ihr der Herzogin die Wahl der Erzieherin abnehmen?« An Johanns Stimme war zu erkennen, dass er diesen Plan für wenig zielführend hielt.
Aber Planks dunkle Augen leuchteten. Er fand seine Idee großartig. Mit einem Ruck setzte er sich auf. Um ein Haar hätte er die rote Flüssigkeit über seine weißen Hemdsärmel verschüttet.
»Ich werde sogar einen Schritt weitergehen«, sagte er begeistert. »Ich werde den Herzog nicht nur dazu bringen, die Erzieherin seiner Tochter zu bestimmen, sondern auch noch dafür sorgen, dass diese Frau mit jemandem verheiratet ist, der mein volles Vertrauen besitzt. Auf diese Weise sichere ich mich doppelt ab.«
»Einer Eurer Vertrauten soll die Erzieherin der Kinder des Herzogs heiraten, damit Ihr Informationen über Elisabeth bekommt?«, fragte Johann. Deutlich fassungslos schüttelte der junge Mann den Kopf.
»Warum nicht?«, sagte Plank. »So bleibt die Frau kontrollierbar. Solange man weiß, was der Feind plant, ist alles halb so schlimm. Und glaubt mir …« Er machte eine bedeutungsschwere Pause. »Menschen haben für mich schon ganz andere Dinge gemacht, damit ich an wichtige Informationen gelange.«
»Das bezweifle ich keinen Augenblick«, sagte Johann leise.
Plank setzte den Becher an den Mund und trank die Flüssigkeit in einem Zug aus. Dann reichte er den leeren Becher an Johann.
»Wie alt seid Ihr eigentlich?«, fragte er so beiläufig als möglich.
Aber auf Johanns Stirn hatten sich bereits tiefe Sorgenfalten gebildet. »Neunundzwanzig«, antwortete er und strich sich den dunkelbraunen Haarschopf zur Seite.
»Ihr seht deutlich jünger aus, als Ihr seid«, stellte Plank zufrieden fest. »Das dreißigste Lebensjahr ist ein hervorragender Zeitpunkt, um in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Was meint Ihr?«
Zum ersten Mal seit Plank seinen Kammerherrn kannte, wirkte dieser erschüttert. Abwehrend machte Johann einen Schritt rückwärts.
»Lasst uns in Ruhe darüber reden«, lenkte Plank versöhnlich ein. Ihm war klar, dass er diesmal etwas länger brauchen würde, um Johann zu überzeugen.
»Schenkt mir erneut von dem wundervollen Wein ein, und füllt Euch selbst einen Becher. Ein Winzer außerhalb der Stadt hat ihn gekeltert, und ich kann Euch versichern, dass Ihr selten einen so guten Tropfen gekostet habt«, sagte er freundlich und stellte sich innerlich auf einen langen Abend ein.
Es war weit nach Mitternacht, als Johann immer noch niedergeschlagen am massiven Holztisch in der Küche im Erdgeschoss des Hauses saß, sich aber trotz der fortgeschrittenen Stunde nicht dazu überwinden konnte, ins Bett zu gehen. Die dicke Honigkerze auf dem verbogenen Metallhalter war beinahe abgebrannt. Die Flamme zuckte nervös, und Johann blinzelte mit rotunterlaufenen Augen in das unruhige Licht. Er war müde, was nicht nur auf die ungewöhnliche Uhrzeit zurückzuführen war, sondern vielmehr auf das Gespräch, das hinter ihm lag.
»Du solltest jetzt wirklich ins Bett gehen«, sagte Anna besorgt. Die Köchin, eine alte Frau mit rundem Gesicht und Wangen in der Farbe reifer Äpfel, schüttelte besorgt den Kopf. In den letzten zwei Stunden hatte sie Johann mit Haselnüssen, getrockneten Marillen und einem Becher warmer Milch versorgt und ihm geduldig zugehört.
»Ich für meinen Teil gehe jetzt schlafen. Ich bin müde!« Schwerfällig erhob sie sich.
»Bleib noch«, bat Johann, rasch griff er nach ihrer faltigen Hand.
Nur widerwillig blieb Anna stehen. Seit vielen Jahren arbeitete sie für Plank, führte den Haushalt, kümmerte sich um die Kräuterbeete im Garten und kochte. Es schien, als fühlte sie sich für Johann in besonderem Maße verantwortlich. Vielleicht sah sie in ihm den Sohn, den sie selbst nie gehabt hatte. Deshalb hatte sie ihm die letzten Stunden über zugehört, und aus demselben Grund ließ sie sich jetzt mit einem etwas übertriebenen Seufzen erneut auf den Stuhl plumpsen. Das Holz knarrte unter ihrem massigen Körper.
»Ich werde nicht heiraten, damit Plank Informationen über Elisabeth bekommt«, sagte Johann bestimmt. Er klang wie ein trotzendes Kind, und die Köchin schien mit seiner Reaktion, so wie eine Mutter, ganz und gar nicht einverstanden.
»Ich finde die Idee mit der Ehe nicht schlecht«, sagte Anna.
»Ich bin doch kein junges Mädchen, über dessen Zukunft ein Vater entscheiden kann, wie es ihm beliebt«, empörte sich Johann. Aufgeregt fuhr er sich mit beiden Händen durch sein dunkelbraunes Haar. Dann legte er sein Kinn in beide Hände und stützte die Ellbogen auf der Tischplatte mit den vielen Kerben und Vertiefungen ab.
Er seufzte laut. »Ich will selbst entscheiden, wen und wann ich heirate.«
»Wie willst du denn je eine passende Frau kennenlernen?«, fragte Anna spitz. Sie stellte diese Frage nicht zum ersten Mal. Seit Jahren drängte sie Johann dazu, abends auszugehen, sich mit gleichaltrigen Männern zu treffen und mit ihnen über heiratsfähige Frauen zu sprechen. Sie konnte nicht ahnen, dass Johann vor den Orten, vornehmlich Wirtshäusern, graute. Er war selbst in einem besonders schäbigen aufgewachsen. Seine Kindheit war alles andere als rosig gewesen, aber darüber sprach Johann nicht gerne. Diesen Teil seiner Vergangenheit wollte er lieber vergessen, auch wenn es schwierig war, denn die eigene Kindheit holte ihn immer wieder ein. Meistens dann, wenn er am allerwenigsten damit rechnete.
»Eine hübsche, junge Frau wäre das Beste, was dir passieren kann. Du solltest dem Dompropst dankbar dafür sein, dass er dir die Suche nach der Richtigen abnimmt und für dich entscheidet«, sagte Anna.
»Ich kann und will für mich selbst entscheiden«, murrte Johann.
»Ja, natürlich!«, schnaufte Anna verächtlich. »Wenn es nach dir ginge, würdest du eine der Küchenmägde des Herzogs heiraten, denn das sind die einzigen Frauen, mit denen du derzeit Kontakt hast.«
Hilfesuchend blickte Johann zur dunklen Decke. Über ihm hingen Würste, Knoblauch und Zwiebeln. Eine der Zwiebelknollen verfärbte sich unappetitlich grün. Anna sollte sie unbedingt auswechseln. Doch jetzt war nicht der Zeitpunkt, sie darauf hinzuweisen. Johann fragte sich, ob Anna ihn absichtlich nicht verstand. Vielleicht hatte sie Angst, Ärger mit dem Dompropst zu bekommen.
»Verdreh nicht die Augen. Ich habe recht, wie immer«, sagte die Köchin und folgte Johanns Blick. »Die Zwiebel ist kaputt. Ich muss mich morgen früh darum kümmern«, fuhr sie fort. Dann richtete sie den Zeigefinger ihrer rechten Hand direkt auf Johanns Nasenspitze. Der Finger war etwas gekrümmt, ob der Gicht, die sie plagte.
»Wenn du heiratest, muss der Kanzler dir und deiner Frau ein kleines Häuschen zur Verfügung stellen, das es zu versorgen gilt. Da ich bald zu alt für die Arbeit in diesem großen Haushalt bin, wird Herr Plank mich vielleicht zu dir und deiner Frau schicken.«
Abrupt hob Johann den Kopf. Daher also wehte der Wind. Anna dachte in erster Linie an sich selbst. Sie hatte Angst, hier bald ausgedient zu haben.
»Warum sollte der Kanzler mir eine Köchin bezahlen?«, fragte er überrascht.
»Weil deine Frau keine Zeit für den Haushalt haben wird, schließlich wird sie die Erziehung der kleinen Elisabeth übernehmen.«
Das leuchtete Johann ein, und irgendwie konnte er Anna verstehen, aber er wollte trotzdem niemanden heiraten, bloß um Anna einen angenehmen Lebensabend zu bescheren.
»Gib der jungen Frau eine Gelegenheit, sie kennenzulernen«, bat die Köchin. »Vielleicht ist sie hübsch und intelligent, schließlich hat unsere Herzogin auch ein Wort mitzureden. Sie würde für ihre kleine Tochter keine Giftschlange akzeptieren. Das weiß unser Kanzler, und er wird nach einer passenden Person suchen.«
Sie machte eine Pause und fügte dann mit ernster Stimme hinzu: »Außerdem hast du wenig Wahl. Was willst du tun, wenn du nicht mehr für Plank arbeitest? Nirgends in der Stadt wirst du eine Anstellung in derselben Position bekommen. Du verdienst gutes Geld, und das, obwohl du aus keiner angesehenen Familie stammst.«
Mit ihren letzten Worten hatte Anna einen von Johanns wunden Punkten erwischt. Er stammte aus keiner adeligen, nicht einmal aus einer bürgerlichen Familie. Ganz im Gegenteil, seine Mutter war eine einfache Schankmagd gewesen, die ihn für ein paar Münzen an einen Kaufmann verkauft hatte. Seine jetzige Stellung hatte er seinem Fleiß, seiner Intelligenz und seinem Talent, nicht alles über seine Kindheit zu erzählen, zu verdanken. Würde ein neuer Dienstgeber ebenso großzügig über Johanns Verschwiegenheit bezüglich seiner Vergangenheit hinwegsehen?
Ärgerlich biss er sich auf seine Unterlippe. Vielleicht hatte Anna recht und er sollte erst einmal abwarten. Die Ehe verweigern konnte er in ein paar Wochen immer noch.
»Ich werde mir die Frau ansehen«, sagte er und fand es schade, dass jetzt kein voller Weinkelch vor ihm stand. Mit der dunkelroten Flüssigkeit wäre es einfacher gewesen, große Worte auszusprechen und auch selbst daran zu glauben. Zumindest ein paar Stunden lang.
Annas Gesicht hellte sich auf. »Du bist ein kluger Junge«, sagte sie zufrieden.
»Nachdem ich diese vernünftigen Worte aus deinem Mund gehört habe, werde ich beruhigt schlafen gehen. Im Winter fällt mir das Aufstehen besonders schwer. Selbst die Hühner dürfen länger schlafen als ich.«
Noch mühsamer als zuvor hievte sie ihren schweren Körper hoch, griff nach der Kerze und machte sich auf den Weg. Um selbst nicht in völliger Dunkelheit durchs Haus zu stolpern, stand auch Johann auf. Er folgte der alten Köchin zur Treppe und stieg hinter ihr die knarrende Holztreppe hoch in den ersten Stock. Dort verabschiedete er sich von Anna, die weiter bis zum Dachboden musste, wo sich ihre Kammer befand. Er sah ihrer dunklen Gestalt nach, die sich humpelnd hochschleppte. Es war wirklich höchste Zeit, dass die alte Frau etwas entlastet wurde. Diesem großen Haus mit den vielen Gästen und den verschiedenen Aufgaben war sie nicht mehr lange gewachsen.
Sopron 1437
elene saß auf ihrem Bett und starrte auf die fertig gepackte Reisetruhe vor sich. Obwohl das Gepäckstück nicht besonders groß war, war es dennoch halb leer. Es war erschütternd, wie wenig sie und Matthias besaßen. Ihr selbst gehörten zwei Sommer- und zwei Winterkleider, Ersatzschuhe, Holztrippen, ein Mantel, ein Kamm, ein kleiner Spiegel, ein Stundenbuch, ihr Ehering und zwei Broschen, wovon eine von ihrer Mutter stammte. Die andere hatte sie zum dreizehnten Geburtstag von ihrem Vater bekommen. Es war einer jener seltenen Momente gewesen, in denen er sich großzügig gezeigt hatte.
Noch vor einem Jahr war sie die reiche Ehefrau des Bürgermeisters gewesen. Aber sowohl das Haus als auch die Einrichtung, der Hausrat, das Geschirr, die Bilder, Truhen, Teppiche und all die anderen Gegenstände waren jetzt Eigentum von Jakob Szekeles, dem Sohn ihres verstorbenen Ehemanns aus erster Ehe. Der junge Mann war noch an dem Tag, als sein Vater verstorben war, aus Budapest angereist, um sein Erbe anzutreten und die junge Witwe samt seinem Stiefbruder aus seinem Haus zu vertreiben. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Zum Glück hatte Helene Zuflucht im Haus ihres Vaters gefunden und hier ein ruhiges und halbwegs glückliches Jahr verbracht. Aber dieses Glück hatte nun ein jähes Ende. Viel schneller als erwartet hatte ihr Vater einen passenden Ehemann gefunden und schickte Helene und Matthias heute noch nach Wien. Allein der Name der fremden Stadt flößte Helene Unbehagen ein. Sie sprach zwar die Sprache der Wiener, aber sie hatte Sopron, einen überschaubaren kleinen Ort, dessen Stadtmauern sie in weniger als einer Stunde abgehen konnte, noch nie verlassen. Jetzt sollte sie in die Hauptstadt der habsburgischen Kronländer reisen, um dort einen wildfremden Mann zu heiraten. Helene graute davor, wegzugehen. Das Haus ihrer Kindheit war der Ort, an dem sie sich vor Jahren sicher gefühlt hatte. Ihn erneut zu verlassen, schien ihr schier unmöglich. Gestern Abend hatte sie sich tränenreich von ihren Brüdern verabschiedet, da beide schon vor dem Morgengrauen aufbrechen mussten. Die bloße Erinnerung an die beiden schnürte Helenes Kehle erneut zu.
Hilflos hatte Adam, ein riesiger Mann mit breiten Schultern und einem Nacken so dick wie ein Stier, vor ihr gestanden und gestammelt: »Wenn Vater das Geschäft nicht mit dem Dompropst von Wien abgeschlossen hätte, sondern mit irgendeinem unwichtigen Mann, dann hätten Benedikt und ich einen Weg gefunden, dich vor der Ehe zu bewahren. Jedoch so …« Er hatte den Satz nicht beendet. Aber das war auch nicht notwendig gewesen, Helene hatte ihn dennoch verstanden. Angesichts des mächtigen Andreas Plank wäre jeder Versuch, sich gegen die Ehe zu wehren, sinnlos gewesen.
»Aber sollte dein neuer Ehemann sich als grausamer Tyrann entpuppen, werden wir dich aus Wien zurückholen. Du bist bereits einmal durch die Hölle auf Erden gegangen, das reicht für ein Menschenleben!« Um seine Worte zu bekräftigen, hatte Adam die Hand auf die Familienbibel gelegt, die auf einer Anrichte in der Stube lag. Es war ein kostbares Stück, das jedem Kloster Ehre bereitet hätte. Vor Jahren hatte ein talentierter Wanderprediger für wenig Geld Szenen aus dem neuen Testament mit vielen, kunstvollen Illustrationen versehen. Heute hätte eine vierköpfige Familie vom Wert der Bibel leicht einen ganzen Winter lang fürstlich essen können. Helene mochte die bunte Malerei mit den fantasievollen, üppigen Blumen und Ornamenten. Als auch ihr Bruder Benedikt seine Hand daraufgelegt und Adams Worte wiederholt hatte, war Helene zutiefst gerührt gewesen. Sie hatte ihre Tränen nicht länger kontrollieren können und hemmungslos geweint.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.